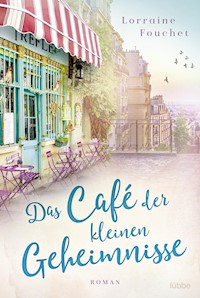9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Menschen, deren Wege sich durch eine Laune des Schicksals kreuzen: eine junge Drehorgelspielerin, die nach einem Streit auf die bretonische Insel Groix flüchtet, ein Kunstschreiner, der von seiner Freundin verlassen wurde, eine junge Marokkanerin, die zwangsverheiratet werden soll, und ein achtzigjähriger Philosophieprofessor, der seine erste Digitalkamera ausprobiert. Doch manchmal entstehen aus den unglücklichsten Verwicklungen die schönsten Liebesgeschichten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Vier Menschen, deren Wege sich durch eine Laune des Schicksals kreuzen: eine junge Drehorgelspielerin, die nach einem Streit auf die bretonische Insel Groix flüchtet, ein Kunstschreiner, der von seiner Freundin verlassen wurde, eine junge Marokkanerin, die zwangsverheiratet werden soll, und ein achtzigjähriger Philosophieprofessor, der seine erste Digitalkamera ausprobiert. Doch manchmal entstehen aus den unglücklichsten Verwicklungen die schönsten Liebesgeschichten …
Über die Autorin
Lorraine Fouchet ist eigentlich Ärztin und erfüllte mit dieser Berufswahl den Traum ihres Vaters, der starb als sie siebzehn war. Mittlerweile hat sie sich ihren eigenen Traum erfüllt und schreibt seit 1977 mit großem Erfolg Romane
Lorraine Fouchet
Ein Tag fürimmer
Roman
Aus dem Französischen von Monika Buchgeister
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 2004 by Editions Robert Laffont, Paris
Titel der französischen Originalausgabe: »Le bateau du matin«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2006 und 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © getty-images/Colin Anderson/Photographer Chris Archinet
Umschlaggestaltung: U1berlin / Patrizia Di Stefano
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-404-17655-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für alle, die schon einmal davon geträumt haben,auf einer Insel zu leben
Für die Bewohner der Insel Groix
Für alle, die die Bretagne lieben
1
Jeder hat schon einmal davon geträumt, auf einer Insel zu leben. Auch sie hatte diesen Wunsch verspürt, aber sie glaubte sich dazu verurteilt, im Dunst der Hauptstadt zu bleiben.
Hätte man ihr vor einem Jahr erzählt, was während dieser zwei Wochen geschehen sollte, so hätte sie es nicht geglaubt. Alles hat seine Grenzen.
Hätte man ihr die Helden dieses Abenteuers beschrieben, die von überallher auf der Insel zusammengetroffen waren, so hätte sie lauthals gelacht.
Hätte man ihr von aufgewühlten Herzen erzählt oder gesagt, den Zufall gebe es nicht, so hätte sie die Achseln gezuckt.
Und doch …
2
Donnerstag, 21. August, erster Tag
Viel zu weit vom Ozean entfernt, warf der Montparnasse-Turm seinen Schatten über den Platz jenes Pariser Viertels, das noch am ehesten an die Bretagne erinnern konnte. Evas Laune wäre auf der Beaufort-Skala bei 1 anzusiedeln gewesen: leichte Brise, ruhiges Meer, ein wenig gekräuselt, schlaffe Segel, Ruder notwendig. Mit dem Baguette in der Hand blieb sie auf der Schwelle des Zeitschriftenladens stehen, um ein junges Mädchen mit grünen Haaren und einen hoch aufgeschossenen Jungen mit rasiertem Kopf vorbeizulassen. Plötzlich hielt der Junge das Mädchen an den Schultern zurück.
»Haltet sie!«, schrie er. »Sie ist eine Diebin, sie hat gestohlen!«
Eva hielt erstaunt inne und musterte die beiden. Die Kunden wandten sich um, um zu sehen, was vor sich ging. Der Händler legte die Stirn in Falten und beugte sich über seine Kasse.
»Durchsuchen Sie sie!«, rief der Junge nun noch etwas lauter.
Der Händler ging steif auf sie zu. Das Mädchen mit den grünen Haaren wehrte sich nicht. Eva wollte ihr gern helfen, sie war ungefähr so alt wie sie selbst.
»Sie ist eine Diebin!«, beharrte der Glatzkopf unerbittlich. »Ich sage es Ihnen, durchsuchen Sie sie!«
Er drehte das Mädchen um die eigene Achse, bis es ihm das Gesicht zuwandte.
»Sie hat gestohlen«, wiederholte er plötzlich ganz sanft. »Sie hat mein Herz gestohlen!«
Er lächelte sie unwiderstehlich zärtlich an und drehte sich dann zu den Anwesenden: »Kennen Sie den Film Mogambo mit Ava Gardner und Clark Gable? Mogambo heißt auf Suaheli Leidenschaft. Das Leben mit ihr ist Mogambo …«
Er beugte sich zu ihr, um sie leidenschaftlich zu küssen. Die Kunden wandten sich beruhigt ab. Der Händler zuckte die Achseln und kehrte hinter seine Kasse zurück. Eva sah den beiden nach, wie sie eng umschlungen fortgingen. Sie beneidete das Mädchen aus tiefster Seele darum, von einem Jungen geliebt zu werden, der solche Auftritte inszenieren konnte.
Sie kaufte ein paar Zeitungen und eine Schachtel tictac, dann trat sie wieder auf die sonnenbeschienene Straße hinaus. Vor zehn Tagen waren der glühenden Hitze viele alte und schwache Menschen zum Opfer gefallen. Die Beerdigungsinstitute waren überfordert, die Zeitungen berichteten von erschreckend vielen Todesfällen, die Stadt brodelte vor Hitze, während es an der Atlantikküste einfach nur schön war.
Beschwingt ging Eva über den Platz und dachte an die kleine Insel des Morbihan, die sie voller Wehmut am Tag zuvor mit der Morgenfähre verlassen hatte, um wie jedes Jahr am Ende des Sommers wieder in die Hauptstadt zurückzukehren. Als das Postschiff, das die alten Inselbewohner »den Dampfer« und die Feriengäste »die Fähre« oder »das Boot« nannten, zwischen den roten und grünen Lichtern aus dem Hafen von Groix ausgelaufen war, hatte sich ihr Herz zusammengezogen. Ein Wolkenstreifen hing zwischen der Insel und dem Festland. Alexis und sie würden erst zu Weihnachten wieder herkommen.
Sie bog in die Avenue du Maine, sodass der Montparnasse-Turm steuerbord lag, streichelte im Vorübergehen die Schnauze des Metalllöwen, der das Eingangstor ihres Hauses zierte, stieg in die vierte Etage hinauf, einen Aufzug gab es nicht, und betrat die große, sonnendurchflutete Wohnung.
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein«, sagte sie und legte das Baguette, den Figaro, den Nouvel Observateur, Libération, Ouest-France und das Télégramme auf den Küchentisch.
Alexis hatte das Frühstück vorbereitet. Das intensive Blau seines Hemdes brachte seine klaren Augen zur Geltung, er wirkte jünger als fünfundfünfzig mit seinem großen, schlanken und geschmeidigen Körper, seinen schwarzen Haaren und seinem sonnengebräunten Gesicht. Sein dunkler Anzug gab ihm das Aussehen eines Bankiers, dabei war er Jurist: Rechtsanwalt Alexis Foresta, medienwirksames und fähiges Mitglied der Pariser Anwaltschaft. Seine Hände waren lang und sehnig wie die eines Pianisten, aber das war eher das Metier seiner Tochter: Eva Foresta, zweiundzwanzig Jahre alt und leidenschaftliche Liebhaberin mechanischer Musik.
Der Vater war stets tadellos gekleidet, die Locken gegelt, glatt rasiert, Designerbrille, Anzüge von Ermenegildo Zegna, dazu handgefertigte Schuhe und natürlich bei jeder Gelegenheit das passende Wort auf den Lippen. Das schwarze Haar der Tochter dagegen war stets zerzaust, der Blick schüchtern, die Kleidung lässig, blaues T-Shirt mit Warhol-Druck, Jeans, rote Sneakers von Puma und eine Vorliebe für die Stille. Stil und Charakter waren sehr unterschiedlich, aber ihre Familienähnlichkeit ließ sich nicht leugnen: die gleichen wasserblauen Augen, der gleiche sinnliche Mund, das gleiche eigenwillige Kinn, die gleiche hoch aufgeschossene Gestalt, die gleiche lockere, runde Handschrift. Hinter seinem ernsthaften Auftreten als Anwalt war Alexis ein Träumer, und hinter Evas verträumtem Aussehen verbarg sich eine ernsthafte Musikerin.
»Wie fühlst du dich?«, fragte sie, während sie ihre Baguettehälfte der Länge nach aufschnitt.
»Besser als mein Klient«, antwortete Alexis, während er seine Hälfte quer durchschnitt und willkürlich eine Zeitung aufschlug.
Am Abend zuvor war der ehemalige Abgeordnete Charbanier in einer Fernsehsendung aufgetreten, wovon ihm Alexis eindringlich abgeraten hatte. Nun zierte ein Foto von ihnen beiden die erste Seite, darüber in fetten Lettern:
ANFANG SEPTEMBER WIRD DER PROZESS GEGEN DEN EHEMALIGEN ABGEORDNETEN CHARBANIER ERÖFFNET. DIE ANKLAGE LAUTET AUF VERUNTREUUNG ÖFFENTLICHER GELDER. RECHTSANWALT FORESTA HAT SEINE VERTEIDIGUNG ÜBERNOMMEN.
»Gar nicht übel«, gab Eva ihr Urteil ab, als sie ihm über die Schulter sah. »Hübsche Krawatte«.
»Die hast du mir geschenkt.«
»Eben. Ich habe einen guten Geschmack!«
Sie lächelten sich verschwörerisch an.
Evas Mutter war eine Woche nach ihrer Geburt gestorben, und Alexis hatte das kleine Mädchen so gut es ging allein aufgezogen. Jahr für Jahr buchstabierte er das Wort Zärtlichkeit aufs Neue. Ab und zu hatte er eine Affäre mit einer Kollegin, aber es war nie von Dauer, da ihm seine Vaterrolle wichtiger war.
»Der Figaro hat dich auf die zweite Seite verbannt«, stellte Eva fest.
»Solange ich nicht in der Rubrik Todesanzeigen lande, ist alles in Ordnung«, erwiderte Alexis.
Jeden Morgen machte er sich über die Manie seiner Tochter lustig, die Todesanzeigen zu studieren. Sie antwortete ihm, dass sie sich anschließend lebendiger fühle, irgendwie beruhigt. In den Spalten waren die am Vortag Verstorbenen aufgelistet, ob sie nun eines plötzlichen Todes, im hohen Alter oder nach langer Krankheit gestorben waren, und die Hinterbliebenen gaben das Hinscheiden nun mit Schmerz- oder Trauerbekundungen bekannt. Die Auflistungen der Namen gaben Aufschluss über die Familienverhältnisse, es steckten Geschichten von Liebe und Hass dahinter. Aus der Anzahl der Zeilen erschloss sich die Bedeutung des Verstorbenen oder die seines Erbes. Manchmal teilte nur ein einziger Freund einen Todesfall mit; dann wieder leisteten sich zehn Kinder, dreißig Enkel, zwanzig Urenkel, eine treue Haushälterin und eine weit verzweigte Verwandtschaft eine opulente, aufwändige Anzeige; oder irgendwelche Verwaltungsräte, Verbände und Unternehmen hatten sich nicht lumpen lassen. Ein ganzes Leben wurde hier auf ein paar Zeilen zusammengedrängt – ganz gleich ob Arzt, Unternehmer, Anwalt, Künstler, Arbeitsloser, Mutter, Großmutter oder Kind. Fasziniert ging Eva diese Spalten Tag für Tag durch, als läse sie einen Roman. Die Menschen meinen, ihr Leben stets im Griff zu haben, lassen dabei aber zwei wesentliche Dinge außer Acht: die Geburt und den Tod.
»Isst du heute Abend zu Hause oder triffst du dich mit Florent?«, wollte Alexis wissen.
Auch Eva hatte nach einer verwandten Seele gesucht und glaubte, sie im Bruder ihrer besten Freundin Laure gefunden zu haben: Florent, ein junger Anwalt, der gerade sein Studium abgeschlossen hatte. Aber Florent hatte sie mit einer blondierten Gerichtsschreiberin betrogen. Er beteuerte zwar, er liebe nur sie allein und das mit der Gerichtsschreiberin sei nichts als ein sexuelles Abenteuer gewesen, Eva hatte trotzdem auf der Stelle mit ihm Schluss gemacht.
»Ich will nie mehr etwas von diesem Mistkerl hören«, sagte sie bissig.
»Ich mochte den Jungen.«
»Na, dann kannst du ihn ja heiraten!«
Alexis entfuhr ein leises Lachen.
»Was wirfst du ihm vor? Er gibt dir Halt. Er steht mit beiden Beinen auf dem Boden.«
Eva legte los.
»Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, das heißt für dich doch nur, ein pralles Bankkonto besitzen und den Titel Rechtsanwalt auf die Visitenkarten drucken lassen, oder?«
In ihren blauen Augen funkelten Blitze.
»Du beschimpfst mich zu Unrecht«, erwiderte Alexis ruhig. »Ich bin Anwalt geworden, um unabhängig zu sein und um frei denken und handeln zu können. Das ist ein wundervoller Beruf, denn wir sind Unruhestifter und merzen den Dreck mit Scharfsinn, Höflichkeit und Streitlust aus.«
Eva zuckte die Achseln.
»Weißt du, was ich beim Einkaufen gesehen habe?«
Sie erzählte ihm die Geschichte von dem Mädchen mit den grünen Haaren und dem schlaksigen Jungen mit der Glatze.
»Das war wild, lustig, originell, einmalig! Florent mag unschlagbar sein, was das Strafgesetzbuch angeht, aber ansonsten ist er vollkommen fantasielos … Da ist mir Mogambo lieber!«
Alexis lächelte.
»Vor zweiundzwanzig Jahren warst du es, die mir mein Herz gestohlen hat«, sagte er und sah seiner Tochter tief in die Augen. »Und davor hat deine Mutter das Gleiche getan. Es heißt, die Katzen hätten sieben Leben. Was mich angeht, so habe ich am Ende drei Herzen.«
Gerührt wollte Eva schon nachgeben, da fiel ihr Blick auf die fette Überschrift in der Zeitung, und sie regte sich wieder auf.
»Florent gefällt dir, weil er dich nachahmen und berühmt werden will«, sagte sie und warf ihr Haar zurück. »Er redet dir nach dem Mund, damit du ihn förderst.«
Alexis schüttelte den Kopf.
»Lieber hätte ich dich gefördert. Mit meinen Beziehungen hätte dir die Welt zu Füßen gelegen …«
Jetzt war es wieder heraus.
»Das hast du mir schon hundert Mal gesagt. Ich habe dich enttäuscht, ich enttäusche dich, und ich werde dich enttäuschen. Anstatt über die Gerichtssäle zu herrschen, vergeude ich meine Zeit damit, schlechte Musik zu machen!«
»Das habe ich nie gesagt«, widersprach Alexis. »Viele meiner Kollegen schreiben, malen oder singen in einem Chor … aber eben am Samstag nach der Arbeit!«
»Die Musik ist meine Leidenschaft«, verkündete Eva bestimmt.
»Du hättest mit dem Fotografieren oder dem Klavierspielen weitermachen können …«
Beides beherrschte Eva ganz hervorragend, aber seit einem halben Jahr hing ihr Herz an der mechanischen Musik, und sie hatte alles andere aufgegeben.
»Mich interessiert einzig und allein die Drehorgel! Im neunzehnten Jahrhundert wurde sie von fremden, fahrenden Musikanten gespielt, sie sprachen einen Dialekt, den keiner verstand, und ihre Instrumente waren durch das Umherziehen verstimmt. Nur deshalb waren die Leute misstrauisch und taten diese Musik als primitiv und unzivilisiert ab. Und ich fühle mich auch unzivilisiert – und fremd!«
War es Alexis bisher gelungen, sich zu beherrschen, so verlor er jetzt die Fassung.
»Was willst du mit deinem Leben anfangen, Eva? Auf der Straße oder in der Metro spielen? Glaubst du, das macht mich stolz?«
»Und was ist mit mir? Glaubst du, mich macht es stolz, einen Vater zu haben, der verlogene Abgeordnete verteidigt?«, erwiderte Eva schlagfertig.
Alexis seufzte.
»Ich möchte heute nicht streiten.«
Eva schob den Stuhl zurück und stand auf.
»Mama hätte mich verstanden, wenn sie noch leben würde …«, stieß sie heiser hervor.
»Tut mir leid für dich, da hast du keine Wahl. Es gibt nur mich!«, entgegnete Alexis barsch.
Eva verließ das Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Ihre Laune war bei 8 Beaufort angekommen – heftig auffrischender Wind, stürmische See mit mittlerer Dünung: an Land mit doppelten Leinen festmachen.
Wütend und frustriert ballte Alexis die Hände zu Fäusten.
Am anderen Ende der Wohnung schloss Eva sich in ihrem Zimmer ein. Sie setzte sich vor das Instrument, das ihr Lehrer Pierre ihr geliehen hatte, schob einen perforierten Karton in den Schlitz der Melodiewalze und begann die Handkurbel im Uhrzeigersinn zu drehen. Der wie eine Ziehharmonika gefaltete Karton lag erst links von der Drehorgel, entfaltete sich dann nach und nach, bis er sich auf der anderen Seite wieder zusammenfaltete. Währenddessen erklangen jazzige Tonfolgen im Zimmer. Natürlich konnte sie keine falschen Töne spielen, aber es kam darauf an, sich in die Musik hineinzufühlen und genau im richtigen Augenblick das Tempo über eine Bewegung der Schulter und des Handgelenks zu beschleunigen oder zu verlangsamen. »Man ist nicht mit dem Arm am Werk, sondern mit dem Ohr«, hatte Pierre auf die Frage geantwortet, in welchem Rhythmus man die Handkurbel drehen sollte. Die Musik der Drehorgel war stärker als jedes Wort: Sie konnte das Papier löchern …
Ein Zauber ging von diesem Instrument aus. Der Karton besaß für sie eine erstaunliche Ästhetik. Es weckte Träume in ihr, wenn er über die Melodiewalze lief und die Musik sich wie eine Kaskade ergoss, immer dieselbe, und doch niemals gleich. Zu ihrem siebten Geburtstag hatte ihr Vater ihr eine Spieluhr geschenkt, die einmal ihrer Mutter gehörte. Sie hatte sie auseinandergenommen, um nachzusehen, wo die Noten versteckt waren …
Eva konzentrierte sich auf das Stück, um den Streit zu vergessen. Alexis machte sich noch einen Kaffee. Sie konnten nicht ahnen, dass sie zum letzten Mal miteinander gestritten hatten.
Eva überquerte die Kreuzung Voltaire-Charonne und parkte in der Straße, in der Pierre wohnte. Sein Atelier lag in einem Hinterhof. An drei Wänden stapelten sich die perforierten Kartons bis zur Decke: links diejenigen für Orgeln mit siebenundzwanzig Tasten, rechts für diejenigen mit vierundzwanzig Tasten, ganz unten die Kartons für jene Orgeln, die mit einem Blasebalg betätigt werden – eine umfangreiche, faszinierende Bibliothek mit Werken, die für die Drehorgel bearbeitet oder eigens komponiert wurden.
Pierre arbeitete hier mit seiner Lebensgefährtin Fabienne und ihrer Katze Mirza, die am Todestag von Nino Ferrer geboren worden war. Er spielte entweder im Duo mit einer anderen Orgel, einer Sängerin, einem Pianisten oder mit einer Jazzband, manchmal auch als Solist in einem symphonischen Orchester. Er spielte auf einer Odin-Orgel mit einhundertvierzehn Ventilen, drei Registern, chromatischer Tastatur mit zweiundvierzig weißen und schwarzen Tasten, die einhundertfünfzig Kilo wog, zwei Meter lang und zwei Meter breit war. Er arbeitete auch als Notenschreiber und Lochbandstanzer, das heißt, er stellte die perforierten Kartons her, um sie zu verkaufen. Es gab nur noch vier Personen in Frankreich, die diesen Beruf offiziell ausübten. Anfangs hatte Pierre mit Schere, Cutter, Uhu und Packpapier gearbeitet. Aber dank der Informationstechnik benutzte er nun längst eine computergesteuerte Perforierungsmaschine. Die Leute fragten ihn manchmal bestürzt: »Wenn jetzt jeder Partituren transkribieren kann, braucht man dann gar keine Musiker mehr?« Darauf antwortete Pierre: »Früher schrieben die Schriftsteller und Dichter mit Feder und Tinte auf Papier. Heute haben sie Textverarbeitungsprogramme. Aber das sind lediglich Maschinen, die den Menschen brauchen, um aus Buchstaben Worte, Sätze und schließlich Bücher zu machen. Auch mein Computer hat Noten, aber es muss schon ein Musiker her, der sie zu einer Melodie zusammenfügt …«
Eva liebte die wehmütigen Melodien, die die »Tonmaschine«, wie Pierre sie nannte, hervorbrachte. Aber man konnte auch Ungewöhnliches mit der Drehorgel spielen. Sie war nicht immer schon ein Straßeninstrument gewesen. Leopold Mozart, der Vater von Wolfgang, Haydn, Beethoven und Bach hatten wunderschöne Stücke für sie geschrieben. Auch Jazz konnte man spielen, zum Beispiel Chick Corea, Sylvie Courvoisier, Martial Solal oder zeitgenössische Musik von Xenakis, Satie, Marius Constant.
»Wie wär’s, wenn du loslegst?«, fragte Pierre. »Ich weiß, dass du darauf brennst, mir deine Komposition vorzuspielen. Also!«
Eva hatte improvisiert und den Karton selbst hergestellt, ohne die Partitur vorher niederzuschreiben. Das Resultat war zunächst wild und feurig, schließlich sanft – eine rohe Musik für eine stille Revolution, ein reifes Stück Musik von einem Mädchen, dessen Liebe der Handkurbel und den Lochkarten gehört. Die Orgel war für sie kein nostalgisches Schmuckstück, sondern ein geheimnisvolles Instrument, das ungeahnte Möglichkeiten bereithielt. Sie hatte ihrem ersten Stück den Titel Höllenschlund gegeben, nach einer Gegend auf der Insel Groix.
»Ich mag es«, sagte Pierre. »Wirklich.«
Sie glaubte, nicht richtig gehört zu haben.
»Könntest du das wiederholen?«
»Ich mag es«, sagte Pierre und lächelte sie an. Dann zwinkerte er Fabienne zu und schubste Mirza vom Tisch, auf den sie gerade gesprungen war.
Eva warf den Kopf nach hinten.
»Wow!«, stieß sie erleichtert hervor.
Das Leben war manchmal so einfach und friedlich, so eindeutig und simpel wie diese Kartons, die sich auseinander- und wieder zusammenfalteten.
Fabienne schenkte ihnen Kaffee ein und erzählte von ihrem Projekt, dem Katerclub, einer Notunterkunft für Katzen in Paris.
»Endlich kann ich diesen Tag genießen«, sagte Eva. »Ich muss nur kurz einen Anruf erledigen.«
Sie kramte im Rucksack nach ihrem Handy, tippte Alexis’ Nummer ein, besann sich dann aber anders.
»Kann ich von hier aus anrufen?«, fragte sie Pierre und zeigte auf sein Telefon.
»Natürlich.«
Es war genau zwölf Uhr mittags. Sie griff nach dem Apparat und wählte die Nummer. Es klingelte einmal, zweimal, dann schaltete sich der Anrufbeantworter ein.
»Guten Tag, Sie sind mit der Mailbox von Rechtsanwalt Foresta verbunden. Sie können mir gern eine Nachricht …«
Enttäuscht legte sie wieder auf. Sie hatte keine Lust, sich gegenüber einem Anrufbeantworter zu rechtfertigen. Sie würde sich heute Abend entschuldigen, und alles wäre wieder in Ordnung. Sie war heute Morgen zu weit gegangen. Sie verehrte ihren Vater und war stolz auf ihn. Er hatte ihr so viel gegeben, war in so viele Rollen für sie geschlüpft. Aber er gehörte eben zu einer anderen Generation und sah die Dinge anders als sie.
Im Gerichtsgebäude sprang Alexis auf und griff nach seinem Handy, zu spät. Der Anrufer hatte keine Nachricht hinterlassen, und seine Nummer wurde nicht angezeigt. Enttäuscht zuckte der Anwalt die Achseln. Eva konnte es nicht gewesen sein, denn ihre Nummer und ihr Name wären auf dem Display erschienen. Alexis bedauerte ihren Streit. Er war fest entschlossen, sich heute Abend mit ihr zu versöhnen. Es war nicht so, wie er heute Morgen gesagt hatte. Sie war für ihn das Kostbarste und Wunderbarste auf dieser Welt. Für ihn war sie mit ihren zweiundzwanzig Jahren noch ein Kind, das an das Glück glaubte, und er wollte sie beschützen.
An diesem Vormittag brummte es in der Notaufnahme des Necker-Kinderkrankenhauses wie im nächtlichen Dschungel. Hilflose und aufgescheuchte Erwachsene warteten mit ihren verängstigten oder apathischen, leidenden Kindern. Ohnmächtiges Aufbegehren und Angst breiteten sich aus.
Laure, eine braunhaarige, rundliche junge Frau Anfang zwanzig mit grünen Augen, die ihr – sehr gutes – Abitur bereits mit sechzehn Jahren gemacht hatte, arbeitete dort als Dienst habende Assistenzärztin. Selbstsicher bewegte sie sich mit einer etwas schwerfälligen Anmut innerhalb dieses traurigen Universums. Sie lächelte den kleinen Kranken zu, beruhigte die Eltern, gab Erklärungen, behandelte und linderte die Schmerzen.
»Frau Doktor!«, rief ein wütender Vater. »Wir warten jetzt schon zwei Stunden, meine Tochter blutet …«
Laure beugte sich über das Kind, entfernte vorsichtig den Verband und begutachtete Größe und Tiefe der Wunde.
»Es müssen acht Stiche gemacht werden. Wir werden uns darum kümmern.«
Der Vater und das Kind verschwanden in einem Behandlungszimmer, das gerade frei geworden war.
»Frau Doktor, Amaury hat heute Nacht gut geschlafen …«
Laure wandte sich zu der Frau mit den jugendlichen Gesichtszügen und der alten Stimme um, die neben ihrem Sohn saß. Seit Laure den Unterarm des autistischen Jungen eingegipst und er sie zaghaft angelächelt hatte, kam seine Mutter jede Woche und hoffte auf eine neuerliche Aufhellung seiner Gesichtszüge. Laure konnte nichts für die beiden tun, aber sie brachte es nicht über sich, sie fortzuschicken. Die Mutter war Polizeiinspektorin und nahm sich extra frei, um an den Tagen zu kommen, an denen Laure Dienst hatte.
»Guten Tag, Amaury, ich freue mich, dass du da bist«, sagte sie und sah dem hübschen Jungen, der wie erstarrt vor sich hin blickte, direkt in seine braunen Augen.
Amaury fixierte sie ohne sichtliche Reaktion. Seine Mutter lächelte Laure aus tiefster Seele an.
»Er erkennt Sie wieder, sehen Sie?«
Laure wollte ihrem flehenden Blick ausweichen. Da entdeckte sie Eva in der Nähe des Eingangs, die mit zerzausten Haaren und strahlenden Augen auf sie wartete.
»Entschuldigen Sie bitte, ich werde erwartet …«
Die Mutter stand auf, wirkte für einen Augenblick erleichtert und brach dann mit ihrem Sohn, der in seiner inneren Welt gefangen war, wieder auf. Laure ging zu ihrer besten Freundin.
»Was verschafft mir das Vergnügen deines Besuchs?«
Eva klimperte mit den Autoschlüsseln.
»Beeil dich«, sagte sie. »Ich stehe in der zweiten Reihe.«
»Mich beeilen? Warum?«
»Pierre fand meine erste Komposition für mechanische Orgel gut, das muss gefeiert werden! Wann ist dein Dienst zu Ende?«
Laure sah auf ihre Armbanduhr.
»In sechs Minuten. Lädst du mich in ein nettes Restaurant ein?«
Eva nickte. »Es gibt Hähnchen-Sandwich mit Mayonnaise und Kaffee von der Tankstelle. Du wirst es lieben.«
Laure zog amüsiert die Augenbrauen hoch. »Ach ja?«
»Wir nehmen das Postschiff am Abend«, erklärte Eva.
Laures rechte Augenbraue kräuselte sich, während die linke hochgezogen blieb.
»Die Fähre, wenn dir das lieber ist! Ich lade dich ein, auf einem Felsen mitten im Atlantik zu Abend zu essen. In fünf Stunden sind wir dort.«
Laure schüttelte den Kopf.
»Das ist unmöglich. Ich bin mit dem Chefarzt verabredet. Morgen Früh muss ich zum Zahnarzt. Ich habe unendlich viel Wäsche zu bügeln. Ich habe Florent versprochen, mich mit ihm zu treffen. Und ich habe in drei Tagen wieder Dienst.«
»Dein Chefarzt will dich nur ärgern. Der Zahnarzt kann warten. Deine Schränke sind voll. Dein Bruder ist ein fieser Verräter. Wir werden in drei Tagen zurück sein. Sonst noch Einwände?«
Laure seufzte.
»Ich kann nicht, Eva. Es wäre alles andere als vernünftig.«
Eva lächelte sie breit an.
»Jetzt hast du dieses blöde Wort ausgesprochen. An meinem achtzehnten Geburtstag habe ich mir geschworen, dass ich mich niemals zu ernst nehmen werde. Wir sind erst zweiundzwanzig, Laure. Vernünftig können wir später noch sein. Wir sind einfach viel zu jung dafür!«
Laure gab sich geschlagen.
3
Die Fußgängerfähre nach Loctudy war gerade ausgelaufen. Erlé Le Gall saß auf der Terrasse des Chez Huitric, einer Kneipe auf dem Kai der Île-Tudy, in einem kleinen Hafen an der Mündung des Flüsschens Pont-l’Abbé. Er überblickte die Bucht von Benodet im südlichen Finistère. Erlé sah zu, wie die Fähre ablegte, und stand auf. Eine Armbanduhr trug er nicht, die Fähre zeigte ihm die Zeit an. Er stieg auf sein Fahrrad und fuhr die Hafenstraße hinauf. An der Segelschule bog er ab, um den Ozean-Boulevard entlangzufahren. Er kam an der Kirche und dem Seefriedhof vorbei und erreichte schließlich den Strand mit seinen Badegästen.
Saint Tudy, Mönch und Mystiker aus dem fünften Jahrhundert, hatte der kleinen Insel ihren Namen gegeben. Im Jahr 1852 war sie durch den Bau des Deiches von Kermor zur Halbinsel geworden. Früher ein Fischerei- und Handelshafen, in dem Bordeauxweine und andere Waren umgeschlagen wurden, ist Saint Tudy heute ein Badeort mit einem langen, feinen Sandstrand, der sich bis nach Sainte-Marine erstreckt und ein ideales Gelände für Muschelsucher abgibt.
Erlé bog links ab und entfernte sich vom Wasser. Er wechselte den Gang, stieg in die Pedale und tänzelte keuchend den Hang hinauf, der zum Haus seiner Mutter führte. Er war aus der Übung. Auf der Straße zeichneten sich immer mehr dunkle Flecken ab.
»Oh nein! Das nicht auch noch!«, stöhnte er und blickte nach oben.
Ein dicker Regentropfen zerplatzte auf seiner Nasenspitze. Sosehr er auch strampelte, es kam ihm vor, als rollte er rückwärts. In der Wettervorhersage hatte man 5 Beaufort angekündigt – frische Brise, hoher Seegang mit Wellen und Gischt: An Land musste man seinen Hut festhalten. Schon bald rann ein feiner, für das Finistère typischer Regen seinen schwarzen Regenumhang hinunter. Hier in der Gegend trugen nur Feriengäste gelbe Wachsjacken und blaue Gummistiefel. Die Bretonen hatten es nicht nötig, Matrosen zu spielen. Erlé zog die Schultern ein, fixierte die Straße und setzte zügig seinen Weg fort.
»Los, Kleiner!«, rief ihm eine spöttische Stimme zu.
Eine dicke rote Limousine hatte auf gleicher Höhe die Fahrt verlangsamt. Am Steuer saß sein Bruder Louis.
»Du siehst aus wie ein begossener Pudel!«, stellte der Fahrer grinsend fest.
»Es geht schon …«, brummelte Erlé. »Sag ihr, dass ich gleich da bin.«
Das Auto überholte ihn und entfernte sich mit fröhlichem Hupen.
»So ein Schwachkopf«, schimpfte Erlé.
Zehn Minuten später hielt er vor dem Haus mit den blauen Fensterläden. Er lehnte sein Fahrrad an den Hortensienstrauch, schüttelte sich, ging ins Haus und hängte seinen triefenden Umhang an die Garderobe. Dankbar nahm er das Handtuch, das seine Mutter ihm reichte, und trocknete seinen nassen Schopf.
Auf dem Fahrrad konnte er es mit jedem aufnehmen. Zu Fuß hinkte er leicht.
»Alles Gute zum Geburtstag, Mama!«, sagte er und beugte sich zu ihr.
Louis saß bereits am Tisch, entkorkte den Champagner, den er mitgebracht hatte, und füllte drei Sektschalen. Als die getigerte Katze ihn erkannte, verließ sie eilig die Fensterbank und flüchtete ins Obergeschoss. Mit dem Hinweis auf seine vermeintliche Katzenallergie versetzte Louis ihr immer wieder hinterhältige Fußtritte.
»Auf die Allerschönste!«, deklamierte er übertrieben und leerte seine Schale.
»Auf dich, Mama«, sagte Erlé.
Er sah die alte Frau zärtlich an, benetzte die Lippen und tat so, als tränke er.
Marie Le Gall wirkte zart und zerbrechlich mit ihrem weißen Haar und den wässrigen Augen. Die vielen Jahre als Lehrerin hatten sie gebeugt. Sie hatte drei Jungen großgezogen. Bruno, Louis und Erlé. Bruno war viel zu früh von dieser Welt gegangen, um sich um die Häuser und Gärten des Paradieses zu kümmern. Louis Le Gall, achtundzwanzig Jahre alt und leicht untersetzt, hatte braune, lauernde Augen, schmale Lippen, einen gestutzten Schnurrbart, kurzärmlige Hemden in unpassenden Farben, grelle Krawatten und rote oder gelbe Blazer. Erlé Le Gall war sechsundzwanzig, ein hoch aufgeschossener Kerl von einem Meter neunzig, eine Statur wie ein Menhir. Seine Augen waren von einem sanften Grau und umgeben von Lachfalten, die Haare aschblond, sein Kinn energisch, die Hände schwielig. Er hatte einen athletischen Körper, trug immer schwarz, ganz gleich ob T-Shirt oder Hemd, Pullover oder Jeans, Jackett und Clarks. Er liebte Filme und Fotos in Schwarz-Weiß und die Schauspieler vergangener Tage, er liebte Domino, Dalmatiner und Apfelschimmel.
Erlé und Louis waren ebenso wenig Brüder, wie Marie ihre Mutter war. Sie hatte sie nach Brunos Tod adoptiert, als sie noch ganz klein gewesen waren. Zuerst Louis, dessen Vornamen sie selbst ausgewählt hatte, dann Erlé, dem seine leibliche Mutter diesen Namen gegeben hatte, bevor sie ihn der öffentlichen Fürsorge übergab. Sein Erbe bestand in einem leichten, aber unheilbaren Hinken, einem seltenen Herzfehler und diesem bretonischen Vornamen, der so geheimnisvoll klang, dass er ihm reichlich Spott von seinen Klassenkameraden eingebracht hatte.
»Warum bist du nicht mit dem Auto gekommen?«, stichelte Louis.
»Ich hatte Lust, mir die Beine zu vertreten«, log Erlé und warf seinem Stiefbruder einen bitterbösen Blick zu.
Louis war der geborene Schnüffler und wusste mit Sicherheit Bescheid. Vor sechs Monaten war Delphine, Erlés Freundin, von einem Tag auf den anderen mit dem Motorbootbesitzer Paul aus Paris durchgebrannt. Nicht einmal eine Segelyacht, sondern eine teure, stinkende Barkasse, auf deren Deck er ständig herumlag, um sich seinen wabbligen Bauch zu bräunen. Erlé, verraten und verkauft, hatte sich in den beiden Kneipen auf dem Kai, dem Winch und dem Mamalok, bis zur Bewusstlosigkeit betrunken. Unglücklicherweise wollte er anschließend nach Hause, um nachzusehen, ob seine Freundin nicht doch zurückgekommen wäre. Er hatte sich ans Steuer gesetzt und vergeblich versucht, mit seinem Twingo einen Baum hinaufzufahren. Er war allein und kam mit ein paar Schrammen davon. Sein Alkoholpegel hatte ihm dennoch ein Jahr Gefängnis auf Bewährung eingebracht, sechs Monate Führerscheinentzug, sechs Strafpunkte und ein dickes Bußgeld als Dreingabe. Als er wieder nüchtern war, packte ihn die Wut, weniger auf die Strafe als auf ihn selbst: Er hätte dabei draufgehen können, es hätte ihm jemand entgegenkommen können, er hätte im Rollstuhl landen oder einen Unschuldigen erwischen können. Er hatte sich geschworen, in seinem Leben nie wieder einen Tropfen Alkohol anzurühren, und Wort gehalten. Seine Freunde hatten versucht, ihn umzustimmen: »Du gehst doch kein Risiko ein, jetzt, wo du Fahrrad fährst«, »Sei kein Trottel, nüchtern sein ist nicht gerade lustig«, »Komm, sei kein Schlappschwanz!«, aber er war standhaft geblieben.
Von Delphine hatte er nichts mehr gehört, und das war vermutlich auch gut so.
Sie hatten sich vier Jahre zuvor an der Universität von Rennes kennen gelernt, wo sie beide an der Filmhochschule studierten. Schon bald waren sie zusammengezogen. Erlé, der ein sehr geschickter Handwerker war, hatte die Möbel für ihre Wohnung selbst gebaut. Er hatte die beste Abschlussarbeit im Bereich Film vorgelegt und dafür einen Preis erhalten, der es ihm ermöglichte, seinen ersten Kurzfilm zu drehen. Der Film trug den Titel Der Apfelbaum und war eine Meditation über einen Satz von Louis Luther: »Wenn ich wüsste, dass die Welt morgen unterginge, so würde ich dennoch einen Apfelbaum in meinem Garten pflanzen«. Die Anerkennung war groß, und Erlé hatte ein Stipendium für einen längeren Film erhalten. Aber zum großen Erstaunen aller lehnte er das Stipendium ab, um nach Île-Tudy zurückzukehren und sich dem Schreinerhandwerk zu widmen. Delphine war mit ihm gegangen. Sie wohnten zusammen, schliefen im selben Bett, teilten das Geld und liebten sich von Zeit zu Zeit. Ihre Beziehung war zärtlich, aber ohne große Leidenschaft. Dennoch hatte es Erlé schwer getroffen, dass sie gegangen war.
Seit sie ihn vor sechs Monaten sitzen gelassen hatte, hatte er weder eine Frau noch einen Führerschein, er fuhr Fahrrad, widmete sich der Restaurierung alter Möbelstücke und beglückwünschte sich jeden Morgen, in jener verrückten Nacht nicht in den Tod gefahren zu sein und niemanden verletzt zu haben.
»Hier ist mein Geschenk, Mama«, verkündete Louis und reichte seiner Mutter ein langes, flaches Päckchen.
Marie öffnete die Schachtel und entdeckte ein elegantes und kostbares Halstuch von Hermès, das sie nie tragen würde. Sie dankte ihm herzlich und wandte sich dann ihrem Jüngsten zu.
»Meines ist selbst gemacht«, murmelte Erlé.
»Hast du ihr eine Muschelkette gebastelt? Wie reizend …«, spottete Louis.
Marie zerriss das Geschenkpapier und war sprachlos. Erlé hatte ein Buch aus feinem Duftholz geschnitzt. Es war aufgeschlagen, und man hatte den Eindruck, als würde sich gerade ein Blatt wenden, die Illusion war perfekt.
»Es ist Thuya-Holz aus Marokko«, erklärte er.
Seine kräftigen Hände hatte er auf den Tisch gelegt, links und rechts neben seinen Teller, nach vorn gebeugt wartete er auf ihr Urteil. Maries Gesicht strahlte.
»Danke«, sagte sie ganz einfach.
Vierzig Jahre lang war sie Grundschullehrerin gewesen, und sie liebte Bücher.
»Ratet mal, wo ich den Geburtstagskuchen erstanden habe!«, ließ sich plötzlich Louis vernehmen, der damit die stille Harmonie des Augenblicks zerstörte.
»Beim teuersten Konditor von Pont-l’Abbé!«, riet Erlé.
Marie und er brachen angesichts der verdutzten Miene von Louis in Lachen aus. Als Marie in die Küche ging, um das Essen zu servieren, nutzte Erlé die Gelegenheit und goss seinen Champagner aus dem Fenster.
Das Mittagessen verlief wie gewohnt. Louis zählte ihnen all die unverkäuflichen Schuppen auf, die seine Immobilienagentur auf Lager hatte, und beschrieb ihnen dann die hübschen Fischerhäuschen am Meer, die oft innerhalb eines Tages verkauft wurden, meistens an Fremde. Diese Leute tauchten mit großen Geldbeträgen bei den Nachkommen der Seeleute auf, deren Familien schon seit ewigen Zeiten am Meer gelebt hatten und die ihr Haus eigentlich gar nicht verkaufen wollten. Durch verlockende Angebote, manchmal das Fünffache des tatsächlichen Verkaufswertes, ließen sie sich jedoch überzeugen, ins Landesinnere zu ziehen. Manche bereuten es später, manche begnügten sich damit, in ihrem funkelnagelneuen Häuschen, abgeschnitten vom Horizont, auf ihrem Reichtum zu hocken. Die neuen Besitzer ließen die alten, geschichtsträchtigen Häuser abreißen und bauten an deren Stelle futuristische Glaswürfel mit großartigem Blick aufs Meer.
»Das ist unmoralisch«, befand Erlé.
»Das ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage«, sagte Louis. »Unglücklicherweise laufen die Privatverkäufe nicht mehr über uns, aber wir halten uns an den Baugesellschaften schadlos.«
»Bist du etwa stolz darauf, die Küste durch Wohnanlagen zu verschandeln, in denen die Leute zusammengepfercht werden wie Sardinen in der Büchse?«
»Und du, bist du etwa stolz darauf, den Handwerker zu spielen, wo du so reich wie Spielberg hättest werden können?«, hielt Louis ihm entgegen.
»Hört auf, ihr beiden!«, unterbrach sie Marie mit der Strenge einer Lehrerin.
Für den Rest der Mahlzeit gaben sie sich Mühe, kein heikles Thema mehr anzuschneiden. Louis schob als Erster seinen Stuhl zurück.
»Ich muss los. Ich habe einen Termin mit den Erben eines Hauses am Ufer des Odet, die keine Ahnung haben, was sie da besitzen. Ich habe sie einem anderen Mitarbeiter der Agentur weggeschnappt, der so naiv war, etwas von Ethik zu faseln. Und jetzt werde ich die Kommission einstecken!«
Er drückte seiner Mutter einen Kuss auf die Stirn.
»Auf dem Heimweg geht es für dich ja nur bergab«, sagte er zu Erlé und lachte hämisch. »Du brauchst nicht einmal zu treten!«
Erlé beherrschte sich und nickte.
»Noch immer keine Neuigkeiten von Delphine?«
Erlé hätte ihn am liebsten als Köder an seinen Angelhaken gespießt. Louis legte mit Vorliebe den Finger in die Wunde. Als Kind hatte er Erlé immer wieder wegen seines Hinkens und seiner Krankheit gehänselt. Er war maßlos eifersüchtig auf seinen jüngeren Bruder, der viele Freunde hatte, während er selbst nicht gerade beliebt war. Mittlerweile hatte er Geld, eine Frau, Kinder, Kontakte zu Politikern und ein großes Haus. Aber die Zeit hatte weder ihre Streitereien noch seine Eifersucht gemildert.
»Du wirst noch zu spät kommen«, mischte Marie sich ein und schob Louis in den Garten.
Die dicke rote Limousine fuhr davon. Sofort kam die getigerte Katze wieder herunter und rieb sich an den Beinen der alten Frau. Marie und Erlé wechselten einen einvernehmlichen Blick.
»So ist dein Bruder eben«, sagte sie resigniert. »Er hat keinen Vater gehabt, der ihm den Hintern versohlt hätte. Das hat ihm gefehlt.«
Erlé lächelte ihr zu.
»Ich auch nicht, falls ich das anmerken dürfte.«
Marie sah ihn mit einem verschmitzten Funkeln in den wässrigen Augen an.
»Ihr seid eben sehr verschieden. In drei Tagen darfst du wieder Auto fahren, oder?«
Erlé starrte sie verdutzt an.
»Du … du wusstest es? Die ganze Zeit über? Und du hast nichts gesagt?«
»Ich habe darauf gewartet, dass du es mir von dir aus erzählst.«
»Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst.«
Marie sah ihn an, als hätte er etwas Ungeheuerliches von sich gegeben.
»Lieben bedeutet, dass man sich um diejenigen sorgt, die einem am Herzen liegen. Das solltest du in deinem Alter eigentlich wissen«, sagte sie.
4
Der Schnellzug fuhr aus dem Bahnhof Montparnasse und ließ ein paar hundert Meter weiter die Hochhäuser der Rue Vercingétorix erzittern. Voller Neid sah Zaka Djemad durch das geöffnete Fenster dem Zug nach, der zum Meer fuhr. Für die Reisenden unsichtbar winkte sie ihnen zu. Wie jedes Mal träumte sie auch jetzt davon, einmal in den Zug zu steigen und Paris zu entfliehen. Sie sah sich in einem bunten Kleid in einem Abteil des Orient-Express sitzen und mit den wunderlichsten Fahrgästen plaudern, die geradewegs ihrer Fantasie entsprungen waren: einem Araber, der seine Wasserpfeife rauchte, einem Matrosen in weißer Uniform mit roter Bommelmütze, einem Fischer in gelbem Wachszeug, einem Mann im Smoking, einer Frau in einem altmodischen Kleid und kleinen, braven Jungen in blau-weiß gestreiften T-Shirts. Und alle tranken sie eisgekühlte Coca-Cola. Kemal, Zakas ältester Bruder, hasste Amerika, und deshalb gab es zu Hause keine Coca-Cola.
Als sie zehn Jahre alt war, hatte sich beinahe ihr innigster Wunsch erfüllt, einmal das Meer zu sehen: Sie durfte mit der Wohlfahrt einen Tag in Deauville verbringen und hatte bereits ihre Tasche samt Badeanzug, Handtuch, Buch und Sonnencreme gepackt, so wie all die anderen Mädchen aus ihrer Klasse, die in die Ferien fuhren. Aber im letzten Augenblick hatte sich Kemal entschlossen, ihren Platz einzunehmen. Man stritt nicht mit Kemal. Zaka war in der Rue Vercingétorix geblieben. Fünfte Etage. Sie hatte ihren Badeanzug angezogen, sich mit Sonnencreme eingerieben, auf das Handtuch gesetzt und ihr Buch gelesen – mit leeren Augen und schwerem Herzen.
In der Schule sollten sie etwas über einen Text von Pierre Loti schreiben, einen Auszug aus seinem Buch Roman d’un enfant:
»Ich war am Abend mit meinen Eltern in einem Dorf an der Küste bei Saintes angekommen, wo wir für die Badesaison ein Fischerhaus gemietet hatten. Ich wusste, dass wir hierhergekommen waren wegen etwas, das ›das Meer‹ hieß, das ich aber noch nicht gesehen hatte (da ich noch sehr klein war, verstellte ein Dünenstreifen mir den Blick), und ich war sehr neugierig, es kennen zu lernen.«
Zaka, die nun siebzehn Jahre alt war, las den Text zum wiederholten Mal. Dann nahm sie einen Kohlestift und zeichnete Wellen, einen Hafen, Seemänner und Häuser am Meer. Auch sie selbst war stets auf diesen Bildern zu sehen, mit ihren dunklen, langen Haaren, ihrer hellen Haut, ihren leuchtenden Augen und ihren schlanken Beinen. Kemal wurde wütend, wenn er ihre Zeichnungen fand, und zerriss sie.
»Du vergeudest deine Zeit, hilf lieber deiner Mutter im Haushalt«, schimpfte er.
Zaka verdrängte ihre dunklen Gedanken, seufzte und vertiefte sich erneut in den Stoff, den sie zu lernen hatte. In einer Woche würde sie eine Aufnahmeprüfung an der Zeichenschule im dreizehnten Arrondissement machen. Sie war eine gute Schülerin und hatte ihr Abitur im ersten Anlauf bestanden. Sie machte sich keine Sorgen um die Noten, aber sie musste hervorragende Leistungen vorweisen, um ein Stipendium zu erhalten, das die Studiengebühren deckte. Die Prüfung umfasste einen theoretischen Teil mit allgemeinen Fragen zu Kunst und Kultur und einen praktischen Teil.
»Zaka! Pass auf deine Brüder auf, ich muss weg«, rief ihre Mutter durch die halb geöffnete Tür.
Widerwillig legte Zaka ihr Buch beiseite. Die drei Jungen waren fünf, sechs und sieben Jahre alt und würden ihr keine Ruhe lassen. Saïd ließ sich alle möglichen Streiche einfallen, Ali führte sie aus, Aziz verletzte sich, und Zaka wurde bestraft.
»Du hattest mir versprochen, dass du mich lernen lässt, Mama. Nächste Woche, das verspreche ich dir, mache ich alles, was du von mir verlangst.«
Ein seltsames Leuchten flackerte auf in den Augen ihrer Mutter.
»Ich brauche dich heute«, sagte sie, vermied es aber, ihre Tochter dabei anzusehen.
5
Alexis Foresta verließ das Gerichtsgebäude durch eine Seitentür in Höhe des Quai des Orfèvres. Während sich die meisten seiner Kollegen im Auto fortbewegten, benutzte er ein altes Hollandrad. Selbst die Motorroller fanden bei ihm keine Gnade. Sie stanken abscheulich, waren zu schwer und alles andere als zuverlässig. Sein Fahrrad dagegen ließ ihn nie im Stich.
»Alexis!«, hörte er eine Stimme, als er gerade sein Rad aufschloss.
Er drehte sich lächelnd um. Sophie kam auf ihn zu. Sie trug noch ihre schwarze Robe mit dem weißen Brustlatz, die deutlich machte, dass sie nicht zur Pariser Anwaltskammer gehörte. Diese hatten einen linken Schulterstreifen aus Hermelinpelz zur Erinnerung an die Enthauptung von Ludwig XVI. und Marie-Antoinette auf dem Hof dieses Gerichtsgebäudes. Ihre langen kastanienbraunen Haare fielen in Locken auf ihre Schultern.
»Du trägst noch deine Robe?«, fragte er erstaunt.
Die verhandlungsfreie Zeit hatte am 10. Juli begonnen und dauerte noch bis zum 1. September. In diesen Monaten wurden nur unaufschiebbare Fälle verhandelt.
»Eine dringende Angelegenheit, Angriff auf die Persönlichkeitsrechte.«
»Kommst du oder gehst du gerade?«
»Ich bin fertig. Und ich habe große Lust auf ein Stück Schokoladenkuchen!«, sagte sie genüsslich.
Er fragte sich zum hundertsten Mal, wie sie es anstellte, kein Gramm zuzunehmen bei all den Süßigkeiten, die sie verschlang. Sie musste von einem anderen Stern kommen.
Wie üblich nahmen sie im Gerichtskeller Platz und bestellten zwei Tee und ein Stück Schokoladenkuchen. Und wie üblich versuchte Alexis, Sophie einen Bissen zu stibitzen, während sie ihr Stück mit allen Mitteln verteidigte.
»Du brauchst nur selbst eines zu bestellen!«, protestierte sie. »Ich kann es nicht leiden, wenn man auf meinem Teller herumstochert. Du bist ein echter kapitalistischer Spaghettifresser, den man die ganze Kindheit über mit wunderbaren, hausgemachten Nudeln und herrlichen Eiscremes vollgestopft hat. Ich dagegen bin die Tochter eines französischen Arbeiters und Gewerkschaftlers, habe mit meinen sechs Geschwistern gedarbt, und jetzt teile ich nichts mehr!«
Alexis lachte los. Sie warf ihm vor, allein deshalb Rechtsanwalt geworden und dem großbürgerlichen Juristenclan beigetreten zu sein, um ein wenig mit der schlechten Gesellschaft in Berührung zu kommen, um aus sicherer Distanz einen Blick auf den Abschaum zu werfen und sich im Schwarzmarktmilieu umzutun, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Für eine Frau war das ein schwieriges Arbeitsgebiet. Sophie hatte sich auf die Verteidigung literarischen und künstlerischen Eigentums spezialisiert. Sie vertrat Klagen zum Recht am eigenen Bild und zählte zahlreiche Prominente zu ihren Klienten.
»Ich beantrage mildernde Umstände«, entschuldigte sich Alexis, »ich wollte nur wissen, was du denkst.«
»Du willst wissen, was ich denke?«, fragte sie und überließ ihm die Spitze des Kuchenstücks. »Ich möchte heute Abend von dir in ein italienisches Restaurant eingeladen werden. Ich stelle mir vor, dass wir einen gut gekühlten Prosecco trinken, Spaghetti Vongole essen, danach Tiramisu und dass wir uns anschließend bis zum Morgengrauen lieben.«
Ihre grünen Augen funkelten bei dem Gedanken an das bevorstehende Vergnügen. Sophie war eine zarte, unverheiratete Vierzigjährige und nahm das Leben wie eine tägliche Mahlzeit, die unweigerlich mit einem Dessert und Sex endete. Seit zwei Jahren aß Alexis häufig mit ihr zu Abend.
»Dein Plan gefällt mir sehr, für morgen Abend«, sagte er.
Sophies Miene verfinsterte sich.
»Wenn es wegen deiner Tochter ist, nehme ich noch ein Stück Kuchen«, drohte sie. »Magst du dicke Frauen?«
»Es geht mir um dich und nicht um deinen Taillenumfang. Es tut mir leid, Sophie. Ich habe mich heute Morgen mit Eva gestritten. Wir haben uns dumme Sachen an den Kopf geworfen. Ich muss einfach mit ihr sprechen. Verstehst du?«
Sophie schüttelte den Kopf.
»Nein, aber ich akzeptiere es. Im Übrigen habe ich ja gar keine andere Wahl, oder? Wenn ich wütend werde, behauptest du am Ende noch, dass ich es nicht verstehen kann, weil ich keine Kinder habe, und dann werde ich mit Sicherheit ausfallend.«
Alexis erhob Einspruch.
»Ich habe niemals …«
»Ich weiß«, fiel Sophie ihm ins Wort. »Mit dir ist niemals etwas ipso facto, nichts ist von vornherein festgelegt. Das schätze ich ja so an dir, auch wenn ich erst nach deiner Tochter komme. Wir haben noch das ganze Leben vor uns. Ich reserviere also einen Tisch für morgen, einverstanden?«
»Abgemacht, Frau Präsidentin«, stimmte Alexis zu und nutzte den günstigen Augenblick, um auch den letzten Bissen von ihrem Kuchen zu stibitzen.
Sophie musste lachen. Sie konnte nicht ahnen, dass er ihr nie wieder das Dessert streitig machen würde.
6
Im Finistère zur selben Zeit griff Erlé Le Gall nach der Spezialpolitur im Regal, um einen alten Schrank damit einzuwachsen. Er besaß eine überbordende Fantasie und liebte es, die Vergangenheit eines jeden Möbelstücks heraufzubeschwören. Er stellte sich den Schreiner vor, der diesen Schrank gezimmert hatte, um darin die Aussteuer aufzubewahren. Dann kam ihm ein kleiner ausgelassener Junge in den Sinn, der sich eines Abends beim Versteckspiel in dem Möbelstück verkrochen haben mochte, und schließlich ein verängstigter Fallschirmspringer, der dort vielleicht Zuflucht vor den Nazis gefunden hatte. Er roch den Duft gestärkter Hemden, die sich einst auf den Regalbrettern stapelten, das Mottenpulver aus dem schwarzen Anzug, der auf den Tod seines Besitzers wartete, um mit ihm beerdigt zu werden, den süßlichen Hauch des Eau de Toilette der eleganten Dame, die ihre Garderobe darin aufbewahrte, den würzigen Wohlgeruch des Möbellagers, in dem der Schrank darauf wartete, wieder hergerichtet zu werden.
»Bald wirst du wieder benutzt«, murmelte Erlé und polierte energisch weiter.
Plötzlich klingelte das Handy in seiner Jackentasche. Widerwillig legte Erlé sein Tuch beiseite und warf einen Blick auf das Display. Die Nummer war nicht in seinem Speicher, sie begann mit 06, das Gespräch kam also ebenfalls von einem Handy.
»Hallo?«
»Erlé, bist du es? Komm schnell her!«
Die panische Stimme einer Frau, nicht irgendeiner Frau: Es war Delphine.
»Was ist passiert?«, fragte er beunruhigt.
»Er ist verrückt geworden, du musst ihn dazu bringen, dass er aufhört. Er hat mich geschlagen. Ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen …«
Erlé zwickte sich, um sicher zu sein, dass er nicht träumte.
»Von wem sprichst du?«
»Von Paul … Ich habe Angst, Erlé … Ich flehe dich an, bitte komm her!«
»Hast du die Polizei gerufen?«
»Auf keinen Fall. Er hat gedroht, mich hinter Gitter zu bringen, wenn ich ihn beschuldige. Er ist dazu in der Lage. Mein Wort wird gegen seines stehen, und er spielt mit einem Richter Golf. Geld ist Macht …«
Erlé konnte sich gerade noch beherrschen, sie daran zu erinnern, dass sie ihn wegen des Geldes dieses Idioten verlassen hatte.
»Wenn er getrunken hat, dreht er durch«, fuhr Delphine fort. »Er ist jetzt fortgegangen, aber er kommt sicher wieder zurück …«
»Wo bist du?«, fragte Erlé und griff nach seiner Jacke.
»Place de Catalogne, direkt hinter dem Montparnasse-Turm …«
»Du bist in Paris? Und du hast niemanden, den du um Hilfe bitten kannst? Jemanden aus deiner Nähe?«
»Niemand außer dir kann mir helfen!«
Ihre Stimme versagte, und einen Augenblick lang konnte sie nicht weitersprechen. Dann fasste sie sich wieder und gab ihm ihre genaue Adresse, bat ihn noch einmal, sich zu beeilen, und der Kontakt riss ab. Als Erlé sie zurückrufen wollte, war ihre Mailbox eingeschaltet.
Er schaute zum Schrank, ließ seinen Blick durch das stille Atelier schweifen und blieb an dem surrenden Kühlschrank hängen, in dem jetzt nur noch alkoholfreie Getränke standen. Nur hundert Meter entfernt lag der Strand. Die Badegäste stapelten sich. Sie tauchten ihre kälteempfindlichen Zehen ins Meer. Die Fischer, die am Morgen ihre Netze eingeholt hatten, waren nun dabei, sie zu säubern.
»Beweg dich nicht, ich komme zurück«, flüsterte er dem Schrank zu.
Er nahm seine Schlüssel, trat eilig auf die Straße und stolperte fast über seinen weißen Twingo, mit dem er seit sechs Monaten nicht mehr gefahren war. In drei Tagen würde er seinen Führerschein zurückbekommen. Aber Delphine war wirklich in Gefahr.
»Mist …«, entfuhr es ihm wütend.
Zum Bahnhof war es mit dem Fahrrad zu weit. Das einzige Dorftaxi war um diese Zeit entweder unterwegs zum Fischen oder reserviert. Mit zitternden Fingern wählte er die Handynummer seines Bruders, aber auch dort erreichte er nur die Mailbox.
»Das gibt es doch nicht!«, schimpfte er.
Er versuchte es in der Immobilienagentur, wo man ihm sagte, Louis wäre bereits nach Hause gegangen. Er rief dort an, aber seine Schwägerin teilte ihm mit, dass ihr Mann bei seiner Mutter wäre. Um sein Gewissen zu beruhigen, rief er seine Mutter an, die nicht die geringste Ahnung hatte, wo sein Bruder steckte. Louis hatte also entweder eine Geliebte, oder er war noch unterwegs, um seinem Kollegen etwas wegzuschnappen.
Erlé blätterte hastig die Fahrpläne mit den Zügen nach Paris durch. Der nächste Zug nach Paris fuhr in einer Dreiviertelstunde in Quimper ab. Ein paar Sekunden zögerte er, dann stieg er ins Auto und drehte den Zündschlüssel herum. Der Motor sprang sofort an. Der Tank war voll. Nach dem Unfall war der Twingo abgeschleppt worden, der hiesige Automechaniker hatte ihn repariert und wieder vor seine Tür gestellt. Die Vordersitze waren noch mit einer Schutzhülle abgedeckt.
Erlé fuhr vorsichtig und senkte mehrfach den Kopf, um nicht erkannt zu werden. Sobald die Straße vierspurig wurde, beschleunigte er, achtete aber darauf, die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht zu überschreiten. Als ihm ein Polizeiauto entgegenkam, durchfuhr ihn der Schreck, und als ihn ein Krankenwagen überholte, fuhr er auf den Seitenstreifen, obwohl es gar nicht notwendig war. Er hatte nicht mit den Staus in Quimper gerechnet. Zwischen all den Autos eingeklemmt, dröhnten ihm ihre Hupgeräusche in den Ohren, und er dachte an Delphine, die es in sechs Monaten nicht geschafft hatte, einen einzigen Vertrauten in Paris zu gewinnen. Ihm war klar, in welch grotesker Situation er sich befand: Er fuhr ohne Führerschein und riskierte eine Gefängnisstrafe, nur um einer Frau zu Hilfe zu eilen, die ihn wie einen alten Lappen weggeworfen hatte. Aber wenn er jetzt umkehrte und ihr tatsächlich etwas passierte, würde er nicht mehr in den Spiegel schauen können.
Als es wieder voranging, war es bereits zu spät. Erlé erreichte den Bahnhof genau in dem Augenblick, als sich der Zug in Bewegung setzte. Er schlug so heftig auf das Lenkrad, dass ihm der Schmerz bis in die Schulter zog. Zwei Minuten früher, und alles wäre in Ordnung gewesen!
Er presste seine Finger an die Schläfen und dachte nach. Der Zug von Quimper nach Paris brauchte vier Stunden und vierzig Minuten. Der nächste ging in drei Stunden. Rechnete man noch den Weg vom Bahnhof zu der angegebenen Adresse hinzu, so kam er auf etwa acht Stunden. Mit dem Auto wäre er in sechs Stunden da, also schneller, aber er durfte auf keinen Fall in eine Verkehrskontrolle geraten …
Er war weder feige noch egoistisch. Er hinkte vielleicht, vermutlich war er ein Bastard, aber mutig war er ganz sicher. Komme, was wolle. Er drehte die Lautstärke des Radios auf, um seine Zweifel zu übertönen, und machte sich auf den Weg nach Paris. Er fuhr nicht sehr schnell, und so konnte er rechtzeitig bremsen, als das Auto vor ihm ohne Vorwarnung an der Abzweigung nach Rennes ausscherte. Der Fahrer lehnte sich aus dem Fenster, fluchte und hupte wie verrückt. Ein schwarzweiß gescheckter Hund befand sich mitten auf der vierspurigen Straße. Die Autos wichen ihm aus und machten einen großen Bogen. Das Tier folgte der Straße schnurstracks geradeaus. Erlé fuhr langsam an den Hund heran und rief ihm zu:
»Man wird dich noch überfahren!«