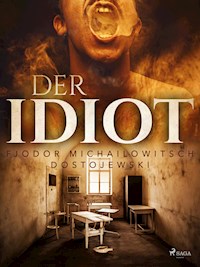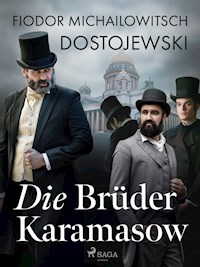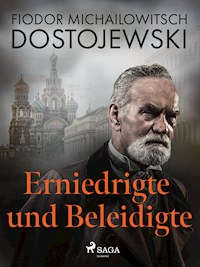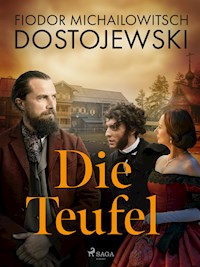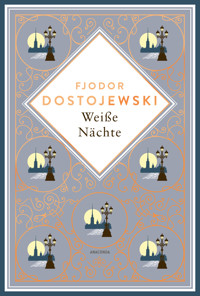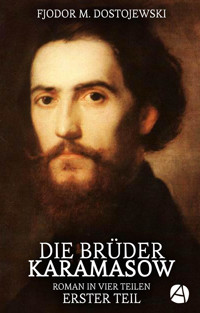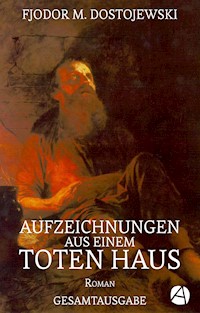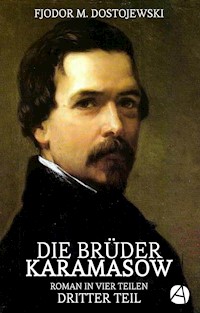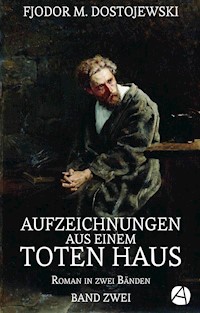Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem Arkadij nach St. Petersburg zurückgekehrt ist, kommt er in den Besitz von zwei Dokumenten. Eines dazu kann er verwenden, um seinen Vater zur Vernunft zu bringen. Dieser befindet sich in einem Rechtsstreit wegen einer Erbschaft mit einem entfernten Verwandten seines Freundes Fürst Sokolskij. Wersilow ist sich jedoch nicht darüber bewusst, dass sein Sohn ein Dokument besitzt, welches den Anspruch des Prozessgegners stützen würde. So wird Arkadij Teil eines Konflikts, der mit ihm persönlich nichts zu tun hat. Wird es dem Jüngling gelingen seinen Vater zu überzeugen den Streit beizulegen oder muss er mithilfe des Dokumentes für das Recht und gegen Wersilow einstehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fjodor M Dostojewski
Ein Werdender - Zweiter Band
Übersezt von Korfiz Holm
Übertragen von H. Röhl
Saga
Ein Werdender - Zweiter Band
Übersezt von Korfiz Holm
Titel der Originalausgabe: Podrostok
Originalsprache: Russischen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1975, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726981315
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Erstes Kapitel.
Die Nacht
I
Es vergingen acht Tage. Jetzt, wo alles vorüber ist und ich diese Geschichte niederschreibe, wissen wir bereits, wie alles zusammenhing; aber damals wußten wir noch nichts, und es war nur natürlich, daß uns manche Dinge sonderbar erschienen. Wir beide, Stepan Trofimowitsch und ich, zogen uns in der ersten Zeit ganz zurück und beobachteten angstvoll von weitem. Ich allerdings unternahm doch einige wenige Ausgänge und brachte ihm wie früher allerlei Nachrichten mit, ohne die er nun einmal nicht existieren konnte.
Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß in der Stadt die mannigfachsten Gerüchte im Umlauf waren: über die Ohrfeige, über Lisaweta Nikolajewnas Ohnmacht und über die übrigen Ereignisse jenes Sonntags. Aber eines setzte uns dabei in Erstaunen: durch wen hatte dies alles mit solcher Schnelligkeit und mit solchen Einzelheiten in die Öffentlichkeit dringen können? Man hätte meinen sollen, keine der damals anwesenden Personen konnte ein Bedürfnis verspüren oder es für vorteilhaft halten, das Geheimnis des Vorgefallenen bekanntzugeben. Dienerschaft war nicht dabei gewesen; nur Lebjadkin hätte einiges ausplaudern können, nicht sowohl aus Bosheit (denn er war damals in größter Angst weggegangen, und durch die Furcht vor dem Feinde wird auch die Bosheit vernichtet, von der man gegen ihn erfüllt ist), sondern einzig und allein aus Schwatzhaftigkeit. Aber Lebjadkin war mitsamt seiner Schwester gleich am andern Tage spurlos verschwunden: im Filippowschen Hause war er nicht vorhanden; er war weggezogen, niemand wußte wohin; er war wie verschollen. Schatow, bei dem ich mich nach Marja Timofejewna erkundigen wollte, hatte sich eingeschlossen und saß, wie es schien, diese ganzen acht Tage in seiner Wohnung; er hatte sogar seine Beschäftigungen in der Stadt unterbrochen. Mich ließ er nicht zu sich herein. Ich ging am Dienstag hin und klopfte an die Tür. Ich erhielt keine Antwort; da ich aber aus untrüglichen Anzeichen davon überzeugt war, daß er zu Hause sei, so klopfte ich zum zweitenmal. Da sprang er anscheinend vom Bette auf, kam mit kräftigen Schritten zur Tür und rief mir aus voller Kehle zu: »Schatow ist nicht zu Hause.« Mit diesem Bescheide mußte ich wieder fortgehen.
Stepan Trofimowitsch und ich blieben schließlich bei einem bestimmten Gedanken stehen; allerdings schien uns diese Annahme gewagt, aber wir bestärkten uns gegenseitig darin: wir gelangten nämlich zu der Überzeugung, der Urheber der umlaufenden Gerüchte könne niemand anders sein als Peter Stepanowitsch, obgleich er selbst einige Zeit nachher in einem Gespräche mit seinem Vater versicherte, er habe die Geschichte bereits in aller Leute Munde gefunden, namentlich auch im Klub; auch der Frau Gouverneur und ihrem Gatten sei sie schon bis auf die kleinsten Einzelheiten vollständig bekannt gewesen. Merkwürdig war aber auch noch dies: gleich am nächsten Tage, Montag abend, traf ich Liputin, und er wußte bereits alles bis auf das letzte Wort, hatte es also offenbar aus erster Hand erfahren.
Viele Damen, auch solche, die den höchsten Kreisen angehörten, erkundigten sich neugierig nach der »rätselhaften Lahmen«, wie sie Marja Timofejewna nannten. Es fanden sich sogar einige, die sie durchaus selbst sehen und ihre Bekanntschaft machen wollten, so daß die Herren, die sich beeilt hatten, das Geschwisterpaar Lebjadkin unsichtbar zu machen, offenbar richtig verfahren waren. Aber im Vordergrunde stand doch Lisaweta Nikolajewnas Ohnmacht; dafür interessierte sich die ganze vornehme Gesellschaft, schon deswegen, weil die Sache Julija Michailowna als Lisaweta Nikolajewnas Verwandte und Patronin direkt anging. Und was wurde nicht alles zusammengeredet! Dem Gerede gab auch noch ein geheimnisvoller Umstand Nahrung: beide Häuser waren fest verschlossen; Lisaweta Nikolajewna lag, wie man erzählte, an einem heftigen Nervenfieber krank; dasselbe wurde auch über Nikolai Wsewolodowitsch behauptet, mit widerwärtigen Einzelheiten über einen ihm angeblich ausgeschlagenen Zahn und über seine geschwollene Backe. In verschwiegenen Ecken sprach man sogar davon, es werde bei uns vielleicht ein Mord stattfinden; Stawrogin sei nicht der Mann, der eine solche Beleidigung hinnähme; er werde Schatow töten, aber insgeheim, wie bei der korsischen Blutrache. Dieser Gedanke gefiel vielen; aber die Mehrzahl unserer vornehmen jungen Männer hörte das alles mit Nichtachtung und mit einer Miene geringschätziger, natürlich erkünstelter, Gleichgültigkeit an. Überhaupt trat die alte Feindschaft unserer Gesellschaft gegen Nikolai Wsewolodowitsch wieder klar zu Tage. Sogar gesetzte Leute suchten ihm die Schuld zuzuschieben, obwohl sie nicht wußten, die Schuld woran. Flüsternd erzählte man sich, er habe Lisaweta Nikolajewna die Ehre geraubt und es habe zwischen ihnen in der Schweiz eine Intrige gespielt. Allerdings verhielten sich vorsichtige Leute dabei reserviert; aber doch hörten alle es mit Genuß an. Es gab auch noch andere Darstellungen, die aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur im Privatverkehr, nur spärlich und beinah im Verborgenen geäußert wurden, äußerst seltsame Darstellungen, deren Vorhandensein ich nur im Hinblick auf die weiteren Ereignisse meiner Erzählung erwähne, um die Leser vorzubereiten. Manche sagten nämlich mit finster zusammengezogenen Augenbrauen und Gott weiß auf welcher Grundlage, Nikolai Wsewolodowitsch habe ein besonderes Geschäft in unserm Gouvernement; er sei durch den Grafen K*** mit hochgestellten Männern in Petersburg in Beziehung gekommen; er sei vielleicht sogar angestellt und von irgend jemand mit irgendwelchen Aufträgen betraut. Und als sehr gesetzte, besonnene Leute über dieses Gerücht lächelten und verständig bemerkten, daß ein Mensch, der fortwährend Skandalgeschichten veranlasse und sich bei uns mit einer geschwollenen Backe eingeführt habe, einem Beamten nicht sehr ähnlich sei, da erwiderte man ihnen flüsternd, er sei ja auch nicht offiziell angestellt, sondern sozusagen konfidentiell, und in einem solchen Falle erfordere der Dienst gerade, daß der Angestellte mit einem Beamten möglichst wenig Ähnlichkeit habe. Dieses Argument verfehlte seine Wirkung nicht; man wußte bei uns, daß die Regierung in der Hauptstadt unseren Landständen eine besondere Aufmerksamkeit zuwende. Ich wiederhole, daß diese Gerüchte nur flüchtig auftauchten und nach kurzer Zeit, bei Nikolai Wsewolodowitschs erstem Wiedererscheinen, spurlos wieder verschwanden; aber ich bemerke, daß die Ursache vieler Gerüchte einige kurze, aber boshafte Äußerungen waren, die der unlängst aus Petersburg zurückgekehrte Gardehauptmann a. D. Artemi Petrowitsch Gaganow in undeutlicher, wortkarger Manier im Klub hatte fallen lassen. Es war dies ein sehr großer Gutsbesitzer unseres Gouvernements und Kreises, ein Angehöriger der vornehmen Gesellschaft der Residenz und ein Sohn des verstorbenen Peter Pawlowitsch Gaganow, eben jenes hochangesehenen Klubvorstehers, mit welchem Nikolai Wsewolodowitsch vor mehr als vier Jahren das durch seine Unmanierlichkeit und Plötzlichkeit überraschende Rencontre gehabt hatte, das ich bereits oben, am Anfange meiner Erzählung, erwähnt habe.
Allen wurde es sogleich bekannt, daß Julija Michailowna bei Warwara Petrowna einen extraordinären Besuch hatte machen wollen, an der Haustür aber benachrichtigt worden war, die gnädige Frau könne wegen Unwohlseins niemanden empfangen. Ebenso, daß Julija Michailowna zwei Tage nach ihrem Besuche sich durch einen besonderen Boten nach Warwara Petrownas Befinden hatte erkundigen lassen. Schließlich begann sie sogar, Warwara Petrowna überall zu »beschützen«, natürlich nur im höchsten Sinne, das heißt in möglichst unbestimmter Weise. Alle die anfänglichen eilfertigen Anspielungen auf die Affäre vom Sonntage hörte sie mit strenger, kalter Miene an, so daß sie an den folgenden Tagen in ihrer Gegenwart nicht mehr erneuert wurden. Auf diese Weise befestigte sich überall die Vorstellung, daß Julija Michailowna nicht nur mit dieser ganzen geheimnisvollen Affäre, sondern auch mit ihrem ganzen geheimnisvollen Zusammenhange bis in die kleinsten Einzelheiten bekannt sei und nicht die Stellung einer Fernstehenden, sondern einer Teilnehmerin einnehme. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß sie bereits anfing, bei uns allmählich jenen hohen Einfluß zu gewinnen, nach dem unzweifelhaft ihr ganzes Sinnen und Streben ging, und sich als den »anerkannten Mittelpunkt« zu betrachten. Ein Teil der Gesellschaft sprach ihr praktischen Verstand und gesundes Taktgefühl zu ... aber davon später. Ihre Gönnerschaft war es auch, durch die sich zum Teil Peter Stepanowitschs sehr schnelle Erfolge in unserer Gesellschaft erklärten, Erfolge, über die damals Stepan Trofimowitsch besonders erstaunt war.
Vielleicht überschätzten aber er und ich diese Einwirkung. Erstens hatte Peter Stepanowitsch sich fast augenblicklich, gleich in den ersten vier Tagen nach seiner Ankunft, mit der ganzen Stadt bekannt gemacht. Angekommen war er am Sonntag, und am Dienstag sah ich ihn schon in der Equipage mit Artemi Petrowitsch Gaganow zusammen, einem trotz seiner weltmännischen Gewandtheit stolzen, empfindlichen, hochmütigen Menschen, mit dem wegen dieser Charaktereigenschaften schwer umzugehen war. Bei dem Gouverneur fand Peter Stepanowitsch ebenfalls eine sehr gute Aufnahme, dergestalt, daß er sofort in die Stellung eines nahen jugendlichen Freundes, ja eines Günstlings einrückte; er speiste bei Julija Michailowna fast täglich zu Mittag. Er war zwar mit ihr schon in der Schweiz bekannt geworden; aber dennoch war sein schneller Erfolg im Hause Seiner Exzellenz tatsächlich etwas auffallend. Hatte er doch früher einmal, ob mit Recht oder mit Unrecht, als ausländischer Revolutionär gegolten und sich bei irgendwelchen ausländischen Publikationen und Kongressen beteiligt, »was sich sogar aus den Zeitungen beweisen läßt«, wie sich mir gegenüber bei einer Begegnung Aloscha Teljatnikow ärgerlich ausdrückte, der jetzt leider ein verabschiedeter Beamter ist, früher aber im Hause des alten Gouverneurs ebenfalls die Rolle eines jungen Günstlings gespielt hatte. Aber dennoch stand die Tatsache fest: der frühere Revolutionär wurde, nachdem er wieder im lieben Vaterlande erschienen war, nicht nur nicht behelligt, sondern er fand sogar Förderung; also hatte vielleicht doch nichts gegen ihn vorgelegen. Liputin flüsterte mir einmal zu, einem Gerüchte zufolge habe Peter Stepanowitsch bei einer maßgebenden Instanz Reue bekundet und durch Angabe einiger anderer Namen für sich Verzeihung erlangt; auf diese Art habe er sein Verschulden vielleicht schon gutgemacht, habe auch außerdem versprochen, in Zukunft dem Vaterlande nützlich zu sein. Ich überbrachte diese giftige Mitteilung Stepan Trofimowitsch, und obwohl dieser es sich nicht zurechtlegen konnte, wurde er doch sehr nachdenklich. In der Folge wurde bekannt, daß Peter Stepanowitsch mit sehr wertvollen Empfehlungsbriefen zu uns gekommen war; jedenfalls hatte er einen an die Frau Gouverneur von einer außerordentlich hochgestellten alten Dame in Petersburg mitgebracht, deren Gatte einer der einflußreichsten alten Herren in Petersburg war. Diese alte Dame, die Patin Julija Michailownas, hatte in ihrem Briefe erwähnt, daß auch Graf K*** durch Nikolai Wsewolodowitschs Vermittelung Peter Stepanowitsch gut kenne, ihn sehr gern habe und ihn »trotz seiner früheren Verirrungen für einen sehr würdigen jungen Mann halte«. Julija Michailowna legte den allergrößten Wert auf ihre spärlichen und von ihr nur mit Mühe unterhaltenen Verbindungen mit den höchsten Sphären und freute sich natürlich sehr über den Brief der hohen alten Dame; aber auch dadurch schien ihr Interesse für Peter Stepanowitsch noch nicht vollständig erklärt. Selbst ihren Gatten suchte sie in beinah familiäre Beziehungen zu dem jungen Manne zu bringen, so daß Herr v. Lembke sich darüber beklagte ... aber davon ebenfalls später. Als Denkwürdigkeit merke ich nur noch an, daß auch der große Schriftsteller sich gegen Peter Stepanowitsch sehr wohlgeneigt benahm und ihn sogleich zu sich einlud. Eine solche Beeiferung von seiten eines so dünkelhaften Menschen war für Stepan Trofimowitsch ein ganz besonderer Schmerz; aber ich erklärte mir die Sache anders: wenn Herr Karmasinow den Nihilisten zu sich einlud, so hatte er dabei gewiß seine Beziehungen zu den fortschrittlich gesinnten jungen Männern der beiden Hauptstädte im Auge. Der große Schriftsteller zitterte ängstlich vor der neuen revolutionären Jugend, und da er in seiner Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse sich einbildete, daß diese den Schlüssel zu Rußlands Zukunft in Händen habe, so suchte er sich in unwürdiger Weise bei ihr einzuschmeicheln, hauptsächlich deswegen, weil sie ihn gar nicht beachtete.
II
Peter Stepanowitsch sprach auch bei seinem Vater zweimal vor, leider beidemal in meiner Abwesenheit. Das erstemal besuchte er ihn am Mittwoch, also am vierten Tage nach jener ersten Begegnung, und zwar geschäftlich. Beiläufig: die Abrechnung über das Gut wurde zwischen ihnen ganz im stillen erledigt. Warwara Petrowna hatte alles auf sich genommen und alles bezahlt, natürlich in der Weise, daß sie das kleine Gut für sich erwarb; an Stepan Trofimowitsch hatte sie nur die Benachrichtigung geschickt, daß alles abgetan sei, und ihr Bevollmächtigter, der Kammerdiener Alexei Jegorowitsch, hatte ihm zum Unterschreiben ein Schriftstück vorgelegt, unter das er denn auch schweigend und mit großer Würde seinen Namen setzte. Anläßlich der Würde bemerke ich, daß ich unseren früheren lieben Alten in diesen Tagen kaum wiedererkannte. Er hielt sich wie nie zuvor, war erstaunlich schweigsam geworden, hatte vom Sonntag an keinen einzigen Brief an Warwara Petrowna geschrieben, was mir als ein Wunder erschien, und war vor allen Dingen ruhig. Was ihn stark und fest machte, war offenbar ein großer Gedanke, mit dem er endgültig ins reine gekommen war, und der ihm Ruhe verlieh. Diesen Gedanken hatte er gefunden, und nun saß er da und wartete auf etwas. Zu Anfang war er übrigens krank gewesen, namentlich am Montag; er hatte an Cholerine gelitten. Ohne Nachrichten konnte er es die ganze Zeit über nicht aushalten; aber kaum verließ ich die äußeren Tatsachen, ging zu dem eigentlichen Kern der Sache über und sprach irgendwelche Vermutungen aus, so winkte er sofort ab, ich möchte aufhören. Aber die beiden Begegnungen mit seinem Sohne übten, wenn sie auch seine Haltung nicht erschütterten, doch auf ihn eine schmerzliche Wirkung aus. An den betreffenden beiden Tagen lag er nach dem Beisammensein auf dem Sofa, ein mit Essig angefeuchtetes Tuch um den Kopf geschlagen; aber er blieb im höchsten Grade ruhig.
Manchmal kam es übrigens auch vor, daß er mir nicht abwinkte. Auch schien es mir manchmal, als ob seine gewöhnliche geheimnisvolle Entschlossenheit ihn verließe und er mit einer neuen verführerischen Idee zu kämpfen beginne. Das war nur in einzelnen Augenblicken der Fall; aber ich bemerkte diese. Ich vermutete, daß er große Lust hatte, sich wieder unter Menschen blicken zu lassen, seine Einsamkeit aufzugeben, seinen Gegnern einen Kampf anzubieten, die letzte Schlacht zu liefern.
» Cher , ich möchte diese Menschen zerschmettern!« entfuhr es ihm am Donnerstagabend nach Peter Stepanowitschs zweitem Besuche, als er, den Kopf mit einem Handtuch umwickelt, ausgestreckt auf dem Sofa lag.
Bis zu diesem Augenblicke hatte er den ganzen Tag über noch kein Wort mit mir gesprochen.
»›Fils, fils chéri‹ und so weiter, nun ja, ich gebe zu, daß all diese Ausdrücke dummes Zeug sind, ein phrasenhafter Jargon; ich sehe das jetzt selbst ein. Ich habe ihn nicht genährt und getränkt, sondern ihn von Berlin als Säugling mit der Post nach dem Gouvernement O*** geschickt, nun ja, und so weiter, ich gebe es zu ... ›Du hast mich nicht genährt‹, sagte er, ›und hast mich mit der Post weggeschickt, und hier hast du mich noch obendrein ausgeplündert.‹ ›Aber Unglücklicher,‹ rief ich ihm zu, ›um dich hat mir ja mein Herz das ganze Leben lang weh getan, wenn ich dich auch mit der Post weggeschickt habe!‹ Il rit . Aber ich gebe es zu, ich gebe es zu ... das mit der Post hat seine Richtigkeit,« schloß er, als ob er im Fieber redete.
» Passons !« fing er nach fünf Minuten von neuem an. »Ich verstehe Turgenjew nicht. Sein Basarow In dem Roman »Väter und Söhne«.ist eine Phantasiegestalt, die gar nicht existiert; die Neuen sind ja die ersten gewesen, die sie damals als unmöglich ablehnten. Dieser Basarow ist eine Art von unklarer Mischung eines Nosdrew (In Gogols Roman »Tote Seelen«. Anmerkung des Übersetzers) mit Byron, c'est le mot ! Betrachten Sie einmal diese Neuen aufmerksam: sie wälzen sich herum und winseln vor Freude wie junge Hunde in der Sonne; sie sind glücklich; sie sind die Sieger! Wo bleibt da die Ähnlichkeit mit Byron? ... Und dabei welche gewöhnliche Alltäglichkeit! Welch eine plebejische Empfindlichkeit der Eigenliebe, welch eine unwürdige Begierde de faire du bruit autour de son nom , ohne zu bemerken, daß son nom ... Oh, welch eine Karikatur! ›Aber ich bitte dich,‹ rief ich ihm zu, ›willst du dich denn wirklich so, wie du bist, den Menschen als Ersatz für Christus anbieten?‹ Il rit. Il rit beaucoup. Il rit trop . Er hat eine seltsame Art zu lächeln. Seine Mutter hatte dieses Lächeln nicht. Il rit toujours .«
Es trat wieder Stillschweigen ein.
»Sie sind schlau; sie hatten sich am Sonntag verabredet ...« sagte er plötzlich unbedachtsamerweise.
»Oh, ohne Zweifel!« rief ich und spitzte die Ohren. »Es war alles ein abgekartetes Spiel, das sie noch dazu herzlich schlecht durchführten.«
»Ich meine etwas anderes. Wissen Sie wohl, daß sie absichtlich so plump spielten, damit es diejenigen merkten, die es nach ihrer Absicht merken sollten? Verstehen Sie das?«
»Nein, das verstehe ich nicht.«
» Tant mieux. Passons ! Ich bin heute sehr nervös.«
»Aber warum haben Sie sich denn mit ihm gestritten, Stepan Trofimowitsch?« fragte ich vorwurfsvoll.
» Je voulais convertir . Lachen Sie meinetwegen! Cette pauvre tante, elle entendra de belles choses ! O mein Freund, können Sie es glauben, daß ich mich vorhin als Patrioten gefühlt habe? Übrigens bin ich mir von jeher bewußt gewesen, daß ich ein Russe bin ... und ein echter Russe kann auch nicht von anderer Art sein als ich und Sie. Il y a là dedans quelque chose d'aveugle et de louche. «
»Zweifellos,« antwortete ich.
»Mein Freund, die echte Wahrheit ist immer unwahrscheinlich; wissen Sie das? Um die Wahrheit wahrscheinlicher zu machen, muß man ihr unbedingt etwas Unwahrheit beimischen. So haben es die Menschen auch von jeher gemacht. Vielleicht ist hier etwas, was wir nicht verstehen. Was meinen Sie, ist hier etwas, was wir in diesem Siegesgekreisch nicht verstehen? Ich möchte wünschen, daß dem so wäre. Das möchte ich wünschen.«
Ich schwieg. Er schwieg ebenfalls sehr lange.
»Manche sagen, das Gerede von dem französischen Verstande«, begann er auf einmal wie im Fieber, »sei eine Unwahrheit und sei immer eine Unwahrheit gewesen. Warum verleumden sie den französischen Verstand? Hier ist weiter nichts zu finden als russische Faulheit, unsere unwürdige Unfähigkeit, einen Gedanken zu produzieren, unser häßliches Parasitentum unter den Völkern. Ils sont tout simplement des paresseux ; aber französischen Verstand haben sie nicht. Ah, die Russen müßten zum Besten der Menschheit wie schädliche Parasiten ausgerottet werden! Wir Älteren, wir haben nach ganz, ganz anderen Dingen gestrebt; ich verstehe nichts, ich verstehe nichts mehr! ›Begreifst du wohl,‹ rief ich ihm zu, ›begreifst du, daß, wenn ihr die Guillotine mit solchem Entzücken in den Vordergrund stellt, ihr das einzig deswegen tut, weil es das Allerleichteste ist, Köpfe abzuschlagen, und das Allerschwerste, einen Gedanken zu haben? Vous êtes des paresseux! Votre drapeau est une guenille, une impuissance. Diese Bauernwagen, oder wie es da heißt: ›Das Rattern der Bauernwagen, die der Menschheit Getreide zuführen,‹ das soll nützlicher sein als die Sixtinische Madonna, oder wie es bei ihnen heißt ... une bêtise dans ce genre . Aber begreifst du wohl,‹ rief ich ihm zu, ›begreifst du wohl, daß der Mensch das Unglück ebenso notwendig braucht wie das Glück?‹ Il rit. ›Du läßt hier Bonmots los,‹ sagte er, ›während du es deinen Gliedern‹ (er drückte sich derber aus) ›auf einem Samtsofa bequem machst ...‹ Und beachten Sie dies: unsere Gewöhnung, daß sich Vater und Sohn gegenseitig duzen, ist ja sehr schön, wenn beide übereinstimmen; aber wie, wenn sie sich zanken?«
Wir schwiegen wieder ungefähr eine Minute lang.
» Cher ,« schloß er dann plötzlich, indem er sich schnell erhob, »wissen Sie wohl auch, daß dies unfehlbar mit etwas enden wird?«
»Nun, natürlich!« erwiderte ich.
» Vous ne comprenez pas. Passons ! Aber ... gewöhnlich enden die Dinge auf der Welt mit nichts; aber hier wird ein Ende vorhanden sein, unfehlbar, unfehlbar!«
Er stand auf, ging in stärkster Aufregung durch das Zimmer, und als er wieder zum Sofa kam, ließ er sich kraftlos darauf niedersinken.
Am Freitagmorgen fuhr Peter Stepanowitsch irgendwohin in unserm Kreise und blieb bis zum Montag fort. Von seiner Abreise erfuhr ich durch Liputin, und gleichzeitig erfuhr ich von ihm wie gesprächsweise, daß die Lebjadkins, Bruder und Schwester, beide irgendwo jenseits des Flusses in der Töpfervorstadt wohnten. »Ich habe sie selbst hinübergebracht,« fügte Liputin hinzu, und von Lebjadkins abbrechend, benachrichtigte er mich plötzlich, daß Lisaweta Nikolajewna sich mit Mawriki Nikolajewitsch verheiraten werde, und wenn das auch nicht publiziert sei, so habe doch die Verlobung stattgefunden und die Sache sei perfekt. Am andern Tage traf ich Lisaweta Nikolajewna, die in Begleitung Mawriki Nikolajewitschs zum erstenmal nach ihrer Krankheit ausritt. Sie blitzte mich von weitem mit ihren Augen an, lachte und nickte mir sehr freundschaftlich zu. All dies erzählte ich Stepan Trofimowitsch; aber er schenkte nur der Nachricht über Lebjadkins einige Aufmerksamkeit.
Nachdem ich so unsere rätselhafte Lage während der acht Tage, wo wir noch nichts wußten, geschildert habe, will ich jetzt an die Erzählung der folgenden Ereignisse gehen, und zwar sozusagen schon mit Kenntnis des ganzen Sachverhaltes, wie er sich jetzt enthüllt und herausgestellt hat. Ich beginne mit dem achten Tage nach jenem Sonntage, das heißt mit Montagabend; denn mit diesem Abend beginnt in Wirklichkeit eine neue Geschichte.
III
Es war sieben Uhr abends. Nikolai Wsewolodowitsch saß allein in seinem Zimmer. Gerade in diesem hatte er schon früher gern gewohnt; es war hoch, mit Teppichen belegt und mit etwas schwerfälligen, altmodischen Möbeln ausgestattet. Er saß in einer Ecke auf dem Sofa, wie zum Ausgehen gekleidet, schickte sich aber, wie es schien, nicht dazu an. Auf dem Tische vor ihm stand eine Lampe mit einem Lichtschirm. Die Seiten und Ecken des großen Zimmers blieben im Schatten. Sein Blick war nachdenklich und auf einen Punkt gerichtet, aber nicht ganz ruhig, sein Gesicht müde und etwas abgemagert. An einer geschwollenen Backe hatte er tatsächlich gelitten; aber das Gerücht von einem ausgeschlagenen Zahne war übertrieben gewesen. Der Zahn hatte nur gewackelt, war aber nun wieder fest geworden; auch die Oberlippe war auf der Innenseite gespalten gewesen; aber auch das war schon geheilt. Die Geschwulst aber war nur deswegen die ganze Woche über nicht vergangen, weil der Kranke sich nicht dazu hatte verstehen mögen, einen Arzt zu nehmen und sie rechtzeitig schneiden zu lassen, sondern gewartet hatte, bis das Geschwür von selbst aufging. Er hatte nicht nur keinen Arzt genommen, sondern auch die Mutter kaum zu sich hereingelassen, nur auf einen Augenblick, einmal am Tage und durchaus nur in der Dämmerung, wenn es schon dunkel geworden, aber noch kein Licht angezündet war. Auch Peter Stepanowitsch hatte er nicht empfangen, der doch, solange er in der Stadt war, täglich zwei- oder dreimal zu Warwara Petrowna herangekommen war. Nun war dieser endlich Montag morgen nach dreitägiger Abwesenheit wieder zurückgekehrt und erschien, nachdem er in der ganzen Stadt umhergelaufen war und bei Julija Michailowna zu Mittag gespeist hatte, am Abend endlich bei Warwara Petrowna, die ihn ungeduldig erwartete. Das Verbot war aufgehoben; Nikolai Wsewolodowitsch empfing wieder Besuch. Warwara Petrowna führte den Gast selbst an die Tür ihres Sohnes; sie hatte schon lange gewünscht, daß die beiden einander wiedersehen möchten, und Peter Stepanowitsch hatte ihr versprochen, von Nikolai nachher wieder zu ihr heranzukommen und ihr Bericht zu erstatten. Schüchtern klopfte sie bei Nikolai Wsewolodowitsch an, und da sie keine Antwort erhielt, wagte sie es, die Tür eine Handbreit zu öffnen.
»Nikolai, darf Peter Stepanowitsch zu dir hereinkommen?« fragte sie leise und ruhig und bemühte sich, ihren Sohn hinter der Lampe zu erkennen.
»Er darf, er darf, natürlich darf er!« rief Peter Stepanowitsch selbst laut und in heiterem Tone, öffnete mit eigener Hand die Tür und trat ein.
Nikolai Wsewolodowitsch hatte das Klopfen an der Tür nicht gehört gehabt, sondern nur die schüchterne Frage der Mutter, fand aber keine Zeit mehr, darauf zu antworten. Vor ihm lag in diesem Augenblicke ein Brief, den er soeben durchgelesen hatte, und über den er ernstlich nachdachte. Er fuhr zusammen, als er plötzlich Peter Stepanowitschs laute Worte hörte, und verbarg schnell den Brief unter einem Briefbeschwerer, der ihm gerade in die Hand kam; indes gelang ihm dies nicht vollständig: eine Ecke des Briefes und fast das ganze Kuvert schauten darunter hervor.
»Ich habe absichtlich aus voller Kehle geschrien, damit Sie Zeit hätten sich vorzubereiten,« flüsterte Peter Stepanowitsch eilig mit erstaunlicher Naivität, lief zum Tische hin und richtete seine Blicke im Nu auf den Briefbeschwerer und die Ecke des Briefes.
»Und Sie haben natürlich noch sehen können, wie ich einen Brief, den ich soeben erhalten habe, vor Ihnen unter dem Briefbeschwerer versteckte,« erwiderte Nikolai Wsewolodowitsch ruhig, ohne sich vom Platze zu rühren.
»Einen Brief? Aber ich bitte Sie, was kümmert mich Ihr Brief!« rief der Besucher. »Aber ... die Hauptsache ...« flüsterte er wieder, indem er sich nach der bereits geschlossenen Tür umwandte und mit dem Kopfe nach jener Seite hindeutete.
»Sie horcht nie,« bemerkte Nikolai Wsewolodowitsch kühl.
»Na, und wenn sie es auch täte!« erwiderte Peter Stepanowitsch flink, laut und fröhlich und setzte sich auf einen Lehnstuhl. »Ich habe nichts dagegen; ich bin jetzt nur hergelaufen, um mit Ihnen unter vier Augen zu reden. Na, nun bin ich Ihrer ja endlich habhaft geworden! Vor allen Dingen: wie steht es mit Ihrem Befinden? Ich sehe, daß es vortrefflich ist; morgen werden Sie sich vielleicht wieder öffentlich zeigen, wie?«
»Vielleicht.«
»Lassen Sie doch die Leute und auch mich selbst endlich wissen, was Sie zu tun gedenken!« rief er mit heftigen Gestikulationen, aber mit scherzhafter, freundlicher Miene. »Wenn Sie wüßten, was ich ihnen habe vorschwatzen müssen! Übrigens wissen Sie es ja.«
Er lachte.
»Alles weiß ich nicht. Ich habe nur von meiner Mutter gehört, daß Sie sehr ... rührig gewesen seien.«
»Das heißt, ich habe nichts Bestimmtes gesagt,« ereiferte sich Peter Stepanowitsch auf einmal, wie wenn er sich gegen einen heftigen Angriff verteidigte. »Wissen Sie, ich habe Schatows Frau hervorgeholt, das heißt die Gerüchte von Ihrer Liaison mit ihr in Paris, wodurch natürlich der Vorfall am Sonntag seine Erklärung fand ... Sie nehmen es doch nicht übel?«
»Ich bin davon überzeugt, daß Sie sich alle Mühe gegeben haben.«
»Nun, das war meine einzige Besorgnis. Indessen was bedeutet das: ›sich alle Mühe gegeben haben‹? Darin liegt ja ein Vorwurf ... Übrigens, bringen Sie nur die Sache in Gang; auf dem Wege hierher fürchtete ich am allermeisten, daß Sie keine Lust haben würden, die Sache in Gang zu bringen.«
»Ich will auch nichts in Gang bringen,« erwiderte Nikolai Wsewolodowitsch etwas gereizt; jedoch lächelte er sogleich wieder.
»Ich werde nicht davon reden, ich werde nicht davon reden; mißverstehen Sie mich nicht, ich werde nicht davon reden!« versetzte Peter Stepanowitsch, indem er mit den Händen abwehrende Bewegungen machte und die Worte wie Erbsen aus dem Munde rollen ließ; an der Reizbarkeit seines Wirtes hatte er sofort seine Freude. »Ich werde Sie nicht mit ›unserer‹ Angelegenheit aufregen, namentlich in Ihrem jetzigen Zustande. Ich bin nur wegen des Vorfalls vom Sonntag herangekommen, und zwar notgedrungen; es geht nicht anders. Ich wollte Ihnen eine sehr offene Erklärung machen, an der das Hauptinteresse ich habe, nicht Sie; das sage ich um Ihrer Eigenliebe willen; aber es ist auch gleichzeitig die Wahrheit. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, daß ich von nun an immer aufrichtig sein werde.«
»Also waren Sie es früher nicht?«
»Das wissen Sie ja selbst. Ich habe es oft mit Schlauheit versucht ... Sie lächeln; ich freue mich sehr über dieses Lächeln, das mir Anlaß zu einer Erklärung gibt; ich habe ja dieses Lächeln durch das prahlerische Wort ›Schlauheit‹ absichtlich hervorgelockt, damit Sie sich sofort ärgern sollten: wie ich nur denken könne, daß ich imstande sei, durch Schlauheit etwas bei Ihnen zu erreichen; und damit ich dann sogleich eine Erklärung daran anknüpfen könnte. Sehen Sie wohl, sehen Sie wohl, wie offenherzig ich jetzt geworden bin? Nun also, ist es Ihnen gefällig, zuzuhören?«
Nikolai Wsewolodowitschs Gesichtsausdruck war bisher ruhig, geringschätzig und sogar spöttisch gewesen, trotzdem der Gast sichtlich bemüht war, seinen Wirt durch die Frechheit seiner vorbereiteten und absichtlich plump naiven Bemerkungen zu reizen, ließ aber jetzt endlich eine gewisse unruhige Neugier erkennen.
»Nun, dann hören Sie!« fuhr Peter Stepanowitsch, sich noch mehr als vorher hin und her drehend, fort. »Als ich hierher kam, das heißt überhaupt hierher, in diese Stadt, vor zehn Tagen, da nahm ich mir bestimmt vor, in einer Rolle aufzutreten. Das Beste ist ja freilich, ganz ohne Rolle aufzutreten und seine eigene Persönlichkeit zu präsentieren, nicht wahr? Es ist nichts schlauer als sich zu zeigen, wie man wirklich ist, weil doch niemand daran glaubt. Ich wollte eigentlich, offen gestanden, die Rolle eines Dummkopfes spielen, weil das leichter ist als die eigene Persönlichkeit zu zeigen; aber da ein Dummkopf ein Extrem ist und jedes Extrem die Neugier rege macht, so bin ich endgültig bei der eigenen Persönlichkeit stehen geblieben. Na, was habe ich denn auch für eine eigene Persönlichkeit? Ich gehöre zur goldenen Mittelsorte: ich bin weder dumm noch klug, ziemlich unbegabt und naiv, wie verständige Leute hier sagen, nicht wahr?«
»Nun ja, vielleicht verhält es sich so,« erwiderte Nikolai Wsewolodowitsch leise lächelnd.
»Ah, Sie stimmen mir bei; das freut mich sehr; ich wußte im voraus, daß das Ihre eigenen Gedanken seien ... Beunruhigen Sie sich nicht, beunruhigen Sie sich nicht; ich nehme es Ihnen nicht übel und habe diese Charakteristik von mir durchaus nicht in der Absicht gegeben, um von Ihnen die entgegengesetzten Lobsprüche herauszulocken: ›Nein, Sie sind nicht unbegabt, nein, Sie sind klug‹ ... Ah, Sie lächeln wieder! ... Ich bin wieder hereingefallen. Sie würden ja gar nicht sagen: ›Sie sind klug‹; na, allerdings; Sie haben recht. Passons ! wie mein Papa sagt, und beiläufig gesagt: nehmen Sie mir meine Redseligkeit nicht übel! Apropos, es geht mir so: ich rede immer viel, das heißt, ich mache viele Worte und überhaste mich; aber dabei hört es sich doch nie gut an. Aber woher kommt das, daß ich viele Worte mache und es sich doch nie gut anhört? Das kommt daher, daß ich nicht zu reden verstehe. Wer gut zu reden versteht, der redet kurz. Das ist eben bei mir mangelnde Begabung, nicht wahr? Aber da diese Gabe der mangelnden Begabung bei mir eine natürliche ist, warum sollte ich sie da nicht künstlich benutzen? Und ich benutze sie. Allerdings, als ich mich anschickte, hierher zu reisen, dachte ich daran, anfänglich zu schweigen; aber schweigen, das ist ein großes Talent und somit nichts für mich; und zweitens ist das Schweigen doch gefährlich; na, da sagte ich mir denn endgültig, daß es doch das Beste sei zu reden, aber nach Art eines Unbegabten, das heißt viel, viel, viel zu reden und in hastiger Manier alles Mögliche zu beweisen und mich zum Schluß immer in meinen eigenen Beweisen so zu verheddern, daß der Zuhörer die Hände über dem Kopfe zusammenschlägt und weggeht, ohne das Ende abzuwarten, und am liebsten ausspucken möchte. Und das Resultat ist, daß man erstens die Menschen von seiner Einfalt überzeugt, zweitens sie sehr langweilt und drittens ihnen unverständlich bleibt: drei Vorteile mit einemmal! Ich bitte Sie, wer wird einen dann noch im Verdachte geheimer Pläne haben? Ja, jeder von ihnen wird es als persönliche Beleidigung auffassen, wenn ihm jemand sagt, ich gäbe mich mit geheimen Plänen ab. Und außerdem bringe ich die Menschen manchmal zum Lachen, was auch sehr viel wert ist. Und sie werden mir jetzt alles schon allein deswegen verzeihen, weil sich nun hier in Rußland herausstellt, daß der vermeintlich kluge Mensch, der im Auslande Proklamationen verfaßt hat, dümmer ist als sie selbst; nicht wahr? An Ihrem Lächeln sehe ich, daß Sie mir zustimmen.«
Nikolai Wsewolodowitsch hatte übrigens gar nicht gelächelt, sondern hörte im Gegenteil mit finsterer Miene und etwas ungeduldig zu.
»Wie beliebt? Ich glaube, Sie sagten: ›Ganz egal‹?« plapperte Peter Stepanowitsch weiter (Nikolai Wsewolodowitsch hatte überhaupt nichts gesagt). »Gewiß, gewiß; ich versichere Ihnen, daß ich durchaus nicht beabsichtige, Sie durch meine Kameradschaft zu kompromittieren. Aber wissen Sie, Sie sind heute furchtbar empfindlich; ich komme in aller Aufrichtigkeit und Heiterkeit zu Ihnen, und Sie legen jedes Wort von mir auf die Goldwage. Ich versichere Ihnen, daß ich heute von keinem kitzligen Gegenstande zu reden anfangen werde; mein Wort darauf; und ich bin im voraus mit allen Ihren Bedingungen einverstanden!«
Nikolai Wsewolodowitsch schwieg hartnäckig.
»Nun? Wie steht's? Haben Sie etwas gesagt? Ich sehe, ich sehe, daß ich wieder, wie es scheint, Unsinn geredet habe. Sie haben keine Bedingungen gestellt und werden keine stellen; ich glaube es, ich glaube es; nun, beruhigen Sie sich nur; ich weiß ja schon allein, daß es sich nicht der Mühe lohnt, mir Bedingungen zu stellen, nicht wahr? Ich nehme Ihnen die Antworten vorweg, und natürlich aus mangelnder Begabung; die ist für mich charakteristisch ... Sie lachen? Nun, worüber?«
»Es ist nichts,« antwortete Nikolai Wsewolodowitsch endlich lächelnd. »Es fällt mir soeben ein, daß ich Sie tatsächlich einmal unbegabt genannt habe; aber Sie waren damals nicht zugegen, also muß man es Ihnen hinterbracht haben ... Ich möchte Sie bitten, möglichst schnell zur Sache zu kommen.«
»Aber ich bin ja bei der Sache; ich sage das ja gerade anläßlich des Sonntags!« erwiderte Peter Stepanowitsch. »Nun, was bin ich nach Ihrer Ansicht am Sonntag gewesen? Ich war der Typus der hastigen, mittelmäßigen Unbegabtheit und bemächtigte mich auf die unbegabteste Weise mit Gewalt des Gespräches. Aber Sie haben mir alles verziehen, weil ich erstens so naiv bin (das scheint jetzt hier die feststehende Meinung aller zu sein), und zweitens weil ich ein hübsches Geschichtchen erzählt und damit allen aus der Verlegenheit geholfen habe, nicht wahr, nicht wahr?«
»Das heißt, Sie haben absichtlich in dieser Weise erzählt, um bei den Hörern einen Zweifel bestehen zu lassen und bei ihnen den Glauben zu erwecken, daß wir beide unter einer Decke steckten, während doch in Wirklichkeit keine Abmachung zwischen uns bestand und ich Sie nicht um Ihre Beihilfe gebeten hatte.«
»Ganz richtig, ganz richtig!« fiel Peter Stepanowitsch ein, wie wenn er höchst entzückt wäre. »Genau so habe ich gehandelt, damit Sie dieses ganze Manöver merken sollten; in der Hauptsache habe ich ja diese Farce Ihretwegen vorgebracht, weil ich Sie fangen und kompromittieren wollte ... Die Hauptsache war mir, zu erfahren, bis zu welchem Grade Sie sich fürchten.«
»Ich möchte wohl wissen, warum Sie jetzt so offenherzig sind!«
»Werden Sie nicht ärgerlich, werden Sie nicht ärgerlich, funkeln Sie nicht so mit den Augen! ... Übrigens tun Sie das gar nicht. Also Sie möchten gern wissen, warum ich so offenherzig bin? Nun, weil jetzt alles sich geändert hat, beendet, vergangen, mit Sand verschüttet ist. Ich habe auf einmal meine Meinung über Sie geändert. Die alte Methode ist vollständig abgetan; ich werde Sie jetzt nie mehr auf die alte, sondern von nun an auf die neue Weise kompromittieren.«
»Sie haben Ihre Taktik geändert?«
»Taktik kann man das nicht nennen. Sie haben jetzt in allen Dingen Ihren freien Willen; Sie können nach Belieben Ja und Nein sagen. Das ist meine neue Taktik Ihnen gegenüber. Von ›unserer‹ Angelegenheit aber werde ich keinen Ton sagen, ehe Sie mich nicht selbst dazu auffordern. Sie lachen? Möge es Ihnen wohl bekommen; ich lache auch selbst. Aber jetzt meine ich es ernst, ganz ernst, obwohl jemand, der so hastet, gewiß unbegabt ist, nicht wahr? Aber ganz egal; mag ich auch unbegabt sein, aber ich meine es ernst, ganz ernst.«
Er sprach wirklich ernst, in einem ganz anderen Tone und in einer besonderen Erregung, so daß Nikolai Wsewolodowitsch ihn mit lebhaftem Interesse anblickte.
»Sie sagen, Sie hätten Ihre Meinung über mich geändert?« fragte er.
»Ja, ich habe meine Meinung über Sie in dem Augenblicke geändert, als Sie nach Schatows Tätlichkeit die Hände zurücknahmen. Aber genug davon, genug davon; fragen Sie, bitte, nichts weiter; mehr werde ich jetzt nicht sagen.«
Er sprang auf und gestikulierte mit den Händen, als wollte er weitere Fragen abwehren; da aber keine Fragen erfolgten und er noch nicht fortzugehen beabsichtigte, so beruhigte er sich einigermaßen und setzte sich wieder auf den Lehnstuhl.
»Apropos, beiläufig gesagt,« schwatzte er wieder los, »hier reden manche, Sie würden ihn töten, und bieten Wetten darauf an, so daß Lembke sogar daran gedacht hat, die Polizei in Bewegung zu setzen; aber Julija Michailowna hat ihn davon zurückgehalten ... Genug davon, genug davon; ich wollte Sie nur benachrichtigen. Noch einmal apropos: ich habe die beiden Lebjadkins noch gleich an demselben Tage hinübergeschafft, Sie wissen; haben Sie mein Briefchen mit ihrer Adresse erhalten?«
»Ja, ich habe es gleich damals erhalten.«
»Das habe ich nicht infolge mangelnder Begabung, sondern aus aufrichtiger Dienstfertigkeit getan. Wenn es unbegabt herausgekommen ist, so war es dafür doch gut gemeint.«
»Nun, das tut nichts; vielleicht war es sogar nötig ...« sagte Nikolai Wsewolodowitsch nachdenklich. »Aber ich möchte Sie bitten: schreiben Sie mir keine Briefe mehr!«
»Es ging nicht anders; ich habe ja auch nur den einen geschrieben.«
»Also weiß es Liputin?«
»Das ließ sich nicht vermeiden; aber Liputin wird, wie Sie selbst wissen, nicht wagen ... Apropos, wir müßten auch zu den Unsrigen gehen, ich will sagen zu denen, nicht zu den ›Unsrigen‹; nehmen Sie nur nicht wieder an dem Ausdruck Anstoß! Und beunruhigen Sie sich nicht; ich meine nicht jetzt gleich, sondern später einmal. Jetzt wird es gleich regnen. Ich werde sie vorher davon in Kenntnis setzen; sie werden sich versammeln, und dann können wir am Abend hingehen. Sie werden mit aufgesperrten Mäulern warten wie die jungen Dohlen im Neste, was wir ihnen für einen schönen Bissen bringen. Es ist ein hitziges Völkchen. Sie haben sich irgendwelche Büchelchen vorgesucht, und dann kommen sie zusammen, um darüber zu disputieren. Wirginski vertritt die allgemein menschliche Richtung; Liputin ist Fourierist, mit einer starken Neigung zum Polizeiwesen; ich sage Ihnen, in dieser einen Beziehung ist er ein wertvoller Mensch, aber in allen andern bedarf er strenger Behandlung; und dann ist da schließlich noch der mit den langen Ohren, der trägt sein eigenes System vor. Und wissen Sie, sie fühlen sich gekränkt, weil ich geringschätzig mit ihnen umgehe und sie mit Wasser begieße, he-he! Aber hingehen müssen wir unbedingt einmal.«
»Haben Sie mich da als eine Art Chef bezeichnet?« fragte Nikolai Wsewolodowitsch in möglichst lässigem Tone.
Peter Stepanowitsch blickte ihn schnell an.
»Apropos,« begann er, schnell auf ein anderes Thema übergehend, als ob er die Frage nicht gehört hätte, »ich bin zwei-, dreimal bei der hochverehrten Warwara Petrowna gewesen und bin ebenfalls genötigt gewesen, viel zu reden.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Nein, stellen Sie es sich nicht vor; ich habe ihr einfach gesagt, Sie würden keinen Mord begehen, na und andere solche süßen Sachen. Und denken Sie nur: sie wußte schon am andern Tage, daß ich Marja Timofejewna über den Fluß hinübergebracht hatte; haben Sie es ihr gesagt?«
»Das ist mir nicht eingefallen.«
»Das habe ich mir gedacht, daß Sie es nicht gewesen waren. Wer außer Ihnen könnte es aber gesagt haben? Das ist interessant.«
»Selbstverständlich Liputin.«
»N-nein, Liputin nicht,« murmelte Peter Stepanowitsch mit finsterem Gesichte. »Ich weiß schon, wer. Das sieht Schatow ganz ähnlich ... Übrigens ist das dummes Zeug; lassen wir es! Aber es ist höchst wichtig ... Apropos, ich erwartete immer, daß Ihre Frau Mutter mir gegenüber plötzlich mit der Hauptfrage herausplatzen werde ... Ach ja, all diese Tage her war sie furchtbar mürrisch, und auf einmal, wie ich heute zu ihr komme, strahlte sie nur so. Wie hängt das zusammen?«
»Das kommt daher, daß ich ihr heute mein Wort gegeben habe, mich in fünf Tagen um Lisaweta Nikolajewnas Hand zu bewerben,« antwortete Nikolai Wsewolodowitsch mit überraschender Offenherzigkeit.
»Ah, nun ... ja, dann allerdings,« brachte Peter Stepanowitsch stammelnd heraus. »Es gehen in der Stadt Gerüchte von einer andern Verlobung; Sie wissen wohl? Es mag auch seine Richtigkeit haben. Aber Sie haben recht; sie würde auch noch vom Traualtar weglaufen; Sie brauchen sie nur zu rufen. Sie nehmen es doch nicht übel, daß ich so rede?«
»Nein, ich nehme es nicht übel.«
»Ich bemerke, daß es heute sehr schwer ist, Sie zu ärgern, und fange an, mich vor Ihnen zu fürchten. Ich bin sehr neugierig, in welcher Weise Sie sich morgen in der Öffentlichkeit zeigen werden. Sie haben gewiß schon viele schöne Streiche vorbereitet. Sie nehmen es mir nicht übel, daß ich das sage?«
Nikolai Wsewolodowitsch gab gar keine Antwort, wodurch Peter Stepanowitsch sich sehr verletzt fühlte.
»Apropos, haben Sie das von Lisaweta Nikolajewna Ihrer Mama im Ernst gesagt?« fragte er.
Nikolai Wsewolodowitsch blickte ihn unverwandt und kalt an.
»Ah, ich verstehe, nur zur Beruhigung, nun ja.«
»Und wenn ich es im Ernst gesagt hätte?« fragte Nikolai Wsewolodowitsch in festem Tone.
»Nun, dann mit Gott, wie man in solchen Fällen zu sagen pflegt; der Sache wird es nicht schaden (Sie sehen: ich habe nicht gesagt: ›unserer Sache‹; Sie können das Wörtchen ›unser‹ nicht leiden). Ich aber ... ich aber, nun, ich stehe zu Ihren Diensten; das wissen Sie selbst.«
»Meinen Sie?«
»Ich meine nichts, gar nichts,« beeilte sich Peter Stepanowitsch lachend zu erwidern; »denn ich weiß, daß Sie Ihre Angelegenheiten selbst im voraus überlegt und alles reiflich bedacht haben. Ich will nur sagen, daß ich Ihnen im Ernst zu Diensten stehe, immer und überall und in jedem Falle, das heißt in jedem, verstehen Sie auch wohl?«
Nikolai Wsewolodowitsch gähnte.
»Ich langweile Sie,« rief Peter Stepanowitsch, griff nach seinem ganz neuen Zylinderhute und sprang auf, als wenn er fortgehen wollte, blieb aber dabei doch noch da und redete im Stehen ununterbrochen weiter; manchmal machte er ein paar Schritte im Zimmer, und an lebhafteren Stellen des Gespräches schlug er sich mit dem Hute gegen das Knie. »Ich hatte gedacht. Sie noch mit Mitteilungen über Lembkes zu erheitern!« rief er in munterem Tone.
»Jetzt nicht; ein andermal. Wie ist übrigens Julija Michailownas Befinden?«
»Was haben Sie doch alle für gute gesellschaftliche Manieren: das Befinden dieser Dame ist Ihnen genau so gleichgültig wie das einer grauen Katze; aber doch erkundigen Sie sich danach. Ich lobe das. Sie ist gesund und verehrt Sie abgöttisch und erwartet von Ihnen unglaublich Großartiges. Über den Vorfall vom Sonntag schweigt sie und ist überzeugt, daß Sie selbst durch Ihr bloßes Erscheinen über alle Gegnerschaft triumphieren werden. Wahrhaftig, sie hat die Vorstellung, daß Sie Gott weiß was vermögen. Übrigens sind Sie jetzt eine rätselhafte, romantische Persönlichkeit, mehr als je vorher, – eine außerordentlich vorteilhafte Position. Alle erwarten Sie in einer Spannung, die geradezu unglaublich ist. Schon als ich wegfuhr, herrschte eine fieberhafte Erregung, und jetzt ist es noch ärger geworden. Apropos, ich danke Ihnen noch einmal für den Brief. Vor dem Grafen K*** haben sie sämtlich Angst. Wissen Sie, man hält Sie, wie es scheint, für einen Spion! Ich sage dazu Ja; Sie nehmen es doch nicht übel?«
»Nein, es schadet nichts.«
»Es schadet nichts; es ist für die Folgezeit sogar notwendig. Die Leute haben hier ihre hergebrachten Ordnungen; ich bin dabei natürlich das belebende Element. An der Spitze steht Julija Michailowna, desgleichen Gaganow ... Sie lachen? Ja, ich habe da meine eigene Taktik: ich rede fortwährend Unsinn, und auf einmal sage ich ein verständiges Wort, gerade in dem Augenblicke, wo alle danach suchen. Dann umringen sie mich, und nun fange ich wieder an, Unsinn zu reden. Sie haben mich schon alle aufgegeben; ›er ist nicht ohne Fähigkeiten,‹ sagen sie, ›aber schrecklich naiv‹. Lembke fordert mich auf, in den Staatsdienst zu treten, damit ich mich bessere. Wissen Sie, ich behandle ihn schauderhaft, das heißt, ich kompromittiere ihn, so daß er die Augen vor Schreck aufreißt. Julija Michailowna stachelt mich dazu an. Ja, apropos, Gaganow ist auf Sie sehr wütend. Gestern in Duchowo hat er von Ihnen in einer ganz abscheulichen Weise zu mir gesprochen. Ich gab ihm sogleich vollständig recht, selbstverständlich nicht vollständig. Ich habe bei ihm einen ganzen Tag in Duchowo verlebt. Ein prachtvolles Gut, ein schönes Haus!«
»Also ist er jetzt in Duchowo?« rief Nikolai Wsewolodowitsch erregt; er machte eine lebhafte Bewegung nach vorn und sprang beinah auf.
»Nein, er hat mich heute morgen hierher gefahren; wir sind zusammen zurückgekehrt,« erwiderte Peter Stepanowitsch, wie wenn er Nikolai Wsewolodowitschs plötzliche Erregung gar nicht bemerkte. »Was ist das? Ich habe ein Buch hingeworfen,« sagte er und bückte sich, um ein Buch aufzuheben, das auf dem Tische gelegen hatte und von ihm heruntergestreift worden war. »Die Frauen, von Balzac, mit Illustrationen,« (er hatte das Buch aufgeschlagen); »das habe ich nicht gelesen. Lembke schreibt auch Romane.«
»Ja?« fragte Nikolai Wsewolodowitsch, wie wenn er sich dafür interessierte.
»Natürlich in russischer Sprache und im geheimen. Julija Michailowna weiß es und erlaubt es ihm. Er ist eine Schlafmütze; aber er weiß sich zu benehmen; diese Fähigkeit hat sich bei den Verwaltungsbeamten herausgebildet. Diese Strenge in den Formen, diese Konsequenz! Wenn wir nur etwas von der Art hätten!«
»Sie loben die Verwaltung?«
»Aber gewiß doch! Die ist ja noch das einzige, was in Rußland von Natur gewachsen ist, und was wir erreicht haben ... ich bin schon still, ich bin schon still!« unterbrach er sich plötzlich. »Ich werde von diesen bedenklichen Dingen keine Silbe mehr sagen. Aber nun leben Sie wohl; Sie sehen ganz grün aus.«
»Ich habe Fieber.«
»Das ist sehr glaublich; legen Sie sich doch ins Bett! Apropos: hier im Kreise gibt es Skopzen (Eine religiöse Sekte, deren Anhänger sich entmannten und auf den Messias warteten. Anmerkung des Übersetzers.), ein merkwürdiges Völkchen ... Aber davon ein andermal. Übrigens noch ein Geschichtchen: hier im Kreise steht ein Infanterieregiment. Freitagabend kneipte ich mit den Offizieren zusammen in B***zi. Da haben wir drei Freunde, vous comprenez? Es wurde über Atheismus gesprochen, und sie setzten natürlich Gott ab. Sie kreischten vor Vergnügen. Apropos, Schatow behauptet, wenn einmal in Rußland ein Aufstand ausbreche, so werde er unbedingt mit Atheismus beginnen. Vielleicht hat er recht. Aber da saß ein grauhaariger Hauptmann dabei, ein Mensch ohne Bildung; der schwieg immer und redete kein Wort; auf einmal stellte er sich mitten im Zimmer hin und sagte laut, aber, wissen Sie, wie wenn er zu sich selbst spräche: ›Wenn es keinen Gott gibt, wie kann ich dann Hauptmann sein?‹ Dann nahm er seine Mütze, breitete wie verständnislos die Arme auseinander und ging hinaus.«
»Da hat er einen ziemlich gesunden Gedanken ausgesprochen,« sagte Nikolai Wsewolodowitsch und gähnte zum drittenmal.
»Ja? Ich hatte ihn nicht verstanden; ich wollte Sie danach fragen. Nun, was hatte ich doch noch für Sie? Ja: interessant ist die Fabrik der Gebrüder Schpigulin; es sind darin, wie Sie wissen, fünfhundert Arbeiter beschäftigt; die Fabrik ist ein richtiger Choleraherd; seit fünfzehn Jahren ist sie nicht gereinigt worden; die Arbeiter werden an ihrem Lohn verkürzt; die Besitzer sind Millionäre. Ich versichere Ihnen, daß unter den Arbeitern manche einen Begriff von der Internationale haben. Sie lächeln? Nun, Sie werden selbst sehen; lassen Sie mir nur noch ein ganz, ganz klein bißchen Zeit! Ich habe Sie schon einmal um Frist gebeten und bitte jetzt wieder darum; aber dann ... Übrigens, Pardon, ich werde nicht weiter davon reden; runzeln Sie nicht die Stirn! Nun adieu! Aber was mache ich nur!« fügte er, plötzlich wieder umkehrend, hinzu. »Ich habe ja gerade die Hauptsache vergessen: es wurde mir soeben gesagt, unsere Kiste aus Petersburg sei angekommen.«
»Was meinen Sie?« fragte Nikolai Wsewolodowitsch, ihn verständnislos anblickend.
»Ich meine Ihre Kiste mit Ihren Sachen, den Fracks, den Beinkleidern und der Wäsche; ist sie angekommen? Wirklich?«
»Ja, es wurde mir vorhin so etwas gesagt.«
»Ach, also ist es für den Augenblick nicht möglich ...«
»Fragen Sie Alexei!« .
»Nun, wie ist es mit morgen? Es ist ja neben Ihren Sachen auch einiges von mir darin: ein Jackett, ein Frack und drei Paar Beinkleider, die ich mir auf Ihre Empfehlung hin bei Scharmer habe machen lassen; erinnern Sie sich?«
»Ich habe gehört, daß Sie hier den Gentleman spielen,« bemerkte Nikolai Wsewolodowitsch lächelnd. »Ist das wahr, daß Sie bei einem Stallmeister Reitstunde nehmen wollen?«
Peter Stepanowitsch verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln.
»Wissen Sie,« sagte er dann außerordentlich schnell, aber mit wiederholt stockender Stimme, »wissen Sie, Nikolai Wsewolodowitsch, wir wollen doch ein für allemal alles Persönliche beiseite lassen, nicht wahr? Sie können mich natürlich verachten, soviel wie es Ihnen beliebt, wenn ich Ihnen so lächerlich vorkomme; aber doch wäre es das Beste, wenn wir eine Zeitlang Persönliches im Gespräche vermieden, nicht wahr?«
»Gut, ich werde es nicht wieder tun,« erwiderte Nikolai Wsewolodowitsch.
Peter Stepanowitsch lächelte, schlug sich mit dem Hute auf das Knie, trat von dem einen Fuß auf den andern und nahm wieder seine frühere Miene an.
»Hier halten mich manche Leute sogar für Ihren Nebenbuhler bei Lisaweta Nikolajewna; wie sollte ich da nicht auf mein Äußeres bedacht sein?« sagte er lachend. »Wer hat Ihnen das aber nur zugetragen? Hm, gerade acht Uhr; nun, dann will ich mich auf den Weg machen; ich habe allerdings versprochen, noch zu Warwara Petrowna heranzugehen; aber ich werde es lassen. Sie aber sollten sich ins Bett legen; dann wird Ihnen morgen besser sein. Draußen regnet es, und es ist dunkel; ich habe übrigens eine Droschke vor der Tür, weil es auf den Straßen hier nachts nicht sicher ist ... Ach, da fällt mir noch ein: hier in der Stadt und in der Umgegend treibt sich jetzt ein gewisser Fedka umher, ein entlaufener Sträfling aus Sibirien, denken Sie sich nur, ein früherer Gutsknecht von mir, den mein Papa vor etwa fünfzehn Jahren für Geld unter die Soldaten steckte. Eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit.«
»Haben Sie ... haben Sie mit ihm gesprochen?« fragte Nikolai Wsewolodowitsch, ihn scharf anblickend.
»Ja. Vor mir verbirgt er sich nicht. Er ist zu allem bereit, zu allem; selbstverständlich für Geld; aber er hat auch eigene Überzeugungen, in seiner Art natürlich. Ach ja, noch einmal apropos: wenn Sie vorhin im Ernst von dieser Absicht gesprochen haben (Sie erinnern sich: in betreff Lisaweta Nikolajewnas), so wiederhole ich Ihnen noch einmal, daß auch ich zu allem bereit bin, in jeder Art, in der es Ihnen gefällig ist, und daß ich vollständig zu Ihren Diensten stehe ... Was heißt das? Sie greifen nach dem Stocke? Ach nein, ich habe mich geirrt. Denken Sie nur, mir schien es, als ob Sie nach dem Stocke suchten!«
Nikolai Wsewolodowitsch hatte nichts gesucht und sagte nichts, stand aber tatsächlich auf einmal mit einer eigentümlichen Bewegung im Gesichte auf.
»Und wenn Sie auch in bezug auf Herrn Gaganow irgend etwas nötig haben sollten,« platzte Peter Stepanowitsch plötzlich heraus und deutete dabei geradezu mit dem Kopfe auf den Briefbeschwerer hin, »so kann ich selbstverständlich alles arrangieren und bin überzeugt, daß Sie mich nicht übergehen werden.«
Er ging schnell hinaus, ohne eine Antwort abzuwarten, schob aber den Kopf noch einmal durch die Türspalte.
»Ich bin der Ansicht,« rief er eilig, »daß auch Schatow nicht berechtigt war, sein Leben aufs Spiel zu setzen, damals am Sonntag, als er zu Ihnen herantrat, nicht wahr? Es wäre mir lieb, wenn Sie das beachteten.«
Er verschwand wieder, ohne eine Antwort abzuwarten.
IV
Vielleicht dachte er, während er verschwand, daß Nikolai Wsewolodowitsch jetzt, wo er allein zurückgeblieben sei, anfangen werde, mit den Fäusten gegen die Wand zu schlagen, und er hätte sich gewiß gefreut, das anzusehen, wenn es möglich gewesen wäre. Aber er hätte sich sehr getäuscht gesehen. Nikolai Wsewolodowitsch blieb ruhig. Etwa zwei Minuten lang stand er noch in derselben Haltung am Tische, anscheinend in Gedanken versunken; aber dann wurde ein mattes, kaltes Lächeln auf seinen Lippen sichtbar. Er setzte sich langsam auf das Sofa, auf seinen früheren Platz in der Ecke und schloß wie vor Müdigkeit die Augen. Die Ecke des Briefes schaute wie vorher unter dem Briefbeschwerer hervor; aber er rührte sich nicht, um das in Ordnung zu bringen.
Bald schwand ihm das Bewußtsein vollständig. Warwara Petrowna, die sich diese Tage über mit schweren Sorgen gequält hatte, konnte es nicht länger ertragen, und nach Peter Stepanowitschs Weggehen, der zwar zu ihr heranzukommen versprochen, aber sein Versprechen nicht gehalten hatte, wagte sie es trotz der ungeeigneten Stunde, Nikolai selbst zu besuchen. Sie hatte immer eine unbestimmte Hoffnung, er werde ihr endlich doch etwas Definitives sagen. Leise, wie kurz zuvor, klopfte sie an die Tür und öffnete, da sie keine Antwort erhielt, sie wieder selbst. Da sie sah, daß Nikolai völlig regungslos dasaß, ging sie mit stark schlagendem Herzen vorsichtig näher an das Sofa heran. Es befremdete sie, daß er so bald eingeschlafen war, und daß er in dieser Haltung schlafen konnte, so gerade und so unbeweglich dasitzend; selbst das Atmen war kaum wahrnehmbar. Das Gesicht war blaß und finster, aber ganz unbeweglich, wie erstarrt; die Augenbrauen ein wenig zusammengezogen; er hatte eine entschiedene Ähnlichkeit mit einer leblosen Wachsfigur. Die Mutter stand ungefähr drei Minuten lang über ihn gebeugt da; sie wagte kaum zu atmen und wurde plötzlich von Angst befallen; sie ging auf den Zehen hinaus, blieb schnell noch in der Tür stehen, bekreuzte ihn und entfernte sich unbemerkt, mit einem neuen, schweren Gefühl des Kummers.
Er schlief lange, über eine Stunde, und die ganze Zeit über in demselben Zustande der Erstarrung: kein Muskel seines Gesichtes zuckte, und an seinem ganzen Körper war nicht die geringste Bewegung wahrzunehmen; die Augenbrauen blieben immer in gleicher Weise finster zusammengezogen. Wäre Warwara Petrowna noch drei Minuten länger geblieben, so würde sie das bedrückende Gefühl, das diese lethargische Unbeweglichkeit hervorrief, sicherlich nicht ertragen und ihn geweckt haben. Aber plötzlich öffnete er von selbst die Augen und blieb wie vorher, ohne sich zu rühren, noch etwa zehn Minuten sitzen; es schien, als blicke er neugierig und beharrlich nach einem ihn interessierenden Gegenstande in der Zimmerecke hin, obgleich da überhaupt nichts Neues und Besonderes vorhanden war.
Endlich ertönte der leise, tiefe Klang der großen Wanduhr, welche einen Schlag tat. Mit einer gewissen Unruhe drehte er den Kopf herum, um nach dem Zifferblatte zu sehen; aber fast in demselben Augenblicke öffnete sich eine nach dem Korridor hinausführende Hintertür, und es erschien der Kammerdiener Alexei Jegorowitsch. Er trug in der einen Hand einen warmen Überzieher, einen Schal und einen Hut, in der andern einen silbernen Teller, auf dem ein Zettel lag.
»Es ist halb zehn Uhr,« sagte er leise, legte die mitgebrachten Garderobenstücke in einer Ecke auf einen Stuhl und präsentierte auf dem Teller den Zettel, ein kleines unversiegeltes Blättchen, auf dem zwei Zeilen mit Bleistift geschrieben standen.
Nachdem Nikolai Wsewolodowitsch diese Zeilen gelesen hatte, nahm er ebenfalls einen Bleistift vom Tisch, schrieb am unteren Ende des Zettels zwei Worte und legte ihn wieder auf den Teller.
»Gib ihn ab, sowie ich weggegangen bin; jetzt will ich mich anziehen,« sagte er und erhob sich vom Sofa.
Da ihm einfiel, daß er ein leichtes Samtjackett anhatte, so überlegte er einen Augenblick und ließ sich dann einen anderen Rock reichen, einen Tuchrock, wie man ihn bei förmlicheren Abendgesellschaften trägt. Nachdem er sich endlich ganz angekleidet und den Hut aufgesetzt hatte, verschloß er diejenige Tür, durch die Warwara Petrowna zu ihm hereingekommen war, nahm unter dem Briefbeschwerer den versteckten Brief hervor und ging, von Alexei Jegorowitsch begleitet, schweigend auf den Korridor hinaus. Von dem Korridor stiegen sie eine schmale, steinerne Hintertreppe hinab und gelangten in einen Flur, der unmittelbar in den Garten hinausführte. In einer Ecke des Flures standen eine Laterne und ein großer Regenschirm bereit.
»Infolge des starken Regens ist auf den hiesigen Straßen ein unerträglicher Schmutz,« berichtete Alexei Jegorowitsch; er machte damit einen letzten bescheidenen Versuch, den jungen Herrn von seinem Ausgange zurückzuhalten.
Aber dieser spannte den Schirm auf und trat schweigend in den nassen alten Garten hinaus, wo es so dunkel war wie in einem Keller. Der Wind brauste und schüttelte die Wipfel der halbkahlen Bäume; die schmalen, mit Sand beschütteten Steige waren morastig und glitschig. Alexei Jegorowitsch ging so, wie er war, im Frack und ohne Hut, und erleuchtete mit der Laterne den Weg voraus auf eine Entfernung von drei Schritten.
»Wird es auch niemand bemerken?« fragte Nikolai Wsewolodowitsch.
»Aus den Fenstern ist es nicht zu sehen; zudem habe ich alle Vorsorge getroffen,« antwortete der Diener leise und gemessen.
»Schläft meine Mutter?«
»Die gnädige Frau haben sich nach Gewohnheit der letzten Tage Punkt neun Uhr eingeschlossen und können jetzt nichts wahrnehmen. Zu welcher Stunde befehlen Sie mir, Sie zu erwarten?« fügte er hinzu, indem er es wagte, selbst eine Frage zu stellen.
»Um eins, halb zwei, jedenfalls nicht später als um zwei.«
»Zu Befehl.«
Sie durchschritten auf gewundenen Wegen den ganzen Garten, den sie beide genau kannten, gelangten zu der steinernen Gartenmauer und fanden hier ganz in der Ecke ein kleines Pförtchen, das auf eine schmale, stille Gasse hinausführte und fast immer verschlossen war, dessen Schlüssel sich aber jetzt in Alexei Jegorowitschs Hand befand.
»Wird die Tür auch nicht knarren?« erkundigte sich Nikolai Wsewolodowitsch wieder.
Aber Alexei Jegorowitsch meldete, er habe sie noch gestern geölt, »und ebenso heute«. Er war schon ganz durchnäßt. Nachdem er die Tür aufgeschlossen hatte, reichte er Nikolai Wsewolodowitsch den Schlüssel hin.
»Wenn Sie einen weiten Weg zu unternehmen belieben, so melde ich, daß ich dem hiesigen geringen Volke nicht traue, insonderheit nicht in den stillen Nebengassen und am allerwenigsten jenseits des Flusses,« konnte er sich noch einmal nicht enthalten zu bemerken. Er war ein alter Diener, der ehemals des kleinen Nikolai Hüter gewesen war und ihn auf den Armen getragen hatte, ein ernster, solider Mann, der gern den Gottesdienst besuchte und fromme Bücher las.
»Sei unbesorgt, Alexei Jegorowitsch!«
»Gott segne Sie, gnädiger Herr, bei allen guten Werken.«
»Wie?« fragte Nikolai Wsewolodowitsch und blieb noch einmal stehen, nachdem er schon auf die Gasse hinausgetreten war.
Alexei Jegorowitsch wiederholte seinen Wunsch in festem Tone; nie vorher hätte er es gewagt, diesen Wunsch mit solchen Worten seinem Herrn gegenüber laut auszusprechen.
Nikolai Wsewolodowitsch schloß die Tür zu, steckte den Schlüssel in die Tasche und ging die Gasse entlang, wo er bei jedem Schritte fünf Zoll tief in den Schmutz sank. Endlich gelangte er in eine lange, menschenleere Straße und auf Pflaster. Die Stadt war ihm so bekannt wie seine fünf Finger; aber die Bogojawlenskaja-Straße war noch sehr fern. Es war schon zehn Uhr durch, als er endlich vor dem verschlossenen Tore des dunklen alten Filippowschen Hauses stehen blieb. Das untere Stockwerk stand jetzt nach dem Wegzuge des Lebjadkinschen Geschwisterpaares ganz leer, und die Fenster waren mit Brettern vernagelt; aber im Halbgeschoß bei Schatow war Licht. Da keine Klingel da war, so schlug er mit der Hand gegen das Tor. Es wurde ein Fenster geöffnet, und Schatow blickte auf die Straße hinaus; es war eine furchtbare Dunkelheit, so daß es schwer hielt, jemanden zu erkennen; Schatow sah lange hin, wohl eine Minute lang.
»Sind Sie es?« fragte er auf einmal.
»Ja, ich bin es,« antwortete der unerwartete Besucher.
Schatow schlug das Fenster zu, kam herunter und schloß das Tor auf. Nikolai Wsewolodowitsch trat über die hohe Schwelle und ging, ohne ein Wort zu sagen, an ihm vorbei geradeswegs nach dem Seitengebäude zu Kirillow hin.