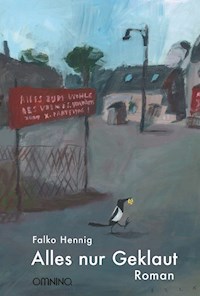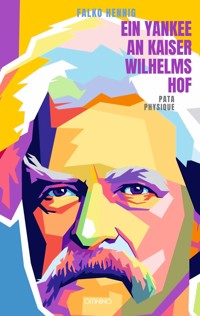
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anfang der 1890er-Jahre feiern in Berlin selbstbestimmte Frauen und homosexuelle Männer eine Sexparty im Jagdschloss Grunewald. Die Teilnehmerinnen stammen aus den höchsten Kreisen, unter anderem sind der Kaiser und seine Schwester dabei sowie der amerikanische Schriftsteller Mark Twain. Niemals hätte jemand davon erfahren. Doch als in anonymen Briefen Einzelheiten der Orgie verbreitet werden, wird als erstes Mark Twain verdächtigt. Es kommt zu einer Staatskrise und zu tödlichen Konsequenzen. Der neue Roman von Kult-Autor Falko Hennig (Alles nur geklaut, Rikscha Blues) lässt das Kaiserreich des späten 19. Jahrhunderts mit den Augen Mark Twains entdecken. Eine Collage aus historischer Realität und frivolen Erfindungen, mit einschlägigen Schauplätzen, niederträchtigen Charakteren und einem Protagonisten, der dem Jahrhundertskandal am Hof auf den Grund geht... „Ich empfehle alle Sätze des fabelhaften Schriftstellers Falko Hennig zu lesen, sobald man diese in die Finger bekommt. Weil: lohnt sich immer.“ (Kirsten Küppers, Die Zeit) „Das so kundige wie gewitzte Buch erklärt sich eingangs als frei erfunden, aber wer sich in der Haut von Mark Twain als wahrhaft authentischer Berliner Zeitgenosse des Kaiserreiches empfinden möchte, sollte es von A bis Z lesen!“ (Horst Bredekamp) „Staunend lesend fügen sich Krimi, Zeitung und Porno zusammen und man weiß: Es ist alles wahr. Wie eine Collage von Kempowski mit dem Humor von Loriot in einem Thriller von Ferdinand von Schirach, allerdings im Zeitgeist der 1890er Jahre aus der Sicht von Mark Twain.“ (Ralf Sotscheck, die tageszeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dieser Roman ist völlig frei erfunden.
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-247-9
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2023
Cover: www.shutterstock.com, 2179272047, Mei Zendra
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Inhalt
PrologVon Setzmaschinen und Ballons
ERSTER TEIL
Ankunft in der Stadt der Evangelen
ZWEITER TEIL
Das Interview
DRITTER TEIL
Ausgelassene Sülze
VIERTER TEIL
Fern von Madrid
Literatur
Prolog: Von Setzmaschinen und Ballons
Manhattan war die Zeitungshauptstadt der Welt. Die Zeitungsjungs riefen die verschiedenen Blätter aus, Redaktionen, Druckereien, Newspaper Row, Times Square. Die Zeitungen waren überall und durch Mark Twains Körper floss Druckerschwärze anstatt Blut. Er liebte die Zeitungen, die Setzereien, die Überschriften, die Druckmaschinen, die großen und die kleinen Journale. Samuel Langhorn Clemens, aus den Zeitungen bekannt als Mark Twain, war bester Laune. Hier oder nirgends würde sich die Setzmaschine vermarkten lassen, in die er schon so viel Geld gesteckt hatte. Es war so viel Geld, dass einem schwindlig werden musste. Es war so viel Geld, dass er pleitegehen könnte.
Twain war aus Hartford nach New York City gekommen, um den Millionär Gordon Bennett in der Redaktion des New York Herald in der Fulton Street zu treffen. Er überquerte die Straße zwischen Pferdebahnen und Kutschen.
Fast 30 Jahre war es her, dass er Bennett kennengelernt hatte. Der war damals noch ein junger Mann und gab den Herald aus einem Keller in der Wall Street heraus. Jetzt war er Mitte 50 und Twain 60. Twain schien es aber eher, als hätten ihre Lebensalter sich angeglichen. Bennett hatte sein dünnes Haar über seine Glatze gekämmt, Twains Haar war zwar voll, dafür war Bennetts Schnurrbart prächtiger. Grau wie die Esel waren sie beide.
„Gordon Bennett!“, rief Twain, „long time no see!“
„Na, wie sieht es aus mit neuem Gossip at the National Capital?“, begrüßte Bennett seinen alten Korrespondenten. Unter dem Titel Tratsch in der Hauptstadt waren Twains Klatschartikel aus Washington vor Jahrzehnten im Herald erschienen. Damals bei ihrem ersten Treffen hatte Twain unter der Bedingung zugesagt, dass er die völlige Freiheit hätte, darin zu beleidigen, wen er wollte, und zwar mit den fiesesten Gemeinheiten und Bennett hatte gesagt:
„All right!“
Twain war Bennett auch dafür dankbar, dass im Herald seine ersten Berichte von der Quaker City gedruckt wurden, die später zum Bestseller Die Arglosen im Ausland wurden. Zeit war Geld und Bennetts Zeit war besonders wertvoll, er fragte direkt:
„Was führt dich zu mir?“
„Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen, eine Beteiligung.“ Twain erklärte die Vorteile, die seine und Paines Setzmaschine gegenüber Ottmar Mergenthalers Linotype hatte. Die war ja nicht einmal eine Setzmaschine, sondern eine Gießmaschine:
„Anstatt die Zeilen zu setzen, werden sie aus Blei gegossen und dann wieder eingeschmolzen! Das kostet unnötig Geld. Paines Prinzip ist wirkliches Setzen, das hat Zukunft und wird allen, die sich an der Entwicklung beteiligen, viel Geld einbringen. Du weißt, dass Mergenthaler mir die Hälfte seiner Gesellschaft angeboten hat im Tausch gegen die Hälfte unserer Firma mit der Setzmaschine von Paine?“ Bennett zeigte keine Begeisterung:
„Ich bin mein eigener Verleger, Redakteur, Anzeigenwerber und Vertriebsleiter, das war ich von Anfang an. Aber ich bin nicht der Setzer und nicht der Drucker. Du bist Setzer gewesen, oder?“ Twain bestätigt es:
„Nach der Schule habe ich beim Missouri Courier als Setzer angefangen, eigentlich für Kost, Logis und Kleidung. Die Kleidung, das sollten eigentlich zwei Anzüge im Jahr sein, aber einer der Anzüge hat es nicht geschafft, sich zu materialisieren und der andere ist nicht gekauft worden, so lange die Anzüge des Chefs noch nicht in Fetzen auseinanderfielen. Die hatte ich dann auszutragen. Ich war nur halb so groß wie er. In seinen Hemden hatte ich das unangenehme Gefühl, in einem Zirkuszelt zu leben. Die Hosen dagegen musste ich mir bis zu den Ohren ziehen, damit die Füße herausgucken konnten.“ Das Klappern einer Linotype war aus der Setzerei zu hören.
„Sam, ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe unsere Setzerei mit der Simplex-Linotype ausgestattet, sie funktioniert und bis zum nächsten Jahr wird keine Zeitung mehr mit Hand gesetzt werden. Alle werden sich Simplex-Linotypes zulegen. Es war ein spannendes Rennen, welche Setzmaschine gewinnen würde, noch vor zwei Jahren wäre ich eingestiegen und hätte mein Geld verloren. Jetzt ist das Rennen gelaufen, Mergenthaler hat gewonnen. Mir scheint, er hat eine Art Arbeitspferd erfunden, nicht schön und elegant, aber es funktioniert. Paige wird bis zum jüngsten Tag an seinem Wunder tüfteln, das zwar ein großes Kunstwerk ist, schneller als die Linotype und eleganter, aber niemals im harten Zeitungsgeschäft bestehen kann. Paiges Maschine ist wie ein arabisches Rennpferd, das beim ersten Schlag mit einem Vorschlaghammer zusammenbricht.“ Twain hatte so etwas in der Art befürchtet, mehr und mehr Druckereien hatten sich mit der Linotype ausgestattet und sie gossen in Bleiwolken Zeitungszeile um Zeitungszeile. Bennett schloss:
„Du hättest Mergenthalers Angebot annehmen sollen, dann wärst du jetzt ein gemachter Mann.“ Twain wusste, dass weiteres Bitten und Drängen keinen Sinn hatte. Er verdrängte die Sorgen über die finanziellen Konsequenzen für sich, für seine Frau, die Töchter, für sein Haus in Hartford. Dass er eigentlich pleite war.
Er fachsimpelte mit Bennett über die neuesten Maschinen: Setzmaschinen, Schreibmaschinen. Bennett mochte Twains Begeisterung, auch wenn seine Leidenschaft mehr Automobilen und Flugmaschinen galt:
„Sam, wir leben in der spannendsten Zeit der Menschheit, was für einen gewaltigen Weg sind wir in den letzten Jahren gegangen! Die Eroberung der Arktis, der Luft. Sieh dir dieses Hochhaus an! Denk an den Keller damals in der Wall Street, unseren einzigen Redaktions- und Geschäftsraum!“ Twain erinnerte sich genau:
„Das war eng und dunkel, eine Art Dunkelzelle.“
„Genau. Da habe ich immer die auswärtigen Meldungen gebracht, von der weder die Sun noch der Transcript auch nur eine Zeile drucken konnten. Die Sun hatte sowieso keinen blassen Schimmer. Die großen Blätter der 6-Cent-Presse haben zwar die Nachrichten veröffentlicht, aber ihre Redakteure waren einer wie der andere stinkfaule, dumme, schlappe Angeber und Trottel, von denen keiner, was draus gemacht hat. Nur wir haben unseren Lesern diese Köstlichkeiten serviert. Nur der Herald hat gut aufgemacht und die Sachen lesbar abgefasst. Deshalb war ich von deinem Gossip auch so angetan. Willst du nicht wieder für den Herald schreiben?“ Da sich die Hoffnung auf Hilfe für die Setzmaschine in Luft aufgelöst hat, musste Twain an sein Tagesgeschäft denken. Er zündete sich eine Zigarre an:
„Grundsätzlich gern, was kannst du mir anbieten? Soll es wieder anonymer Klatsch sein? Diesmal aus Hartford?“ Nichts lag Bennett ferner, warum sollte er einen der wegen seiner Berühmtheit teuersten Autoren engagieren, um ihn dann zu verheimlichen? Und warum sollte sich jemand dafür interessieren, was in Hartford passierte?
„Klatsch aus Hartford klingt nach Milchsuppe für die Wall Street. Der Herald war schon so gut, als wir uns kennenlernten, weil wir ganz anders geschrieben und gelebt haben als die verbummelten Wall-Street-Redakteure. Die sind erst zwischen zehn und zwölf in ihre Redaktionen gekommen und haben sich dann einen Glimmstängel angezündet und die Schere genommen. Die haben nichts anderes gemacht, als auszuschneiden, zu paffen, zu paffen und wieder auszuschneiden, stundenlang!“ Mark Twain paffte an seiner Zigarre und wusste, dass er damit seinen Marktwert im Moment nicht erhöhte.
„Dann sind sie zu Deloniko essen gegangen, trinken, schlemmen und haben die friedlichen Bürger verhetzt. Wir dagegen sind um fünf aufgestanden und haben die Leitartikel, Glossen, Übersichten, alles schon vor dem Frühstück geschrieben.“ Twain brachte nicht zur Sprache, dass er am liebsten gar nicht aufstand, sondern den ganzen Tag im Bett lag, rauchte und dort schrieb. Bennett erklärte weiter seine vorbildliche Arbeitsmoral:
„Von neun bis eins haben wir alle unsere Zeitungen gelesen, die Originalberichte unserer Leute, von denen wir viel mehr hatten, als irgendjemand sonst. Das war unser Nachrichtenmaterial. Wir haben unsere Gedanken, Einfälle, Anspielungen, Plots notiert, um sie in eigenen Kolumnen zu veröffentlichen. Dann haben wir Besucher, Geschäftsleute und die schönsten Frauen New Yorks empfangen. Die wollten alle abonnieren! Gott segne sie!“ Ergriffen schaut Bennett aus dem Fenster, als würde er genau dort die schönen Frauen sehen:
„Um eins war ich dann draußen, habe von den Bankiers und Nichtstuern von der Börse den Stand der Kurse und des Geldmarktes erfragt und bin dann zurück zum Redaktionsschluss. Erst um vier sind wir essen gegangen, bescheiden und mäßig. Dann haben wir Korrekturen gelesen, Außenstände eingeholt, Anzeigen gesammelt. Es wurden immer mehr. Spätestens um zehn waren wir in der Klappe. So macht man eine Zeitung mit Geist, Witz und Erfolg!“ Twain widersprach nicht, Bennett erinnerte sich weiter:
„Die Konkurrenz hat mich für vogelfrei erklärt. Sie haben meinen Keller in der Wall Street mehrfach gestürmt und verwüstet. Sie haben mich auf der Straße verprügelt. Genau das waren die besten Geschichten, die ich schreiben konnte.“ Twain stimmte zu:
„Das war in Tennessee genauso. In die Redaktion ist mal durchs Fenster geschossen worden und der Redakteur schoss zurück!“ Twain schien das eine gute Geschichte zu sein, aber Bennett ließ sich nicht darauf ein:
„Da kommt mir plötzlich Watson Webb entgegen, mault irgendwas Unverständliches und stößt mich eine Ladentreppe hinunter und prügelt auf mich ein, dass ich gegen ein eisernes Gitter fliege. Ich habe ihm einige Zähne ausgeschlagen.
Aber mich kann man nicht einschüchtern. Ich sage in meinem Blatt die Wahrheit. Alles Übrige lege ich in Gottes Hand. Man kann mich überfallen, mir die Bude stürmen, mich töten, mich ermorden. Aber ich gebe nicht nach! Ich weiche nicht vom Weg der Tugend, der Wahrheit und des Rechts.“ Twain war kein großer Freund von Frömmlerei und Heuchelei, aber es gab keinen Grund, Bennett das wissen zu lassen. Der erzählte weiter:
„Danach ist die Auflage von 6000 auf 9000 gestiegen! Ich habe mit Mutterwitz das rauflustige Volk vom Hafenviertel genauso versorgt wie die Händler und Kommis. Ich habe damals keine Milchsuppe im Herald haben wollen und will sie auch heute nicht. Mit genau dem richtigen Schuss Religion habe ich die Frömmler und Sektengläubigen mit ihren Predigten an den Straßenecken bekommen.“
„Der Herald hat die Konkurrenz weggefegt.“
„Ich habe immer Nachrichten gemacht, das hat schon mein Vater getan, ich mache sie in diesem Augenblick. Darum geht es: Die Nachrichten selber machen!“ Mark Twain begann vorsichtig, auf seinen ja letztlich nicht so geringen Marktwert hinzuweisen:
„Ich habe auch viele Nachrichten erfunden, den versteinerten Mann, das Massaker bei Carson, Kannibalismus in der Eisenbahn. Ich habe niemals gezögert, für die Zeitung auf dem Papier eine Familie abzuschlachten, wenn die Öffentlichkeit etwas Unterhaltung zum Frühstück brauchte. Die beschauliche Redaktion des Enterprise in Virginia City war damals eine Produktionsstätte von grauenhaften Blutbädern, Verstümmelungen bis hin zu allgemeiner Vernichtung.“ Bennett war nicht schockiert:
„So macht man es! Schon viel zu viele gute Zeitungsgeschichten sind durch Überprüfen ruiniert worden! Meine größten Erfolge waren immer die Nachrichten, die ich selber gemacht habe. Ich habe Henry Morton Stanley nach Afrika geschickt, um Livingstone zu finden. Ich selber habe die Quellen des Nils entdeckt. Ich habe die Franklin-Expedition organisiert und die leider etwas unglückliche Rettungsexpedition für Nordenskiöld.“
Twain verkniff sich ein Lächeln: Etwas unglücklich war gut gesagt. Nach dem Verlust des Schiffs waren 20 Expeditionsmitglieder verhungert. Doch es stimmte, Bennett produzierte seit vielen Jahren die Nachrichten selbst und die anderen Zeitungen mussten seinen Sensationsmeldungen abgeschlagen hinterherhecheln:
„Das erste Polo-Turnier habe ich in dieses von Gott gesegnete Land gebracht. Nachrichten muss man machen, nicht darauf warten, dass sie einen zufällig erreichen! Dafür habe ich den Gordon Bennett Cup gestiftet als Anreiz für Segel-Wettrennen und den Gordon Bennett Cup für Automobilrennen. Und natürlich den Coupe Aéronautique Gordon Bennett, das größte Ballonrennen der Welt von St. Louis aus. Sam, ich will, dass du davon berichtest!“
Mark Twain exklusiv für den New York Herald! Pommern aus Berlin in Missouri
Der Wind soll angeblich über die großen Seen wehen! Es entfaltet sich in den letzten Tagen vor dem Rennen in St. Louis eine fieberhafte Tätigkeit, um die Ballonkörbe mit Korkplatten auszuschlagen, damit für den Fall, dass ein Ballon ins Wasser fällt, der Korb die Insassen und Instrumente schwimmend tragen kann. Sie sind außer mit Schwimmgürteln auch jeweils mit Axt und Säge versehen, damit die Aeronauten im Falle einer Landung im Urwald sich und den Ballon aus dem Dickicht heraushauen können.
Am Abend vor dem Rennen versammelt das Komitee alle Beteiligten zu einem großen Festbankett im Hotel Jefferson, wo zwischen Blumen- und Luftballon-Dekorationen die besten Speisen und Getränke gereicht werden. Der Abenteurer Gordon Bennett ist der großzügige Erfinder, Organisator und Finanzier des wichtigsten Ballonrennens der Welt.
In der Frühe finden sich die Ballonführer bei ihren Ballons ein, die auf dem großen Füllplatz am Forest Park in St. Louis ausgebreitet und mit großer Sorgfalt zusammengesetzt werden. Die Ballonriesen, die bald einen harten Konkurrenzkampf gegeneinander zu bestehen haben, liegen so friedlich nebeneinander, der deutsche neben dem französischen und der amerikanische neben dem englischen, als hätte sich der Traum des Weltfriedens nun endlich erfüllt.
Um zehn Uhr beginnt die Füllung der Ballons, eine Stunde später sind sie halb gefüllt und das Gas kann wieder abgedreht werden. In der Mittagspause bis um zwei Uhr stellen die Luftschiffer den Proviant für die Reise fertig und stärken sich mit warmen Speisen.
Ich habe die Ehre mit Oscar Erbslöh im Ballon Pommern aus Berlin mitfahren zu dürfen, denn fliegen wie die Vögel können wir Menschen nicht. Wir fahren oder schweben im Luftmeer. So wie Schiffe über die Meere, so fahren Ballone durch das Meer der Luft.
Der Frühstückskorb für den Pommern wird mit Butterbroten, Eiern, Kotelette, etwas kaltem Geflügel, Brot, Wurst und Schokolade gefüllt. Zwei halbe Flaschen Burgunderwein sollen uns Aeronauten in der Nacht wärmen, für den Morgen hat Oscar Erbslöh, der bescheidene Mann aus Wuppertal, warmen Kaffee in Thermosflaschen und für den Tag kalten Tee und Cider.
Ich selber habe mich mit ausreichend Zigarren bevorratet. Zwei Uhr wird die Füllung fortgesetzt und vollendet, neun Ballons stehen im prachtvollen Sonnenschein unter ganz klarem Himmel nebeneinander. Der Ballon Pommern unterscheidet sich durch seine kugelrunde Form und die zitronengelben Farben von den gelben bis dunkelbraunen mit ihren birnenförmigen Hüllen. Dieser wunderschöne Anblick wird noch durch die eleganten Damen auf der Tribüne verstärkt.
Vier Uhr gibt die Sportkommission das Zeichen zur Abfahrt. Sieger wird derjenige, mit dem am weitesten von St. Louis entfernten Landungsplatz sein. Die Fahrt des Pommern beginnt, mit 41 Sack Ballast steige ich mit Erbslöh auf. Deutschland, Deutschland über Alles erklingt, Hurrarufe der Menge, „Glück ab!“
Mark Twain exklusiv für den New York Herald! Nach abgewendeter Katastrophe Explosionsgefahr!
Die geringe Übung meiner amerikanischen Landsleute beim Abwiegen führt um ein Haar zu einer Katastrophe, der Pommern kollidiert fast mit einem Schornstein der Gasanstalt und droht, in Telefondrähte zu kommen. Nur der Geistesgegenwart von Erbslöh, der viel Ballast abwirft, ist es zu verdanken, dass es zu keinem Unglück kommt. Pommern schlägt mehr östliche Richtung ein, als die anderen Ballons. Er steigt schneller, als die anderen und kommt über eine Dunstschicht, die anderen Ballons geraten uns außer Sicht, wir steigen mit unserem Ballon, bis er eine Windströmung von Westen findet.
Auf 1500 Meter dreht er in die gewünschte Richtung. Von St. Louis aus fährt er einen Halbkreis nach Westen, aber über Alton nimmt er den richtigen Kurs. Um 17.30 Uhr geht die Sonne mit herrlichen Farben unter und ich biete Herrn Erbslöh eine Zigarre an. Seine Begeisterung hält sich eher in Grenzen:
„Sie werden doch nicht ernsthaft im Korb eines mit Leuchtgas befüllten Ballons Zigarre rauchen?“ Ich erwidere:
„Sie werden mir doch nicht ernsthaft das Rauchen verbieten wollen?“
„Ist Ihnen die Explosionsgefahr bekannt? Wissen Sie, dass der Ballon mit einem explosiven Gas gefüllt ist? Es ist vergleichbar mit einem Pulverfass.“
„Ich bin aus einer Reihe von Gründen sehr beruhigt. Ich habe mich intensiv mit dem Prinzip des Ballonfahrens befasst. Sie wissen bestimmt, dass unser Gas leichter als Luft ist, also beim Ablassen nicht zu uns und meiner brennenden Zigarre hinuntersinkt, sondern im Gegenteil nach oben aufsteigt in Sphären, in denen ich keinerlei Lust habe, Zigarre zu rauchen. Es besteht also nur dann die Gefahr einer Explosion, wenn ich nicht rauchen darf. Denn in diesem Fall explodiere ich mit völliger Sicherheit.“ Oscar Erbslöh macht auf mich keinen zufriedenen Eindruck:
„Mir scheint eine menschliche Explosion durchaus weniger lebensgefährlich als eine durch Gas.“
„Sie wissen vielleicht, dass ich Reporter aus dem Wilden Westen bin und dass ich schon für einen sehr harmlosen und kurzen Bericht von einer Kleintiermesse in Carson City drei Menschen erschießen und zwei erschlagen musste. Wie viel würde ich wohl massakrieren für einen sehr langen Bericht vom wichtigsten Ballonrennen der Welt?“ Die Logik und Feinheit dieser Gedankenführung überzeugt Herrn Erbslöh und vielleicht auch der Anblick meines Revolvers. Schließlich verspürt er als normalerweise starker Raucher eine gewisse Solidarität mit mir:
„Für die deutsch-amerikanische Freundschaft und dafür, dass nicht noch mehr Menschen für Ihre freiheitlichen Ideale sterben müssen, erlaube ich Ihnen das Rauchen, aber nur unter einer Bedingung!“
„Mit Freuden, um welche Bedingung handelt es sich?“
„Dass ich Ihnen bei der Vernichtung des gefährlichen Zigarrenvorrats beistehen kann.“ Gern gebe ich dem wackeren Luftschiffer eine Zigarre und bei völliger Windstille steigen unsere Rauchwolken auf. Der Mond erhebt sich und erhellt die Landschaft unter uns mit seinem silbernen Licht. Nur im Korb eines Ballons kann man dieses Schauspiel genießen.
Mark Twain exklusiv für den New York Herald! Landarbeiter und Hunde
Neben dem Mondlicht hat Erbslöh nur ein starkes elektrisches Flutlicht mit zwei Packungen Batterien für jeweils zwölf Stunden zum genauen Studium der Karten. Leider sind die amerikanischen Karten viel schlechter als die in Deutschland, klagt er, so dass die Navigation sehr schwierig wird.
Er berechnet seinen Kurs und hofft in der jetzigen Richtung nach Nordosten Massachusetts oder Connecticut zu erreichen. Er muss aufpassen, nicht von diesem Kurs abzukommen. Da wir nicht sicher sind, wo wir uns befinden, sinken wir und rufen dem Bauern zu:
„Wie heißt die nächste Stadt?“ Doch der geistesschwache Landarbeiter fragt nur zurück:
„Woher kommt Ihr?“ Auch den nächsten Bauern rufen wir an:
„Guter Mann, wo sind wir?“ Der Bauer schaut nach rechts und links, nach vorn und hinten, dann von unten nach oben und antwortet:
„Ihr seid genau 3 ½ Meter über meinem Kartoffelfeld.“ Erbslöh nickt und sagt zu Mark:
„Korrekte Antwort.“ Nur ein einziges Mal bekommen wir so etwas wie eine hilfreiche Auskunft auf die Frage, aber wir verstehen den Hinterwäldler nicht. Als wir nochmal fragen und der Hillbilly etwas ruft, sind wir schon zu weit entfernt und wir können ihn nicht mehr hören. Bis zu einer Höhe von 500 Metern funktioniert unser Rufen sehr gut, besonders wenn wir ein Megaphon benutzen. Nur die Antworten können wir nicht verstehen.
Wir schweben über eintönige Gebiete mit einer Farm neben der anderen. Am Nachmittag erreichen wir eine Hügelkette und eine malerische Landschaft mit Städten, Dörfern, Flüssen und Wäldern. Eine besondere Attraktion ist die Pracht der Herbstfarben der Wälder, wie ein getüpfeltes Gemälde aus Korallenrot, Strohgelb, Rosenrot, Blond, Fuchsrot, Magenta, Rostrot, Zinnober, Orange, Pink und Rosa präsentiert sich uns die Landschaft.
Als wir um 19 Uhr Pittsburgh überschweben, ist es bereits völlig dunkel. In der Dunkelheit leuchtet diese riesige Industriestadt wie ein gigantisches Lichtmeer unter uns, die Feuer der großen Schmelzöfen blenden unsere Augen. Der Lärm der Fabriken kontrastiert zu der Stille der Stunden zuvor. Wir werfen, wie über allen Städten, die Telegramme des New York Herald mit Zeit, Höhe und Namen ab, damit so schnell wie möglich bekannt wird, welche Strecke unser Ballon genommen hat.
Durch Aufstieg auf 1500 und 2000 Meter gelangen wir auf einen günstigeren Kurs und der Ballon bewegt sich in Richtung Nordosten. Unsere Geschwindigkeit beträgt am ersten Tag 18 Meilen pro Stunde und beschleunigt sich nun auf 28 Meilen. Bis zur zweiten Nacht kostet es etwa zwölf Säcke Ballast. Ein solcher Aufstieg ist eine der schwierigsten Operationen bei einer langen Ballonfahrt. Dank des guten Gases und des riesigen Ballastvorrats gelingt es uns recht gut, den Ballon oben zu halten.
Mark Twain exklusiv für den New York Herald! Landung
In der Nacht überqueren wir das Alleghanygebirge bei Altoona über Hängen, Tälern und Schluchten im hellen Licht des Mondes. Der Ballon darf nicht zu tief sinken, sonst könnte ein Berg den Wind abschneiden. Beim Manövrieren driftet er nach Südosten ab. Wir befürchten, dass wir in dieser Richtung zur Küste von New Jersey abkommen und versuchen alles, um zumindest den Bundesstaat New York zu erreichen. Schlafen dürfen wir nicht mehr, denn jetzt geht es um jede Meile, die wir noch zurücklegen können. Den Anbruch der Nacht kündigen Hunde durch ununterbrochenes Bellen an.
Am Morgen des dritten Tages breitet sich unter uns eine sanfte Landschaft aus. Es ist die Gegend von Philadelphia mit einem hübschen Landhaus neben dem anderen. Hier hören wir die typische Musik des Morgens, das Krähen von Tausenden von Hähnen über eine Stunde lang.
Es herrscht noch dichter Nebel über Philadelphia, als wir uns der Stadt in sehr geringer Höhe nähern, nur die Schlote der Fabriken ragen aus den Schleiern. Grauer Rauch steigt aus den Schornsteinen auf und vermischt sich mit dem weißen Nebel. Langsam erwacht die große Stadt aus dem Schlaf, und ein Horn nach dem anderen kündigt den Beginn der Schichten in den Fabriken an, so dass es bald ohrenbetäubend laut wird.
Im Osten geht die Sonne mit einem unirdischen Funkeln auf. Die Wärme der Sonnenstrahlen müsste das Gas im Ballon aufheizen und ihn in größere Höhen steigen lassen. Aber als wir in den oberen Teil der Stadt kommen, muss Erbslöh doch wieder Ballast abwerfen, um eine Kollision mit der Spitze eines Kirchturms zu vermeiden.
Wir wagen einen letzten Versuch, weiter nach Norden zu kommen und lassen den Ballon bis auf eine Höhe von 3200 Metern aufsteigen. Aber der Kurs ändert sich nur wenig nach Nordosten. Ungefähr zehn Meilen entfernt sehen wir den Atlantischen Ozean und ziehen das Ventil, in moderatem Sinkflug nähert sich unser Ballon Asbury Park.
Herr Erbslöh versucht, einen geeigneten Landeplatz direkt am Ufer zu finden, aber weder er noch ich sehen einen. So beschließen wir, in der Innenstadt auf einem öffentlichen Platz zu landen. Aber eine Reihe von Stromleitungen versperrten uns den Weg, der Ballon verfängt sich darin. Durch Abwurf von Ballast gelingt es uns, den Korb zu befreien, er steigt wieder auf. Nach weiterem Ablassen des Gases landen wir sicher und unverletzt auf einer Kreuzung. Die Hülle fällt auf ein mit Büschen bewachsenes Feld.
Mark Twain exklusiv für den New York Herald! Souvenirjäger und 10.000 Goldmark
Als wir aus unserem kleinen Korb kriechen, der uns 40 Stunden lang beherbergt hat, ist bereits eine große Menschenmenge um uns geschart. Den Ballon zusammenzupacken ist erst möglich, nachdem Erbslöh und ich das Feld mit Seilen und der Hilfe von zwei Wachtmeistern abgeriegelt haben.
Bei der Inspektion des Netzes stellen wir fest, dass ein Souvenirjäger einen Teil herausgeschnitten hat. Eine Fahne schenken wir einem deutschen Mitbürger, eine andere wird uns gestohlen.
Eine Stunde brauchen wir, bis alles auf einen Expresswagen verladen ist. Wir werden durch einige liebenswürdige Herren in einer Kutsche zum nächsten Telegraphen-Büro gefahren, wo ich diese Zeilen an den Herald telegrafiere und Herr Erbslöh seine Telegramme aufgibt und durch eine amtliche Persönlichkeit die Landung bescheinigen lässt.
Eine Gesellschaft von angesehen Bürgern der Stadt findet sich ein, sie lassen es sich nicht nehmen, uns zum Essen einzuladen. Der Bürgermeister von Asbury Park steigt auf den Tisch und heißt uns Luftschiffer in der Stadt willkommen.
Um unseren Landungsplatz genau zu bezeichnen, fahren wir wieder dorthin und lassen durch Augenzeugen einen Holzpflock in die Erde rammen, auf dem wir Tag und Stunde der Landung bezeichnen.
In New York erfährt Erbslöh, dass er mit einer Strecke von über 876 Meilen den Gordon-Bennett-Pokal gewonnen haben. Neben der silbernen Trophäe zahlt der großzügige und hochherzige Gordon Bennett ihm als Gewinner 10.000 Goldmark in bar und weitere 8.000 Goldmark aus den Eintrittsgeldern aus.
Da der folgende Cup immer im Land des Siegers stattfindet, wird der nächste Coupe Aéronautique Gordon Bennett, das größte Ballonrennen der Welt in Berlin starten.
ERSTER TEIL
Ankunft in der Stadt der Evangelen
Verglichen mit den Zügen in Amerika waren die in Deutschland erstaunlich langsam. Die Familie Clemens saß im Abteil Erster Klasse, keine 100 Meilen waren es mehr bis Berlin. Mark Twain las weiter im Berliner Lokal-Anzeiger und versuchte seiner Frau Livy den Artikel zu übersetzen:
Der Deutsche Vegetarier-Bund hält derzeit in Berlin seinen 1. ordentlichen Bundestag ab. Er wird in Kürze sein eigenes Bundesorgans, die „Vegetarische Warte“ herausgeben. Abgeschlossen wurde der Bundestag mit einem Festmahl folgender Speisen: Kraftbrühe mit Semmelflocken, Pilzragout mit Reis, Blumenkohl mit Petersilienkartoffeln, Linsenbratklößchen, Hirse-Milchpfanne, Apfelsinen- und Schokoladenspeise, Polentaflammerie, Apfelmus, Aprikosen, Birnen, Kartoffel- und grüner Salat, Pumpernickel und Käse, frisches Obst.
„Sam, I only understand train station.“ Mark lächelte sie an. Livy liebte Samuel Langhorn Clemens über alles, aber er war auch der verrückteste Mensch, den sie jemals getroffen hatte. Sein unablässiges Schreiben, sein andauerndes Rauchen: 20 Zigarren am Tag! Seine unberechenbaren Launen, sein Lesen, sein Billardspielen, seine ruinösen Geschäfte, er machte von allem zu viel. Er hatte die Gabe, selbst eine so wenig aufregende Tätigkeit wie die Lektüre einer Zeitung maßlos zu übertreiben.
Doch dann ließ sie sich doch ein, mit ihm die Wörter Pumpernickel, Linsenbratklößchen und Polentaflammerie nachzuschlagen. Aber ihre Taschenwörterbücher halfen ihnen nicht. Mark machte sich keine Illusionen, Englisch konnte man in 30 Tagen lernen, Französisch in 30 Wochen, für Deutsch brauchte man 30 Jahre. Er lernte diese unglaubliche Sprache seit knapp 50 Jahren und immerhin, er hatte sie gelernt.
Die älteste Tochter Susy las in Max Nordaus Degeneration, Clara und die jüngste Jane waren versunken in das neueste Geduldsspiel, sie hatten je einen kleinen Rahmen in den Händen, darin Zahlensteine, die sie unsystematisch hin- und herschoben.
Es war unheimlich, wie sie so dasaßen, nicht aus dem Fenster schauten und keinen Roman lasen, sondern nur auf diese absurden Schiebesteine starrten. Konnten sie nicht rauchen?, fragte sich Mark. Oder sonst irgendwas Sinnvolles tun?
Mark las für sich weiter, wenigstens alle Überschriften, auch wenn er sie nicht verstand, ab und zu einen Artikel, den er auch nicht verstand. Aber er glaubte, eine Ahnung von dem zu bekommen, was man hier für wichtig hielt. Er notierte sich besonders skurrile Wörter: Kleinkinderbewahranstalt, Duellunwesen, Gasglühlicht, Taxameterdroschkenbesitzer.
In Berlin lebten momentan 1,3 Millionen Personen, fast 80.000 mehr Frauen als Männer, die meisten Einwohner waren evangelisch, aber über 100.000 auch katholisch, über 70.000 jüdisch, 38 Mohammedaner, 21 Buddhisten, vier Konfuzianer, zwei Sintoisten und ein Zoroaster. 204 bezeichneten sich als Atheisten und 477 hatten keine Religion. Dazu kamen noch 98 Humanisten, 19 Freidenker, vier Heiden sowie je ein Spiritist, ein Naturalist, ein Kosmopolit, ein Thesophist, ein Gottesleugner und ein Indifferenter.
Mark überlegte, wozu er sich rechnen würde, natürlich war er Presbyterianer, also evangelisch. Katholiken und Evangelen waren die beiden anerkanntesten Sekten in Deutschland. Sie unterschieden sich voneinander so sehr wie ein rothaariger Mann sich von einem rotblonden unterscheidet.
Andererseits besagte das Wort Glauben doch schon, dass man an etwas glaubte und also wusste, dass es nicht stimmte. Die Gedanken waren frei, also waren doch alle, die denken konnten, Freidenker.
Er legte die Zeitung beiseite, sah auf die Uhr, immerhin hielten sie sich an den Fahrplan, und blickte wieder aus dem Fenster. In den Kiefernwäldern waren ab und zu kleine Hüttendörfer zu sehen und dazwischen Müllplätze, die ersten zweistöckigen Häuser tauchten auf und schließlich waren sie in Charlottenburg mit fünfstöckigen Häusern. Mark hatte in Berlin kein schönes Wetter erwartet, aber noch nie hatte er eine Stadt gesehen, die ihm bei der Ankunft so grau und trostlos erschienen wäre. Gerade einmal kurz nach Mittag wurde es schon wieder dunkel.
Das erste Mal in Berlin, das erste Mal mit Familie in Europa. Das also war Berlin! Es gab keine Telegrafenmasten, auch keine für Telefon oder Strom und das war ein angenehmer Anblick.
Ich bin ein Glückspilz, dachte er beim Blick auf seine Familie: Livy, die schönste Frau der Welt, und seine Töchter.
Er freute sich auf die Wohnung in einer gehobenen Wohngegend nicht weit vom Potsdamer Platz. Der Immobilienmakler Herr Prächtel hatte ihnen versichert, dass dort der Adel lebte, Herzöge wären so zahlreich wie Gänseblümchen auf der Wiese. Mark warf einen Blick auf dessen Schreiben und den Briefkopf:
Möbel-Fabrik & Dampfschneidemühle
Künstlerische Wohnungseinrichtung & Innenausbau
Gegründet 1824
Carl Prächtel
Kaiserlicher und Königlicher Hof-Lieferant
Berlin, s. w.
Krausenstraße 32
Ankunft Anhalter Bahnhof, nicht weil die Züge dort anhielten, sondern wegen eines deutschen Königreiches namens Anhalt.
„Bitte fahren Sie uns in die Körnerstraße 7!“, bat Mark den Kutscher.
„Ick bin Justav!“, sagte der Kutscher, lud die Koffer auf und zündete sich seine Zigarre an. Die Damen setzten sich, der Kutscher nahm auf dem nach hinten schwingenden Ausleger Platz, die Zügel führten über die Köpfe der Familie Clemens zum Pferd. Mark saß mit dem Rücken zum Zugtier seinen Girls gegenüber, über denen wiederum der Kutscher thronte. Mark qualmte ebenfalls eine Zigarre und die Fahrt begann.
„Ferien oda Arbeet?“, fragt der Droschkenkutscher., Mark verstand kein Wort:
„Wie bitte?“ Der Kutscher schrie:
„SIND SE HIA FOR FERIEN ODA ARBEET?“
„Bitte wiederholen Sie und sprechen Sie langsamer!“ Doch der Kutscher konnte langsamer nur zusammen mit lauter:
„FEEHRIIIIIIJÄN OOOOODAAAAAH AAAARHBEEET?“ Mark gab es auf:
„Ich verstehe nicht, mein Deutsch ist sehr schlecht.“ Noch auf dem Schiff, in London, in Paris, in Heidelberg, schon damals vor über zehn Jahren bei seinem ersten Besuch in Germany war sein Deutsch gelobt worden. Konnte es denn seitdem so viel schlechter geworden sein?
Die Straßen waren schnurgerade, sehr breit, unglaublich sauber und sie verloren sich in der Unendlichkeit. Mark fühlte sich wohl, vielleicht war das Wetter schmutzig, Europa, Paris, Frankreich, auch London waren mit Sicherheit schmutzig, doch Berlin war so sauber, dass es strahlte, wie es selbst die Sonne nicht vermochte. Normalerweise fühlte er sich in seinem weißen Anzug sauber in einer schmutzigen Welt. So trübe es in Berlin war, so sehr fühlte er sich doch schon jetzt in einer sauberen Welt.
„Berlin ist schön!“, wagte er einen neuen Versuch auf Deutsch mit dem Kutscher.
„Ditt is hia nich Berlin, ditt is Schöneberch!“
Sie waren da, hier war ihre Wohnung, Nummer 7 Körnerstraße.
Körnerstraße
Neugierig schaute Mark nach den Grafen, Baronen, Freiherren und Herzögen, die hier wohnten. Doch ihm fielen nur die vielen Frauen in den Fenstern auf, die sehr konzentriert auf gar nichts starrten.
Der Dampfschneidemüller und künstlerische Wohnungseinrichter Carl Prächtel erwartete die Familie Clemens. Er war ein gutaussehender und erstaunlich junger Mann mit seidenweichen Umgangsformen und tadellosem Englisch. Die Wohnung lag im Hochparterre, Herr Prächtel erklärte es:
„Das ist eine Berliner Spezialität, auf der ganzen Welt wäre das die erste Etage, aber in Berlin ist es Hochparterre. Es gibt auch Souterrainwohnungen, wenn Sie das bevorzugen, ich kann Ihnen eine vermitteln.“
„Souterrainwohnung klingt gut“, sagte Mark, „in welcher Etage liegt eine Souterrainwohnung?“
„Das ist noch unter dem Tiefparterre.“
„Also im Keller? Es sind Kellerlöcher?“
„Mister Clemens, Sie neigen zu drastischen Bezeichnungen, so scheint es mir. Souterrainwohnung klingt entschieden besser, finden Sie nicht auch?“ Das konnte Mark nicht abstreiten.
„Falls Sie eine solche Wohnung mieten möchten, lassen Sie es mich wissen. Hier in der Körnerstraße 7 ist sie jedenfalls nicht verfügbar, denn hier unten wohnt der Hausmeister. Bei allen Problemen können Sie sich an ihn wenden. Aber Sie werden keine Probleme haben, denn das ist die Körnerstraße, ein Ort für Götter. Hören Sie?“ Mark hörte keine Götter und wusste nicht, was Herr Prächtel meinte.
„Hören Sie? Sie hören eben nichts! Und das um diese Zeit! Ganz Berlin lärmt und rumort, aber diese Straße ist so ruhig, nur einen Block lang, aber ein süßes kleines Nest, verborgen im Herz der Großstadt.“
„Aber der Geruch!“, fragte Livy, „es riecht hier etwas schlecht, oder?“
„Aber nein!“, widersprach Herr Prächtel, „dieser Geruch kommt nicht von dieser Straße, er kommt von den anderen Straßen.“ Mark überlegte, ob es einen Unterschied ergab, wenn man die eigene oder eine benachbarte Straße roch.
„Was hat es mit den Frauen in der Straße auf sich, die hinter den Fenstern zu sehen sind und ins Leere sehen?“, fragte er.
„Das sind echte Herzoginnen, sie pflegen sich auf diese Art zu entspannen.“
„Sie entspannen, indem sie vor sich hin stieren?“
„Natürlich, sie haben doch die ganze Nacht im kaiserlichen Schloss getanzt. Übrigens gehört dieses Haus einem Rittmeister.“ Mark war zufrieden, er war sich zwar nicht sicher, welchen Adel Rittmeister genau verkörperten, aber bestimmt einen, der weit über den Herzoginnen stand. Herr Prächtel zeigte zur anderen Straßenseite auf einen kranken Hund, der vor einen Kohlekarren gespannt war:
„Sehen Sie diesen Hund?“
„Ja, was hat er?“
„Was er hat? Es ist der Jagdhund des Herzogs! Ein wunderbares Tier, beste Zucht für die Hirschjagd.“
„Aber warum ist er vor den Kohlekarren gespannt?“
„Zum Training, in Berlin ist die Hirschjagd in der Innenstadt nur noch dem Kaiser selbst gestattet. Lang lebe der Kaiser! Der Hund soll in Übung und stark bleiben.“
„Was will denn der Herzog mit diesem Hund, wenn er keine Hirsche jagen darf?“
„Es geht um den Stil, alle Adeligen haben diese Hunde. Und in ihren Parks jagen sie damit Hirsche. Und natürlich haben sie auch antike Häuser, so wie dieses.“ Herr Prächtel führte aus, dass das Haus, obwohl nicht älter als 30 Jahre, doch schon eine Antiquität sei. Das Alter der Berliner Häuser sei an ihrer Höhe zu erkennen, je weniger Stockwerke sie hatten, desto älter wären sie. Das allerdings, fand Mark, war eine Banalität, das war schließlich in allen Städten dieser Welt so. Dieses Haus hatte drei Stockwerke, nach normaler Zählweise wären es vier Stockwerke gewesen.
Wegen seines Alters habe das Haus auch keine Elektrizität, erläuterte Herr Prächtel, abends um 10 lösche der Hausmeister das Gaslicht im Treppenhaus und schließe die Haustür ab.
Er hob noch die Ausstattung der Wohnung mit Kachelöfen hervor und wie diese mit erstaunlich wenig Brennstoff alle Zimmer mit der wohligsten Wärme der Erde füllten.
„Bitte beachten Sie die Hausordnung!“, schloss er. „Und natürlich den Mietvertrag!“
Mark hatte bereits unterschrieben, denn die Wohnung war unfassbar günstig. Sie hatte fünf vollständig möblierte Zimmer und ein Wannenbad. Und dann natürlich die Katzen. Katzen waren Marks Tiere. Zwei schnurrende Katzen lagen auf dem Ofen. Katzen waren zweifellos die saubersten, gerissensten und intelligentesten Wesen, die er kannte, natürlich abgesehen von Livy und seinen Töchtern. Livy blätterte den Vertrag durch und fragte:
„Wir dürfen unsere Wäsche nicht in der Wohnung waschen und aufhängen, sondern nur auf dem Wäscheboden?“
„So steht es im Vertrag, aber niemand wird in die Wohnung schauen, ob Sie die Wäsche dort oder woanders waschen“, versicherte Herr Prächtel.
Sie waren beisammen, seine liebste Livy, die Töchter Susy, die unvergleichliche, Clara und Jane und Livys Schwester Susan Crane, Marks Schwägerin. Eigentlich war sie eine Adoptivschwester. Nicht zu vergessen das Hausmädchen Katie Leary.
Sie waren angekommen und eine große Überraschung stand der Familie bevor, leider aber keine freudige.
Die frohe Botschaft
Mark schlief tief und gut in der ruhigen Straße und so erging es auch dem viel größeren weiblichen Teil der Familie. Am Morgen unternahm er mit Livy seinen Antrittsbesuch in der Amerikanischen Botschaft am Wilhelmplatz. Der Botschafter William Walter Phelps war ein alter Freund von Mark, Yaas nannten ihn seine Töchter, weil er nicht „Yes“ sagte, sondern „Yaas“. Aber sie mussten unter Obhut der Kinderfrau zurückbleiben. Mark und Livy gingen die Potsdamer Straße Richtung Leipziger Platz. Mark war von Berlin begeistert:
„Die Bürgersteige sind allein schon breiter als in allen anderen europäischen Städten die Hauptstraßen!“ Auf den Dächern der hohen Gebäude waren gigantische Eisenkonstruktionen, die aussahen wie Vogelkäfige mit hunderten von Drähten, die mit weißen Isolatoren aus Porzellan verbunden waren. Von dort spannten sich die Drähte wie riesige Schattenstrahlen durch den Himmel zu anderen Käfigen.
Die amerikanische Botschaft lag am Wilhelmplatz in einem Bankgebäude. Der Name der Bank beeindruckte Mark:Kur- und Neumärkisches Haupt-Ritterschaftliches Creditinstitut.
Das Wiedersehen mit Phelps war herzlich, eine bemerkenswerte Erinnerung hatte er für den berühmten amerikanischen Sohn aus dem Archiv herausgesucht, Marks handschriftlichen Antrag auf sein erstes Visum für Deutschland von 1878 an Phelps’ Vorgänger in Marks damaligem Deutsch:
Geboren 1835; 5 Fuss 8 ½ inches hoch; weight doch eher about 145 pfund, sometimes ein wenig unter, sometimes ein wenig oben; dunkel braun Haar und rhotes Moustache, full gesicht, mit sehr hohe Oren und leicht practvolles strahlenden Augen und ein Verdammtes gut moral character, Handlungkeit: Author von Bücher. Mark bat um eine Kopie und schwärmte von ihrem neuen Zuhause:
„Endlich keine Hotels mehr! Ich habe von Hotels gestrichen die Schnauze voll. Von nun an werde ich nur noch in schönen Wohnungen leben wie in der Körnerstraße, wie es sich für ein ehrenwertes Mitglied der Menschheit gehört.“
„Körnerstraße? Ach du meine Güte, gefällt es Ihnen da?“
„Natürlich!“, sagte Mark und führte die Annehmlichkeiten und Schönheiten des häuslichen Lebens ausgiebig aus, dass Phelps es gar nicht fassen konnte:
„Ich bin mir unsicher, ob wir von derselben Körnerstraße reden. Die Straße an der Bahn, die parallel zur Potsdamer Straße verläuft?“
„Genau, ein Paradies! Sie werden nicht glauben, wie viele Herzoginnen dort wohnen.“
„Herzoginnen in der Körnerstraße? Sind Sie sicher?“ Mark bestätigte es:
„Nachts tanzen sie beim Kaiser und tagsüber erholen sie sich, indem sie vor sich hinstarren.“
„Ich war lange nicht in der Körnerstraße, sie muss sich sehr verändert haben in den letzten Jahren.“
„Und diese Berliner Kachelöfen, es sind die besten, die ich je gesehen habe. Es sind viel eher gewaltige Denkmäler der Wärme für die Wohnzimmer. Am Morgen um sieben brauchen wir ihn nur mit wenigen billigsten Briketts beladen, dem preisgünstigsten und übelsten Brennstoff, den sich die Menschheit bisher ausgedacht hat, abgesehen von Kameldung. Einfach zusammengepresster Kohlenstaub! Wir lassen ihn eine halbe Stunde brennen, schließen ihn und Tage lang ist der Ofen warm und die ganze Wohnung wunderbar behaglich.“
„Aber Sie sind doch erst gestern angekommen?“
„Ja, aber Herr Prächtel hatte die Wohnung einige Tage vorher geheizt und sie war wunderbar warm, als wir ankamen.“ Phelps war noch nicht überzeugt:
„Körnerstraße? Ist es da nicht sehr laut?“
„Nein, es ist ruhig wie in einem einsamen Forsthaus unter 20 Fuß Schnee.“
„Ach, sieh an! Dann muss es eine andere Straße sein, als ich dachte. Aber so oder so, wenn du Ruhe oder Telefon oder den Telegrafen brauchst oder einen Arbeitsplatz, mache mir die Freude und komme zum Arbeiten her! Allzulange gibt es diese Möglichkeit hier nicht mehr, denn wir müssen umziehen, die Bank baut neu.“
„Danke für das Angebot!“
„Sei willkommen! Dafür gibt es schließlich Botschaften, dass sie ihren Landeskindern den Aufenthalt in der Fremde so angenehm wie möglich machen.“
„Das ist doch aber nicht ihre einzige Aufgabe?“
„Es gibt hier tausende von Amerikanern, sie haben sogar eine eigene Kirche hier samt Pfarrer und allem Drum und Dran.“ Er lud die Clemens’ für den nächsten Morgen zu sich zum Frühstück in die Dorotheenstraße 57 ein.
Es klopfte, ein Mann von Anfang 60 trat ein, er hatte einen weißen Schnurrbart und einen weißen Haarkranz um seine Glatze. Phelps begrüßte ihn und machte ihn mit Mark und Livy bekannt:
„Darf ich Euch Rudolf Lindau vorstellen! Pressereferent des preußischen Auswärtigen Amtes und unser deutscher Lieblingsdiplomat. Als er hörte, dass du nach Berlin kommst, hat er mich angefleht, einen Kontakt herzustellen.“ Lindau sprach perfektes Englisch, Mark schien es um Dimensionen besser als sein eigenes. Vielleicht lag es an dem sehr feinen deutschen Akzent. Jede Finesse der Grammatik beherrschte dieser Mann, der sich als wirklicher Kenner seiner Bücher entpuppte:
„Mister Clemens oder bevorzugen Sie Mister Twain? Ich habe alle Ihre Bücher verschlungen und immer wieder gelesen! Sie sind für mich der größte amerikanische Schriftsteller, sogar der erste wirkliche! Ihr Huckleberry Finn ist kein Kinderbuch, sondern das wichtigste Werk der amerikanischen Literatur!“ Mark war geschmeichelt:
„Damit haben Sie mein Jahr gemacht! Und ich bin Sam!“ Es stimmte, sein Huckleberry war schon sein liebstes Kind und wer Huck ebenfalls mochte, konnte kein schlechter Mensch sein. Lindau lud die Clemens’ zum Abendessen ein:
„Es wäre die größte Freude, die Sie mir machen können. Ich lasse für Sie zubereiten, was immer Sie wollen. Ich hole Sie ab, von wo immer Sie wollen und bringe Sie wieder zurück!“ Es stellte sich heraus, dass seine Wohnung in der Sigismundstraße keine zehn Minuten zu Fuß von der Körnerstraße entfernt lag.
So trat ein neuer Heiliger in die Familie Clemens.
Glocken, Chöre und Nummern
In der zweiten Nacht genoss Mark wiederum die Stille der Körnerstraße bis zur großen unerfreulichen Überraschung. Denn eine große Karawane schwerer Wagen donnerte übers Pflaster der Straße und zertrümmerte dabei, dem Geräusch nach zu urteilen, Flaschen. Mark war hellwach und zitterte mit dem ganzen Haus. Das Donnern wiederholte sich unregelmäßig, bis gegen 2.30 AM einige Dutzend Menschen an Marks Fenster vorbei trampelten und dabei laut schrien, heulten, lachten, kreischten und sangen. Mark zündete das Gaslicht an und schrieb sich den Text ihres Liedes auf:
„Kling Glöckchen, klingelingeling! Kling Glöckchen, kling!“ Er verstand den Sinn der Worte nicht. 28 Minuten danach fuhr jemand bei lautem Hundegebell durch die Straße und ließ an jedem Eingang eine durchdringend laute Klingel erklingen. Jetzt verstand Mark den Text des Liedes,
Die Schmerzen in Marks Arm führten ein Eigenleben und hatten einen gänzlich anderen Tagesrhythmus als er. Am muntersten waren sie, wenn er schlafen wollte. Es war bemerkenswert, wie der beim Zubettgehen noch unscheinbare Druck zu einem ganz unermesslichen nagenden Vibrieren wurde, das nicht nur die Körnerstraße, sondern ganz Schöneberg, sogar noch Berlin und die Hälfte der Provinz Brandenburg ausfüllte.
Ab 3 Uhr begann die Zeit der Hundechöre, auch einige Wolfsrudel heulten. Ab 5 erklangen Klagegesänge und manchmal auch Bellen der Herzoginnen, die offensichtlich von den Bällen bei Hofe zurückgekehrt waren.
Als es hell wurde, waren Explosionen von der nahen Bahn zu hören und dann war die zweite Nacht der Familie Clemens in Berlin zu Ende. In jeder der folgenden Nächte wurde die vorhergehende durch Lautstärke und Originalität des Lärms übertroffen.
Die Familie wirkte am Morgen welk vor Schlafmangel. Sie brachen übernächtigt auf zum Frühstück zu Phelps, Dorotheenstraße 57.
Zuerst dachte Mark, die Berliner Hausnummerierung wäre das Werk eines Idioten. Auf der einen Straßenseite war die Nr. 5, gegenüber auf der anderen die Nr. 125. Er ging zum nächsten Eingang, nun war hier die Nr. 5A und gegenüber die Nr. 124CIV. Nein, für einen Idioten war das zu abwechslungsreich. Kein Idiot konnte sich so viele konfuse Arten von Nummern ausdenken. Die Familie ging weiter, nun waren sie bei 5IVc, als Nächstes kam 5IVd. Eher war die Berliner Hausnummerierung das Werk eines Wahnsinnigen.
Wer bei dieser Nummerierung nicht vom Glauben an, egal welchen Gott oder Satan abfiel, hatte keinen Verstand. Manchmal wurde die gleiche Nummer für drei oder vier Häuser verwendet, manchmal hatten man mehrere Häuser ganz vergessen zu nummerieren. Mark wurde klar, dass er alt und gebrechlich sein würde, sollte er jemals bis zur Nummer 6 kommen. Er war nun bei der rätselhaften 5DIII und bemerkte, dass er gar nicht in der Dorotheenstraße war, sondern in der Neustädtischen Kirchstraße.
Mark bekam einen seiner gefürchteten Wutanfälle. Egal was jetzt eine seiner Damen sagte, es war falsch. Und tatsächlich war keinerlei System in der Nummerierung erkennbar. In der nächsten Straße kam nach der Nummer 60 plötzlich die Nummer 140, danach die 139, die Nummern wechselten einfach die Laufrichtung ohne Warnung oder Erklärung.
Das Chaos in der Hausnummerierung war zweifellos das größte Durcheinander seit Anbeginn der Welt. Doch dann waren sie angekommen und das Frühstück entschädigte für alles.
Im Palais Mendelsohn
Die Clemens’ besuchten den Salon des Ehepaars du Bois-Reymond in der Jägerstraße 51 bis 53. Noch nie, so schien es Mark, war einem amerikanischen Paar so viel Ehre zuteilgeworden, wie ihnen beiden. Phelps, der ebenfalls eingeladen war, bestätigte es. Auch wenn er schon zum zweiten Mal hier war, hatte man ihm eine gemeinsame Teilnahme mit Ehefrau bisher verweigert.
Hier in der Jägerstraße war der Firmen- und Familiensitz, das legendäre Palais Mendelssohn. Frau du Bois-Reymond war wirklich eine Nachkommin Mendelsohns, also sowohl des Philosophen Moses als auch des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ihr Mann Alard du Bois-Reymond stammte aus der wichtigsten Hugenottenfamilie Berlins und war Professor für Latein und Griechisch, aber verstand auch sehr viel von Elektrizität und Patenten.
Berlin war ein Dorf, Theodor Mommsen war ein anderer Gast und Mark konnte erstmals Anna und Hermann von Helmholtz in echt sehen. Die Reaktionen auf Marks Schwärmereien und Lobliedern auf die Wohnung in der Körnerstraße waren eigenartig.
„Oh je, Körnerstraße!“, sagte Mommsen und wechselte das Thema. Anna von Helmholtz erschreckte sich ein wenig:
„Ach du lieber Gott, Körnerstraße, da möchte ich nicht tot überm Zaun hängen!“ Hermann von Helmholtz war überrascht:
„Körnerstraße? Wie in aller Welt sind Sie darauf gekommen, sich dort eine Wohnung zu nehmen?“ Die du Bois-Reymonds hatten nichts davon mitbekommen, sie waren umgänglich und zugewandt, bis sie fragten:
„Wo wohnen Sie in Berlin?“
„In der Körnerstraße.“ Beiden schien das eine ganz unglaubliche Aussage:
„Körnerstraße?“ Die Clemens’ bejahten und die du Bois-Reymonds starrten einige Minuten vor sich hin, offensichtlich konnten sie diese Information nicht einfach einordnen. Sie atmeten schwer, aber dann war das Schlimmste überwunden und Frau du Bois-Reymond rief aus:
„Du lieber Gott!“
„Was hat es mit der Körnerstraße auf sich?“, fragte Mark, Herr du Bois-Reymond ging gar nicht darauf ein:
„Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie wirklich in der Körnerstraße wohnen? Sie sind doch so liebe Menschen, wer hat Sie dorthin verfrachtet?“
„Herr Prächtel aus der Krausenstraße.“
„Ah, jetzt verstehen wir, das erklärt natürlich alles. Wie viel zahlen Sie Miete?“ Mark sagte es ihnen.
„Das Dreifache des normalen Preises! Herr Prächtel hat sie prächtig über den Tisch gezogen!“
Herr Prächtel war also prächtig, dachte Mark, er war nicht schlechter oder schlimmer als irgendeiner seiner Kollegen. Nur seine Möbel, die waren schlechter, er selbst war ein normaler Mensch bestehend aus Fleisch, Blut und Geldgier.
Richter und Henker
Als Mark ihn sah, wurde ihm klar, dass der preußische Adlige so geht und sich benimmt, als hätte er den Stock verschluckt, mit dem man ihn als Kind geschlagen hat. Graf Götz von Seckendorff war Kammerherr und Oberhofmeister der Kaiserin und ein unerträglich arrogantes Scheusal.
Gegenüber Mark brüstete er sich mit vielen seiner Vorfahren. Mark machte ein Gesicht, als ob er aufmerksam zuhörte. Von Seckendorffs Großväter, seine Urgroßväter, seine Urururgroßväter, und auch etliche Ururururgroßonkel hatten bei den Schlachten von Jena, Leipzig, Großbeeren, Fehrbellin, Rathenow und Warschau gekämpft sowie im Fünfjährigen Krieg, im Sechsjährigen und im Siebenjährigen.
Graf Seckendorff zählte alle Kriege bis zum Hundertjährigen Krieg auf. Auch beim Kleinen und Großen Nordischen Krieg hatten sie gefochten, beim Kleinen, Mittleren und Großen Türkenkrieg und den ungefähr 100 Schlesischen Kriegen, und zwar immer auf der Seite der Gewinner. So wie er, Götz von Seckendorff selber, mit den Engländern in Abessinien und den Preußen gegen Frankreich gekämpft hatte.
Mark dachte an General Grant, den er nicht dafür bewunderte, dass er den Krieg gewonnen, sondern dass er ihn beendet hatte. Frieden, Glück, Brüderlichkeit, das waren doch die eigentlichen Ziele in dieser Welt. Stattdessen hatte ihm Phelps diese Einladung des Kaisers für seine Parade im kommenden Monat überbracht, die Eintrittskarten waren Gold wert. Mark musste hingehen. Aber er verachtete militärische Spektakel und eigentlich den ganzen Militarismus, ob nun in Preußen oder Frankreich.
Tolstoi hatte die Armee eine Schule für Mord genannt. Wie recht er hatte, wobei das edle, uralte Handwerk des ehrlichen Mordens durch die Armee immer wieder in den Dreck gezogen wurde.
In Deutschland gab es heute zehn Millionen Männer, die darauf gedrillt waren, den Kaiser als Gott zu betrachten. Und wenn der Kaiser sagte: Tötet!, dann töteten sie. Und wenn er sagte: Sterbt für mich!, dann würden sich diese Männer einfach erschießen lassen. Schande über die Kriegstreiber! Die Deutschen waren nichts als Untertanen, sie hatten 2000 Jahre Buckeln im Blut.
Graf Seckendorff war dabei, die Besitzungen der Familie aufzuzählen, bei jeder Schlacht hatten sie sich wohl ein Schloss, eine Burg oder ein Land geraubt: Unternzenn, Unteraltenbernheim, Gunzenhausen, die Rittergüter in Schnodsenbach, Neuendettelsau, in Taschendorf, Obertaschendorf und Überobertaschendorf, in Reichenschwand, Krotendorf, Schnodsenbach, Sugenheim, es nahm kein Ende und Mark staunte, wie viele Dörfer es im Deutschen Reich gab.
Graf Seckendorff wies auf den Kupferstich an der Wand, der den Prozess gegen Karl den Ersten von England zeigte:
„Dieser Diener des Königs war auch ein Vorfahre von mir, nur drei Getreue hatte er bei diesem Justizmord.“ Phelps stand dabei und hatte Marks Not bemerkt. Er zeigte auf einen der Puritaner, die den König zum Tode durch die Axt verurteilten:
„Mein Vorfahre!“ Etwas indigniert schaute Graf Seckendorff sich den Abgebildeten von Nahem an und war endlich sprachlos.
Ein weiterer Stich hing daneben, die logische Fortsetzung der Gerichtsverhandlung von 1649, die Abscheulichste Unerhörte execution an weyland dem Durchleuchtig- und Großmächtigsten König in Groß Britannien abgebildet, ein Henker hielt den aus dem Hals tropfenden Kopf nach oben. Der zweite Henker zeigte mit der einen Hand auf den knienden König ohne Kopf, aus dessen Hals das Blut unrealistisch in vier Fontänen herausspritzte. In der anderen hielt er seine Henkersaxt. Mark zeigte auf ihn:
„Das ist mein Urururgroßvater!“ Graf Seckendorff schaute ungläubig auf die Kupferstiche und wieder zu Phelps und Mark. Die blickten ihn unschuldig an und verzogen keinen Gesichtszug.
Livy und Mark kehrten zurück in ihre Straße. Es gab hier keine Herzöge und keine Herzoginnen, auch keine Freiherren. Ein Rittmeister war kein Adeliger, sondern ein recht niedriger Dienstgrad. Der Hausbesitzer war ungefähr so adelig wie Sam Clemens. Aber das Fehlen von Adeligen war ein kleines Problem verglichen mit dem, was sich mit ihren Töchtern anbahnte.
Mister Langhorn Clemens, Berlin
Die Schmerzen im rechten Arm folgten keinem nachvollziehbaren System, damit ähnelten sie der Nummerierung in den unendlichen Straßen von Berlin. Es gab Minuten, manchmal sogar halbe und ganze Stunden ohne Schmerzen, dann kehrten sie zurück, darauf war Verlass.
Mark blieb im Bett, um zu arbeiten. Jeden Tag mindestens ein Brief oder ein Telegramm nach New York an Frederick Hall, der Marks Verlag Charles Webster & Co. leitete. Egal wie er rechnete, die finanziellen Schwierigkeiten waren groß. Es sah nach einem gigantischen Flop aus, nicht einmal 200 Stück der Lebenserinnerungen des Papstes waren verkauft. Wie konnte das sein? Der Papst! Darüber kam doch nur noch Gott selbst.
Ein deutscher Steuerbescheid über 48,40 Mark!