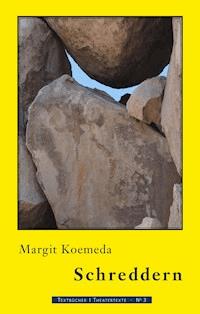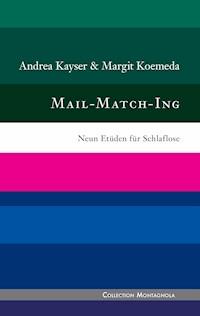Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Collection Montagnola
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In einem Wiener Krankenhaus wird eine junge Frau eingeliefert, bewusstlos. Nicht identifizierbar, da sie nichts bei sich hat. Man findet lediglich eine Mappe bei ihr, die einen Stapel loser, mit Schreibmaschine beschriebener Blätter enthält. In den Texten meldet sich eine Frau zu Wort, die, obwohl sie scheinbar alles hat, ihr eigenes Leben nicht zu fassen bekommt. Als letzte Hoffnung sucht sie einen Analytiker in Wien auf. In der Mappe befinden sich auch Briefe an einen fiktiven Geliebten, dem sie ihr Leben erzählt, die Geschichten ihrer weiblichen Vorfahren, ihre eigenen Erfahrungen als Mutter, Erinnerungen an pränatale Zeiten, Baby-Perspektiven. Die Seelenlandschaften der Protagonistin sind brüchig und zerklüftet, ihre Suche zielstrebig und gleichzeitig verzweifelt. Immer wieder greift sie ins Leere und steuert auf eine Katastrophe zu. Günstige Umstände und das geduldige Zusammenwirken einiger Mitmenschen geben Lena eine zweite Chance zur Selbstfindung, zeigen ihr einen Weg ins Offene.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
W
IEN
K
OPFBAHNHOF
Blaulicht mit Frau
Ankommen
Scheidungsgründe
Eine Prise Unvernunft
B
RIEFE AN
D
ANIEL
Traumwirklich
Rolf zuliebe
Wochenenden
Im Spiegelkabinett – Kommunizieren
Mein Eigensinn
Familienfotos
Stellenantritt: Martha
Marthas Reinfall
Ehre oder Leben: Maria
Im Krebsschalenpanzer
Rollenkollaps – Ich bin Vera
Austreiben
Von Lust und Last: Anna
Phantom der Liebe: Wenn ich nur will
Rückspiegel
Mutterfreuden und das ganze Waschprogramm
Die Schuld der Mütter – Das überhörte
Nein
Bodenlos
Wegen Umbau geschlossen
Katastrophenalarm
Alle Schande zum Abschied
Vernunft annehmen
Prallrote Lippen
L
ENA AUS DEM
S
CHERBENHAUFEN
Personalien unbekannt
Niemand da – Lenas Rache
Halten
Teilchen, Zerfall und das Ganze
Geschlossene Welt
Heimschaffung
Wahrnehmen
Ein Spiegel zum Letzten
Der leere Spiegel
Verbeult und käsefarben
»Nicht einmal das sogenannte physikalische Licht vermag ja als Licht in Erscheinung zu treten, wenn es nicht auf ein Ding trifft, das es zum Scheinen bringen kann.«
Martin Heidegger
I.
Wien Kopfbahnhof
BLAULICHT MIT FRAU
»Die Hinfahrt war schlimmer als die Rückfahrt.« Herberts Blick geht an mir vorbei und verschwimmt. »Das tägliche Tatü-tata, merkwürdig, ich habe früher nie darauf geachtet.«
»Hat der Notarzt Sie heute mitgenommen?« frage ich.
»Ja, er hat mich herbeigewunken, als alle schon rannten. Das Heulen der Blaulichtsirene fährt einem direkt ins Blut. Atem und Herzschlag rasen. Kein Halt an Rotlichtern. Andere Autos ducken sich in Rinnsteine oder hüpfen auf Bordsteinkanten. Gespannte Ruhe, darunter liegen alle Nerven blank.«
»Die Fliehkraft läßt uns hin und her schwanken«, berichtet Herbert weiter, »stumm glotzen wir in den Tunnel der vor uns liegenden Momente. Das Martinshorn bohrt Löcher in die alltägliche Belanglosigkeit.«
So habe ich Herbert noch nie reden gehört. Er macht ein Praktikum bei uns und wird sich an diese Arbeit noch gewöhnen müssen. Einen Augenblick lang fürchte ich, daß er dem Sog seiner wegdriftenden Gedanken nicht widerstehen kann. Ich mag ihn, diesen rötlich-blonden, etwas dicklichen Jungen.
»Sie wissen ja«, fügt Herbert hinzu, »daß alle Züge in Wien zur Umkehr gezwungen werden.« Er meint wahrscheinlich den Kopfbahnhof. Ich biete ihm eine Tasse Kaffee an. Er schüttelt aber den Kopf und verschwindet.
Als er kurze Zeit später wiederkommt, quellen weitere Eindrucksfetzen aus ihm. Er schraubt die Thermoskanne auf, hält sie schräg, legt eine Kaffeetropfenspur über die durchsichtige Schreibunterlage, bevor er bei seiner Tasse ankommt und einschenkt.
»Gutwetterdunst über der Stadt. Ein schneidend kalter Novembermorgen. Plötzlich sehen wir auf der linken Seite eine Menschenansammlung. Unser Chauffeur fährt knapp heran, tritt scharf auf die Bremse und schaltet das Martinshorn ab.
Dann springen wir hinaus. Die Herumstehenden sind bereits auseinander gewichen und haben eine Gasse für uns frei gemacht.
Auf der Promenade liegt eine Frau. Der unterste Knopf ihres hellbeigen Mantels ist aufgesprungen. Die Beine liegen steif und leicht zur Seite gedreht da. Augenscheinlich unbeschädigt die matt glänzenden Strümpfe. Rötlich-gekräuselte Haare wie zu einem Strahlenkranz ausgebreitet um ein schmales, blasses Gesicht.
Der Körper, etwa 30jährig – soll ich das in mein Rapportheft schreiben? – , ein schlanker, zierlicher Körper liegt schräg über dem Bordstein. Der Bauch erscheint dadurch etwas vorgewölbt. Einen Augenblick lang entsteht der Eindruck von Schwerelosigkeit. Mir wird flau im Magen. Der Notarzt beugt sich zu der Frau hinunter, er versucht, sie anzusprechen. Sie gibt keine Antwort. Er fühlt den Puls. Dann hebt er vorsichtig Arme und Beine. Während er noch nach möglichen Verletzungen sucht, haben wir eine Tragbahre geholt und legen die Frau jetzt darauf. Ihre Füße stecken in Wildleder-Ballerinas. Viel zu kalt für diese Jahreszeit.
Und noch einmal Blaulicht und Sirene. Mit quietschenden Bremsen kommt ein zweiter Wagen zum Stehen. Zwei Polizisten steigen aus. Sie fragen nach Zeugen. Der stiernackige, ältere der beiden fragt noch einmal:
›Zeugen?‹
Nach einer gedehnten Zeitspanne, in der das Gemurmel der umherstehenden Passanten langsam verstummt, tritt ein Mann vor, unrasiert, mit angegrautem Haar. Er trägt einen zerbeulten dunkelgrauen Mantel, dazu einen unordentlich geknoteten Schal. Er teilt mit, daß er die Rettung und die Polizei verständigt habe. Er sei wie immer mit seinem Hund spazierengegangen, dabei deutet er mit einer Kopfbewegung zum gußeisernen Geländer hinüber, wo ein großes schwarzes Tier festgebunden liegt. Kein Mensch sei zu sehen gewesen, soweit er sich erinnern könne. Vereinzelte Autos, ja. Da habe er die Frau hier liegen gesehen und sei sofort ins nächste Kaffeehaus gelaufen, um zu telefonieren. Bei seiner Rückkehr seien sich bereits mehrere Menschen zusammengelaufen gewesen. Man habe gerätselt, was hier vorgefallen war. Er habe auch keine Ahnung.
Der Sanitäter und ich bringen die Frau ins Auto. Kurzer Wortwechsel zwischen Notarzt und Polizist, der für die Umstehenden nicht verständlich ist. Der Rettungswagen fährt ab. Das Blaulicht bleibt ausgeschaltet.
Die Frau wird nun künstlich beatmet. Auf Ansprechen reagiert sie nach wie vor nicht. Machen Sie die Augen auf! Geben Sie mir die Hand! Keine Reaktion.
Im Inneren des Wagens schwebt diffuses gelbliches Licht. Die Rettungsmannschaft ist jetzt ruhiger geworden. Die Rückfahrt geht langsam vonstatten.«
Eigentlich sollte ich Herbert jetzt zeigen, wie man die Medikamente richtet. Er ist aber, wie mir scheint, immer noch nicht ganz bei sich.
Deshalb stelle ich die Schuhe der Neuen und eine blaugraue Mappe in den Schrank und bürste ihren hellbeigen Mantel aus.
Wenn ich mich ein wenig strecke und den Oberkörper leicht zur Seite verschiebe, habe ich ihr Bett im Blick. Die Zimmer auf unserer Station sind ohne Türen. Die Patientin liegt dort unter weißen Decken und Leintüchern, ist zur Beatmung mit Plastikschläuchen verkabelt, mit Verbandsmull und Heftpflastern verklebt. Neben ihr die piepsenden und wandernde Lichtkurven zeichnenden Monitore.
Weiblich. Personalien unbekannt. Um sechs Uhr dreißig hat man sie in komatösem Zustand eingeliefert. Vegetative Funktionen unauffällig, größere Verletzungen keine, nicht ansprechbar, Reflexe in Ordnung, Reaktionen auf Schmerzreize adäquat. Fundort: Roßauer Lande. Auffallend, daß die Patientin keine Handtasche, weder Schlüssel noch Personalausweis bei sich hatte. Direkt neben ihr lag lediglich eine blaugraue Mappe, darin befinden sich mehrere lose, mit Schreibmaschine beschriebene Seiten.
Fundort? Komische Bezeichnung. Unfall- oder Tatort wäre natürlich unzutreffend. An Findelkinder muß ich denken. Mich wundert, daß sich bisher niemand für diese Blätter interessiert hat. Falls die Mappe morgen abend, wenn ich zum Nachtdienst komme, immer noch unberührt im Schrank liegt, werde ich hineinschauen.
›Immer korrekt‹, so steht es in meinen Arbeitszeugnissen. Ich weiß nicht, warum ich mich von den Kleidern der Neuen verführen ließ. Der Allerleirauh-Pullover, die zusammengenähten Leder- und Pelzstücke, Strickflicken aus Chenille, Angora und Popcorn-Bouclé. Und alles in Erdtönen, dazwischen ein Oktobergold-Orange, ein ausgehendes Herbstfeuer. Ich habe einfach darüberfahren und meine Hand länger darauf liegen lassen müssen als gut war. Die vielfältig zusammengestückelte, weich-klebrige, warm-kratzige Empfindung, die mich durch meine Fingerkuppen kitzelte, machte mich so neugierig, daß ich anschließend in die Manteltasche griff. Die hätte leer sein sollen. Schlampigkeit der Polizei.
Jetzt habe ich diesen Kassenzettel in meinem Kittel, wo er nichts zu suchen hat, außer daß schon jetzt feststeht: Ich werde hinfahren. Eine Bäckerei in Bahnhofsnähe. Das aufgedruckte Datum liegt knapp zwei Wochen zurück.
Ich werde fragen, ob sich jemand an eine junge Frau, der Kamelhaarmantel so bleich wie ihr Gesicht mit langen rötlichen Korkenzieherlocken, erinnern kann. Natürlich weiß ich nicht, ob sie an jenem Tag denselben Mantel getragen hat und ob sie immer so bleich ist wie gerade jetzt.
Ich muß die Medikamente richten. Nein, zuerst in Zimmer Sechs das Beatmungsgerät überprüfen. Die Neue liegt in Fünf. Wir haben noch keinen Bericht über sie. Sie ist nach wie vor nicht ansprechbar. Hängt am Tropf. Wird künstlich beatmet. Ihre Kleider waren nur staubig gewesen. Nicht zerrissen. Ohne Blutflecken. Ich hab sie abgebürstet.
Sie ist blaß. Aber das sind sie alle. Und sediert, damit sie sich die Infusion oder den Beatmungsschlauch nicht herausreißt. Nach jeder halben Stunde muß ich die Blutdruckwerte notieren, auch nachts. Sie ist ruhig. Namenlos. Abwesend.
Den Gefallen, sich zu erinnern, erweist ihr niemand. Hätte ich mir ja denken können. Eine Bäckerei in der Tannengasse, wo täglich Hunderte von Menschen ein- und ausgehen. Ich hab mir ein Stück Apfelstrudel gekauft. Dann hab ich die Kassenzettel verglichen. Der Zufall will es, daß sie sich nur im Datum unterscheiden. Vierter und neunzehnter November.
Siebzehn Uhr zehn. Ich muß zur Arbeit. Ich nehme die U3. Fahrkarten waren bei der Patientin keine zu finden gewesen. Kann ja sein, daß sie Schwarzfahrerin ist.
Auf dem Weg von der U-Bahn ins Krankenhaus wehen mir eisige Schneeflocken ins Gesicht. Ich gehe schnell. Wenige Menschen auf der Straße. Als habe die Kälte das Stadtleben eingefroren. Nächte, in denen nicht viel geschieht, außer daß vielleicht ein Mensch still wegstirbt und nichts als Routinevorgänge auslöst.
Ich werde die blaugraue Mappe anschauen.
ANKOMMEN
5. November
»Als gestern um achtzehn Uhr null null der Zug in Wien Westbahnhof hielt, hatte ich bloß eine Adresse im Kopf. Niemand holte mich ab. Menschen strömten mir entgegen oder überholten mich, manchmal stieß jemand an meine Tasche. Der Straßenname und die Hausnummer boten keinen Halt. Meine Augen schwammen ziellos in der Dunkelheit umher. Die unzähligen Lichtpunkte der abendlichen Stadt waren ohne Bedeutung. Kein einziger zog mich an.
Ich habe gelernt, mich zu behaupten. Ich hätte jemanden ansprechen und nach dem Weg fragen können. Oder etwas zu essen kaufen. Ich könnte mich nach Parkplatzmöglichkeiten umsehen, denn vielleicht werde ich das nächste Mal mit dem Auto kommen.
Eigentlich suche ich Doktor Morten wegen meiner Eheprobleme auf. Aber vielleicht sollte ich ihm besser von dieser Verlorenheit erzählen.
Schließlich zog mich ein winziger Bäckerladen an, eine verwinkelte, aber freundlich erleuchtete Lokalität. Vielleicht war es die offenstehende Tür, die mich einlud, hineinzugehen. Ich grüßte. Da war – und das erschreckte mich für einen Augenblick – niemand.
Merkwürdig, dachte ich. Und für den Bruchteil einer Sekunde fragte ich mich, ob es vielleicht schon zu spät sei und ich die Ladenschlußzeit übersehen hatte.
Doch bevor ich meinen Impuls, mich zurückzuziehen, umsetzen konnte, erschien aus einer durch Regale halb verdeckten Tür eine junge, rotblond gelockte Frau, die sich die Hände an einer weißen Schürze abwischte und sich gutgelaunt nach meinen Wünschen erkundigte. Ich verlangte ein Stück Apfelstrudel und fragte nach der Reitergasse.«
Das war offensichtlich kein Brief. Vielleicht eine Tagebuchaufzeichnung, aber warum in Maschinenschrift? Ich hatte einfach das oberste von mehreren losen Blättern genommen und zu lesen begonnen, dahinter lag, extra zusammengeheftet, ein dickeres Seitenbündel.
Geschieht Wiederbelebung durch Lesen? Hat diese Frau sich zu zerstören versucht und mit der Mappe eine Art Abschiedsbrief hinterlassen wollen? Der Oberarzt war ungehalten über den Fall, so viel habe ich mitbekommen. Die Ursache für ihren Zustand scheint ungeklärt. Unklar ist deshalb auch, wie man sie behandeln soll. Sie wird offensichtlich einfach liegengelassen.
Ich will weiterlesen.
»Eine Stunde später hatte ich das rettende Ufer endlich erreicht, nestelte aber nur nervös an einem Tempotaschentuch herum. Doktor Morten saß mir gegenüber in einem dunklen Ledersessel und sah mich aufmerksam und – wie mir schien – freundlich an. Damit hatte ich nicht gerechnet, weshalb meine Spannung zunahm.
Ich hatte bereits mehrere Taschentuchfetzchen abgerissen und zu Kügelchen gezwirbelt und erwartete von mir, daß ich spätestens jetzt zu reden anfinge. Aber das ging nicht. Statt dessen kämpfte ich gegen Tränen an.
Der Therapeut räusperte sich und fragte, ob ich eine gute Reise gehabt hätte. Und ob ich ihm erzählen wolle, was mich herführe.
Sehr gut, antwortete ich, und war dankbar und erleichtert, auf eine einfache Frage eine ganz und gar unscheinbare Antwort geben zu können.
Warum ich zu Ihnen komme, ist sehr viel schwieriger zu beantworten. Ich habe einmal einen Vortrag von Ihnen gehört. Und ich weiß auch nicht, es geht mir in letzter Zeit nicht gut. Ich will mich von meinem Mann trennen und bringe es einfach nicht fertig. Ich weiß aber auch nicht einmal genau, warum. Wenn ich anderen davon erzähle, aber Sie müssen nun nicht denken, daß ich dieses Thema überall herumposaune, im Gegenteil … In den wenigen Fällen, in denen ich von der Möglichkeit einer Trennung gesprochen habe, stieß ich auf blankes Unverständnis. Im Augenblick weiß ich eigentlich nicht mehr, was ich Sie hatte fragen wollen. Oder hatten Sie mich etwas gefragt?
Ich kenne das, daß sich mitten in einem Gespräch die Rollen und Perspektiven zu vermischen beginnen. Es hängt mit der Aufregung zusammen, in die mich jede Unterhaltung versetzt. Ich verliere manchmal den Faden.
Und daß ich einfach weit weit weg von meinem Mann und meinem schweizerischen Wohnort wollte, daß ich es nicht mehr ausgehalten hatte, konnte ich in diesem Moment noch nicht sagen. Daß ich in Wien eine Art Heimat suchte, was natürlich vollkommen absurd war, kommt mir höchstens jetzt in den Sinn.
Immerhin waren inzwischen die weißen Taschentuchkügelchen von meinen Oberschenkeln in die Rockmulde meines Schoßes gerollt. Das war eine Form von Sammlung. Auch wenn ich nicht wußte, was ich als nächstes sagen sollte, fühlte sich das Schweigen in diesen Augenblicken deutlich weniger gespannt an. Kurzzeitig kam mir das schmiedeeiserne Geländer im Treppenhaus wieder in den Kopf.
Wir haben keine Eile. Die dunkle Stimme des Arztes erreichte mein Ohr wie eine Welle, die am Ufer leckt.
Vielleicht mögen Sie mir sagen, wie das genau ist, wenn Sie sich nicht gut fühlen. Arbeiten Sie?
Wieder so eine bodenständige Frage. Ich griff sie dankbar auf. Ja, an drei Tagen in der Woche arbeite ich. Es wurde ruhiger in mir.
Immer wenn dieser Gefühlsstau von Alles-auf-einmalmitteilen-Wollen eine dünne Abflußmöglichkeit erhält, eine Frage und dann eine Folge von aneinander anschließenden Sätzen, läßt der innere Druck ein wenig nach. Eigentlich war es ganz einfach. Jede Mitteilung hatte mit einem einzigen ersten Satz zu beginnen. Und wahrscheinlich war es gleichgültig, mit welchem. Andere Sätze konnten folgen, und am Ende hätte ich gesagt, was zu sagen war. Aus irgendeinem Grund glaube ich aber, daß von der Richtigkeit des ersten Satzes mein Leben abhängt. Das sagte ich Doktor Morten vorerst nicht.
Das Geländer kam mir ein zweites Mal in den Sinn. Ich hatte die ausgetretenen Steintreppen unter den Schuhsohlen spüren wollen und deshalb darauf verzichtet, den Aufzug zu benützen. Eine dunkle, seidenmatt glänzende Palisandertüre war mir aufgefallen. Nachdem ich den Klingelknopf unter dem geschwungenen Messingschild gedrückt hatte, sah ich nichts mehr. Doktor Morten war mir zur Tür entgegengekommen. Von dem Augenblick des Händedrucks an hatte ich zu atmen aufgehört. Jedenfalls glaube ich das jetzt. Erst als er das wegen der Eile sagte, wagte ich, den Blick wieder zu heben und ein wenig umherwandern zu lassen. Da war ein hohes Fenster hinter seinem Sessel. Man sah auf ein mit Leuchtreklamen verziertes Kino, grellrosa-gelbgrüne Streifenschlangen, die im Viereck wanderten, zwei unrasierte Heldengesichter beleuchteten und einen bluttriefenden Titel umrundeten. Dahinter lagen drei spitz zusammenlaufende Straßenzüge, Häuser von der Jahrhundertwende. Vor dem Fenster stand eine ausladende Grünpflanze, daneben eine unaufdringlich bestückte Bücherwand.
Sie haben einen weiten Weg auf sich genommen, bemerkte der Psychiater. Ich nickte.
Ich hatte das Gefühl, mein Leben nicht mehr auszuhalten, bevor ich Sie anrief. Aber gerade jetzt geht es mir wieder besser.
Haben Sie ein Zimmer? fragte Doktor Morten. Sie werden nun ja zwei Wochen lang täglich zu mir kommen. Vielleicht ruhen Sie sich zuerst einmal aus und verstauen anschließend alles, was Sie mitgebracht haben. Wir sehen uns also morgen.
Er war aufgestanden und hielt mir die Hand zum Abschied hin. Ich streckte meine ebenfalls aus, ergriff seine aber nicht, spürte seinen Händedruck, drehte mich um und ließ mir in den Mantel helfen. Noch ganz benommen stand ich dann wieder im Treppenhaus.
SCHEIDUNGSGRÜNDE
6. November
Heute ist der Himmel über der Stadt grau. Der Blick aus meinem Hotelzimmer fällt auf verschmutzte Häuserfassaden. Die Sitzung bei dem hageren Mann mit den samtigen Augen soll um fünfzehn Uhr zwanzig beginnen. Ich will Papier kaufen, eine Zeitung vielleicht, ein Päckchen Zigaretten, Fruchtsaft, ein Glas löslichen Kaffee. An der Rezeption haben sie mir gesagt, daß ich eine Schreibmaschine ausleihen könne.
Zuletzt habe ich noch einen Blumenstrauß erstanden. Der hat mich, als ich über den kleinen Markt lief, so sehr angelacht. Da steht er nun, wacklig und eingepfercht in meinem Zahnputzbecher. Später werde ich am Empfang um eine Vase bitten.
Die Kälte ist beißend. Die Hochnebellage drückt den Rauch von den Kaminen zu Boden. Deshalb bin ich rasch ins Hotelzimmer zurückgekehrt. Ich reiße die Papier-Packung auf und ziehe ein paar Blätter heraus. Beinahe gewohnheitsmäßig schreibe ich: Lieber Daniel, merke aber, daß ich keine Lust mehr habe, Briefe an Daniel zu komponieren. Seit ich den Entschluß gefaßt habe, Doktor Morten aufzusuchen, ist diese Lust, Daniel zu schreiben, verschwunden.
Daniel? Ich bin ja nicht zum ersten Mal in Wien. Ziemlich genau vor einem Jahr hatte Rolf mich zu seinem Schulfreund geschickt. Seifried hieß der, Doktor Horst Seifried. Damals hatte Rolf gefunden, ich sei komisch. Und hatte es auf hormonelle Umstellungen nach der Geburt geschoben, obwohl Vera bereits ein Jahr alt war. In Rolfs Augen war eine krankhaft enge Bindung zwischen ihr und mir entstanden. Er fand, daß ich mich ihm gegenüber zunehmend abweisend und aggressiv verhalte. Er ging davon aus, daß Horst mich wieder »hinkriegen« könnte. Damals hatte ich mich zum ersten Mal für mehrere Tage von meiner Tochter getrennt, was mir tatsächlich schwerfiel und Rolf in seiner Auffassung bestärkt hatte, daß das Problem bei mir lag.
Zuletzt freute ich mich darauf, für ein paar Tage alleine zu verreisen. Im Zug war ich Daniel begegnet und hatte ihm seither Briefe geschrieben.
Nein, jetzt schreibe ich nur auf, was mir tagsüber in den Sinn kommt oder aber nächtliche Träume. Und über Rolf will ich nachdenken. Seitdem wir hunderte von Kilometern getrennt sind, geht es mir besser. Aus der Entfernung kann ich durchaus seine sympathischen Seiten würdigen und ihn sogar nett finden. Was ist nur so unerträglich, wenn ich unter dem gleichen Dach mit ihm lebe?
Es gibt Momente, in denen ich Rolf hasse. Die Art, wie er atmet, treibt mich auf die Palme, geschweige denn die Bartstoppeln, die er grundsätzlich nie aus dem Waschbecken entfernt. Oder die Kuchenkrümel, die ich als Spuren seiner einsamen nächtlichen Zwischenmahlzeiten am nächsten Morgen bei der Frühstückszubereitung vorfinde. Aber sind das Scheidungsgründe?
Eine innere Stimme ist es, die mir einflüstert, ich müsse mich trennen. »Hilfe!« hat es mehrmals in mir geschrien. Das gemeinsame Leben fühlt sich trostlos an. Oder es hat einfach tausend Mal »Nein!« gesagt in mir, sehr entschieden. »So nicht! Nein!« Aber was eigentlich? Jedenfalls habe ich eines Tages diesem Psychiater geschrieben und gefragt, ob ich zu einigen Therapiesitzungen zu ihm kommen könne. Ich müsse diese Sitzungen en bloc haben, betonte ich, da ich Mutter einer kleinen Tochter sei und von weit her anreise. Ich war nicht einmal sehr überrascht, als einige Zeit später ein Antwortschreiben aus Wien eintraf, in dem mir mitgeteilt wurde, daß ich Anfang November für zwei Wochen nach Wien kommen und täglich eine Sitzung haben könne. Das war überaus einfach gegangen; plötzlich trennten mich nur noch drei Wochen Wartezeit von meinem ersten Sitzungstermin.
Als ich heute nachmittag die Messingklingel drückte, schien es mir, als kehre ich an einen vertrauten Ort zurück. Erst jetzt sah ich das Schild »Bitte eintreten und warten«. Ich drückte gegen die Tür. Doktor Morten kam mir entgegen und führte mich ins Behandlungszimmer.
Wie geht es Ihnen? fragte er, nachdem wir uns eine Weile lang gegenübergesessen und geschwiegen hatten.
Besser, antwortete ich und überlegte, was ich den Rest des Vormittags und über Mittag gemacht hatte. Im Nachdenken über Rolf war ich keinen Schritt weitergekommen.
Wie ich schon gestern sagte, fuhr ich deshalb fort, ich weiß nicht, ob ich mich trennen soll.
Der eisgraue Mann mir gegenüber nickte und fügte hinzu: Mögen Sie mir etwas von den Schwierigkeiten mitteilen, die Sie zu dieser Frage führen?
Da kommt mir als erstes unsere letzte gemeinsame Reise in den Sinn. Ich erzähle, daß es mir schon auf die Nerven ging, als Rolf am Vorabend erst gegen zehn aus dem Institut kam. Er erwartete dann, daß ich ihm nicht nur ein Abendessen hinstellte, sondern ihm auch noch beim Essen Gesellschaft leistete. Obwohl ich bereits müde war. Als ich die Küche aufgeräumt hatte und endlich schlafen gehen wollte, weil wir am nächsten Morgen wirklich sehr früh zum Zug mußten, hatte er natürlich noch nicht gepackt. Ich lag also bereits im Bett, da riß Rolf die Schlafzimmertür auf. Grelles Licht knallte auf meine geschlossenen Augenlider herunter. Rolf holte mit Schwung seinen Koffer vom Schrank, stellte ihn neben mich auf das gemeinsame Bett, öffnete die Kleiderschranktür und begann zu packen.
Plötzlich werde ich unsicher. Erzähle ich da nicht lauter Kleinigkeiten, vollkommen lächerliches Zeug? Das faltendurchfurchte Gesicht scheint aufmerksam zuzuhören. Also fahre ich fort.