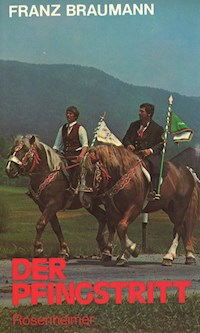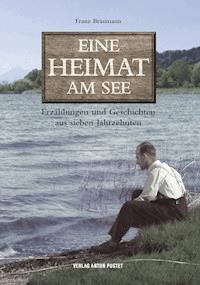
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Anton Pustet Salzburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franz Braumann war zu Lebzeiten einer der erfolgreichsten Salzburger Schriftsteller. Der Heimatdichter, Sagenerzähler, Jugendbuch- und Reiseschriftsteller hinterlässt ein umfangreiches Werk an veröffentlichten Büchern, Erzählungen, Artikeln und Berichten. Mit Literaturpreisen und Auszeichnungen im In- und Ausland wurde seine Bedeutung gewürdigt. Anlässlich seines 100. Geburtstages sind seine besten Erzählungen und Sagen in einem spannenden Lesebuch erschienen: Vom "Bauerndichter" über den begnadeten Sagen- und Märchenerzähler bis zum Romanschriftsteller, der modernen gesellschaftspolitischen Themen im Spannungsfeld zwischen Land und Stadt ebenso gerecht wird wie historischen Erzählungen und Biografien. Auch die Abenteuer aus aller Welt und Reisegeschichten sind in dem Sammelband aufgenommen, weiters Braumanns lyrisches Werk. Gedichte sind das verbindende Element zwischen diesen einzelnen literarischen Landschaften, als deren Herzstück freilich die Gegend rund um den Wallersee anzusprechen ist. Das Zuhause, das den Dichter geprägt und immer aufs Neue inspiriert hat, weit über die Jugend am See hinaus, als er längst den Reisenden und Fotografen in sich entdeckt hatte, der alle Kontinente der Erde besuchte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Braumann
EINE HEIMAT AM SEE
Erzählungen und Geschichtenaus sieben Jahrzehnten
Franz Braumann
EINE HEIMAT AM SEE
Erzählungen und Geschichtenaus sieben Jahrzehnten
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2010 Verlag Anton Pustet
5020 Salzburg, Bergstraße 12
Sämtliche Rechte vorbehalten
Herausgeber: Christoph Braumann
Lektorat: Gertraud Steiner
Layout & Satz: Tanja Kühnel
Druck: Druckerei Theiss, St. Stefan im Lavanttal
Gedruckt in Österreich
ISBN: 978-3-7025-8012-4
www.pustet.at
INHALTSVERZEICHNIS
Ein Bauerndichter und Meistererzähler aus Huttich am Wallersee
Franz Braumann (1910–2003) zum 100. GeburtstagVorwort des Herausgebers Christoph Braumann
1. Jugend am See
Chronik der Herkunft. Gedicht
Wie ein Bauernbub Dichter wurde
Der letzte Gulden
Wie ich den Vater kennenlernte
Meine erste Wallfahrt
Die Patenfahrt über den See
Am Himmel steht roter Morgenschein
Seltsame Heimfahrt auf den Äpfeln
Mein Gang um Weihnachtsfreude
Abschied von der Kindheit
Gefährlicher Frühling
Das Feuer der Entscheidung
Meine erste Dichterlesung
2. Ländliche Heimat
Ausblick. Gedicht
Als der Friedl davonlief
Gang durch die Nacht
Die Lawinenrinne
Der Abtrieb der Stiere
Die Nacht auf dem Eis
Das Jahr mit Christine
3. Sagen und Märchen
Das Märchen. Gedicht
Die Sage – eine Deutung
Die Wildfrauen in der Tiefsteinklamm
Der Birkenzweig als Spielmannslohn
Trink nicht allweil, iss auch Bröckerl!
Der Vieräugl auf der Frimlalm
Hüte Dich vor dem Rester!
Die Zwölflinge von Schloss Dorfheim
„Lösch die Lichtln aus!“, sagte Frau Percht
Der Lessacher Jäger und das Kasermandl
Der blühende Schneekirschbaum
Das Wolfskind
Die hölzernen Pantoffeln
Wie der Holzknecht mit dem Teufel gewettet hat
Hüte die Kindlein gut!
Das unheimliche Schloss
4. Historische Erzählungen
Dein fernes Bild. Gedicht
Der Keltenkrug vom Dürrnberg
Aus der Zeit um 500 v. Chr.
Der baierische Königstraum
Herzog Tassilo und die Awaren
Die erste Durchquerung Tibets
Pater Johannes Grueber, der Kundschafter des Papstes
Der große Versuch
Pater Antonius Sepp und die Jesuiten-Reduktionen in Paraguay
Gefährliche Entdeckungsreise
Der Ritt durch Australien
Alles schläft, einsam wacht …
Wie das Weihnachtslied „Stille Nacht“ entstand
Im Sturm des Lebens
Eine Erzählung um Friedrich Wilhelm Raiffeisen
5. Abenteuer in aller Welt
Vergebliche Flucht. Gedicht
Der Kampf mit dem Bären
Ein Jugendabenteuer auf der Großen Plaike
Die Pilgerfahrt nach Santiago
Das Gelübde des Hagerbauern vom Irrsberg
Die Smaragdhöhle
Eine Entdeckung in den Hohen Tauern
Der Marsch ins Unbekannte
Auf der Suche nach Professor Bergham im brasilianischen Urwald
Im Schloss des Trauco
Mythisches Bergland in Patagonien
Die Höhlen von Qumran
Khirbet Qumran am Toten Meer
Die Elche kommen
In den Wäldern von Saskatchewan River, Kanada
6. Reiseberichte
O, die Fernen! Gedicht
Zum Berg des Erzengels Michael
Österreich in Brasilien
7. Materialien
Der letzte Aufbruch. Gedicht
Hildemar Holl, Der Schriftsteller Franz Braumann
Zeittafel
Werkverzeichnis
Quellennachweis
Kurzbiografien
VORWORT
Ein Bauerndichter und Meistererzähler aus Huttich am Wallersee Franz Braumann (1910–2003) zum 100. Geburtstag
AM 2. DEZEMBER 2010 jährt sich zum hundertsten Mal der Geburtstag des Schriftstellers Franz Braumann. Wäre er nicht im Herbst 2003 bei der Ernte in seinem geliebten Köstendorfer Obstgarten von einem Baum gestürzt und an den Folgen dieses Unfalls verstorben, könnte er dieses Jubiläum noch erlebt haben.
Er zählte zweifellos zu den erfolgreichsten Schriftstellern Salzburgs im 20. Jahrhundert. Dass sein Werk sowohl in Österreich wie auch darüber hinaus gewürdigt wurde, beweisen die Verleihungen des Österreichischen Staatspreises für Jugendliteratur 1958, des Georg-Trakl-Preises für Lyrik 1967 sowie des Italienischen Jugendbuchpreises 1968. Er war literarisch immens produktiv. In den sieben Jahrzehnten seines Schaffens sind an die 100 Bücher erschienen – viele davon in mehreren Auflagen – manche erzielten Lizenzausgaben in verschiedenen Fremdsprachen und erreichten so eine Leserschaft weit über den deutschen Sprachraum hinaus. Dazu ergänzt sich eine fast unübersehbare Anzahl von Artikeln, Berichten und Essays für Zeitschriften, Kalender und sonstige Publikationen.
Das gibt Anlass zum Feiern und Erinnern, sollte aber auch Anstoß sein, dieses Lebenswerk mit einer Rückschau auf bedeutende Stationen und einer Sammlung seiner literarischen Höhepunkte neu zugänglich zu machen. Wie die richtige Auswahl an Texten treffen? – Angesichts des Umfangs und der Vielseitigkeit seiner Themen und Genres eine nicht ganz einfache Aufgabe. Leichter fiel indessen die Entscheidung, die Umsetzung dieses Lesebuches – eines „Best-of-Braumann“ nach heutiger Diktion – in die Hände des Anton Pustet Verlages zu legen. Im Haus in der Bergstraße 12 hat die literarische Karriere des jungen Flachgauer Bauerndichters 1931 begonnen und die Zusammenarbeit hat über die Jahrzehnte gehalten. Auch wenn nach und nach eine Reihe von Verlagen mit Manuskripten aus der Feder von Franz Braumann erfolgreich war. Genau genommen war es ja eine Zeigerschreibmaschine, auf der Franz Braumann in seinem Haus in Köstendorf seine Geschichten und Bücher eintippte. Unermüdlich und rastlos hat er den Horizont seines Recherchierens und Schreibens erweitert, beharrlich der Spur des Neuen, Unbekannten, noch Unerprobten folgend. Auf seiner Lebenssuche nach neuen Stoffen, Ideen, Sparten, Motiven ist der Schriftsteller Franz Braumann einen weiten Weg gegangen. Das vorliegende Buch soll das Wesentliche davon zusammenfassen und bewahren.
Franz Braumann (2. v. l.) mit seinen Eltern und Geschwistern
Wege zu Franz BraumannDer erste zielt – auf die literarische Entwicklung
1910 wurde er als zweites von sechs Kindern des Augerbauern in Huttich bei Seekirchen geboren. In seiner Jugend las er unersättlich alles, was sich an Büchern in der Umgebung auftreiben ließ und schon bald versuchte er sich selbst im Dichten und Schreiben. Mit kaum zwanzig Jahren brachte er es zum „Bauerndichter“ und fand in Karl Bacher, damals Obmann des „Reichsbundes deutscher Mundartdichter“ wegen seiner „ungewöhnlichen Strebsamkeit und Energie“ einen einflussreichen Förderer. 1932 erschien Franz Braumanns erster Roman, „Friedl und Vroni“, im Jahr darauf folgte der Gedichtband „Gesang über den Äckern“. Das Märchenbuch „Das Haus zu den vier Winden“ (1936) gewann ihm sogar die Baronin von Trapp als bewundernde Leserin. Es folgte im Fach des bäuerlichen Familienromans „Das schwere Jahr der Spaunbergerin“ (1938). Damit hatte er die Vielseitigkeit seiner Begabung wie auch seiner Interessen schon früh unter Beweis gestellt. Die Notzeiten der dreißiger Jahre und das Veröffentlichungsverbot nach dem Anschluss an Hitlerdeutschland setzten seinem Schaffen freilich vorerst enge Grenzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da war er bereits Volksschuldirektor in Köstendorf, wandte er sich dezidiert der Sparte des Jugendbuches zu. Indem er spannend zu erzählen wusste und dabei auch den richtigen Ton traf, wurden „El Trauco, der Berggeist“ (1953), „Gold in der Taiga“ (1957) oder „Die schwarzen Wasser von Anahim“ (1962) zu Erfolgstiteln auf dem damals noch überschaubaren Buchmarkt.
Franz Braumann war ein erklärter Freund der Geschichte und des Reisens, und als Schriftsteller hat er es immer wieder verstanden, beides zu verbinden. Er bearbeitete den Reisebericht des österreichischen Jesuiten Johannes Grueber, der als erster Europäer im 17. Jahrhundert Tibet bereiste. Daraus entstand „Ritt nach Barantola“ (1958). Es folgten „Die Blutsbrüder“ (1958), der Lebensroman des Hl. Wolfgang „Die tausendjährige Spur“ (1966) und „Unternehmen Paraguay“ (1967) über die Umsetzung der Gemeinschaftsutopie der Jesuiten. Ein echter „Welterfolg“ glückte ihm 1959 mit „Ein Mann bezwingt die Not“, einer Biografie über Friedrich Wilhelm Raiffeisen, den Begründer der bäuerlichen Genossenschaftsbewegung. Das Buch stieß auf sensationelles Interesse, es wurde weltweit in mehr als einem Dutzend Sprachen, selbst in Japanisch und in Suaheli veröffentlicht. Die gründliche historische Recherche – eine besondere Stärke von Franz Braumann – zeichnete übrigens auch seine Biographie „Leben und Dichtung“ (1973) über Franz Stelzhamer aus.
Bei der Feldarbeit
Der junge Dichter vor seinem Elternhaus in Huttich um 1930
Auch die Romane „Das Jahr mit Christine (1953), „Die heimliche Brautschau“ (1960) und „Wiedersehen mit Johanna“ (1967) trugen zu seiner steigenden Bekanntheit bei. Dies gilt genauso für seine zahlreichen Bücher mit Sagen und Volksmärchen, an deren Beginn die „Sagenreise durch Oberösterreich“ (1966) stand und die mit der „Sagenreise durch Europa“ (1981) ihren geografischen Radius ausschöpfte.
In seinen späteren Lebensjahren entwickelte sich Franz Braumann schließlich zum Reiseschriftsteller mit Berichten und Erzählungen aus allen Erdteilen. Sein besonderes Interesse galt den Leistungen von Österreichern und Deutschen in aller Welt, und er besuchte mehrmals Gründungen von Tiroler Auswanderern in Südamerika wie Dreizehnlinden (Treze Tílias) in Brasilien. Wie sehr er dennoch seinen bäuerlichen Wurzeln die Treue hielt, illustriert im Übrigen die Tatsache, dass er im „Salzburger Bauernkalender“ – unterbrochen nur durch die Zeit des Zweiten Weltkrieges – bis 2003 so gut wie jedes Jahr einen oder mehrere Beiträge veröffentlichte, darunter spannende Erzählungen und Sagen, aber auch landwirtschaftliche Fachartikel.
Der zweite führt – zur Persönlichkeit Franz Braumann
Behinderndes zu überwinden und auch unter persönlichen Risiken Neues zu beginnen, diese Fähigkeit hat den Menschen Franz Braumann in hohem Maß ausgezeichnet, ihn von Jugend auf geprägt. Sein tief empfundener christlicher Glaube verlieh ihm dabei Kraft und Zuversicht. Den ersten Lohn als Zimmermannslehrling investierte er in einen Fernkurs für Deutsch und nach den ersten literarischen Erfolgen absolvierte er – neben fünfzehn Jahre alten Mitschülern – die Lehrerbildungsakademie. Sowie er seine erste Anstellung als Junglehrer erhalten hatte, heiratete er, ohne jede finanzielle Absicherung, am Heiligen Abend 1936 seine große Liebe Rosa Goldberger. Dieser Ehe entsprossen in den folgenden Jahren fünf Kinder. Ende 1945 wurden ihm als politisch Unbescholtenem mehrere Schuldirektorenstellen angeboten. Im Interesse seines schriftstellerischen Schaffens entschied er sich nicht für eine städtische Schule, sondern für die kleine Volksschule im ruhigen Köstendorf, einer Nachbargemeinde von Seekirchen, die er in den folgenden Jahren mit viel Engagement leitete.
Ein altes, während des Krieges ausgebrochenes Leiden zwang ihn allerdings dazu, bereits im Alter von 50 Jahren seinen Abschied aus dem Schuldienst zu nehmen. Diesen Einschnitt nutzte Franz Braumann für seinen schriftstellerischen Aufschwung – über die Hälfte seiner Bücher entstand in den Jahren nach 1960. Als öffentliche Anerkennung für seine kulturellen Verdienste verlieh ihm der Bundespräsident 1963 den Professorentitel. Neben dem Schreiben widmete er die gewonnene Zeit noch einer zweiten Leidenschaft – dem Reisen zusammen mit seiner Gattin Rosa. Die damit verbundenen Eindrücke und Anregungen brachten wichtige Impulse für seine schriftstellerische Arbeit.
Der dritte ergibt sich – aus seinen Flachgauer Wurzeln
Die bronzezeitlichen Hügelgräber am Fuß des Tannberges und die Reste altrömischer Gutshöfe bei Pfongau und die Zelle des Heiligen Rupert aus dem 7. Jahrhundert in Seekirchen am Wallersee geben Zeugnis von der Jahrtausende alten Besiedelung und kulturellen Bedeutung dieser Region. Die Ruine der mittelalterlichen Burg Lichtentann bei Henndorf kündet noch heute von der Herrschaft des Geschlechts der Tanner, die im 11. Jahrhundert zu den einflussreichsten weltlichen Würdenträgern des Erzbistums Salzburg zählten. Auch die planmäßige Gründung des Marktortes Neumarkt im 13. Jahrhundert östlich des Wallersees an der wichtigen Verbindungsstraße vom Erzbistum Salzburg nach Oberösterreich weist auf die historische Bedeutung der Region hin. Die 1860 fertig gestellte Kaiserin-Elisabeth-Westbahn von Wien nach Salzburg öffnete das Gebiet um den Wallersee der weiten Welt. Der Bahnbau brachte auch den Großvater von Franz Braumann, einen Fuhrwerksunternehmer aus dem Innviertel, nach Seekirchen, wo er in Huttich zwei Bauerngüter für seine Söhne erwarb.
Die Landschaft um den Wallersee entwickelte sich in der Folge zu einer „Literaturlandschaft“: Franz Stelzhamer verbrachte in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts seinen Lebensabend in Henndorf; nur wenige Jahre danach wurde dort Johannes Freumbichler geboren. Karl Zuckmayer lebte in der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg zwölf Jahre in der Wiesmühl in Henndorf, Freumbichlers Enkel Thomas Bernhard verbrachte zur selben Zeit Kindheitsjahre in Seekirchen. Erweitert man den Blick auf das ganze Salzburger Seengebiet, spannt sich der Bogen bis zum Büchner-Preisträger Walter Kappacher, der in Obertrum lebt. In diese „Literaturlandschaft“ um den Wallersee hineingeboren wurde auch Franz Braumann, und sie bildete den Bezugsraum für viele seiner Werke. Lassen wir daher Franz Braumann selbst zu Wort kommen, ihn den Wallersee und seine tiefe Wirkung auf ihn beschreiben:
Die Familie Braumann vor ihrem Hof 1924. Das Ehepaar Maria und Paul Braumann mit den Söhnen (v. l.) Paul, Felix und Franz sowie den beiden kleinen Töchtern, zu denen sich noch eine Nachzüglerin einstellen wird.
Eine Heimat am See
„Wer aber von Geburt an schon am Wallersee aufgewachsen ist, für den erwächst der See in seinem jahreszeitlichen Wechsel, in seinen duftigen Frühnebelmorgen und den leuchtenden Sonnenuntergängen zu einem viel tiefer formenden Erleben heran.
Wenn ich als junger Schulbub meinen stundenweiten Schulweg im Winter auf dem spiegelblanken Eis des Sees jauchzend auf Schlittschuhen bis nach Seekirchen hinein durchglitt, erlebte ich schon als Kind die Faszination, die der Sport dem Menschen schenkt. Aber auch die Gefahren des Sees wirkten schon damals tief und in manchem Erlebnis unauslöschbar in das junge Gemüt hinab. Da diente beim Nachbarn eine junge Magd, die ich als ein gerade der Schule entwachsener Bub immer von ferne heimlich verehrt hatte. An einem Wintertag ging sie mit dem Knecht und dem Sohn des Nachbarn über den See auf Holzarbeit zur Großen Plaike, wo der Nachbar Brennholz schlägerte. Dichter Nebel deckte den See, als die drei jungen Menschen noch in tiefer Morgendunkelheit das Eis betraten, das an den Bachmündungen noch gefährlich dünn war. Sie mussten auf dem blanken, schneelosen Eis die Orientierung verloren und zu sehr gegen eine Bachmündung hin abgekommen sein. Plötzlich knisterte der schwarze Eisspiegel, und alle Drei sanken zwischen dünnen Eissplittern ins Wasser hinab. Wir hörten im Dorf die Hilferufe und rannten keuchend an den See. Wir schoben vor uns her Bretter über das dünne Eis und konnten Sohn und Knecht retten. Die junge Magd aber muss nach dem Versinken im Wiederauftauchen an die noch feste Eisdecke gestoßen sein. Am Morgen ruderten wir mit einer Zille aus dem noch offenen Wasser zur Einbruchstelle und fanden die Ertrunkene bald mit der großen Tiefangel. Doch den Anblick, wie die junge Magd heraufglitt und wir sie, mit noch rosigem Gesicht, als schliefe sie nur, auf das Ufer hinlegten, kann ich nicht vergessen, und wenn ich hundert Jahre alt würde.
Aber das Leben ging weiter. Ich mähte am gerade erst andämmernden Maimorgen das junge Gras für die Kühe und sah die Birkhähne, die es damals noch reichlich im Moor gab, ihre balzenden Reigen um die Hennen tanzen. In den Herbsttagen saß ich als junger Hüter der Kühe des Vaters am hohen, rauschenden Schilf und las mit heißem Gesicht, so tief in einen aufregenden Ritterroman hineingebannt, dass ich erst aufblickte, als die durstigen Rinder schon weit durch das Schilf in den See hinaus gerannt waren. Damals erlebte ich wohl die größte Angst meines Lebens, weil ich meine Schutzbefohlenen schon eine nach der andern im tiefen See versinken und ertrinken sah.“
Diese in Kindertagen gewachsene Verwurzelung in der heimischen Landschaft sollte Zeit seines Lebens Grundlage und Ausgangspunkt für sein Schaffen sein. Ausgehend von der Jugend am See und den ersten Romanen aus der bäuerlichen Lebenswelt prägte die Verbundenheit mit der Heimat auch seine spannenden Jugend- und Abenteuerromane, selbst wenn sie auf fremden Kontinenten handeln. Auch die Faszinationskraft von Sagen und Märchen zog ihn zuerst in seiner engeren Heimat in den Bann. In der Folge erweiterte er dieses literarische Thema auf ganz Österreich und darüber hinaus. Wenn Franz Braumann schließlich in einem Vorwort zu seinen Reiseberichten meint: „Doch wer das Fernweh liebt, dem ist auch das Heimweh nicht fremd“, so klingt daraus unmissverständlich sein tiefinnerer Heimatbezug.
Vor dem Hintergrund dieser drei Zugänge zum Werk von Franz Braumann entstand die Auswahl der folgenden Erzählungen. Diese wurden zum Teil in Zeitschriften und Kalendern abgedruckt, zum Teil sind sie Buchveröffentlichungen entnommen. Der Verlag Anton Pustet öffnete dafür seine literarischen „Schatzkammern“, und eine Reihe weiterer Verlage gaben ihre freundliche Zustimmung für Abdrucke von Erzählungen und Auszügen aus Büchern, wofür hier herzlich gedankt werden soll!
Dieser Sammelband soll gleichauf die schriftstellerische wie die persönliche Entwicklung von Franz Braumann nachzeichnen und dabei sein breites Werk in einer thematischen Gliederung komprimieren. Der Bogen der ausgewählten Erzählungen reicht von den Jugenderzählungen aus der ländlichen Heimat bis zu seinen Sagen und Märchen, und spannt sich weiter über historische Erzählungen und spannende Abenteuer aus aller Welt bis zu den Reiseberichten.
Selbstredend lässt sich das Lebenswerk eines Schriftstellers nicht so einfach in systematische Kategorien zwängen, umso weniger bei der inhaltlichen Fülle und thematischen Breite eines Franz Braumann. Es ist daher unvermeidlich, dass diese Sammlung ausschnitthaft und subjektiv ist, und letztlich geprägt von den Vorlieben des Herausgebers.
Gewidmet ist dieses Buch meiner Mutter Rosa Braumann, von der die ursprüngliche Idee dafür stammte, und die mit Unterlagen und Anregungen bis zu ihrem letzten Lebenstag maßgeblich zu seinem Entstehen beigetragen hat!
Christoph Braumann
1
JUGEND AM SEE
Wie ein Bauernbub Dichter wurde
Der letzte Gulden
Wie ich den Vater kennenlernte
Meine erste Wallfahrt
Die Patenfahrt über den See
Am Himmel steht roter Morgenschein
Seltsame Heimfahrt auf den Äpfeln
Mein Gang um Weihnachtsfreude
Abschied von der Kindheit
Gefährlicher Frühling
Das Feuer der Entscheidung
Meine erste Dichterlesung
CHRONIK DER HERKUNFT
Den ersten Schritt umschlangen frohe Hügel.
In Kinderhand fiel Korn aus prallen Ähren.
Der Sonnenvogel nahm mich auf die Flügel;
hochbordig warteten am Rand die Fähren,
mich knarrend durch den Strom der Welt zu steuern,
der auch die Ufer meiner Kindheit säumte.
Ich stand ergriffen vor den Sonnwendfeuern,
sah, wie die Flamm’ erlöst zum Himmel träumte.
Die Sterne hingen hoch – die Menschen schwiegen.
Ich biss in hartes Brot und sah nur Steine.
Ich fand mich weinend wo im Grase liegen;
und Pan saß flötend auf dem Distelraine.
Die Straße wand sich mühsam in die Weiten.
Der Himmel spiegelte sich blau im Weiher.
Heut karr’ ich selber auf der Straße. – Doch zu Zeiten,
da folgt mein Aug’ dem weißen Flug der Reiher.
WIE EIN BAUERNBUB DICHTER WURDE
IN HUTTICH, EINEM kleinen Dorf an der Ostgrenze der Gemeinde Seekirchen, wurde ich geboren. Der Markt liegt ungefähr in der Mitte der großen Landgemeinde. Markt und Land wurden damals noch von zwei Bürgermeistern mitsamt je einem Gemeinderat geleitet. Diese Doppelgemeinde besaß eine gemeinsame Volksschule, zu der eine einklassige Nebenschule in Edt-Mödlham am Fuße des Haunsberges sich im großen Gemeindegebiet anschloss.
Geboren wurde ich als zweites von sechs Kindern am 3. Dezember 1910. Allerdings gab es eine Ungewissheit meines Geburtsdatums, die bis zum heutigen Tag nicht eindeutig gelöst ist. Meine Mutter ließ ihr Leben lang von der Feststellung nicht ab, dass ich am 3. Dezember um drei viertel eins in der Früh auf die Welt gekommen sei. Sie hatte noch am Tag zuvor ihre Weckeruhr nach der alten silbernen Taschenuhr des Vaters eingestellt, und deren Vergleichsmaß war seit Jahren die Turmuhr der Kirche im Markt.
Doch als mich mein Vater beim Schuleintritt in die Matrik eintragen ließ, die ihre Daten aus dem Gemeindeamt erhielt, schrieb mich die Lehrerin als am 2. Dezember 1910 geboren ein! Der Vater schüttelte dazu den Kopf. „Das muss doch die Kindsmutter am besten wissen!“ Aber die eintragende Lehrerin lächelte nur. „Wir dürfen nur das amtliche Geburtsdatum von der Gemeinde eintragen!“ Und zum Kopfschütteln des Vaters sagte sie: „Eure Bauernuhr ist sicher wie üblich um eine halbe Stunde vorausgegangen, und so war’s bei euch der 3. Dezember um Viertel nach zwölf!“ Und wie es immer geht: Dem Amt wurde Recht gegeben. So blieb ich bis zum heutigen Tag um einen Tag älter, als ich wirklich bin. Was wird man einst im Jenseits dazu sagen, wenn ich dort zur falschen Zeit anrücke?
Die Volksschule verließ ich – es ist fast eine Angeberei – mit lauter Einsern im Zeugnis. Allerdings war’s im Schönschreiben ein geschenkter Einser. Danach absolvierte ich auch noch zwei Winterhalbjahre an der Landwirtschaftsschule, denn es stand immer noch das Ziel vor mir, in späteren Jahren auch selber einmal ein Bauer zu werden. Allerdings war dies nicht auf dem elterlichen Gut möglich, denn nach einer alten bäuerlichen Ordnung war es allgemein so üblich, dass der älteste Sohn einmal das Erbe übernehmen sollte. Vielleicht aber traf es sich einmal nach Jahren so, dass anderswo wegen des Fehlens eines Sohnes eine weibliche Hoferbin in der näheren oder ferneren Nachbarschaft einen Besitz übernahm, die dazu auch einen rechtschaffenen Bauern brauchen konnte.
Wie hoch allerdings die Chancen für einen solchen Glücksfall waren, das musste wohl erst die Zukunft erweisen.
Nun besaß der Vater drei kräftige Söhne auf dem über zweihundert Jahre alten Bauernhof, der noch ganz von Grund auf aus Holz erbaut war, mit einem sehr flachen Dachstuhl, der mit Holzschindeln eingedeckt war. Bei unheilvollen Wettern geschah es, dass die schweren Sommergewitter mit Stürmen die Regenfluten stauten, sodass das Wasser nicht rasch genug ablaufen konnte und auf die Heustöcke oder gar bis in die oberen Kammern tropfte. Ein steilerer Dachstuhl war für unser Haus am notwendigsten.
Zum Glück besaßen wir ein paar Joch schlagbaren Waldes, aus dem wir die Trambalken für den Dachstuhl und neue Holzschindeln herausfällen konnten. Damals war es auch noch ein alter Bauernbrauch, dass jeder Nachbar weitum einen gefällten Blochstamm spendete und auch einen Knecht mehrere Tage lang auf Robotarbeit sandte.
Wochenlang fällten wir zwei Söhne mit unserem Vater selber im Wald das notwendige Bauholz. Viele eiskalte Winterwochen lang fuhren und streiften wir die Stehsäulen und Dachtrambalken zum Sägewerk und danach das geschnittene Holz auf den Bauplatz. Mein Bruder hatte dabei gut lachen – er war gegen die Kälte so unempfindlich, dass er kaum einmal Handfäustlinge brauchte. Mir aber nützten nicht einmal die Fäustlinge – und oft trieb es mir, ohne dass ich’s verhindern konnte, vor Fingerfrieren das Wasser in die Augen.
Doch auch dieser kalte Winter ging vorbei. Einmal lief ich direkt in die Falllinie eines gefällten Blochbaums – doch dieser verfing sich an einem stehenden Stamm. Ich konnte aus dem sausenden Geäst herauskriechen – kaum mit ein paar Kratzern im Gesicht.
Der Vater war leichenblass, als er mich lebend wiedersah. Er atmete tief auf, als er mich gesund herauszog. Er machte nicht viel Worte dabei und brummte nur: „Du wirst noch einmal recht alt werden, weil du einen so guten Schutzengel geschenkt gekriegt hast!“ Bei unseren Bauersleuten galt zu meiner Jugendzeit die feste Auffassung, dass jeder Mensch bei der Geburt seinen Schutzengel bekomme, der ihn sein ganzes Leben lang bis zum Tode begleite und schirme.
In meiner Jugendzeit – mit 16 oder 17 Jahren – fiel in mein unbelastetes Dahinleben eine neue Unruhe hinein. Als ich mir in den ersten Volksschuljahren auch die Kunst des Lesens errungen hatte, fing für mich eine neue Leidenschaft an. Ich konnte seither kein Buch – war es nur ein Kalender oder ein altes Geschichtenbuch – auch nur sehen, ohne dass dieses mich nicht auch gleich wie magisch anzog. Von einem alten, belesenen „Viertelmann“, einem Auszugbauer, erfuhr ich, dass es im nahen Neumarkt eine Pfarrbibliothek gebe. Schon am nächsten Sonntag stand ich vor dem Pfarrhof unter ein paar anderen „belesenen“ Leuten.
Es wurde eine der tiefsten Erschütterungen meiner Jugend, in einem einzigen Raum Hunderte von Büchern zu entdecken, die sich mir darboten, gelesen zu werden. Ich lieh mir aus, was ich tragen konnte. In den kommenden Wochen ging ich nur noch wie ein Träumender meinen Arbeiten nach. Bald hieß ich in der Nachbarschaft nur noch „Der Lesenarr“.
Doch nicht alle meine Nachbarn sahen diese meine neue Leidenschaft gern. Eine ältere Nachbarin, die in einer angrenzenden Wiese ihre Kleinhäusler-Kühe hütete, sagte am nächsten Sonntag beim Kirchgang zu meinem Vater: „Sogar beim Hüten tut dein Bub nichts anderes als lesen! Wenn ich da was zu reden hätte, ich würde ihm das Büchel um die Ohren schlagen!“
Damals dachte wohl mancher unserer Nachbarn still bei sich: „Aus dem Auger Franzl wird wohl auch einmal nichts Gescheites werden bei seiner Leserei! Wohl halt ein so traumhappiger Mensch.“
Nichts Rechtes werden! – Das lag damals als Drohung von manchen Seiten der Dörfler über mir. Und diese trübe Zukunfts-Prophetie besaß ja eine gewisse Berechtigung: Ich kannte auch kein größeres Wissen, als es die Volksschule vermittelte. Wohl auch noch einige Fachkurse, die jedoch noch lange nicht für einen echten Beruf ausreichten – etwa als Zimmermann oder Maurer. Und zu meinem Unglück war ich auch nicht als Erbe eines Bauernhofes geboren worden. Vor mir lag damals nur die trübe Zukunft, mein Leben lang ein dienender Knecht bleiben zu müssen.
Nur heimlich, ganz für mich allein, hatte ich etwas Neues angefangen: Ich „dichtete“, das heißt, ich schrieb Verse und Geschichten. Und hier stellte sich – für mich selber ganz unerwartet – sogleich ein Erfolg ein: Meine Geschichten, aber auch die Verse wurden in einer Monatsschrift gedruckt!
Noch jetzt, nach einem ganzen, langen Menschenleben erinnere ich mich der inneren Erschütterung, als das erste gedruckte Gedicht vor mir lag:
Wohin lenkte dieser Anruf aus meinem innersten Daseinsgefühl auf einmal mein Leben? Versank ich damit noch tiefer ins Spinntisieren hinein – oder hatte ein seelischer Funken in mir ein geistiges inneres Licht entzündet, das von jetzt an mein ganzes Leben lang nie mehr erlöschen würde?
In den nächsten Tagen meines äußeren Lebens aber änderte sich kaum etwas um mich herum.
Der Vater redete am anderen Morgen mit dem Zimmermeister eines nahen Marktes: „Kannst du nicht wieder einmal einen Zimmermann brauchen? Ich schicke dir unseren Franzl gleich jetzt über den Winter in die Lehre! Er ist gesund und stark genug und versteht es auch sicher bald, was er als Zimmermann alles lernen muss!“
Ich stand in dieser Stunde neben dem Vater, aber mich verlockte das Angebot, jetzt ernsthaft in eine Handwerkslehre einzutreten, viel weniger. Ich kannte einige Zimmerleute von unserem neuen Dachstuhlbau als starke, im Reden und Handeln kurz angebundene Kerle. Diese waren von ihrer harten und schweren Arbeit meistens auch im Reden schroff und kantig geworden. Damals hatte ich ja bei unserem Dachstuhlbau mit ihnen wochenlang die härtesten und gröbsten Arbeiten getan.
Der Zimmermeister nickte meinem Vater zu: „Wenn dein Bub gern dabei ist, kann er gleich morgen bei mir als Zimmerlehrling anfangen!“
Vor einer Woche gerade war im härtesten Winter ein Bauernhaus abgebrannt, und so schnell wie möglich musste über den brandverrußten Hausmauern ein neuer Dachstuhl aufgestellt werden.
So stand ich schon am nächsten Morgen in dicken Handschuhen und frierend auf der Brandstätte. Keiner der anderen Zimmergesellen aber trug auch Fäustlinge an den Händen.
Einer der Zimmerer spottete auch gleich: „Wie willst du denn mit großen Fäustlingen bei einer richtigen Arbeit zugreifen? Wenn du nur fingerwarme Arbeiten verträgst, hättest du eine Hebamme werden sollen!“ Und alle Gesellen um mich lachten schallend. Betroffen und stumm tat ich meine Fäustlinge weg – doch nach einer halben Stunde hatte ich das Gefühl, alle meine Finger wären schon erfroren. Dabei wehte der Ostwind hohe Schneewehen auf, und es fing ganz dicht und dunkel zu schneien an. Ich war am frühen Morgen noch auf trockenen, eisigen Straßen mit meinem Fahrrad angekommen. Als der erste Arbeitstag spät in der wehenden Dunkelheit zu Ende war, musste ich am Abend noch mit dem Rad schiebend fast zwei Stunden weit bis zum Elternhaus heimgehen.
Aller anfängliche Mut zu diesem neuen Lebensanfang hatte mich verlassen. „Ich geh’ morgen früh nimmer zu den Zimmerleuten!“, sagte ich verbittert und unglücklich zum Vater. Ich erwartete ungewiss, was nun auf mich zukommen würde. Mein Vater war nie ein jähzorniger Mensch gewesen und in unserer Familie hatte immer ein guter Hausfriede geherrscht. Auf diesen baute ich zaghaft auch jetzt.
Darauf schaute mich der Vater eine Weile wortlos an. Auch die Mutter wartete furchtsam, was nun geschehen würde. Eine Weile schwieg der Vater. Und darauf brummte er nur – wohl ein wenig unwirsch: „Das musst du jetzt selber wissen, was du verträgst! Das Händefrieren hast du ja von deiner Mutter geerbt!“
Und meine Lehrzeit als Zimmermann war mit dieser Stunde auch schon wieder zu Ende.
Gleich am nächsten Tag schnitt ich wieder dickes Eis auf dem See. Und als diese Arbeit zu Ende gebracht war, schaffte ich ein paar Wochen lang mit dem Bruder aus dem Grafenwald heraus einen halben Wald gefällter Blochstämme als Lohnarbeit an die große Dampfsäge in Seekirchen. Die Arbeit war schwer, aber sie brachte uns einen guten Taglohn ein.
Und was geschah mit meiner Dichterei? Ich hatte in den Wintermonaten, während die Winterstürme um unser Haus tobten und unser kleines Dorf von Schneewächten eingeschlossen war, sodass wir kaum eine Arbeit im Freien tun konnten, meinen ersten Roman geschrieben, von dem ich beim Beginn noch gar nicht wusste, wie er enden würde. Immer wieder war eine neue Handlung dazugewachsen, die ich aus meinem seelischen Innern heraus wohlgefällig und glücklich zur Kenntnis nahm, immer in der Hoffnung, es werde sich zuletzt auch noch das „stimmige“ Ende einfinden.
Mein erstes, ein paar hundert Heftseiten langes Romanwerk schrieb ich in jenem Winter auch tatsächlich zu Ende. Ich starrte auf die eng beschriebenen Seiten, denn eine Schreibmaschine hatte ich damals noch nicht. Wie würde mein erster Leser darüber urteilen?
Ich besaß wohl bereits einige Lesefreunde – ehrlich gesprochen waren es mehr Freundinnen meiner Geschichten, aber ein Roman war wohl eine viel anspruchsvollere Dichterleistung! So wenigstens schien es mir damals wegen des gewaltigen Umfangs. Mir war, als stiege eine neue Welt vor mir herauf. Dichten können, das musste das höchste Ziel für mich werden! Tagelang ging ich wie in einem neuen Dasein herum – als hätte sich vor mir ein Tor aufgetan, durch das ich dann hindurchgehen müsste, wenn ich einem noch gar nicht für mich deutbaren inneren Befehl folgte – wie eine neue, für mich noch nicht erfahrene Daseinswelt!
Der Verlag Tyrolia hatte bereits in seinen Kalendern manche Geschichte von mir gedruckt, vielleicht druckt er auch meinen ersten vollen Roman als Buch? Lange hörte ich nichts und wähnte mich nach Wochen des Schweigens dort schon vergessen, doch da tauchte gegen Ende des Winters ein städtischer Herr in unserem Dorf auf, trat in unser Bauernhaus und fragte: „Wo ist jetzt der Dichter?“
Überrascht trat ich vor den Fremden hin. „Meinen Sie mich?“, fragte ich mit einem roten Gesicht.
Es war der Generaldirektor des Innsbrucker Verlages, der nach der Lesung meines Romans entschieden hatte: „Diesen jungen Dichter schau ich mir an, aus welcher Wurzel er gewachsen ist!“ – Ja, es sei daran wohl noch manches zu glätten, erklärte er. „Aber diese Geschichte werden wir bis Weihnachten in alle Buchläden liefern können.“
Mir schwindelte und es kam mir vor, als hätte sich vor mir eine Tür in die Welt aufgetan. Ein Buch – und ich der Dichter!
Es kam alles wie geplant. Zu Weihnachten hatte ich mein erstes Buch, den Roman „Friedl und Vroni“ in den Händen.
DER LETZTE GULDEN
STEHT ES NOCH dafür, heute eine Geschichte zu erzählen, die sich vor – sagen wir es rund überschlagen, ja, vor drei Generationen zugetragen hat? Vielleicht mag sie mir etwas bedeuten, weil es mein Großvater war, der sie erlebte. Und das alles wegen eines Guldens, der allerdings als letzter viel mehr wog als nur irgendeiner von vielen Gulden, – der sozusagen Leben oder Tod auf seinem Wappen trug! So lebendig und nah der Großvater vor uns Kindern stand, so wirkte er doch in einem geheimen Sinn schon damals wie eine sagenhafte Gestalt. Er lebte in einem eigenen Haus und kam selten zu uns, weil er den Handel mit Wein und Rossen noch immer nicht aufgegeben hatte, obwohl ihn keine Not dazu trieb. Die Not des Großvaters, die lag weit zurück. Aus den Andeutungen des Vaters wussten wir, dass er diese einmal hautnah und bitter gespürt haben muss; aber zwischen damals und heute lag sein großer Fuhrbetrieb mit zwölf Paar Rossen, stand der Erwerb der zwei prächtigen Bauernhöfe, auf dessen einem mein Vater und auf dessen anderem der Bruder meines Vaters saß.
Nun ruht der Ahn’ Jahrzehnte schon drüben; er ist noch tiefer hinter die Schatten getreten, die irgendwie bereits damals um ihn warteten, als wir Kinder ihn zärtlich und furchtsam verehrten. Doch am unvergänglichsten in meiner Vorstellung von ihm ist der Bericht, in dem ein Gulden, der letzte, die Entscheidung seines Lebens herausforderte. Die Worte des Großvaters liegen unverwandelbar in meinem Ohr, – er soll diese Geschichte darum auch selber noch einmal erzählen. Es sind seine Worte:
Das wisst ihr schon, Buben, dass eure Vorfahren von der Vaterseite her seit Generationen Brunnenmacher gewesen sind. Ich hab in meiner Jugend auch diesen Beruf gelernt. Ich habe Brunnen gegraben, fünfzig, achtzig, hundert Fuß tief, – eine schöne, aber eine gefährliche Arbeit. Einmal ist der Sand in der Brunnenwand neben mir lebendig geworden. Wie Wasser ist er über mir zusammengeschlagen. Gott steh’ mir bei! Ich hab das Kreuz über mich gemacht und den Tod erwartet. Er ist neben mir gestanden, – nur ein paar Atemzüge weit, die mir als letzte Frist für Reu’ und Leid geschenkt gewesen sind. Aber bevor das Bewusstsein weg ist, quillt unter dem fließenden Sand ein dicker Sturzbach Wasser herauf und trägt mich im Brunnenschacht empor. Ein Strick von dem herab baumelnden Erdkübel schlägt mir ins Gesicht – und was keiner der bleichen Männer oben auf der taghellen Erde erwartet hat, geschieht mit mir: Ich stehe über dem eingestürzten Schacht noch lebend unter ihnen!
Eure Urgroßmutter ist schuld gewesen, Buben, dass ich dann das Brunnengraben aufgegeben habe. Aber was fängt ein junger, starker Mann mit bald dreißig Jahren an? Die Arbeit im großen Kobernaußerwald hat mir gefallen; ich bin Holzknecht geworden. Was wisst ihr Buben, wie es zu diesen Zeiten gewesen ist: Arbeit von der Taghelle bis zum Einnachten und zwei Gulden Lohn die Woche! Und wenn du zehn Jahre lang sparst, es langt doch nicht zu einem eigenen Haus mit Kartoffelacker und Wiesenland für drei Kühe! Sei froh, dass du zu arbeiten hast und nicht hungern musst, sei nur froh! So hat es geheißen. Einmal, mitten im Winter, bin ich wenig froh am Abend in der „Schenke zur Hinteren Reihe“ gesessen – heute ist lang schon die große Glasfabrik über das alte Wirtshaus hinweggewachsen. Aber zu dieser Zeit sind nur etliche Arbeiter von der Glashütte mit ihren verrußten Gesichtern dagesessen und an dem breiten Tisch unterm Herrgottswinkel zwischen ein paar hartledernen Bauern der grölende Glasfuhrwerker aus Friedburg. Es hat noch keine Bahn in den Wald herein gegeben; der Quarzsand hat viele Stunden weit von einer fernen Bahnstation hereingefuhrwerkt werden müssen. Der Glasfuhrwerker Reininghans ist zum Anfang mit zwölf Paar Rossen gefahren, aber er ist ein Prahlhans und Saufbold geworden bei diesem Beruf – und jetzt ist er mit dem letzten Paar schwarzer Rappen noch mit Sand zur Glashütte und mit Glas zur Bahn hinaus gefahren, im Sommer mit dem Wagen, im Winter mit dem langen, schweren Schlitten, der Schlaipfe.
„He, noch dageblieben!“, krächzt auf einmal der Reininghans in das halblaute Gemurmel der wenigen Gäste. Aber die Bauern neben ihm haben sich schon erhoben. „Was sollen wir noch weiterspielen, Reininghans!“, lacht einer der Bauern hart. „Du hast kein Geld mehr!“ Die Spielkarten liegen noch verstreut auf dem Tisch, als die Bauern ihre Rockkragen aufstellen und hinaus in die eisig stürmende Winternacht fahren. Keiner kehrt um; sie finden wohl ihren Pfad durch den hohen, fliegenden Schnee.
Der Glasfuhrwerker sitzt schwankend auf seinem Stuhl und tastet alle seine Rocktaschen ab. „Haha!“, grunzt er und schlägt ein Guldenstück auf den Tisch. „Kein Geld mehr, haha!“ Doch keiner von den Glashüttlern setzt sich an seinen Tisch, um das unterbrochene Spiel fortzusetzen. Zuletzt erhebt sich der Reininghans schwankend. Gewaltig steht er in der Wirtsstube, breitschultrig und Achtung fordernd, trotz seiner trunkenen Hinfälligkeit. Es wirkt für uns arme Hunde, die Glashüttler und die Holzknechte, immer noch nach, dass er einmal mit zwölf Paar Rossen gefuhrwerkt hat. Ein Herr noch im Niedergang!
„He, Hausknecht, die Rappen anspannen!“, knurrt er gegen den Schanktisch hin. Der Wirt kommt hervor und schüttelt den Kopf. „Jetzt in der Nacht kommst du nicht mehr hinaus nach Friedburg mit deiner Glasfuhre, Reininghans. Die Straßen sind mannshoch mit Schnee zu. Du bleibst stecken und erfrierst in dem eisigen Sturm!“
„Heimgefahren wird, anspannen! Wer will mir da dreinreden?“, begehrt der Fuhrwerker auf. „Du kennst mich und meine Rappen nicht, Wirt! Was weißt du überhaupt vom Fuhrwerken, he!“ Der Wirt aber bleibt fest. „Geh hinauf in die Kammer und schlaf dich aus, Reininghans! Morgen bei Taglicht ist alles anders. Ich muss auch an Kathrine, deine Tochter, denken! Allein fährst du nicht in dieser eisigen Nacht!“ Vielleicht flackerte im Kopf des Fuhrwerkers eine leise Einsicht auf. Er tappt mit der Faust nach der Münze auf dem Tisch und hält sie vor sich hin. „Aha, du magst recht haben, Wirt. Dann soll einer mit mir fahren! Ich zahl ihm dafür einen Gulden – meinen letzten Gulden!“
Ein Gulden Fuhrlohn – das ist die Löhnung für eine halbe Woche Arbeit im Holz! Dieser Gedanke hat mich so aufgestachelt, dass ich auf einmal vor dem Reininghans stehe. „Ich fahr mit Euch, Herr!“
Der Wirt und sein Hausknecht sind kopfschüttelnd neben der schwer beladenen Schlittenfuhre gestanden, wie ich die Rappen an die Deichsel gespannt und zuletzt den langen, ledernen Leitriemen vom Kummet gehoben habe. Der Herr der Rosse hat in dem Augenblick seine Faust geöffnet und mir die dicke Silbermünze entgegengehalten. „Nimm den Gulden gleich jetzt, der Wirt ist Zeuge, dass ich richtig zahle.“ Zahlen gehört sich erst nach der Arbeit. Ich habe mich ein wenig gesträubt, aber dann doch den Gulden zu mir gesteckt – den letzten Gulden des einst reichen Fuhrwerkers. Der Wirt ist Zeuge – ich bin verdingt für diese Nacht!
Es ist so kalt gewesen, dass die klammen Finger an den eisernen Kettengliedern kleben geblieben sind. Selbst in dem windgeschützten Hof des Wirtshauses ist die Fuhre fußtief überweht worden.
„Hüh, Rappen!“, sage ich erregt und lasse die Peitsche durch die Luft schnalzen. Die Pferde spitzen die Ohren bei der neuen Befehlsstimme; sie legen sich tief in die Stränge und lösen knarrend die festgefrorene Schlittenfuhre. Die Hufe mit den scharfen Stollen aus Eisen greifen in das Eis unter dem Schnee, ächzend gleitet der Schlitten unter dem Hoftor auf die spurlose Straße hinaus. Der Wirt und sein Knecht bleiben in dem Wehen wie fahle Schatten zurück – dann sind wir in der diesigen Winternacht allein. Der Fuhrwerker hält sich hinter mir an der Kette, die die Glaslast zusammenhält. Er torkelt hin und her; mich überkommt Angst, dass er einmal unter die Schlittenkufen fällt. „Geht lieber hinter der Fuhre nach, Herr!“, bitte ich ihn. „Der Schnee ist dort nicht so tief!“ Der mächtige Mann sieht das ein und bleibt zurück.
Wie wir aber aus dem windgeschützten Wald zu der Höhe hinauf kommen, springt uns der Wind wie ein Wolf entgegen. Die Straße läuft durch einen flachen Hohlweg; die Rappen waten bis zum Bauch durch die wachsenden Wachten. Der fliegende Schnee bringt mir bald die Augen zum Tränen. Um uns ist nichts mehr als das Schnauben der starken Rosse und das hohe, singende Windjohlen. Aber wir kommen voran, Schritt um Schritt in eine grau verstürmte Welt hinein, die nur die hohen Schneestangen rechts und links der Straße an der Wirklichkeit festmachen.
Festmachen? – Da hängt auch jählings die Schlittenfuhre fest! Die Rappen stehen schnaubend und zitternd still und dampfen vor Ungeduld und Anstrengung. Mir steigt das erste Grausen auf. Hier mitten im Sturm dürfen wir nicht lang halten, sonst gefrieren die schweißdampfenden Rosse zu Eis! Ich wate vor und kraule den Rappen die Mähne. „Eh, Rappen, eh! Brav seid ihr, brav!“ Und dann fällt es mir wie eine Erleuchtung zu, dass ich vorauswaten und den Rossen eine Spur treten muss. Vielleicht kann der Fuhrwerker die Rappen führen, und sein Rausch ist schon ausgekühlt!
„Herr!“ – ich wende mich um. „Komm zu den Rappen vor, Herr!“, rufe ich lauter. Niemand meldet sich. Hört er mich nicht? Ich wate zurück. Da friere ich auf einmal, dass es mich schüttelt – „Hallo, Herr!“ Ich lasse Rosse und Fuhre allein und stolpere zurück. Die Schlittengeleise sind wieder zugefallen und ich sollte viel schneller laufen können. Ich schreie, wate und starre mir die Augen blind. Dann stolpere ich. Bis ich es recht erfasse, wühle ich den Fuhrwerker schon mit den bloßen Händen aus dem Schnee. „Auf, auf!“, keuche ich und schlage zornig auf den breiten Rücken. „Ihr dürft nicht liegen bleiben!“
Ach, ist das eine Mühe gewesen, bis ich den Fuhrwerker zu seiner Fuhre geschleift habe! Ich ziehe den Stöhnenden auf den Schlitten und reiße die Decken von den Rücken der Rosse. Wie ein lockeres schweres Bündel verschnüre ich ihn mit einem Strick, der am Pferdekummet hängt. Er lässt alles willenlos geschehen. „Eh, Rosse, brav, brav!“, beschwichtige ich mein eigenes Grausen. Jetzt bin ich allein, verantwortlich für Mensch und Rosse und Fuhre! Der Gulden, der letzte Gulden, drückt mich nieder. Umkehren? Wie sollt’ ich das in dem Hohlweg! Die Rosse ausspannen? Bis ich das erste Haus erreiche in dieser menschenleeren Öde und wieder zurückkomme mit Helfern, ist der Reininghans erfroren! Was bleibt mir anderes, als vor den Rappen tiefe Spuren vorauszuwaten?
Ich wühle mich durch fließenden Schnee bis zum Bauch dahin und kehre nach einer Weile auf einer zweiten Spur für das andere Ross wieder um. Den Fuhrwerker auf dem Schlitten rüttle ich, damit er nicht erstarrt, schnalze mit der Peitsche und ziehe am Leitseil. „Hüh, Rappen, hüh, hüh!“ Tiere verstehen den Menschen, wenn Gefahr um sie ist! Beinahe bis zum Boden hinab krümmen sie die Rücken, dass die Muskeln wie Wulste abstehen. Sie lockern den schweren Schlitten, sie graben sich durch den Schnee, auch dann, als meine Spur schon wieder zu Ende ist. Ich höre sie keuchen wie Menschen, ich hänge das Leitseil an das Kummet, löse im Dahinstapfen das behindernde Gebiss aus dem schäumenden Maul. Nun kann ich sie nicht mehr lenken, aber sie verfehlen den Pfad weniger als ein Mensch. Ich halte sie nur an der Halfter fest, wate atemlos mit ihnen und rede ihnen zu: „Meine braven, braven Ross’ seid ihr!“
Wir müssen diesmal weit gekommen sein, bis Tier und Mensch wieder der Atem ausgeht. Lebt der Fuhrwerker noch? Ich bohre meinen Arm bang durch die Decken zu seinem Gesicht. Es fühlt sich warm an – das ist genug. Die Decken sind hoch zugeweht; das schützt den Trunkenen. Ich bin noch dreimal in dieser Nacht vorausgewatet. Ich habe den Rappen Mut geschenkt und sie mir, dem verzagenden Menschen. Und zuletzt, wohl nach vier Stunden oder fünf, sind wir vor dem Haus in Friedburg gestanden. Ich hab an die eichene Haustür geschlagen.
„Aufmachen!“ Und wieder gepumpert: „Aufmachen!“ Licht kommt über die Stiege herab, der Riegel knarrt. Die Kerze flackert im Sturm, erlischt. Aber Kathrine kennt es doch, dass ein Fremder vor ihr steht. „Wo ist der Vater?“, erschrickt sie. Wir haben ihn in die Stube getragen; die Füße sind erfroren gewesen, alle zwei. Aber das hat sich erst später gezeigt. Als auch die Rappen im Stall stehen, wagt Kathrine zu fragen: „Und warum bist du mit ihm gefahren?“ Mir wollt’ es bitter aufsteigen, aber ich hab den Ärger über die Sache, in die ich hineingeraten war, unterdrückt.
„Einen Gulden wollt’ ich mir verdienen – seinen letzten Gulden und meinen ersten als Fuhrmann!“, versuchte ich die tödlich gefährliche Sache ins Harmlose, vielleicht ein wenig Prahlerische, abzubiegen.
Da richtet sich der mächtige und herrische Fuhrwerker Reininghans von seinem Lager auf und sagt ganz nüchtern: „Du musst mein Fuhrmann bleiben, Holzknecht! Mit mir ist es aus, aber du bringst mein Gewerbe wieder in die Höhe!“
Und hier ist eigentlich die Geschichte vom letzten Gulden zu Ende. Eine andere fängt an – die mit dem ersten Gulden als Glasfuhrwerker. Aber die weiß auch euer Vater schon, Buben! Und wenn er sie noch nicht erzählt hat, kann er es einmal tun!
Der Großvater, den wir mehr zärtlich zu verehren als rückhaltlos zu lieben wagten, blieb wieder schweigsam und ernst. Wir wussten damals noch lange nicht alles. Erst allmählich bauten wir die neue Geschichte aus kargen Berichten des Vaters zusammen. Der Großvater war Glasfuhrmann geworden. Anfangs haben ihn die treuen Rappen festgebunden, aber bald band ihn Kathrine fester. Wir wussten jetzt, warum unsere Großmutter Kathrine hieß. Er verdiente soviel dazu, dass nach zwei Jahren wieder sechs Paar Rosse fuhren und nach vier Jahren zwölf. Doch da trug das Fuhrunternehmen schon den Namen des Großvaters.
Die Zeit blieb nicht stehen, eine Bahn wurde bis zur Glashütte gebaut. Aber das hatte der Großvater vorausgesehen; er sattelte auf den Weinhandel um und band seine zwei ältesten Söhne wieder als Bauern auf sicherem Ackergrund fürs Leben fest. Stand es dafür, eines Guldens wegen diese Geschichte zu erzählen? Ich bin in dieser Sache befangen und kann es nicht genau sagen.
Einst aber stand es wohl dafür, dass ein Mann, dessen Taten heute keine Zunge mehr lobt, um eines Guldens willen, des letzten, in das Eis und die Nacht hinaus schritt – wie es immer sein muss, wenn ein Werk, auch ein spät erst reifendes, gedeihen soll.
WIE ICH DEN VATER KENNENLERNTE
WIE ICH DEN Vater kennenlernte? Vielleicht meint ihr, davon wäre doch kein Aufhebens zu machen. Vater und Mutter, die sind in der Welt schon da, wenn das Kind zum ersten Mal die Augen aufmacht – ja, sind ihm lange Zeit die Welt selber!
Mit der Mutter ist es gewiss immer so. Sie ist ohne Frage schon immer vertraut; und bis wir allmählich zu Verstand und eigenem Urteil kommen, steht ihr Bild schon fest und unverrückbar vor unserer Seele.
Aber mit meinem Vater ist es mir doch ganz anders ergangen! Der Vater schien uns Kindern schon von jeher mehr zum Achten und Respektieren da zu sein als zum unmittelbaren Liebhaben. Er arbeitete immer schwer und hart vom Morgen bis zum Abend. Ja, eigentlich konnte ich mir den Vater gar nicht anders als arbeitend und schaffend vorstellen. Die stete Mühe und die Einsamkeit der weiten Bauernlandschaft formten an ihm sein ganzes Leben lang.
Da trat eines Tages ein Ereignis ein, welches so tief in mein junges Bubenherz wirkte, dass ich auf einen Schlag, wie hinter jäh zurückgezogenen Schleiern, meinen wirklichen Vater erkannte.
Mein bäuerliches Elternhaus stand uralt und sonnenbraun ganz aus Holz erbaut auf einer kleinen Bodenwelle über flachen Wiesen und dem weit bis zum See hingestreckten Moor. In den eichenen Türstock des Hauses stand die Jahreszahl 1717 eingeschnitten.
Einst mochte die Landschaft meiner Heimat völlig einsam gewesen sein. Doch bereits in meiner Kinderzeit schnitt zwischen Wiesen und Moor ein hoher, buschbewachsener Bahndamm hindurch, und zwischen blühenden Wiesen und dem strohgelben Schimmer des reifenden Korns rollten schon damals die Güterund Expresszüge als Boten einer fernen, betriebsamen Welt vorbei, die mir zu jener Zeit meiner Kindheit noch völlig rätselhaft und außerhalb meines Lebenskreises bleiben musste.
Jenseits des Bahndammes lagen nur noch einige schmale Wiesenstreifen und daran schloss sich das weite Moor mit seinen niedrigen Büschen, dem Brombeergestrüpp und seinen Schlangennestern an. Unscharf ging das Moor dann in Schilfdickicht und das lang hin unbewohnte Seeufer über. Die Wohnstätten der Menschen lagen allesamt hinter unserem Dorf, wo das Bauernland allmählich anstieg und den Einschichthöfen und Dörfern genug Raum zum Ausbreiten gab. Dort hinauf musste auch ich gehen, um mir als Kind das erste Schulwissen zu holen.
Damals in meinen ersten Schuljahren stand ich oft völlig fassungslos der überquellenden Buchstabenwelt der Bücher gegenüber. Fassungslos verfiel ich auch dem Lesen mancher Bücher; und dass ich dabei Zeit und Umgebung um mich vergaß, war wohl noch das geringste Übel. Denn zuweilen ging ich auch noch, wenn ich ein Buch schon längst zu Ende gelesen hatte, tagelang verstört wie in einer anderen Welt herum, sodass mein Vater einmal brummend zu mir sagte:
„Ja, Bub, wenn du so weitertust, kann dich einmal kein Bauer als Knecht brauchen!“ In jenen Zeiten kränkte mich dieses Wort sehr. Es erschien mir wie eine düstere Prophezeiung. Heute aber muss ich dem Vater recht geben, – denn an einen Knecht werden wohl ganz andere Anforderungen gestellt als die: Bücher zu lesen und bei jeder Arbeit mit abwesendem Geist zu träumen!
Doch trotz allen Abmahnens nahm ich heimlich und verstohlen weiterhin zu mancher Beschäftigung etwas Lesbares mit – in der Hoffnung, hin und wieder ein Viertelstündchen für mich und mein Buch allein zu haben.
In der Zeit des Herbstes war es in meiner Heimat Brauch, das tägliche Grünfutter nicht mehr zu den Kühen in den Stall zu bringen, sondern sie hinaus auf die Wiesen zu treiben und sie dort selbst ihr Futter abweiden zu lassen. Da aber bei uns daheim die Grundstücke der Bauern lustig durcheinander gemischt waren, musste jemand aus unserem Hof als Hüter der Rinder aufgestellt werden.
Dass ich zu dieser Arbeit gern bereit war, kann man sich ja vorstellen: Denn dabei waren die Hände frei von Sense, Rechen und Gabel. Man brauchte nur mit offenen Augen darauf zu achten, dass kein Rind die elterliche Wiese verließ und auf des Nachbarn Grund hinüber wechselte. Und mir kam eine solche Beschäftigung wie gerufen – konnte ich doch dabei lesen und wieder lesen. Wenn ich nur hie und da aufschaute und mit raschem Blick meine Herde zählte, musste dies völlig genug der Arbeit sein!
So saß ich wieder einmal eines warmen Herbstnachmittages jenseits des hohen Bahndammes über der letzten Wiese vor dem Moor auf einem Steinhaufen und hütete unsere Rinderschar. Gegen die Sicht von daheim war ich durch den hohen Bahndamm geschützt, und die Kühe weideten so friedlich, wie ich es immer gewohnt war. Das war ein leichtes Hüten! Denn jenseits des schmalen Grabens gab es auf dem schwankenden Moor voll blühendem Heidekraut kaum ein saftiges Büschel Gras, das die Kühe hätte hinüberlocken können. Weiter draußen aber am Rande des weiten Moores schimmerte über dem schmalen Streifen Schilf nur der spiegelglatte, weite See.
Tief und tiefer ließ ich mich hineinsinken in das Geschehen meines Buches, das aufgeschlagen auf meinen bloßen Knien lag. Auf dem Damm hinter mir brauste ein dröhnender Schnellzug vorüber – ich schenkte ihm keinen Blick und nahm ihn nur unbewusst wahr, weil der moorige Wiesenboden, auf dem ich saß, auch noch leicht schütternd mitschwang.
Als der Zug hinter dem Wald verschwunden war, sank von neuem Stille herab. Umso lauter aber erfüllte sich beim Lesen meine Phantasiewelt mit klirrendem Waffenlärm. Da war ein edler Ritter nach harter Belagerung in die Burg des Raubritters eingedrungen und hatte ihn zum Zweikampf gestellt. Hieb klirrte auf Hieb, und als der Bösewicht vom letzten Streich getroffen niedersank, verhüllte sogar der nächtliche Mond seinen Schimmer. Immer noch spann sich die Geschichte weiter, bis ein glückliches Ende erzwungen war und der Gute den Sieg über den Bösen errungen hatte.
Als die letzte Seite des Buches ausgelesen war, hob ich mit einem tiefen, erlösten Aufatmen den Kopf und ließ meine Augen wie traumverloren über die Wiese vor dem Moor schweifen. Erst allmählich kam mir zu Bewusstsein, dass darauf etwas fehlte. Ich saß wohl noch da auf dem Stein – aber die Kühe waren nicht mehr da!
Ja, – Himmel! Hatten sie sich schon satt gefressen und waren ohne mich heimgetrottet? Der hohe Bahndamm hatte einige hundert Schritte weiter vorne einen Durchlass für die Straße. Ich sprang rasch an dem Damm empor, um auch jenseits der Straße bis zu dem kleinen Dorf alles überblicken zu können. Auch dort entdeckte ich die Kühe nicht. Fassungslos drehte ich mich um und suchte von der Höhe des Bahndammes noch einmal die Weite des Torfmoores ab.
Und da schnitt mir ein jäher Stich durch das Herz: Dort draußen, schon fast vor dem Rand des Moors gegen den See hin, sah ich die letzten Rinder dahinstürmen – den Schwanz hoch über den Rücken geschwungen; ein Zeichen, dass sie in einem wilden Lauf begriffen waren. Die vorderen Rinder drängten schon in das hohe Schilfröhricht hinein. Dahinter aber gleißte träge und höhnisch der Unheil verkündende, tiefe See!
Im nächsten Augenblick rannte ich barfuß wie auf Windesflügeln über die Wiese dahin. Von hier unten konnte ich keines der flüchtenden Rinder mehr sehen – nur die Richtung hatte ich mir gut gemerkt. Im jagenden Laufen überstürzten sich alle meine Schreckensgedanken: Nach diesem schwülen, warmen Tag hatte wohl der Durst die Kühe dem See zugetrieben. Sicherlich konnten sie nicht schwimmen – wo hätten sie das auch hergehabt, die doch ihr ganzes Leben lang im Bauernstall an der Kette standen! Wenn sie nun aber durstig durch das Schilf in den See hineinplanschten, wenn der Seegrund vielleicht plötzlich tief hinabsank, dann – dann musste eine nach der anderen ertrinken! Und ich wäre schuld daran!
Ich stürzte in die größte Angst meiner Jugend, achtete nicht auf die Brombeerranken, die mit ihren Stacheln meine nackten Waden blutig rissen, rannte nur keuchend und heimlich weinend dahin. Doch bis ich atemlos vor dem Schilf stand, waren meine Rinder in dem hohen Röhricht untergetaucht. Ich rief, lockte und drohte – vergebens! Ich wollte hinter ihnen auf der breit getretenen Spur hineinwaten, – doch damit trieb ich sie vielleicht noch weiter hinein gegen das tiefe Wasser.
Kaum fünfzig Schritte neben mir mündete ein breiter Moorgraben in den See. Sein Wasser hatte feinsten Moorschlamm in den See geschwemmt, der nun wie eine Landzunge in den See hinausgriff. Dort fehlte auch das Schilf, und die braune Kruste auf dem Wasser schien leidlich tragfähig zu sein. Wie wäre es, wenn ich dort drüben in den See hinauslief und den Kühen so den Weg in das tiefe Wasser abschnitte?
Ich fühle es noch heute, wie mir bei diesem verwegenen Entschluss der Mund zu beben begann, – denn schwimmen konnte ich damals nicht. Als ich dann drüben auf der trockenen Moorkruste stand, fühlte ich mich halbwegs sicher. Nur jetzt keine Zeit verlieren! Ich lief anfangs und tappte dann, als die Kruste der Schlammbank durchbrach, hastig gegen das offene Wasser hinaus. Nur wenn ich vor den Kühen draußen vor dem bald tiefer absinkenden See stand, konnte vielleicht noch alles gut werden.
Es sollte jedoch nicht sein. Bald brach ich bis zu den Knien durch die immer feuchtere Kruste und wusste nicht mehr, wie ich die Beine rasch wieder aus dem Schlick lösen könnte. Ich ließ mich nach vorne fallen, um leichter voranzukommen. Und dabei stand ich noch gar nicht wirklich im See, erst weiter draußen begann das offene Wasser. Ich hastete keuchend und wühlte mich verzweifelt weiter hinaus. Dabei sank ich mit jedem Ruck tiefer in den Moorschlamm hinein. Aber ich dachte immer noch nicht an eine Gefahr, – ich hatte alle Gedanken nur bei den Kühen des Vaters.
Wenn ich diese nicht retten konnte, – ich, der Hirt, dem sie anvertraut waren, – dann traute ich mich nie mehr nach Hause!
Erst als ich so tief in dem Morast steckte, dass er mir über die Brust heraufstieg, als ich nicht mehr vor oder zurück konnte, da fing ich an zu begreifen, in welch unheimliche Gefahr ich geraten war. Meine Füße fanden immer noch keinen festen Grund, – ich fühlte sogar, dass ich langsam – langsam tiefer sank. Und aus dieser zähen, breiigen Tiefe herauf kroch mir eine Eiseskälte bis ans Herz empor.
Da fühlte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen dunklen Schatten neben mir – den Schatten des Todes.
Ich wusste ja, dass um diese Herbstzeit weitum im Moor keine Menschenseele unterwegs war, – und wenn mich niemand in meiner Einsamkeit rufen hörte, bevor der Schlamm über mir zusammenschlug, dann – dann musste ich sterben!
Ich schrie von neuem, als mir das Wasser schon über die Brust bis gegen das Kinn heraufstieg: „Vater! – Vater!“ Doch weder die Weite des Moores noch die Spiegelfläche des Wassers gaben eine Antwort.
Da ließ ich mich zurücksinken und breitete die Arme aus. Die Tränen liefen mir über die Wangen und schmeckten salzig auf meinen Lippen. Ich begann aus meiner tiefen Not heraus zu beten, mit einer Glaubensinbrunst, die ich noch nie gekannt hatte. Und allmählich erfüllte mich eine seltsame, gehobene Ruhe.
Erst als es drüben im hohen Schilf aufrauschte, dachte ich wieder an die Rinder, die ich nicht sehen konnte und die mir wohl auch schon aus dem Sinn entschwunden waren. Ich hab versucht, was ich mit meinem Bubenverstand nur tun konnte! So dachte ich. Die Rinder standen mir auf einmal ganz seltsam fern. Jetzt hob ich die Augen und wendete langsam den Kopf gegen das Ufer hin. Da gab es meinem Herzen jählings wieder einen Ruck: Denn dort drüben tappten die Rinder, eines hinter dem anderen, aus dem Schilf hinaus, schüttelten ihre nassen Flanken und schauten unschlüssig zu mir herüber, als warteten sie darauf, dass ich mein Hirtenamt wieder anträte.
Doch zu dieser Stunde konnte ich es nicht mehr. Da tappten die Rinder langsam über einen Moorweg davon. Ich blickte ihnen nach, bis die letzte Kuh mir aus den Augen entschwand.
Noch immer schien ich langsam, langsam tiefer zu sinken. Zuletzt versiegten auch meine Tränen. Ich schaute zu den Schäferwölkchen empor, die langsam über mich hinweg zogen. Ich wusste nicht mehr, wie lang ich in dem moorigen Schlamm mit ausgebreiteten Armen gestanden war, als mich ein jäher Ruf in die Wirklichkeit zurückholte: „Ja, Bub, Bub, was tust du dort draußen!“
In dieser Stimme lag ein großes Erschrecken, das mich aus meinem Dahinträumen riss. Dann erst konnte ich stöhnend jubeln: „Vater, Vater – du bist da!“
Ich konnte nur regungslos ausharren, bis der Vater hinter mir kniete und mich aus den zähen Klammern des Moores zog. Dann erst sah ich es, dass er von der nahen Bohlenbrücke über den Moorkanal die lose darüber gelegten Schwellen gerissen und mit ihnen einen schwimmenden Steg gelegt hatte, indem er die hinteren Hölzer immer wieder nach vorne schob, bis er mich erreichen konnte.
Als mich der Vater draußen auf den festen Boden stellen wollte, sank ich zusammen. Vielleicht war ich gelähmt von der Kälte im Leib, vielleicht war es nur die Erschöpfung nach der Angst: Ich lag hilflos zu seinen Füßen.
Und da geschah es das erste und einzige Mal, dass ich meinen Vater weinen sah! Aufschluchzend kniete er vor mich hin und rieb meinen Körper trocken und warm. In dieser Stunde lernte ich meinen wirklichen Vater kennen. Ich spürte, wie heiß mir sein Herz entgegenschlug, das sonst immer verborgen blieb hinter Lebensernst und Arbeitsmühe. Ich schlang meine Arme um seinen Hals und drückte mein Gesicht an seine bärtige Wange. Wir hielten lange still, und kein Wort fiel dabei.
Später lud mich der Vater auf seine Schultern und trug mich heim.
Weiter gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Dass mich der Vater suchen gegangen war, als die Kühe allein, ohne ihren jungen Hirten, heimkamen; dass er bald die Rinderspuren über das Moor gesehen hatte, die ihn zum See hinaus wiesen, – das war leicht zu erraten gewesen.
Wenn ich heute aber zurückschaue auf die so weit hinab gesunkenen Jahre meiner Kindheit, – dann weiß ich es, dass tiefer als tausend wohlgesetzte väterliche Worte jene Stunde durch mein ganzes Leben wirkte, da ich in jener wortlosen Erschütterung meinen wahren, wirklichen Vater kennenlernte …
MEINE ERSTE WALLFAHRT
„MAGST DU MORGEN mit mir auf Wallfahrt gehen, Bub?“, fragte mich unsere Barbara, seit Lichtmess junge Dienstmagd bei uns daheim.
„Wohin?“, fragte ich, glücklich darüber, dass die Bärbel, die ich heimlich verehrte, mich Buben mit 12 Jahren zum Mitgehen einlud.
Sie lachte schelmisch. „Ich hab mit der Kathi vom Nachbarn für morgen eine Wallfahrt nach Maria Plain ausgemacht, aber ihre Bäuerin ist krank geworden – und allein mag ich auch nicht wallfahrten gehen.“
Jetzt verstand ich, – sie brauchte halt einen männlichen Begleiter und dazu war ich ihr gut genug! Trotzdem, in meinem Herzen klang es: Auf Wallfahrt gehen, mit der Bärbel!
In meiner Jugendzeit wallfahrtete man zu Fuß drei gute Stunden nach Maria Plain, auf Bauernstraßen und stillen Feldwegen. Und das durften Bauersleute einer Magd nicht abschlagen, die man dringend nötig hatte. Im Mai vor der Heumahd war ja die rechte Zeit dafür.
Ich war gleich freudig zum Mitgehen bereit. „Muss halt noch Vater und Mutter fragen!“, lachte ich glücklich.
„Ja, frag sie – und sag auch, wir wollen brav sparsam sein, kein unnötig Geld vertun und hin und zurück zu Fuß gehen!“, sagte sie. So geschah es, dass Barbara und ich am Morgen ums Tagwerden zur Wallfahrt aufbrachen. „Tut aufs Beten nicht vergessen!“, rief uns die Mutter unter der Haustür noch nach. Es war damals Brauch, dass ein Rosenkranzpsalter voll werden sollte bis zum Ziel der Wallfahrt.
Als wir aus dem Dorf kamen, nahm Bärbel den Rosenkranz zwischen die Finger und betete vor. Die aufgehende Sonne traf uns schon beim dritten Gesätzel an. Später waren auch die Dörfer erwacht. Ein junger Fuhrmann lud uns ein, eine Strecke weit bei ihm aufzusitzen. „Das ist wohl dein Bruder – für einen Bräutigam wär’ er noch arg jung!“, spottete er fröhlich und unterhielt sich nur mit unserer sauberen Magd. Ich saß ziemlich überflüssig daneben und war froh, als der Wagen ins Feld abbog. Einen Bräutigam brauchte Bärbel nicht! Mich ärgerte dieses Wort! Nach drei Stunden ging es unter lichtem Buchenwald steil bergan. Und oben stand auf einmal die Wallfahrtskirche schimmernd vor uns. Von der Stadt herauf stiegen Wallfahrer mit einer brokatenen Fahne und hallendem Gebet. Mir war es, als würde ich mit den vielen Menschen hinein in die Kirche geschwemmt unter rauschenden Orgelklängen. Sehr fromm war ich in diesem Augenblick wohl nicht, aber ich bemühte mich, ernst zu sein. Die Umgebung wurde ich erst wieder gewahr, als ich im Wirtshaus vor einer Suppe mit Würsteln saß.