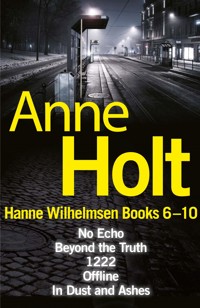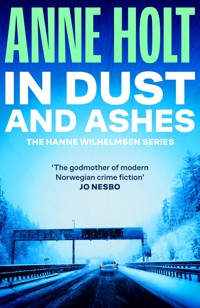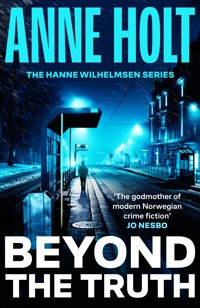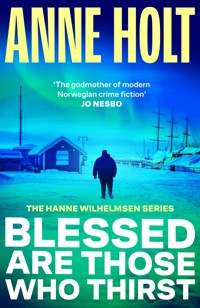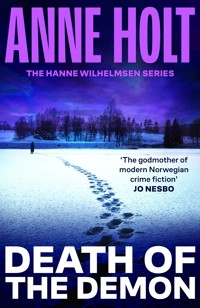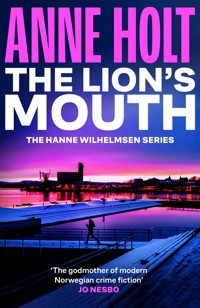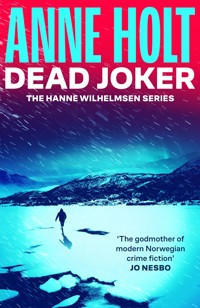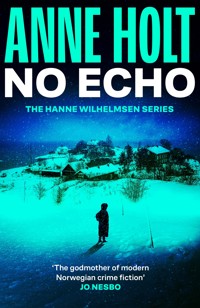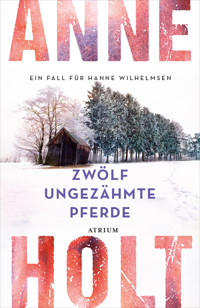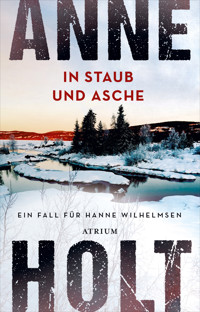Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: USM Audio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Selma Falck
- Sprache: Deutsch
Der neue Fall für Anne Holts Star-Ermittlerin Selma Falck sitzt mit zwei Freundinnen vor einem Café, als plötzlich ein Schuss fällt. Selma wird nur leicht gestreift, die Parlamentsabgeordnete Linda trifft es jedoch tödlich. Lindas relative Anonymität veranlasst alle zu der Vermutung, dass Selma das eigentliche Ziel des Attentats war. Auch sie selbst geht davon aus – zumal sie seit einiger Zeit einen Stalker hat, der sich heimlich Zugang zu ihrer Wohnung verschafft. Doch dann gibt es weitere Opfer, und Selma stößt auf ein unübersichtliches Gemenge aus Machtmissbrauch, Verschwörungen und persönlichen Tragödien. Und nicht zuletzt auf eine eiskalte Rache, die nicht aufzuhalten zu sein scheint.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Anne Holt
Eine Idee von Mord
Der dritte Fall für Selma Falck (Bd. 3)
Kriminalroman
Übersetzt von Gabriele Haefs
This translation has been published with the financial support of NORLA, Norwegian Literature Abroad
Deutsche Erstausgabe
© Atrium Verlag AG, Zürich, 2023
Alle Rechte vorbehalten
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Mandela-effekten bei Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo.
Copyright © Anne Holt 2020
Published by agreement with Salomonsson Agency
Lektorat: Julie Hübner
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-193-7
www.atrium-verlag.com
www.facebook.com/atriumverlag
www.instagram.com/atriumverlag
Für Jan Guillou, meinen Freund, mit Dank
Mai 2010
Der Anfang
Sie nuschelte und grinste. War trotzdem reizend. Damenhaft reizend, ganz anders als jüngere Mädchen. Ein bisschen mama-mäßig, aber auch ziemlich frech. Eigentlich hübsch. Fülliger Mund mit Lippen, die echt wirkten. Rotblonde Haare, die einwandfrei nicht echt waren. Und sie war schwer beschäftigt. Sie kotzte gerade in eine Mülltonne, als er sie entdeckte. Er blieb stehen und sah ihr eine Weile zu, bis sie sich aufrichtete, zu ihm hinüberschaute und ihm plötzlich zuwinkte. Er gehorchte dem Wink und sah, wie eine Ratte an ihren Füßen vorüberrannte. Das Maul des Nagetiers war vollgestopft mit Kebabresten oder so etwas. Die Frau war zu sehr weggetreten, um das Tier zu bemerken. Sie tat ihm leid. Andere Leute taten ihm oft leid.
Er sich selbst auch.
Es kam so, wie er es gewollt hatte, er durfte mit ihr nach Hause gehen.
»Wie alt bist du eigentlich?«, fragte er zum dritten Mal.
»Tick, tack. Tick, tack.«
Vielleicht weinte sie ja eigentlich. Vor allem hatte sie gelacht, sogar, als er sie reichlich hart packen musste, damit sie im U-Bahnhof Nationaltheatret nicht in den Spalt zwischen Bahnsteig und Wagen fiel. Ihr Lachen war ansteckend, sogar im Suff. Sie kam ihm trotzdem nicht besonders fröhlich vor.
»Tick, tack.«
Ihre Wohnung war schweineschick. Nicht, dass er selbst ausgerechnet in Scheiß-Manglerud hätte wohnen wollen, und schon gar nicht in einem riesigen Hochhaus. Die Wohnung war auch nicht besonders groß, zeigte aber wirklich guten Geschmack. Geschmack wie in Einrichtungszeitschriften. Ziemlich dunkle Farben. Gerade genug Bücher im Regal, und ein viel zu schüchterner Flachbildschirm. Und solche Gruppen aus leeren Vasen und Kerzen, auf einem Holzbrett arrangiert, um ganz zufällig auszusehen. Hier und dort, überall, aber nicht übertrieben viele. Die Wohnung war perfekt, um dort zu übernachten, und derzeit war er total abhängig davon, solche Orte zu finden. Bekannte oder fremde, wenn es dort nur einigermaßen sauber aussah und die Leute in Ordnung waren, dann war er bis zum nächsten Tag gerettet.
»Viel zu alt«, jammerte sie. »Die Uhr tickt.«
Er hatte eine große Kanne Kaffee gekocht und der Frau außerdem eine Menge Wasser eingetrichtert. Er wusste, wie sie sich fühlte. Er betrank sich nur selten, aber wenn es passierte, war es danach das Beste, den Rausch auszuschlafen. Die Hölle, wenn man dann endlich aufwachte, aber dennoch.
»Vielleicht solltest du schlafen«, schlug er vor und stand vom Sofa auf.
»Nein«, sagte sie und versuchte, ihn zu sich zu ziehen. »Du bist so niedlich. So lieb. Du wärst sicher ein toller Papa. Können wir nicht zusammen ein Kind machen?«
Er lachte.
»Ich hab es dir eben in der Bahn doch schon gesagt. Ich bin homo. H-O-M-O. Ich habe keine Lust auf Frauen … no offence.« Er trat einen Schritt zurück und hob beide Handflächen. »… und ich hab auch keine große Lust auf Kinder. Ich bin einundzwanzig.«
»Es wäre so leicht«, sagte sie und versuchte, sich bequemer hinzusetzen. »Ich habe alles, was wir brauchen, und es ist die richtige Zeit im Monat, und …« Ihre R mussten irgendwo auf dem Boden eines Glases liegen. Sie sagte »wä’e« und »hichtig«. Ihre Hand rutschte von der Sofakante ab, als sie aufstehen wollte, und sie fiel zurück. War nicht mehr so hübsch.
Er tippte auf vierzig Jahre.
»Achtunddreißig«, sagte sie, und der Schluckauf setzte ein. »Ich bin achtunddreißig, und die Uhr tickt fleißig.« Ein Kichern. »Das hat sich gereimt. Komm, wir machen ein Baby.«
Sie schloss die Augen. Noch einige Minuten, dann würde sie schlafen. Er nutzte die Gelegenheit, um sich noch einmal umzusehen. Neben dem jämmerlichen Flachbildschirm lag ein iPad. Das hatte sie offenbar in den USA gekauft, denn Apple hatte das coolste gadget aller Zeiten erst vor einem Monat lanciert. Sauteuer.
Saugeil.
Ab und zu stahl er.
Nicht viel. Meistens Speis und Trank. Ein seltenes Mal Geld, aber nur kleine Beträge, und nur im Notfall. Das iPad hatte ein knallrotes Lederetui und führte ihn in Versuchung.
»Kind«, sagte sie unerwartet energisch.
Diesmal konnte sie aufstehen. Das Grinsen war verschwunden. Sie deutete ein Kopfschütteln an. Dann leerte sie die halb volle Tasse lauwarmen Kaffees, stellte sie ab, streckte den Rücken und hob die Hände über den Kopf, als ob sie eben erst aufgewacht wäre. Er hatte gehofft, sie werde auf dem Sofa einschlafen, damit er sich in das verlockende Bett legen könnte, das sich aller Wahrscheinlichkeit nach hinter der Tür in der Längswand befand. Nun würde es wohl umgekehrt sein. Auch gut. Anspruchsvoll zu sein, konnte er sich nicht leisten, und gegen das Sofa war nichts einzuwenden.
Mit überraschend festen Schritten ging sie durch das Zimmer zu der integrierten Küche. Eine Schublade klirrte. Mehrere Schubladen. Er starrte das iPad an. Sie hatte auch ein iPhone, das wusste er. In der Handtasche, die im Gang am Haken hing und eine Brieftasche und jede Menge Schminke enthielt. Die Tasche war in der U-Bahn zwischen ihren Beinen umgekippt, und er hatte ihr helfen müssen, alles wieder aufzusammeln.
»Hier«, sagte die Frau und hob eine riesige Spritze über ihren Kopf.
Groß genug für ein Pferd. Oder einen Elefanten. Die Spritze hatte keine richtige Spitze, das sah er nun. Sie hatte überhaupt kein Metall, war stumpf und seltsam. Sie sah ein bisschen aus wie eine dieser Spielzeugspritzen, wie sie oft in niedlichen Arztköfferchen mit einem aufgedruckten roten Kreuz lagen.
»Hast du was zu essen?«, fragte er.
»Sicher. Nachher. Erst das hier.«
Dumm war er nicht. In der Schule war er lange Zeit der Beste in der Klasse gewesen. Clever und eingebildet, hatte er die Lehrer sagen hören. Dann war seine Mutter gestorben, und mehr Schule hatte es nicht gegeben. Das Leben war weitergegangen, irgendwie. Er stolperte hinterher, so gut es eben ging, lebte vor allem von der Hand in den Mund. Ab und zu wie ein Prinz. Meistens nicht. Eine feste Adresse hatte er nicht mehr gehabt, seit sein Vater schließlich die Geduld verloren und ihn vor die Tür gesetzt hatte.
Da war er siebzehn.
Seit vier Jahren lebte er nun schon von Sozialhilfe und der Barmherzigkeit anderer. Dumm war er trotzdem nicht, und als die Frau ein weiteres Mal mit der riesigen Plastikspritze winkte, begriff er, was sie wollte.
»Bist du gesund?«, fragte sie.
»Ja. Aber ich hab keinen Bock auf …«
»Keine HIV-Infektion?«
»’türlich nicht«, antwortete er irritiert. »Ich passe auf.«
»Erbliche Krankheiten?«
Ihr R war zurückgekehrt.
»Nein«, antwortete er. »Außerdem können wir mit dem Ding da kein Kind machen.«
Sie stand jetzt dicht vor ihm. Ihr Atem roch nach Kotze, Kaffee und Rotwein. Ihre Zunge war bläulich verfärbt. Ihre Augen noch blauer.
»Zehntausend Kronen«, sagte sie tonlos.
»Was?«
Er trat einen Schritt zurück.
»Du kriegst zehntausend Kronen. Dafür brauchst du bloß in eine Tasse zu wichsen. Im Badezimmer oder so. Dann gibst du mir die Tasse und kriegst zehntausend Kronen. Siehst aus, als könntest du die brauchen.«
Zehntausend Kronen in bar hatte er zuletzt bei seiner Konfirmation besessen.
»Dreißig«, sagte er rasch. »Ich will dreißigtausend.«
»Nein«, sagte sie und ging zu dem kleinen Möbelstück, auf dem iPad und Flachbildschirm ihren Platz hatten.
Aus einer schmalen Schublade zog sie einen Stapel hellbrauner Banknoten, zusammengehalten von etwas, das aussah wie ein Haargummi.
»Zehntausend Kronen«, erklärte sie entschieden. »Ich weiß nicht einmal, wie du heißt, also gehst du keinerlei Risiko ein. Niemand wird etwas von dir verlangen. Weder Geld noch irgendwelche Besuche zu Familiengeburtstagen. Du gibst mir, was ich will, du kriegst das Geld und …«
Wieder setzte der Schluckauf ein, und sie musste einen Schritt zur Seite treten, um nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten.
»Das ist verdammt noch mal nicht in Ordnung«, sagte er leise. »So kannst du doch kein Kind machen. Kinder dürfen nicht …« Er fuhr sich mit der Hand durch die halblangen Haare. »Warum fährst du nicht nach Dänemark oder so? Oder suchst dir einen Typen, mit dem du zusammen sein kannst, verdammt noch mal, du bist doch …«
Sie schwenkte die Geldscheine.
»Du siehst gut aus«, sagte sie. »Du bist Norweger und blond und jung. Du bist lieb. Du hast mir nach Hause geholfen. Ich habe keine Ahnung, wie intelligent du bist, aber ich bin clever genug für zwei.«
Er hätte sie niederschlagen können. Ihr das Geld entreißen und weglaufen. Sie war nicht mehr so betrunken wie noch vor zwei Stunden, als er sie gefunden hatte, aber es wäre leicht, sie zu überwältigen. Und sie hatte keine Ahnung, wer er war.
»Zehntausend Kronen für ein paar Sekunden Arbeit«, sagte sie.
In dem Punkt hatte sie recht. Lange würde es nicht dauern.
»Und das iPad«, sagte er und zeigte darauf.
»Nein. Zehntausend. Take it or leave it.«
»Aber wieso ich? Hast du nicht …«
»Du weißt nichts über mich. Ich weiß nichts über dich. So soll es bleiben. Und jetzt brauche ich eine Antwort.«
Er antwortete.
Zehn Minuten später stand er allein im Flur der kleinen Wohnung und hatte ein ganzes Vermögen in der Tasche. Die Frau war mit Tasse und Spritze in ihrem Schlafzimmer verschwunden und hatte ihn weggeschickt. Ohne ihm etwas zu essen anzubieten, wie sie versprochen hatte. Ihre Handtasche hing noch immer am Haken neben der Wohnungstür. Er öffnete sie vorsichtig und zog die lederne Brieftasche heraus. Sie liebte Bargeld, diese Frau. Hinter dem Foto eines Schäferhundes steckte ein Bündel Zweihunderter. Die Kreditkarte klemmte fest in dem engen Seitenfach, aber mit einigem Gefummel konnte er sie weit genug herausziehen, um den Namen darauf zu lesen.
Wenn sie schon keine Ahnung hatte, wer er war, wollte er jedenfalls wissen, mit wem er möglicherweise ein Kind gemacht hatte. Andererseits, in dem Alter schwanger zu werden, nach einem mehr oder weniger zufälligen Versuch, im Suff eine künstliche Befruchtung vorzunehmen, wäre ja wirklich ein Glückstreffer. Nach kurzem Zögern schob er die Karte wieder ins Fach und legte auch die Brieftasche zurück, ohne das Bargeld anzurühren. Dann lief er aus dem Haus, um sich etwas zu essen und eine andere Übernachtungsmöglichkeit zu suchen. Unten auf der Straße beschloss er, so zu tun, als hätte sich diese absurde Szene niemals zugetragen.
Ihren Namen vergaß er seltsamerweise nie.
Donnerstag, 5. September 2019
Das Attentat
Als der Schuss Selma Falck traf, war sie eigentlich nur überrascht.
Es tat nicht besonders weh. Ein Rucken in der Schulter, ganz oben am linken Arm. Instinktiv griff sie an die Eintrittswunde und merkte mit wachsendem Erstaunen, dass das Blut schon ihre Samtjacke tränkte und sie dunkelrot färbte.
Ein gewaltiges Spektakel brach los.
Der Tisch kippte um, Menschen kreischten. Tassen, Gläser und Stühle flogen in alle Richtungen. Die Gäste in dem engen Straßencafé ließen sich auf den Asphalt fallen oder sprangen auf, um die Flucht zu ergreifen. Ein Kinderwagen, der am äußeren Rand der Tischreihe stand, fiel um, und die Schreie der Mutter übertönten allen anderen Lärm.
Nur Selma Falck blieb ganz ruhig sitzen. Während sich das Blut unter ihrer rechten Hand ausbreitete, wurde ihr immer schwindliger. Später würde sie aussagen, dass viele Sekunden vergangen waren, vielleicht sogar Minuten, ehe sie bemerkt hatte, dass Linda tot war.
Der Schuss hatte Selmas alte Freundin aus der Handballnationalmannschaft in den Kopf getroffen.
Ein scharfer Knall hatte die Herbstluft zerfetzt. Es hatte nicht zweimal geknallt, das wusste Selma mit Sicherheit. Sie blieb sitzen, die Übelkeit hinderte sie am Aufstehen, während sie versuchte, die Kakophonie aus Weinen, Jammern und scharfen Warnungen auszusperren.
Ein einziger Schuss. Definitiv keine zwei. Linda hatte links von ihr gesessen. Vanja Vegge, Selmas älteste Freundin, saß den beiden genau gegenüber. Ein gestresster Kellner hatte soeben ein Glas Wasser auf den wackligen kleinen Tisch geknallt. Das Glas stand so weit am Rand, dass es fast umgekippt wäre, als der Kellner sich zwischen den eng stehenden Tischen umdrehte. Linda Bruseths Reflexe waren vielleicht nicht so gut wie vor dreißig Jahren, aber sie hatte den Fall in letzter Sekunde verhindern können. Ihre Hand umklammerte noch immer das Glas. Ihr Kopf war nach vorn gesunken. Es konnte aussehen, als wäre sie betrunken eingeschlafen. Aber alles, was vor wenigen Sekunden auf dem Tisch gestanden hatte, waren das Wasser, eine Pepsi Max und ein Cappuccino gewesen.
Feinkalibrige Waffe, konnte Selma noch denken. Die Kugel hatte Linda von hinten seitlich am Kopf getroffen. Dort hatte sie Masse und Gewicht hinterlassen, während sie im Gehirn rotiert war, hatte den Winkel geändert und ihre Reise durch ein neues und größeres Loch in Lindas Schädel fortgesetzt, ehe sie Selmas Arm traf. Vor Selmas Augen tanzten Punkte, schwarze und grüne, aber sie konnte den verletzten Arm doch weit genug heben, um zu sehen, dass es keine Austrittswunde gab.
»Selbe Kugel«, murmelte sie. »Und jetzt ist die in mir.«
»Wir müssen weg!«, schrie Vanja Vegge hysterisch unter dem Tisch.
»Sie hat mich gerettet«, sagte Selma.
»Was? Wir müssen weg, Selma! Vielleicht gibt es noch weitere Schüsse!«
»Linda hat mich gerettet«, wiederholte Selma. »Aber ohne das zu wissen, glaube ich.«
Danach erhob sie sich, schwankte ein wenig, packte ihren linken Oberarm fester mit der rechten Hand und ging mit überraschend sicheren Schritten auf den heulenden Rettungswagen zu, der sich wie durch ein Wunder bereits näherte.
»Das darf Anine nie im Leben erfahren«, murmelte sie immer wieder. »Meine Tochter darf davon einfach nichts hören.«
Als ob sich das vermeiden lassen würde.
Samstag, 7. September
Die Vernehmung
Privatermittlerin Selma Falck und Hauptkommissar Fredrik Smedstuen saßen in einer Besenkammer im Ullevål-Krankenhaus. Diese Besenkammer war überraschend groß. Zum Ausgleich roch sie alles andere als sauber. Feuchtigkeitsflecken zeichneten große Muster an die fensterlose Außenwand, und in einer Ecke hing ein Bündel stinkender Wischlappen.
»Sie in ein Viererzimmer zu legen«, murmelte der Polizist und schüttelte den Kopf. »Und das im reichsten Land der Welt. So weit ist es gekommen.«
»Das geht schon«, sagte Selma kurz. »Ich werde ja bald entlassen. Ist nur eine Fleischwunde. Und sie haben uns immerhin diese Kammer zur Verfügung gestellt. Für unsere kleine … Plauderei.«
Sie hob den Blick und ließ ihn durch die Kammer wandern. Die eine Wand war mit Regalen aus emailliertem Metall verstellt, und diese Regale quollen über vor so vielen giftigen Reinigungsmitteln, dass die ganze Station damit umgebracht werden könnte, wenn sie in die falschen Hände fielen. In die gegenüberliegende Wand waren Eisenhaken eingeschraubt, die aussahen wie von einem Grobschmied alter Zeiten hergestellt. Sie waren alle unterschiedlich groß. An jedem waren mit geflochtenem Bindfaden Besen und Wischmopps befestigt, alles zusammen dermaßen verdreckt, dass Selma hoffnungsvoll davon ausging, dass diese Kammer nicht mehr in Gebrauch war. Sie war einfach nur ein überzähliger Raum in einem gewaltigen Krankenhauskomplex, der bald dem Erdboden gleichgemacht werden würde. Jedenfalls sollte das Krankenhaus verlegt werden, was zu einem so dermaßen heftigen Protest fast des gesamten Ärztestandes geführt hatte, dass Selma schon gedacht hatte, sie müssten recht haben. Hier und jetzt änderte sie ihre Meinung. Vierundzwanzig Stunden in einem Krankenzimmer, das viel höher war als breit, mit drei jammernden Zimmernachbarinnen und einem ekligen Uringeruch aus dem gemeinsamen Bad, hatten in ihr eine Sehnsucht nach dem viel neueren Rikshospital entfacht. Dort hatte sie ein Jahr zuvor sechs Wochen lang gelegen und sich wohlgefühlt.
Sie saß in einem Rollstuhl, ohne so recht zu wissen, weshalb. Die Krankenschwester hatte darauf bestanden. Fredrik Smedstuens breite Oberschenkel quollen über die Seiten des schmächtigen Stahlrohrstuhls, und er rutschte die ganze Zeit unbehaglich hin und her. Ins Regal neben ihnen zwischen eine Flasche Lauge und einen Vierliterkanister reinen Salmiak hatte er ein iPhone mit Aufnahmemöglichkeit gelegt.
»Wie gesagt«, wiederholte er, »das ist nur eine einleitende und absolut nicht offizielle Befragung. Hoch priorisierter Fall, das Ganze. Wir sind all over it. Eine Parlamentsangehörige wurde auf offener Straße ermordet. Das sind ja geradezu schwedische Zustände! Ich gehe davon aus, dass Sie ein Interesse daran haben, Ihren Teil beizutragen. Sie wissen …«
Selma gab keine Antwort. Irgendetwas an diesem Mann ließ sie stutzen. Er respektierte sie offenbar und hatte das Gespräch damit eröffnet, dass er Bewunderung und Hochachtung für Selmas frühere Heldentaten zum Ausdruck gebracht hatte. Sie war ihm mit der üblichen Verbindlichkeit und Offenheit begegnet, als er ohne Vorwarnung an ihrem Krankenbett aufgetaucht war. Das war ein Automatismus gewesen; allen anderen gegenüber, mit Ausnahme einer kleinen Handvoll Menschen, glitt sie in die Rolle ihres zweiten Ichs, war freundlich und humorvoll, ein bisschen flirtend und großzügig. Das wirkte immer. Aber nicht bei diesem Mann. Er hatte etwas Reserviertes an sich. Etwas Verschlossenes, so als ob ihm das Ganze eigentlich egal sei. Als ob selbst ein Fall wie dieser, ein tödlicher Schuss auf eine Menschenmenge am helllichten Tag, ihn im Grunde doch nur langweilte.
Vielleicht fühlte er sich einfach nicht wohl in seiner Haut. Er war groß, beleibt und ungepflegt. Seine Pilotenjacke war haarscharf zu eng. Seine Haare eine Spur fettig. Er hatte versucht, den Zigarettengeruch aus seinem Mund mit Fisherman’s Friend zu camouflieren. Selma ihrerseits hatte vor seinem Eintreffen noch schnell duschen können, den Arm in Plastikfolie gewickelt. Vanja hatte ihr saubere Kleider aus ihrer Wohnung gebracht. Armani-Jeans und ein mitternachtsblaues weites Hemd von Acne. Der Polizist redete, zuckte mit den Schultern und rückte sein Handy einige Millimeter weiter in ihre Richtung.
»Ein einziger Schuss«, stellte er fest. »Da sind Sie sich sicher?«
»Ja.«
»Zeugen vor Ort wollen mehrere gehört haben. Einige sagen zwei, andere drei. Noch andere meinen, es könne die Rede von einer Automatikwaffe sein. Viele Schüsse in einer Serie.«
»Zeugen lügen. Wir Menschen sind chronisch unzuverlässig. Wir machen uns im Kopf Bilder, die nicht stimmen. Haben Sie gehört von …«
Er brachte sie mit einer ungeduldigen Handbewegung zum Verstummen.
»Klar. Aber was macht Sie so sicher?«
»Meine Ohren. Ich habe einen Schuss gehört. Einen einzigen. Und das werden die technischen Untersuchungen auch beweisen. Eine Kugel. Sie hat Linda im Hinterkopf getroffen, hat in ihrem Gehirn die Richtung geändert, ist wieder ausgetreten und hat mich danach am Arm erwischt. Wo sie stecken blieb.«
Der Polizist schnalzte kurz mit der Zunge und befeuchtete seine Lippen.
»Die Reste der Kugel sind zur Untersuchung geschickt worden«, sagte er und nickte zu Selmas Schulter hinüber. »Wir haben sie direkt aus dem Operationssaal bekommen. Sie ist so deformiert, dass wir eine gute Portion Glück brauchen werden, um überhaupt feststellen zu können, womit wir es zu tun haben.«
»Aber wir reden von einem leichten Hochgeschwindigkeitskaliber, nicht wahr?«
»Vermutlich. Was einen guten Schützen erfordert. Ein grobes Kaliber hätte Ihrer Freundin den Kopf weggesprengt. Wo haben Sie das gelernt? Das von Waffen und Kalibern und so, meine ich?«
Selma hielt eine Antwort nicht für notwendig. Der Polizist fühlte sich offenbar immer weniger wohl in seiner Haut. Er zog an seinem Hemdkragen, obwohl der offen stand, und kratzte sich im Dreitagebart. Er wirkte ehrlich uninteressiert an dem Fall und an Selma Falck.
»Wir werden sehen, was die Techniker herausfinden«, murmelte er. »Streng genommen können wir nicht wissen, ob Sie oder die andere Frau, mein Beileid übrigens, diese …«
Er griff sich an die Brusttasche, wie, um nach einem Notizbuch zu suchen.
»Linda Bruseth«, sagte Selma hilfsbereit.
»Genau. Linda, ja. Wir wissen nicht, für welche von Ihnen beiden die Kugel bestimmt war. Oder ob vielleicht noch für andere. Diese Varda, zum Beispiel.«
»Vanja. Vanja Vegge hat auf der ganzen Welt nicht einen einzigen Feind. Sie ist eine freundliche Psychologin, die alle lieben. Das einzig Provozierende an Vanja sind ihre bunten Flatterkleider. Was wohl kein Grund ist, getötet zu werden.«
Fredrik Smedstuen murmelte etwas, das bedeuten konnte, dass auch die Polizei Vanja Vegge für ein unwahrscheinliches Mordobjekt hielt.
»Es braucht überhaupt niemand Bestimmtes gewesen zu sein«, fuhr er fort. »Vielleicht war es ein Terrorakt. Ein Schuss ins Blinde, um Angst zu machen.«
Selma lachte. Die Stiche, mit denen eine Drainage gesetzt worden war, ziepten. Sofort wurde sie ernst, legte ihren Arm besser in der Schlinge zurecht und versuchte, die Hand locker zu halten, wie ihr aufgetragen worden war.
»Terrorakt«, wiederholte sie; wenn der Polizist ihre Freundlichkeit nicht haben wollte, sollte er eben Ironie bekommen. »Genau. Ein typischer Terrorakt. Sich richtig in Stellung bringen, um dann einen einzelnen Schuss auf ein Straßencafé abzugeben. Wo vielleicht dreißig Personen saßen. Und wo nur ich, zufällig die einzige bekannte Person in dieser Menschenmenge, getroffen wurde. Ehe der Terrorist seinen Kram zusammenpackte und sich im Wirrwarr davonschlich. Aber sicher doch.«
»Nicht nur Sie. Linda …«
»Bruseth«, vollendete Selma, als er abermals zögerte.
»Ja. Sie ist auch getroffen worden. Zwei Fliegen mit einer Klappe, sozusagen.«
»Offenbar, weil sie sich plötzlich vorgebeugt hat. Sie wollte ein Glas Wasser retten, das sonst umgekippt wäre.«
»Das haben wir schon gehört.« Er nickte träge. »Diese andere Freundin …«
Abermals klopfte er sich auf die Brust.
»Vanja Vegge«, sagte Selma.
»Genau. Mit der habe ich gestern gesprochen. Sie sagt dasselbe wie Sie. Ein Schuss nur und eine plötzliche Bewegung von Linda. Ungefähr gleichzeitig.«
»Wie gesagt, das …«
»Trotzdem kann sie das Ziel gewesen sein.«
Diesmal begnügte Selma sich mit einem Lächeln.
»Linda war die anonymste Hinterbänklerin im Parlament«, sagte sie.
»Ja, aber …«
»Aus dem inneren Vestfold, wo der Tag lang ist, und …«
Selma hätte fast erwähnt, dass die ehemalige Handballkollegin ein wenig schlicht gewesen war, riss sich aber zusammen.
»… ein sonniges Gemüt. Wenn jemand wirklich Interesse daran gehabt haben sollte, sie umzubringen, könnte ich auf der Stelle zehn bessere Methoden aus dem Ärmel schütteln. Besser, als dass sich ein Schütze in Grünerløkka versteckt und Schüsse auf ein Café abgibt, meine ich.«
»Das gilt doch wohl auch für Sie.«
»Für mich? Was denn?«
»Dass es einfachere Methoden gibt, Sie umzubringen.«
Selma beugte sich im Rollstuhl vor.
»Voriges Jahr, ungefähr um diese Zeit, bin ich nackt durch die Hardangervidda geirrt«, sagte sie leise. »Fünf Tage lang. Bei Schneesturm. Schwer verletzt. Erst nach drei Nächten hatte ich wieder etwas Richtiges zu essen und zu trinken. So leicht bin ich nicht umzubringen.«
Der Polizist streckte die Hand nach seinem Handy aus, überlegte sich die Sache jedoch anders.
»Es ist zu früh, um zu sagen, was wirklich passiert ist«, seufzte er. »Wir werden eine Rekonstruktion des Tathergangs durchführen, sobald Sie dazu imstande sind.«
»Jederzeit. Wenn ich heute nicht entlassen werde, haue ich einfach ab. Das hier mit dem Rollstuhl ist nur Unsinn. Ich kann gehen.«
Selma hatte alles satt. Die Kammer wirkte plötzlich enger. Sie wollte weg. Ihr Arm tat weh, aber nicht so sehr, dass sie nicht einfach ein paar Schmerztabletten mitnehmen und sich zu Hause zwei Tage auf das Sofa legen könnte.
»Möchten Sie Polizeischutz?«
»Was?«
»Sie sind offenbar überzeugt davon, dass der Schuss für Sie bestimmt war. Wir sind nicht ganz so sicher. Aber wenn Sie meinen, dass jemand bereit ist, Sie auf offener Straße zu erschießen, dann brauchen Sie vielleicht …«
»Nein, danke.«
Selma verstummte. Der Gedanke, der ihr unmittelbar nach dem Schuss gekommen war, war verloren gegangen, als sie zum Krankenhaus gefahren und dann sofort operiert worden war. Und bis jetzt hatte er den Morphinnebel nicht durchdringen können.
»Shit«, flüsterte sie.
»Was?«
»Nichts«, winkte sie ab.
Der Zwischenfall in Grünerløkka wurde in den Medien jetzt seit über einem Tag in marktschreierischen Überschriften abgehandelt. Anine, Selmas Tochter, hatte sich trotzdem nicht gemeldet.
»Shit«, formte sie ein weiteres Mal mit den Lippen, aber ohne einen Laut von sich zu geben.
Der Polizist zog eine Tüte Fisherman’s Friend aus der Jackentasche, fischte eine Pastille heraus und schob sie sich mit Wurstfingern in den Mund.
»Sie wollen also keinen Personenschutz. Nein, nein. Darauf können wir ja noch zurückkommen. Wer hat gewusst, dass Sie sich in diesem Café mit Ihren Freundinnen treffen wollten?«
»Was?«
»Sie haben mich gehört. Hatten Sie irgendwem erzählt, dass Sie gerade zu dieser Zeit in gerade diesem Straßencafé verabredet waren?«
Selma deutete ein Kopfschütteln an.
»Nein. Das glaube ich nicht. Also, wir hatten es natürlich untereinander abgemacht.«
Er verzog nicht einmal den Mundwinkel zu einem Lächeln.
»Sind Sie sicher?«
»Ich glaube schon. Oder …«
Sie überlegte.
»Wir haben das am Montag abgemacht«, sagte sie nach einigen Sekunden. »Per SMS. Ich lebe allein, und ich kann …«
Noch eine Pause, ehe sie den Kopf schüttelte.
»Nein. Ich habe sonst mit niemandem über diese Verabredung gesprochen. Nur mit denen, mit denen ich verabredet war.«
»Haben Sie das irgendwo aufgeschrieben?«
»Nein. Nur eben in den SMS.«
»Kein automatischer Terminkalender im Handy?«
»Nein. Ich verstehe ja, warum Sie fragen, aber ich glaube, ich kann beschwören, dass ich es niemandem gesagt habe.«
»Mit wem könnten die anderen gesprochen haben, was denken Sie?«
»Das weiß ich doch nicht.«
Er lutschte laut hörbar seine Pastille.
»Wer kann von diesem Treffen gewusst haben?«
Selma musste sich wirklich zusammenreißen, um ihre Missbilligung nicht laut zu äußern. Er schmatzte munter weiter, und der scharfe Pfefferminzgeruch war in diesem Raum, der ohnehin schon nach Schimmel und Reinigungsmitteln stank, fast nicht zu ertragen.
»Lindas Mann vielleicht. Ingolf. Er wohnt nicht in Oslo, aber soviel ich weiß, hatten sie eine gute Beziehung.«
Selma fiel plötzlich ein, dass sie ihn anrufen und ihm ihr Beileid aussprechen musste. Dieser Gedanken kam ihr wirklich erst jetzt, und für einen Moment war sie unkonzentriert.
»Na gut«, sagte der Polizist und machte mit der Hand eine Kreisbewegung, um sie zum Weiterreden zu bringen.
»Linda ist in der Regel an den Wochenenden nach Hause nach Vestfold gefahren«, sagte Selma nun. »Und sie hat jeden Tag mit Ingolf telefoniert. Soviel ich weiß. Es kann ja sein, dass jemand aus dem Parlament darüber Bescheid wusste. Vielleicht haben die da ein System, nach dem alle mitteilen müssen, was sie machen und wo sie sind. Im Fall von Abstimmungen und so, meine ich. Ich habe keine Ahnung. Das müssen Sie untersuchen.«
»Sitzt Ihr Mann nicht auch im Parlament?«
»Ex-Mann. Doch. Aber ich habe keine Ahnung von diesem Prozedere. Wie gesagt, das müssen Sie untersuchen.«
»Das werde ich. Und Vanja?«
»Die können Sie selbst fragen.«
»Schon, aber jetzt frage ich Sie.«
Selma seufzte.
»Vanja ist mit Kristina verheiratet. Sie leben in einer Symbiose. Sie haben vor zwei Jahren ihren Sohn verloren, und seither war es fast unmöglich, die eine ohne die andere zu irgendeiner Unternehmung zu überreden. Kristina hätte auch mit ins Café kommen sollen, aber sie hatte Halsschmerzen. Übrigens tut mir mein Arm ziemlich weh, deshalb hoffe ich, dass wir dieses Gespräch bald beenden können.«
Nun machte er sich Notizen.
»Ah ja«, sagte er nichtssagend. »Ah ja.«
Plötzlich schaute er auf und blickte ihr genau in die Augen.
»Haben Sie Feinde?«
Selma kniff die Augen zusammen. Sie zögerte.
»Ich glaube, Sie haben recht«, sagte sie anstelle einer Antwort. »Sicher war Linda das Ziel.«
»Warum sagen Sie das? Vor drei Minuten haben Sie über diesen Gedanken noch gelacht, und ich …«
»Sie war trotz allem Parlamentsabgeordnete. Eine wichtige Person. Und wir sind uns einig, dass es ein fähiger Schütze war. Also war es wohl kaum ein Fehlschuss.«
»Wir werden auf alles noch zurückkommen«, sagte der Polizist verärgert. »Bitte, beantworten Sie meine Frage.«
»Welche?«
»Gibt es Leute, die Ihnen schaden wollen? Irgendeine Art von Feinden?«
Selma versuchte, einen gelangweilten Eindruck zu machen. Das war überraschend schwierig. Mehr als alles andere wünschte sie sich, ihre Tochter Anine anzurufen und ihr klar und deutlich zu erklären, dass Linda Bruseth das Ziel des Mörders gewesen war. Selma hatte nur unvorstellbares Pech gehabt. Wie groß war denn die Wahrscheinlichkeit … es würde nicht noch einmal passieren.
»Vor zwei oder drei Jahren hätte ich mit Nein geantwortet«, sagte sie endlich. »Das heißt, mein Ex-Mann und meine Kinder konnten ihre Begeisterung für mich seit einiger Zeit zügeln, aber sie wollen mir bestimmt nichts Böses. Nehme ich an. Ansonsten hatte ich nur Freunde. Keine Feinde. Glaube ich. Aber jetzt?«
Sie schnitt eine Grimasse. Er starrte ihr direkt in die Augen. Unter den buschigen Augenbrauen, die über der Nase in ein tiefes V übergingen, blitzte es. Sein Blick war plötzlich scharf, als ob er bisher versucht hätte, sie in die Irre zu führen, indem er sich als ein anderer ausgab, als er war. Selma schüttelte den Kopf.
»Ich würde unbedingt behaupten, dass ich jetzt Feinde habe, ja.«
Er zuckte nicht mit der Wimper. Selma verspürte ein immer stärkeres Unbehagen. Als ob er im Voraus mit der Oberschwester abgemacht hätte, dass er diese widerliche Besenkammer als Vernehmungsraum nutzen dürfte. Und sie in einen absolut unnötigen Rollstuhl gezwungen worden wäre, um sie schwächer zu machen, als sie in irgendeiner Hinsicht war.
»Abgesehen von einer umfangreichen und geheimen paramilitärischen Organisation«, fing sie an, »mit Mitteln und Waffen und …«
»Zerfurcht/Verwittert wurde im vorigen Jahr zerschlagen. Was Ihnen zu verdanken war.«
»Zerschlagen?«
Es war schwer, nicht wieder zu lachen.
»Sie halten es für möglich, einen solchen Apparat zu zerschlagen?«
»Ja, es hat ja einen Höllenaufstand gegeben, einen Haufen Anklagen, politische Skandale, viele …«
»Sie haben mich gefragt, ob ich Feinde habe«, unterbrach sie ihn. »Ich versuche zu antworten. Zerfurcht/Verwittert war eine Operation. Die Organisation an sich war eigentlich namenlos. Konturlos. Unmöglich zu fassen. Dass es dort draußen immer noch Leute gibt, die mich lieber unter der Erde sehen würden, davon bin ich überzeugt. Außerdem haben Sie noch Dutzende von Leuten in Langlaufnorwegen, die sich freuen würden, wenn es mir richtig schlecht ginge …«
Sie zählte jetzt vorsichtig einige Personen an den Fingern ab, die aus der kreideweißen Schlinge herausragten.
»Die würden sich wohl kaum auf ein Dach legen und auf Sie schießen«, sagte Fredrik Smedstuen. »Es sei denn, es wäre ein Biathlet.«
Zum ersten Mal lächelte er. Seine Zähne waren grau verfärbt.
»Da ist auch noch ein verärgerter Diamantendieb«, sagte Selma ungerührt und hob den linken Zeigefinger. »Aber der sitzt im Gefängnis. Und im Spätwinter, als ich mich endlich nach der kleinen … Bergwanderung des vorigen Jahres wieder bewegen konnte, habe ich bei Telenor einen Angestellten entlarvt, der hohe Summen unterschlagen hatte. Er ist noch immer auf freiem Fuß und wurde zuletzt auf Bali gesichtet. Wird sich sicher so bald nicht wieder nach Hause trauen. Dann haben wir …«
»Sie brauchen nicht Ihre ganzen Fälle durchzusehen. Ich habe schon verstanden.«
»Und dann sind da noch all diejenigen Leute, die ich abgewiesen habe.«
»Abgewiesen? Sie meinen …«
»Nein. Keine Männer. Nicht auf diese Weise. Klienten. Ich habe fünf, sechs Anfragen pro Woche. Mindestens. Ich nehme so ungefähr alle zwei Monate einen Auftrag an. Einige von denen, die unverrichteter Dinge abziehen müssen, sind ganz schön sauer.«
Sie zuckte mit der unversehrten Schulter und fügte hinzu: »Was ich verstehen kann.«
»Woran arbeiten Sie zurzeit?«
»Gerade jetzt sitze ich mit Ihnen in einer Besenkammer und möchte wissen, ob wir bald fertig sind. Mein Arm tut weh, und hier stinkt es.«
Der Polizist seufzte und erhob sich mit einer gewissen Mühe.
»Bleiben Sie erst mal in Oslo. Im Prinzip haben Sie übrigens Anspruch auf einen Anwalt.«
Selma schüttelte den Kopf.
»Nein, danke. Ich komme schon zurecht. Ich bin ziemlich sicher, dass der Mann es nicht auf mich abgesehen hatte.«
Sie merkte, wie viel einfacher es war, zu lügen, als die Wahrheit zu sagen.
»Oder die Frau«, fügte sie rasch hinzu. »Das Geschlecht wissen wir ja streng genommen noch nicht.«
»Rufen Sie mich an, wenn Sie sich einer richtigen Vernehmung gewachsen fühlen. Im Polizeigebäude. Und einer Rekonstruktion des Tathergangs, wie gesagt. Die findet wohl ziemlich bald statt, nehme ich an.«
Er öffnete die Tür. Eilige Schritte, Wortwechsel und vereinzelte Rufe drangen zu ihnen herein. Der ewige Geruch nach Essen aus den Sechzigerjahren hing schwer über dem Gang. Nach der Operation war ihr davon schlecht geworden. Im Vergleich zu den stinkenden Putzlappen war der Geruch von Industriefrikadellen fast schon erfrischend.
Fredrik Smedstuen blieb mit der Pranke auf der Türklinke stehen.
»Sie haben nicht geantwortet«, sagte er.
»Worauf denn?«
»Auf die Frage, woran Sie gerade arbeiten.«
Selma zögerte. Ganz falsch. Eine gute Lüge wurde spontan vorgebracht und war samtweich. Nie zu detailliert, aber auch nicht so kurz, dass sie die Aufforderung zu weiteren Fragen in sich trug. Sie kam wie aus eigener Kraft, ohne Verspätung, präzise und ganz und gar unbeschwert.
»An gar nichts«, sagte sie plötzlich und lieferte ein so strahlendes und blendendes Lächeln, dass sie hätte schwören können, der Polizeibeamte sei errötet.
Der Smiley
Schulter und Oberarm schmerzten wie die Hölle, als Selma Falck endlich vor ihrer Wohnungstür in Sagene stand. Zwischen ihrer und der Tür zur Nachbarwohnung lehnten fünf eingewickelte Blumensträuße an der Wand. Sie ging davon aus, dass die für sie waren. Die Medien hatten ausführlich über den Schuss in Grünerløkka berichtet, DGTV zu allem Überfluss bereits zweiundzwanzig Minuten nach dem Zwischenfall direkt vom Tatort. Das Aufsehenerregende daran, dass eine Parlamentsabgeordnete einem, wie es schien, regelrechten Attentat zum Opfer gefallen war, reichte eigentlich schon aus. Dass sofort Spekulationen aufgekommen waren, nach denen Selma Falck das eigentliche Ziel gewesen war, machte die Sache nur noch pikanter.
Selma stand wie immer im Mittelpunkt. Im Krankenhaus hatte sie sechzehn Blumensträuße zurückgelassen. Es waren keine Vasen mehr vorhanden gewesen, als früh an diesem Tag der letzte geliefert worden war.
Mit der rechten Hand suchte sie in ihrer Handtasche nach den Schlüsseln. Ihre Finger prickelten, und sie wusste, dass das leichte Zittern des rechten Arms nichts mit der Verletzung des linken zu tun hatte. Sie ertappte sich bei dem Wunsch, dass Lupus noch am Leben wäre. Der halb wilde Streuner, der sie vor einem Jahr gerettet hatte, war zwei Wochen nach der Rettung friedlich eingeschlafen. Wärme, ausreichend Futter und Fürsorge nach, wie es sich herausgestellt hatte, einem halben Jahr allein in den Bergen waren für das alte Tier zu viel gewesen.
Lupus hatte auf sie aufgepasst. Jetzt musste sie wieder selbst auf sich aufpassen.
Nach einigem Gefummel steckte der Schlüssel im Schloss, und sie drehte ihn um. Zuerst in diesem Schloss, dann im Sicherheitsschloss. Sie öffnete die Tür einen winzigen Spaltbreit.
Jemand war da gewesen. Schon wieder.
Es gab viele Möglichkeiten, zu überprüfen, ob ein ungebetener Gast in ihrer Wohnung gewesen war. Eine Alarmanlage war natürlich das Einfachste. Schon als sie vor fast zwei Jahren in den Neubau in Sagene gezogen war, war eine installiert gewesen. Nicht gerade State of the Art, aber in Ordnung. Selma hatte auch nie eingesehen, wozu Kameras in der kleinen Wohnung gut sein sollten. Die Alarmanlage war neu und gut genug. Dennoch war sie vor drei Wochen nach Hause gekommen und hatte die unangenehme Gewissheit verspürt, dass jemand dort gewesen war. Bei ihr. In ihrer modernen und sicheren Wohnung, zu der es nur zwei Zugänge gab. Der eine führte durch die Wohnungstür. Der andere über den Balkon, der einzige seiner Art an der glatten Wand; zudem hing er mehr als acht Meter über dem Boden. Keine der beiden Türen wies die geringste Einbruchsspur auf. Dass jemand eine Hausfassade in einer dicht besiedelten Gegend hochgeklettert sein sollte, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, war schwer vorstellbar. Unmöglich, eigentlich. Der Eindringling musste also die Wohnungstür benutzt haben. Was bedeutete, dass diese Person einen Schlüssel hatte. Ins Haus konnte man gelangen, wenn man darauf wartete, dass irgendwer nicht aufpasste und die Haustür hinter sich nicht ins Schloss fallen ließ, aber Selmas Wohnung war etwas anderes. Der Eindringling hätte einen Schlüssel haben und auf irgendeine Weise die Alarmanlage aus- und danach wieder einschalten müssen.
Niemand sonst hatte einen Wohnungsschlüssel, soviel sie wusste. Niemand kannte den Code für die Alarmanlage, soweit ihr bekannt war.
Vor einer gefühlten Ewigkeit, noch bevor sie auf der Hardangervidda fast ihr Leben verloren hatte, hatte sie eine Beziehung zu einem jungen Mann gehabt. Zu einem zu jungen Mann für eine Frau mittleren Alters wie sie. In einem unbedachten Moment hatte sie ihm einen Schlüssel überlassen. Er hatte den Schlüssel zurückgegeben, als sie brutal Schluss mit ihm gemacht hatte, nicht weil sie das wollte, sondern weil es sein musste. Er hatte den Schlüssel einfach eines Tages auf die Kommode in der Diele gelegt und war verschwunden. Den Code für die Alarmanlage hatte sie ihm nie genannt. Als sie Ende Oktober endlich aus dem Krankenhaus entlassen worden war, hatte sie versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ohne Erfolg. Ob es verletzte Eitelkeit oder ein Hauch von ehrlichem Liebeskummer gewesen war, was sie damals gepackt hatte, wusste sie nicht so recht.
Als sie vor drei Wochen dieses unbehagliche Gefühl gehabt hatte, dass jemand heimlich in ihrer Wohnung gewesen war, hatte sie nicht so ganz begriffen, weshalb. Es war über sie gekommen, sobald sie die Wohnung betreten hatte, obwohl alles am selben Platz stand. Jedenfalls, soweit sie sehen konnte. Das Ganze war wie eine paranormale Bewegung, wie der Streif einer fremden Substanz. Kein Geruch, nichts Sichtbares. Eine Art Anwesenheit, hatte sie erkannt, und sie hatte gespürt, wie ihr Puls schneller schlug, als sie weiter ins Schlafzimmer gegangen war.
Auch dort nicht die Spur eines Einbruchs. Irgendwann hatte sie diesen Gedanken dann verdrängt. Im vergangenen Jahr hatte sie sich verändert, war ein wenig ängstlicher geworden, ein bisschen schreckhaft. Auch wenn sie das niemandem zeigte. Sie dachte nun an den Tod. Alles andere wäre seltsam gewesen, denn Selma Falck war im wahrsten Sinne des Wortes nur Minuten vom Jenseits entfernt gewesen, als sie im vorigen Herbst von einer Rettungsmannschaft gefunden worden war.
Vielleicht war es einfach das Alter.
Sie hatte also alles als Einbildung abgeschrieben, bis sie ins Bett gegangen war. Das Bett war nicht gemacht gewesen. Die eine Decke lag als Knubbel auf dem Kissen. Als sie sie hochhob, fiel ihr Blick auf eine Packung Kaugummi.
Eine Packung KIP.
Drei kleine, rechteckige Kaugummistücke, rot, grün und gelb, dicht an dicht in Zellophan gepackt.
Das Kissen war aufgeschüttelt worden, nachdem sie aufgestanden war. Es lag fluffig da, wo es hingehörte, ohne irgendeinen Abdruck ihres Kopfes. In der Mitte, in einer kleinen Vertiefung, die jemand mit zwei Fingern hineingedrückt haben musste, lagen die Kaugummis. Selma Falcks Lieblingssüßigkeit, als sie noch klein gewesen war.
Sie hatte KIP geliebt. Der Geschmack, fruchtig und von viel zu kurzer Dauer, aber auch die Konsistenz waren das viele Kleingeld wert gewesen, das sie zusammenkratzen musste, weil sie kein festes Taschengeld bekam. Die Stücke waren beim ersten Kauen mürbe, fast mehlig, dann sammelten sie sich zu einem perfekten gummiartigen Gleichgewicht zwischen hart und weich. Nach nur wenigen Minuten machte das Kauen in der Regel nur noch müde, und es schmeckte nach nichts mehr, aber die Erinnerungen an diese ersten Sekunden mit einem KIP waren dermaßen intensiv, dass sie beim bloßen Anblick einer Packung einen schwachen Krampf im Kiefer verspürte.
Diese kleine Süßigkeit wurde seit vierzig Jahren nicht mehr hergestellt.
Selma hatte seit damals keine Packung mehr gesehen.
Aber nun lag eine hier, auf ihrem eigenen Kopfkissen.
Einige Sekunden totaler Verwirrung wurden von einer ihr fremden Angst abgelöst. Diese war so heftig in sie gefahren, dass sie nicht einmal gewagt hatte, die Packung aufzuheben. Viele Minuten lang hatte sie sie nur angestarrt. Am Ende hatte sie Decke und Kissen von der anderen Seite des Bettes genommen und sich aufs Sofa gelegt. Ohne schlafen zu können.
Es gab nur zwei Menschen auf dem Erdball, die wissen konnten, dass Selma Falck als kleines Mädchen für eine Packung KIP Feuer und Wasser getrotzt hätte. Vanja Vegge, ihre älteste Freundin, und Selmas kleiner Bruder Herman.
Vanja war natürlich nicht in Selmas Wohnung eingebrochen, ohne Spuren zu hinterlassen. Sie hatte keinen Schlüssel, und sie kannte den Code nicht. Und Herman war seit vielen Jahren tot.
Nach einer schlaflosen Nacht hatte sie den Gedanken aufgegeben, die Polizei anzurufen. Mit ihrer Geschichte hätten die den Zwischenfall sicher ernst genommen, trotz der kuriosen Drohung, aber bei genauerem Nachdenken war Selma zu dem Schluss gekommen, dass hier von einer Drohung wirklich nicht die Rede sein konnte. Es ging um eine Packung Kaugummi, die ihr Verfallsdatum schon ewig überschritten hatte. Es konnte sich nur um einen absurden Scherz handeln. Nichts war passiert, außer dem Schrecken und dem Unbehagen, das sie empfunden hatte. Selma hatte Wochen und Monate gebraucht, um bei den Ermittlungen, die auf die Entlarvung von Zerfurcht/Verwittert gefolgt waren, alles zu erklären. Die Lust, das Polizeigebäude schon wieder zu betreten, hielt sich in Grenzen. Als das Tageslicht durch den Spalt im Wohnzimmervorhang drang, hatte sie keine Angst mehr.
Dennoch hatte sie mit dem Kartoffelmehl angefangen. Eine hauchdünne Schicht auf dem hellen Eichenboden vor der Tür, ehe sie hinausging, die Tür hinter sich zuzog und abschloss.
Drei Wochen lang hatte sie das gemacht, ohne neue Hinweise auf ungebetene Gäste zu finden. An den letzten Tagen vor dem Attentat hatte sie anderes zu tun gehabt, und die vielen Blumensträuße hätten sie fast alle Vorsicht vergessen lassen, als sie hineinging. Zum Glück fiel es ihr noch ein, ehe sie die Tür aufschloss.
Jemand war in das Kartoffelmehl getreten. Selma musste in die Hocke gehen, um den unvollkommenen Fußabdruck sehen zu können. Eine kaum sichtbare Schuhspitze. Als sie die Brille tiefer auf die Nase schob und die Spur genauer musterte, fuhr sie so heftig zusammen, dass sie nach hinten kippte. Ihr Hals war wie zugeschnürt. Sie musste mit offenem Mund atmen. In ihrem Kopf wirbelte alles durcheinander, als sie es endlich wagte, sich auf die Knie zu erheben und sich alles noch einmal anzusehen.
Sie hatte sich nicht geirrt.
Die Schuhspitze hatte ein Zickzackmuster in das Kartoffelmehl gezeichnet. Das war an sich schon beängstigend. Schlimmer war jedoch der Smiley daneben. Er war vielleicht fünf Zentimeter im Durchmesser und mit etwas gezeichnet, das dünner war als ein Finger.
Selma hörte auf zu atmen, als sie sah, dass der Smiley frech mit dem einen Auge zwinkerte.
Die Trauerfeier
Die sozialdemokratische Parlamentsfraktion hatte beschlossen, die Trauerfeier so unauffällig zu gestalten wie überhaupt nur möglich.
Linda Bruseth war ein Name, der außerhalb ihres Heimatbezirks kaum bekannt war. Der Weg auf die Vestfold-Bank im Parlament hatte überschaubar angefangen. In einer kleinen Stadt im Binnenland war sie immer wieder zur Vorsitzenden der Elternvertretung gewählt worden, durch eine Kinderschar aus fünf Jungen hindurch. Das machte insgesamt mehr als fünfzehn Jahre, und als der Jüngste ihr zuwinkte, um in die Großstadt überzusiedeln, war ihr Dasein unerträglich grau geworden. Sie suchte sich etwas anderes, um ihre leeren Tage zu füllen. Nach einem Engagement in einer erfolgreichen Bürgerinitiative gegen die Enteignung von drei Grundstücken, die einem Windpark oben in der Heide weichen sollten, war sie bei der Gemeinderatswahl auf der Liste der Sozialdemokraten gelandet. In der Geborgenheit der Kleinstadt leistete sie großartige Arbeit. Sie kannte alle, und alle mochten sie, Parteigenossen wie Gegner. Groß und schwer und doch athletisch, so war sie immer gewesen. Eine patente Frau, hieß es über Linda Bruseth, eine Brückenbauerin der alten Sorte.
Immer ein Lächeln und eine Krone übrig.
Als im Herbst 2015 die Flüchtlinge ins Land strömten, griff Linda zu energischen Maßnahmen. Ein altes Gebetshaus und ein eben erst stillgelegtes Pflegeheim wurden innerhalb von zwei Wochen zu Wohnheimen für Asylbewerber umgebaut. Der Ort breitete die Arme aus und nahm Syrer und Afghanen mit Wärme und Begeisterung auf. In einem Aufwasch wurden zwanzig dringend benötigte Arbeitsplätze im Ort geschaffen. Das Ganze fiel so effektiv, inkludierend und erfolgreich aus, dass Linda Bruseth, die treibende Kraft bei diesem Projekt, in die wichtigste Talkshow des NRK eingeladen wurde. Am Tag vor Heiligabend 2015, eingehüllt in den Duft nach frisch gebratenen Schweinerippchen, umgeben von Weihnachtsliedern und geschmückten Bäumen, saßen Linda und zwei reizende Jungen aus Syrien nebeneinander und lächelten.
Warmherzig, wurde in den sozialen Medien geschrieben.
Endlich eine sozialdemokratische Politikerin mit Mitgefühl, schrieben andere.
Mich würde sie auf jeden Fall zur Partei zurückholen, schrieben ziemlich viele.
Linda Bruseth war etwas sehr Seltenes: eine ergebnisorientierte Politikerin. Im Laufe des Jahres 2016 wuchs ihre Popularität in ihrem Regierungsbezirk stetig an, und zu Beginn des folgenden Jahres wurde sie auf einem sicheren Listenplatz für die Parlamentswahlen später im Jahr aufgestellt. Um schließlich vollständig in Vergessenheit zu geraten, nachdem sie dann gewählt worden war.
Sie wurde in eine Abteilung im Justizausschuss gesteckt, ohne eine Ahnung von Jura zu haben. Sie war an gesunden Bauernverstand und energisches Handeln in einem vertrauten Milieu gewöhnt, nicht an meterweise Dokumente in der Großstadt. Sie fühlte sich in ihrer neuen Rolle so wenig wohl, dass sie sich so rasch wie möglich umplatzieren ließ, und der nächste Stopp war der Landwirtschaftsausschuss. Auch dort fand sie sich nicht zurecht. Zum ersten Mal in ihrem Leben erzählte sie in aller Öffentlichkeit von ihrer Schwäche. Sie litt unter Legasthenie. Über fünfzig Jahre lang war sie mit ihren geheimen Lese- und Schreibproblemen hervorragend zurechtgekommen, aber jetzt machten diese ihr wirklich zu schaffen. Nur wenige Monate vor dem Ende der vierjährigen Legislaturperiode, von der alle jetzt wussten, dass sie ihre erste und letzte sein würde, wurde sie in den Familien- und Kulturausschuss abgeschoben.
Dort ging es ihr ein kleines bisschen besser.
Mit Kindern kannte die fünffache Mutter sich aus. Und mit Sport ebenfalls. Kultur dagegen war nicht gerade ihre Stärke, und noch immer machte ihr das Lesen Probleme.
In der Statistik der redseligen Abgeordneten stand sie ganz unten.
Und jetzt war sie tot. Erschossen in einem Café, weil sie einer für die viel profiliertere Selma Falck bestimmten Kugel in die Bahn geraten war.
Die Partei hatte sich für die kurze Trauerfeier die Wandelhalle ausgesucht, einen Saal mitten im Parlamentsgebäude, der zu dem Zweck gestaltet war, den der Name verriet; ein Raum, in dem man hin und her wandeln konnte. Er wurde zwar auch zu vielen anderen Zwecken benutzt, zu offiziellen und inoffiziellen Gesprächen, und nicht zuletzt war dort das Jagdrevier der Presse, wann immer ein politischer Sturm heraufzog und die Politiker sich am liebsten verkrochen hätten.
Einzelne Stimmen hatten sich vorsichtig für den Gruppenraum der sozialdemokratischen Partei ausgesprochen. Das wäre ein kleines bisschen passender, meinten sie. Persönlicher und intimer. Es hätte auch Linda Bruseths Zugehörigkeit zur Partei stärker betont, wurde behauptet. Diese Einwände wurden ohne weitere Diskussion abgebügelt.
Das hier war etwas, das eben getan werden musste. Die anonymste Vertreterin der Partei sollte kurz geehrt werden, aber ohne mehr als ein Minimum an Kommentaren zu ihrer misslungenen Parlamentskarriere zu gestatten. Die Presse ging gewöhnlich mit toten Politikerinnen und Politikern viel freundlicher um als mit lebenden, aber schon waren in den sozialen Medien Gemeinheiten zu finden, von denen die Familie doch lieber verschont bleiben sollte.
Lars Winther, Nachrichtenjournalist bei Aftenavisen, stand in einem der großen Bogengänge vor den Türen zum Plenarsaal. Er war allein gekommen, ohne Fotograf. Bestimmt könnte irgendein Bilderdienst aushelfen. Er war stocksauer, weil er Selma Falck nicht hatte besuchen dürfen. Nachdem sie ihm vor einem Jahr das beste journalistische Geschenk aller Zeiten in den Schoß geworfen hatte, war ihre Freundschaft noch enger geworden. So eng, dass der Chefredakteur ihm keinerlei professionellen Kontakt zu ihr erlaubte.
Stattdessen musste er sich jetzt anhören, wie der Fraktionssprecher vor der spärlichen Versammlung eine Gedenkrede herunterleierte. Der Politiker hatte tief in der Vergangenheit der Kollegin gegraben, um einige geeignete und einigermaßen wahre Lobesworte zu finden. Neben ihm stand ein kleiner Tisch mit einer brennenden Kerze und einer Kondolenzliste, in die sich noch niemand eingetragen hatte. Als er fertig war, kritzelte er einen kurzen Gruß hinein und überließ das Mikrofon dem ältesten Vertreter aus Linda Bruseths Heimatbezirk. Der setzte zu einer Rede an, die zumindest zu Anfang um einiges herzlicher war als die vorige. Aber er hatte die verstorbene Politikerin auch mehr als zwanzig Jahre lang gekannt. Lieb war das Wort, das in jedem zweiten Satz auftauchte.
Lars Winther verspürte einen Stups im Rücken. Gereizt fuhr er herum.
»Hallöchen«, murmelte ein Kollege von NTB. »Hier ’s nix los, siehste doch. Müsste viel mehr Gedöns gemacht werden, wenn ’ne Abgeordnete umgebracht wird. Das hier ’s doch bloß peinlicher Kleinkram. Wer sterben sollte, war Selma Falck. Nicht Linda Bruseth.«
Der Redner verstummte jählings. Eine vage Verwirrung verbreitete sich in der Versammlung. Lars trat einen Schritt aus der Halle hinaus und schaute sich um. Vom anderen Ende der Wandelhalle kam die Parlamentspräsidentin, die streng genommen bei der Trauerfeier hätte zugegen sein müssen, mit energischen Schritten auf sie zu. Hinter ihr gingen vier Männer und eine Frau, die Lars nicht kannte. Ihr Gang, ihre Blicke und die Tatsache, dass sie fast im Gleichtakt miteinander einherschritten, machten ihm jedoch sofort klar, wer sie waren.
»Die Polizei hat immerhin ihre Zweifel«, sagte er leise zu dem überzeugten Kollegen. »Für die liegt hier nicht alles auf der Hand. Sie wollen Linda Bruseths Büro durchsuchen.«
Der Friedhofswanderer
Es war spät, und die Dunkelheit hatte sich bereits vor mehreren Stunden über Oslo gesenkt. Ein leichter Regen fiel aus der bleischweren Wolkendecke. Der Gehweg war glitschig vom feuchten Laub. Obwohl die Tage noch immer warm sein konnten, war die erste Frostnacht wohl nicht mehr fern. Der Mann kam von Westen her auf den Friedhof zu, und er hatte den Hauptweg durch eine Unterführung passiert. Das linke Knie schmerzte weniger als sonst. Er versuchte, mit gleichmäßigen Schritten zu gehen, ohne zu hinken. Wenn er das rechte Bein zu sehr belastete, würde auch das wehtun.
Kein Mensch war zu sehen.
Er ging langsam zwischen den Gräbern weiter. An einzelnen Stellen hatten die Hinterbliebenen batteriebetriebene Lichter aufgestellt, die eine düstere, unbehagliche Stimmung hervorriefen. Er selbst hatte wie immer ein Grablicht in der Tasche, zusammen mit Streichhölzern und einer Packung Zigaretten. Er blieb für einen Moment stehen, fischte eine Zigarette heraus und stellte sich in den Schutz einer Eiche, während er die Hände um das angerissene Streichholz krümmte.
Sie hätten aufhören müssen, alle beide. Er und Grethe. Im Laufe der Neunzigerjahre hatten immer weniger in ihrer Umgebung geraucht. Doch sogar, als bei seiner Frau 2002 Lungenkrebs attestiert wurde, der bereits gestreut hatte, rauchten sie weiter. Grethe konnte auf die Zigaretten einfach nicht verzichten, und da hätte es für ihn doch auch keinen Sinn gehabt, das zu tun. Er war ja ohnehin meistens verreist.
Nach ihrem Tod im folgenden Jahr ging er dazu über, nur noch heimlich zu rauchen. Außerdem hörte er auf zu trinken. Nicht, dass Alkohol jemals ein Problem für ihn gewesen wäre, aber als er seine Frau begraben musste, verlor er alle Freude an einem oder zwei Gläschen. Stattdessen schob noch der kleinste Drink ihn in eine Finsternis, aus der er nur mit immer größeren Schwierigkeiten wieder hinausklettern konnte. Also hörte er auf, so wie er in seinem dumpfen Schmerz über sein Dasein als Witwer fast mit allem aufhörte.
Abgesehen von den heimlichen Zigaretten.
Und dann war da noch seine Arbeit. Er machte weiter, bis er fünfundfünfzig war, dann wurde ihm von seinem bisherigen Arbeitgeber ein üppig vergoldetes Abschiedsangebot gemacht. Er hatte darüber hinaus wirklich genug zu tun, denn er verfügte über ein gefragtes Sachwissen. Auf dem sozialen Sektor sah es nicht so gut aus. Grethe war die Gesellige gewesen. Sie hatte sich zu Hause um alles gekümmert, um das Haus und die Familie und das Zusammensein mit anderen, um den Jungen und den Garten und die Finanzen und alles, was zum Familienleben dazugehörte.
Das Dasein hatte eine etwas zu rasche Wendung genommen, als sie krank geworden und gestorben war. Er war nur mit knapper Not hindurchgekommen, ohne in den Graben zu fallen. Noch immer, so viele Jahre später, war er niemals richtig froh. Das Leben wurde sepiabraun, aber es lag noch immer ein kurzer Trost im allerersten Zug an einer frisch angezündeten Marlboro. Die Glut leuchtete warm, als er einen Lungenzug machte und weiterging.
Der Grabstein aus Marmor war klein, niedrig und grob behauen. So hatte sie es haben wollen, seine Grethe. In einem dicken Briefumschlag auf dem Nachttisch neben dem Bett, in dem sie ihren letzten Atemzug getan hatte, hatten Anweisungen gelegen. Der Inhalt war nüchtern gewesen, und vor allem praktisch. Es ging um die Papiere für das Haus und die Reserveschlüssel für die Hütte, um Versicherungsunterlagen, den Familienschmuck und die Abmachung mit den Nachbarn über die gemeinsame Nutzung eines Weges, aus der dann nichts geworden war. Dennoch las er zwischen den Zeilen auch hier und da tiefe Liebe heraus, Zusammenhalt und einundzwanzig gute Jahre der Geborgenheit.
Sie lag ganz am Rand, seine Grethe. Ganz am Rand und am unteren Ende eines von Schwerverkehr und Kleinindustrie umgebenen Friedhofs. Der Stein neigte sich ein wenig nach Südwesten, zum Fjord hin, als ob er Heimweh nach seiner Heimat Italien hätte.
Ihr Name stand auf einer Bronzeplakette. Die Buchstaben waren in Reliefschrift in eine kleine Platte eingeprägt, die mit Schrauben an der größeren befestigt war. Das Ganze hatte etwas Unnorwegisches. Üblich war, Namen und Daten in den Stein einzumeißeln. Aber auch das hatte seine Frau vor ihrem Tod entschieden. Vielleicht hatte sie das irgendwo im Ausland gesehen.
Trotz der Schmerzen, die ihm Tränen in die Augen trieben, ging er in die Hocke. Dreißig Kniebeugen pro Tag waren noch immer seine Routine, aber viel besser wurde davon gar nichts. An dem Tag, an dem er die Morgengymnastik ausfallen ließ, würde allerdings alles zu Ende sein. Er würde diese Übung dann niemals wiederholen können. Es war unvorstellbar, sich einfach so verfallen zu lassen. Von den kleinen Dingen, die den Alltag noch immer von einem Datum zum anderen vergehen ließen, gehörte die Befriedigung, sich in Form zu halten, zu den wichtigsten.
Seine Finger wanderten über die eiskalten Buchstaben. Die Bronzeplatte, die vor wenigen Wochen noch tiefgrün gewesen war, fast schwarz an einzelnen Stellen, war kürzlich blank und golden poliert worden. Unter Grethes Namen war Platz für einen weiteren geschaffen worden. Er war selbst hier gewesen, als der Steinmetz die Platte wieder angebracht hatte.
Die Stelle unter der großen Ulme war zu einem Grab für zwei geworden.
Der untere Name war noch nicht angebracht worden. Der Steinmetz war überrascht gewesen, als der Witwer es abgelehnt hatte, die zweite Platte anzubringen. Dienstbeflissen und schweigend hatte er dem Befehl gehorcht und ihm die kleine Platte mit Namen, Geburts- und Sterbedatum überreicht. Die lag jetzt zu Hause. Sie würde dort liegen, in Seidenpapier gewickelt in Grethes alter Nachttischschublade, bis alles vorüber wäre. Bis alles vollbracht und das Atmen wieder möglich wäre.
Das war das Einzige, was er sich im Leben jetzt noch wünschte: die Luft tief in die Lunge zu ziehen und sie langsam wieder entweichen zu lassen. Wieder und wieder. Zu spüren, wie der lebensspendende Sauerstoff durch die vielen Muskeln im Körper transportiert wurde und ihn dazu brachte, sich lebendig zu fühlen. Was dann passieren würde, wusste er nicht. Es spielte keine Rolle. Er hatte in seinem Leben zweifellos unverzeihliche Fehler begangen, aber viel größeres Unrecht war ihm und seiner kleinen Familie angetan worden.
Zu groß war sein Verlust gewesen.
Hätte Grethe nur leben dürfen, dann sähe die Welt anders aus.
Er murmelte einige Wörter und richtete sich langsam auf, zündete das mitgebrachte Grablicht an und stellte es in das nasse, tote Gras. Vielleicht sprach er ein Gebet. Er war sich nicht ganz sicher. Er wandte sich wohl eher an Grethe als an Gott. Am Ende drehten sich seine Gedanken im Leerlauf.
Wieder fischte er eine Zigarette hervor und ging langsam den Weg zurück, den er gekommen war.
Sonntag, 8. September
Der Helfer
»Wie kann ein Smiley zwinkern? Hat der sich bewegt?«
Einar Falsen wischte sich die gelblich verfärbten Hände an den Hosenbeinen ab und setzte sich auf sein uraltes Sofa. Ein Kater sprang ihm liebevoll schnurrend auf die Knie und begann, Käseflips-Fett von den Fingern seines Besitzers zu lecken.
»Natürlich nicht«, sagte Selma Falck gereizt und knallte eine große Aktentasche auf den Couchtisch, ehe sie in einem wackligen Sessel Platz nahm. »Das eine Auge war so gezeichnet. Geschlossen. Als ob das Gesicht zwinkerte.«
Sie demonstrierte das und versuchte dabei, den schmerzenden Arm anders zu positionieren.
»Nimm die hässliche Perücke ab«, sagte Einar. »Und was ist das da?«
Selma riss sich die Perücke vom Kopf und stopfte sie in die Handtasche. Die vielen Jahre, in denen sie verkleidet Oslos illegale Spielhöllen aufgesucht hatte, hatten ihr eine ansehnliche Auswahl an Perücken, Brillen und Kopfbedeckungen beschert. Das Bedürfnis danach, nicht erkannt zu werden, war jetzt mindestens ebenso groß. Sie hatte längst gelernt, ihren Gang zu variieren, und sie hatte den frisch operierten Arm in einen Jackenärmel gezwungen, ehe sie durch die Kellergarage gegangen war, statt die übliche Haustür zu benutzen. Danach hatte sie die knappe Viertelstunde zu Einar Falsens kleiner Wohnung zu Fuß zurückgelegt. Sosehr sie auch hoffte, dass Linda Bruseth das Ziel des Attentäters gewesen war, so konnte sie doch nicht sicher sein. Deshalb ergriff sie ihre Vorsichtsmaßnahmen.
»Das«, sagte Selma und legte eine flache Hand auf den Papierstapel, der vor ihr lag, »sind alle Fälle, mit denen ich zu tun hatte, seit ich als Anwältin aufgehört und als Privatermittlerin angefangen habe.«
Sie schob den Stapel einige Zentimeter auf ihn zu.
»Was soll ich damit?«, fragte Einar.
Der ehemalige Polizist starrte den Stapel skeptisch an.
»Du sollst jeden Fall ganz genau durchgehen«, sagte Selma.
»Warum?«
»Weil …« Gereizt erhob sie sich, knüllte die übel riechende, leere Käseflips-Tüte zusammen und ging in die Küche, um sie wegzuwerfen.
»Hast du nichts von dem begriffen, was ich dir am Telefon erzählt habe?«, fragte sie laut.
»Du kannst froh sein, dass ich überhaupt ans Telefon gegangen bin, als du angerufen hast. Ich bin ja gewaltig zusammengezuckt. Du sollst das doch nur im Notfall verwenden, hab ich gesagt. Viele Male schon.«
»Das hier ist ein Notfall. Ich bin angeschossen worden.«
»Überlass die Sache der Polizei. Die werden das schon klären.«
Selma ging zurück und setzte sich. Ihr Blick ruhte auf dem Mann auf der anderen Seite des dreibeinigen, schiefen Couchtisches. Er machte gerade eine gute Phase durch. Aß nicht nur Käseflips, auch wenn sein Verbrauch noch immer groß war. Soweit sie wusste, nahm er die ihm verschriebenen Antipsychotika. Nach zwei Jahrzehnten als Obdachloser hatte es ihm gutgetan, ein festes Dach über dem Kopf zu haben. Selbst wenn es nur eine Wohnung wie diese hier war. Sie war zugig und feucht, was er dadurch ausglich, dass er sämtliche Heizkörper rund um die Uhr voll aufdrehte.
»Hier drinnen ist es heiß wie in einer Sauna«, seufzte sie und zupfte an ihrem Pulloverausschnitt.
»Gerade richtig«, sagte Einar lächelnd und legte sich den Kater an die Schulter. »Miez findet das auch.«
Einars Zustand hatte sich im vergangenen Jahr ganz eindeutig gebessert. Er war jetzt so gesund, dass er sie fast immer Selma nannte und nicht Mariska, nach einer Schauspielerin aus den USA, mit der sie nach allgemeiner Auffassung Ähnlichkeit hatte.
Viel zu viele Jahre lang hatte Selma ihn mindestens einmal in jeder dunklen Jahreszeit mit vierzig Grad Fieber und röchelnder Lunge in die Notaufnahme bringen müssen. Im vergangenen Winter jedoch hatte er sich durchgehangelt, ohne auch nur ein einziges Mal ernsthaft krank zu werden. Mit seinem physischen Zustand besserte sich auch der psychische. Noch immer litt er unter Zwangsvorstellungen über alles, von tödlicher elektrischer Energie bis hin zu der Überzeugung, das Land sei einem totalitären, alles überwachenden und geheimen Regime unterworfen. Welches natürlich von der CIA gesteuert wurde. Die ganze Geschichte mit Zerfurcht/Verwittert war da keine Hilfe gewesen. Noch immer konnte er von furchtbaren Ängsten und Verschwörungsideen gepackt werden. Aber diese Phasen waren zusehends seltener und dauerten nie mehr so lange wie früher. In den letzten Wochen hatte er sich fast normal verhalten. Er hielt die Wohnung einigermaßen sauber und duschte immerhin zweimal pro Woche. Einar Falsen wirkte zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten zufrieden mit sich und der Welt.
Bei Selma sah es nicht so gut aus.
Sie war müde. Es war nicht mehr so leicht, die Fassade aufrechtzuerhalten. Das Nahtod-Erlebnis des vergangenen Jahres hatte ihr stärker zugesetzt, als sie sich eingestehen mochte. Solange sie sich zurückerinnern konnte, vermutlich schon als Kind, hatte sie sich im Spagat zwischen der, die sie eigentlich war, und ihrem Außenbild befunden. So hatte sie ihr Leben führen wollen. Viel von dem ewig Rastlosen in ihr war zu positiver Energie geworden. Sie schaffte eine Menge. Die Unruhe, die übrig blieb, hatte sie spielsüchtig gemacht, was sie erst vor zwei Jahren um ein Haar in den vollständigen Ruin getrieben hätte.
Aber nicht ganz: Selma Falck kam immer wieder auf die Beine.
Der Ruhm von damals, als sie zu den weltbesten Handballspielerinnen gehört hatte, war mit der Zeit durch stetig wechselnde Aufmerksamkeit ersetzt worden. Zuerst als Anwältin. Es kam oft vor, dass sie Mandanten explizit annahm oder abwies, je nachdem, wie viel Aufmerksamkeit der Fall ihr einbringen könnte. Sie war immer in der politischen Mitte gesegelt, mit der ihr ganz eigenen Fähigkeit, mitten im allgemein Akzeptablen auf den Füßen zu landen, wenn sie ein seltenes Mal zu einer politischen Äußerung aufgefordert wurde.
Selma provozierte niemanden.
Bald würde es keine Promi-Show mehr geben, an der sie nicht teilgenommen hatte. Sie hatte mehrere dieser TV