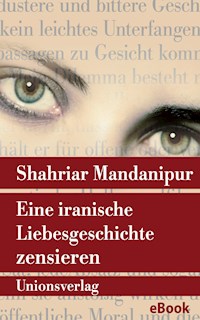
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein iranischer Schriftsteller ist es leid, immer nur düstere Romane mit tragischem Ausgang zu schreiben. Also beginnt er eine Liebesgeschichte – ein Projekt mit Tücken. Denn wie ein mächtiger Schatten wacht Herr Petrowitsch, der Zensor, über jedes Wort und liest sogar die Gedanken des Schriftstellers zwischen den Zeilen. Also müssen Sara und Dara, das junge Paar aus Teheran, tausend Listen und Tricks ersinnen, um sich zu finden. Ihre Liebe muss sich bewähren gegen Anfeindungen und Gefahren, nicht zuletzt gegen die Verdikte des Zensors, der dem Schriftsteller genau dann in die Tasten fällt, wenn die Zauberkraft der Liebe ihre Wirkung zeigt. Wird es dem Schriftsteller gelingen, die Geschichte von Sara und Dara zu einem glücklichen Ende zu bringen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Ein iranischer Schriftsteller ist es leid, immer nur düstere Romane mit tragischem Ausgang zu schreiben. Also beginnt er eine Liebesgeschichte – ein Projekt mit Tücken. Wird es ihm gelingen, die Geschichte von Sara und Dara zu einem glücklichen Ende zu bringen, während der Zensor ihm doch beim Schreiben im Nacken sitzt?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Shahriar Mandanipur (*1957) studierte Politikwissenschaften und war Soldat im iranisch-irakischen Krieg. Über zehn Jahre lang war er Chefredakteur einer Literaturzeitschrift. Mehrere Gastprofessuren führen ihn immer wieder in die USA, wo er zeitgenössische iranische Literatur und Film unterrichtet.
Zur Webseite von Shahriar Mandanipur.
Ursula Ballin, geboren 1939 in Hamburg, wuchs in England und Finnland auf. Viele Jahre verbrachte sie in China und Taiwan, zuletzt als Professorin für Geschichte in Taipeh. Sie arbeitet als freie Übersetzerin.
Zur Webseite von Ursula Ballin.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Shahriar Mandanipur
Eine iranische Liebesgeschichte zensieren
Roman
Aus dem Englischen von Ursula Ballin
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Erstausgabe dieses Romans erschien in englischer Sprache unter dem Titel Censoring an Iranian Love Story. Die Übertragung aus dem Persischen erfolgte durch Sara Khalili.
Auf Wunsch des Autors wurde die deutsche Fassung aus dem Englischen übersetzt.
Die Übersetzerin dankt Bahman Nirumand für zahlreiche hilfreiche Hinweise.
Die Übersetzung aus dem Englischen wurde mit Mitteln der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V.
Originaltitel: Censoring an Iranian Love Story (2009)
© by Shahriar Mandanipur 2008
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Alexander Hafemann (Montage)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30714-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 28.05.2024, 09:28h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
EINE IRANISCHE LIEBESGESCHICHTE ZENSIEREN
Nieder mit der Diktatur!Nieder mit der Freiheit!Bārān und DanielZensierte HodenDer abgrundtiefe BrunnenIch wäre lieber Spatz als SchlangeIch liebe dich, aber ich will dich nie wiedersehenDer BartBitterwasserDer Mann aus BronzeDie Araber kommenStaubgefäße der DamaszenerroseEin Gatte mit drei FrauenAvenue MirdamadEine Kobra am FensterDie Assassinen in TeheranWie eine FliegeDavālpāNarrenfreiheitSchuld und SühneTeherans Schneekönigin»Kanarienvögel, geröstet auf einem Feuer von Lilien und Jasmin …«MördergasseDie Hochzeit»Und Blumenduft erfüllt mein Bett, seit ich erwacht …«WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Shahriar Mandanipur
Shahriar Mandanipur: Mein Weg
Helena Drakakis: Verbotene Früchte
Über Ursula Ballin
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Shahriar Mandanipur
Zum Thema Iran
Zum Thema Arabien
Zum Thema Asien
Zum Thema Liebe
Für Robert Coover, Karen Kennerly, Sara Khalili, James Kimmel und Jane Unrue, ohne deren Vertrauen und Unterstützung ich diesen Roman nicht hätte schreiben können.
Die Mär von einem, der eine Landkarte fand, welche zu einem Schatz führte: Dass man sich zum Tore hinaus aufmache bis an den Ort, woselbst eine Kuppel steht; dass man dieser den Rücken zukehre, sein Antlitz gen Mekka wende und einen Pfeil aussende; wo aber der Pfeil niederfalle, dort liege ein kostbarer Schatz verborgen. Da ging er hin, und Pfeile schoss er so viele an Zahl, dass er schier verzagte, denn er fand nichts. Und die nämliche Kunde kam an den König, weit schießende Bogenschützen hieß er Pfeile schießen, jedoch wahrhaftig fanden auch sie nichts. Da wandte jener sich an den Heiligen, und es ward ihm offenbart, dass wir nicht gewiesen seien, die Bogensehne zu spannen. Den Pfeil an den Bogen setzte er, und dieser fiel am selbigen Ort vor ihm nieder.
Rumi, Die Geschichte des Schams-e Tabrizi (1244–1273)
Nieder mit der Diktatur!Nieder mit der Freiheit!
Teherans Luft ist erfüllt vom Duft der Frühlingsblüten und Abgase, von giftigen Düften aus Tausendundeiner Nacht, sie umschlingen, vereinigen sich, sie flüstern sich Geheimnisse zu. Die Stadt treibt durch die Zeiten …
Auf der Straße der Freiheit vor dem Haupteingang zur Teheraner Universität haben sich Studenten zum Protest versammelt. Mit erhobenen Fäusten rufen sie: »Nieder mit der Knechtschaft!« Auf der gegenüberliegenden Straßenseite rufen Mitglieder der Partei Gottes mit geballten Fäusten und vielleicht mit Ketten und Schlagringen in den Taschen: »Tod den Liberalen!«
Die Bereitschaftspolizei, eine Spezialeinheit gegen Aufruhr, bewaffnet mit modernstem, im Westen gekauftem Zubehör einschließlich Elektroschockknüppeln, hat sich vor den Studenten in Stellung gebracht. Bevor es zur Schlägerei kommt, versuchen die Gegner, einander zu überschreien. Schweißüberströmte Gesichter … Speichel sprühende, aufgerissene Münder … Zum Himmel gereckte Fäuste … Doch der Himmel schweigt und lässt kein Wunder geschehen.
Vielleicht liegt es an diesen Fäusten, dass vom heiligen Himmel Irans niemals ein Wunder herabsteigt. Seit hundertundeinem Jahr, seit der ersten Revolution für Demokratie, werden so die Fäuste von Gottesmännern in den Himmel über dem Iran gereckt, beim Gebet, unter Tränen, mit frommen Klagen; und ich glaube, kein anderes Land fleht so inständig um den baldigen Anbruch des Auferstehungstags.
Nicht weit davon entfernt auf dem Gehweg steht ein Mädchen vor dem Stahlgitter über der einen Meter hohen Mauer um die Teheraner Universität. Anders als die meisten Mädchen der Welt, doch wie die meisten Mädchen im Iran trägt es ein schwarzes Kopftuch und einen langen schwarzen Kittel, der es von Kopf bis Fuß verhüllt. Es ist so schön wie alle Mädchen in den Liebesgeschichten der Welt und des Irans, so schön wie jedes Mädchen gern selbst wäre, das solche Geschichten liest. Wenn die Geister jener Poeten, die vor Jahrhunderten starben, Hand in Hand mit den Geistern der noch ungeborenen Dichter durch Teherans Straßen wandeln – im Gegensatz zu den Lebenden gehen sie in der großen Demokratie des Jenseits freundschaftlich und tolerant miteinander um –, werden sie die großen schwarzen Augen des Mädchens poetisch mit den traurigen Augen der Gazelle vergleichen. Eine alte Metapher für ein orientalisches Augenpaar, das schon Lord Byrons Herz eroberte, und Arthur Rimbauds ebenso. Doch im Blick dieses Mädchens liegt ein rätselhafter Ausdruck, der zu dem klassischen Vergleich nicht recht passen will. Als hätte er die Macht, durch die Zeiten zu blicken, die goldenen Mauern der Harems zu durchdringen, ja selbst die Firewalls und Filter des Internets.
Allerdings sieht das Mädchen nicht voraus, dass es in genau sieben Minuten sieben Sekunden, auf dem Siedepunkt der Zusammenstöße von Studenten, Polizei und den Leuten der Partei Gottes, im Chaos von Kampf und Flucht, mit großer Wucht gestoßen wird, hintenüberfällt, mit dem Kopf gegen eine Zementkante schlägt und seine traurigen orientalischen Augen für immer schließt.
Das Mädchen erregt die Aufmerksamkeit jener geheimnisvollen Personen, die wie bei jeder Kundgebung von diskreten Winkeln aus das Geschehen überwachen und die Identität der Anwesenden feststellen. Sie weisen einander auf die junge Frau hin. Einer von ihnen fotografiert und filmt sie höchst professionell.
Ich weiß: Dieses Mädchen gehört keiner politischen Partei an, und doch hält es schüchtern ein Plakat, worauf steht:
NIEDER MIT DER FREIHEIT,
NIEDER MIT DER KNECHTSCHAFT
Eine sonderbare Botschaft! Ich glaube nicht, dass man ihr schon mal begegnet ist, weder unter despotischer, kommunistischer noch unter populistischer Herrschaft, ja nicht einmal unter einem sogenannten liberalen Regime. Und auch künftig, unter all den Herrschaftsformen, für die wir noch gar keine Namen haben, dürfte man ihr schwerlich begegnen.
In den Atempausen zwischen ihrem Parolengeschrei für Freiheit und Demokratie zeigen die Studenten auf das Mädchen mit dem Schild und fragen: »Wer um alles in der Welt ist denn die? Was will sie damit sagen?«
Erfahrenere Kommilitonen, die Veteranen des Protests, antworten: »Achtet nicht auf sie. Die ist eingeschleust! Die Gottespartei bezahlt sie, damit sie Misstrauen und Zwietracht unter uns sät. Um dieses Komplott zu durchkreuzen, müsst ihr einfach so tun, als wäre sie gar nicht da.«
Auf der andern Straßenseite weisen die fanatischen Anhänger der Partei Gottes ebenfalls auf das Mädchen und fragen: »Was meint diese Göre da drüben?«
Sie hören von ihren Führern: »Das ist so eine Schlampe von diesen Kommunisten, die neuerdings wieder aus ihren Löchern kriechen, weil ihr Großer Bruder in Russland an Stärke gewinnt. Aber die Flegel haben bloß eine Handvoll Parteimitglieder. Lächerlich, mit so was wollen die sich wichtigmachen. Ignoriert das dumme Ding. Tut, als wäre sie Luft.«
Geheimpolizisten mit Funkgeräten streifen am Standort des Mädchens vorbei und fragen: »Was soll das? Für solche Fälle haben wir keine Richtlinien. Was machen wir mit ihr?« Und sie empfangen die Weisung: »Mit äußerster Wachsamkeit und Vorsicht beobachten! Es handelt sich höchstwahrscheinlich um eine vom amerikanischen Imperialismus gesteuerte Verschwörung, ein neues Komplott für eine weiße Revolution … Observieren, aber so, dass sie keinen Verdacht schöpft.«
Stumme Schatten von Zorn und Hass, lautlose Schreie voller Blut und Hoffnung und Finsternis flirren durch die Luft. Aus Richtung der Anatole-France-Straße und vom runden Platz der Revolution hat die Polizei den gesamten Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt. Hunderte Autos stauen sich, nervöse, gereizte Fahrer hupen. Dazwischen stehen Neugierige und spähen zur Universität hinüber. Genau hier haben vor über einem Vierteljahrhundert an einem bewölkten Wintertag die Menschen von Teheran das Reiterstandbild des Schahs niedergerissen.
Den protestierenden Studenten ist klar, dass sie jeden Moment angegriffen werden, und sie stimmen eine herzzerreißende Hymne an:
O mein Freund, mein Kamerad,
Steh mir zur Seite treu und grad
Tränen teilen wir und Schmerz,
Unsern Leib bedecken Striemen,
Spuren von Tyrannenhand,
Unkraut wuchert übers Land,
Ob sie gut sind, ob sie fehlen,
Tot sind unsrer Menschen Seelen,
Mit eignen Händen müssen wir den Vorhang teilen,
Wer sonst als du und ich kann diese Schmerzen heilen …
In Vers und Melodie der Hymne liegen Jahrhunderte iranischen Kummers, er füllt die Augen des Mädchens mit Tränen. Sie hebt ihr Plakat noch höher. Durch den Tränenschleier zeigt sich ihr eine verwandelte Welt aus wogenden Gebäuden, zerrissenen Schatten und auf Wasser zitternden Lichtreflexen. Die junge Frau fühlt sich völlig allein, ihre Angst vor all den Fremden nimmt zu. Sie blickt hoch und sucht Trost im Himmelsblau. Dort sieht sie ein geflügeltes Pferd, das, ohne die Menschen unten zu beachten, wie eine weiße Wolke vorüberfliegt. Entsetzt nimmt sie wahr, dass aus seinem Rücken Flammen züngeln. Das brennende Pferd verschwindet hinter einem Hochhaus. Sie wartet, aber es taucht nicht wieder auf …
Da ist ihr so, als würde inmitten des zornigen, trotzigen Geschreis eine gedämpfte Stimme ihren Namen rufen.
»Sara! Sara!«
Sie reibt sich die Tränen aus den Augen und schaut sich um. Menschen und Schatten streben nach allen Seiten fort. Jeder macht einen Bogen um sie.
»Dummkopf! Dummkopf! Ich rede mit dir!«
Von der Stimme geht dieselbe Kälte, der gleiche Modergeruch aus wie von einem seit Wochen nicht geöffneten Kühlschrank. Das Mädchen blickt um sich. Ein dunkles Gesicht ohne Hals und Oberkörper hängt in der Luft. Zwei Stahlstangen des grünen Gitters um die Teheraner Universität sind aus der Mauer gebogen und dreiteilen das Gesicht. Sie meint, es gehöre einem jener Kobolde, von denen ihre Großmutter erzählt hat, dass sie nachts in den öffentlichen Bädern der Stadt zusammenkämen, und die man nur daran von Menschen unterscheiden könne, weil sie statt Füßen Hufe hätten.
»He, kleiner Dummkopf! Ich rede mit dir! Mach, dass du dies Plakat loswirst und abhaust!«
Wieder schaut sie sich um. Am Gitter sieht sie immer noch das zerfließende dunkle Gesicht. Da hockt jemand hinter der Mauer, denkt sie, der den Kopf zum Gitter hinaufstreckt.
»He! Tagträumerin, geh nach Haus! Heut ist der Tod hinter dir her. Geh heim! Kapierst du nicht? Schon vor ’ner halben Stunde hat sich der Tod in dich verknallt. Er schleift seine Sichel, um sie dir in den Leib zu jagen. Renn, was du kannst. Hörst du mich?«
Nein, dieses Gesicht, diese Spinnwebstimme können nicht wirklich sein. Sara blinzelt durch das Gitter. Dort erkennt sie die Gestalt eines buckligen Zwergs in Kleidern aus einem längst vergangenen Jahrhundert.
Sie öffnet den Mund, um zu fragen: Was willst du denn von mir? Aber die Worte bleiben ihr in der Kehle stecken. Sie erstarrt. Ihr wird klar, dass jetzt jede Frage sinnlos wirken muss. In den runden Augenhöhlen des Gesichts scheinen keine Augäpfel zu sitzen. Sie erinnern an zwei Brunnen, auf deren Grund sich in dunklem Wasser das Mondlicht spiegelt.
»Was hast du mit meinen Augen? Denk doch an dich. Du kommst um. Kapierst du? Lauf! Hier geht jeden Moment der Kampf los.«
Das Handgemenge beginnt. Rufe von Parolen, obszöne Flüche, Schreie niedergeknüppelter junger Männer und Frauen mitten im Alltagslärm der Elfmillionenstadt.
Wir überspringen die Szene, denn sie gehört offensichtlich nicht in eine Liebesgeschichte. Immerhin – wenn Sie aufgepasst haben, ist Ihnen nicht entgangen, wie ich mit der bekannten List des Schriftstellers das Gerangel zwischen Bereitschaftspolizei und Studenten so darstelle, dass man mir keine politische Einseitigkeit vorwerfen kann.
Fragen Sie mich, wer ich bin, damit ich Ihnen Auskunft gebe:
Ich bin ein iranischer Schriftsteller, der es leid ist, düstere und bittere Geschichten zu schreiben, Geschichten voller Gespenster, gestorbener Erzähler und einem vorhersehbaren Ende in Tod und Untergang. An der Schwelle der fünfzig habe ich begriffen, dass die angeblich wirkliche Welt hinreichend Tod, Zerstörung und Schmerz enthält und ich als Autor kein Recht habe, ihr in meinen Geschichten weitere hoffnungslose Niederlagen hinzuzufügen. In meinen Erzählungen und Romanen treten Männer auf, denen ich eine romantische Tapferkeit angedichtet habe, über die ich selbst nicht verfüge. Ebenso schuf ich Frauen, deren Leib und Seele ich nach der Frau meiner Träume und Sehnsüchte ausformte – obgleich ich nie aufrichtig genug war, dabei wirklich präzise vorzugehen, es war ja nicht auszuschließen, dass ich sie am Ende mit ihren realen Vorbildern verwechselte. Unter uns: Ich habe gelegentlich sogar geschummelt und mir das blonde Haar meiner Fantasiefrau als schwarz, einmal auch als braun gedacht und es so beschrieben. Kurz und gut: Ich kann mich nicht ausstehen, wenn ich Figuren, die ich mag, die ich sorgfältig Wort für Wort geschaffen und entwickelt habe, zuletzt ins Dunkel, in einen blutigen Tod schicke, wie Dr. Frankenstein.
Aus diesem Grund und aus Motiven, die mir, wie bei Autoren üblich, vermutlich erst später aufgehen werden, möchte ich aus tiefstem Herzen eine Liebesgeschichte schreiben. Die Geschichte eines Mädchens, das den Mann, der es seit einem Jahr anhimmelt, nie gesehen hat und leidenschaftlich liebt. Eine Erzählung, die am Ende ein Tor zum Licht aufstoßen soll. Eine Story, die zwar kein Happy End hat wie romantische Hollywoodfilme, aber doch eins, das dem Leser keine Angst macht, sich zu verlieben. Und selbstverständlich soll niemand den Text als politisch abstempeln können. Mein Dilemma besteht nun aber darin, dass ich die Liebesgeschichte in meiner Heimat herausbringen will. Anders als in vielen Ländern der Erde ist das Schreiben und Veröffentlichen von Liebesgeschichten in meinem geliebten Iran kein leichtes Unterfangen. Nach dem Sieg einer unserer letzten Revolutionen – als mithilfe westlicher Medien unsere Rufe nach Freiheit der Welt in den Ohren gellten – wurde, um zweitausendfünfhundert Jahre despotischer Königsherrschaft gutzumachen, eine islamische Verfassung verabschiedet. Diese neue Verfassung gestattet, alle nur erdenklichen Bücher und Zeitschriften zu schreiben und zu drucken, und verbietet ausdrücklich deren Zensur. Leider aber erwähnt sie mit keinem Wort, dass die Bücher und Zeitschriften auch ohne Weiteres die Druckereien verlassen dürfen.
In der ersten Zeit nach der Revolution lief es so: War ein Buch gedruckt, hatte der Verleger dem Ministerium für Kultur und islamische Führung drei Exemplare vorzulegen, um eine Auslieferungsgenehmigung zu erhalten. Beurteilte das Ministerium das Werk als schädlich, dann blieb die gesamte Auflage im Lager der Druckerei liegen, und der Verleger musste zusätzlich zu den Druckkosten entweder Lagergebühren zahlen oder die Bücher zu Pappe recyceln. Dieses System brachte viele Verlage an den Rand des Ruins.
Um das finanzielle Risiko einzuschränken und zu vermeiden, dass die Bücher bis zur Vertriebsgenehmigung jahrelang in Lagerräumen vor sich hinmodern, hat sich in letzter Zeit aufgrund einer halb mündlichen, halb offiziellen Übereinkunft die Praxis ergeben, dass der unabhängige Verleger freiwillig, eigenhändig und auf eigenen Füßen drei Ausdrucke des mit modernster Layoutsoftware erstellten Manuskripts im Ministerium für Kultur und islamische Führung abliefert, damit er die bewusste Genehmigung erhält, bevor er den Druckauftrag erteilt.
In einer bestimmten Abteilung dieses Ministeriums sitzt ein Herr mit dem Spitznamen Petrowitsch (ganz recht: jener Untersuchungsrichter Porfirij Petrowitsch, der Raskolnikows Morde aufzuklären hat). Ihm obliegt die gewissenhafte Lektüre von Büchern, namentlich von Romanen und Erzählungen und ganz besonders von Liebesgeschichten. Er streicht jedes Wort, jeden Satz, jeden Absatz und sogar ganze Seiten, wenn sie anstößig wirken und folglich eine Gefahr für die öffentliche Moral und die altehrwürdigen gesellschaftlichen Werte darstellen. Gibt es zu viele solche Streichungen, gilt das Buch als ungeeignet zur Veröffentlichung; sind sie nicht gar so zahlreich, wird dem Verleger und dem Autor mitgeteilt, dass sie die markierten Stellen zu ändern oder zu tilgen haben. Für Herrn Petrowitsch ist diese Arbeit weit mehr als ein Job. Sie bedeutet ihm religiöse Pflicht, also sozusagen heilige Berufung. Er darf nicht zulassen, dass dem schlichten, unschuldigen Volk, vor allem der Jugend, unethische oder unsittliche Wörter und Textpassagen zu Gesicht kommen und ihren reinen Geist verseuchen.
»Pass bloß auf, Mann!«, ermahnt er sich selbst. »Entgeht auch nur ein Wort, ein Satz deinem Stift und bringt einen jungen Menschen auf schmutzige Gedanken, hast du teil an seiner Sünde, ja, schlimmer noch: Dann bist du ebenso schuldig wie jene verkommenen Subjekte, die pornografische Filme und Fotos produzieren und illegal unter die Leute bringen.«
Seiner Meinung nach handelt es sich bei Schriftstellern durchweg um abartige, unzüchtige, gottlose Individuen. Manche hält er für offene oder verdeckte Agenten des Zionismus und des amerikanischen Imperialismus, die ihn mit ihren Tricks und Kniffen hinters Licht führen wollen. Unter der Last seiner Verantwortung spürt Petrowitsch beim Lesen der Typoskripte heftiges Herzklopfen. Während er sich Seite für Seite voranarbeitet, geraten die Zeilen vor seinen Augen in seltsame Bewegung. Aus dem Widerhall der Wörter hört er geheimnisvolles Wispern heraus, das ihn wachsam macht. Misstrauisch blättert er einige Seiten zurück und liest noch gründlicher. Schweiß bedeckt seine Stirn, seine Finger zittern beim Umblättern. Je sorgsamer er prüft, desto trügerischer wirken die verbrecherischen Wörter. Sie verschieben sich; ganze Sätze schachteln sich ineinander. Implikationen, Assoziationen, Konnotationen, Explizites und vage Verschleiertes wirbeln tosend durch seinen Schädel. Er erkennt, dass manche Wörter untereinander Buchstaben austauschen – und schon sind sie schmutzig geworden, bilden verderbte Begriffe oder wecken schlüpfrige Vorstellungen. Das Geräusch beim Wenden der Seiten klingt wie das niederzischende Beil der Guillotine. Petrowitsch glaubt zu hören, wie die Wörter mit Zetern und Geschrei in seinen Ohren platzen.
»Seid still, zur Hölle noch mal!«, schreit er.
Er setzt seinen Stift an, um das Wort »Tanz« zu streichen, muss aber erkennen, dass der umsichtige Autor selbst stattdessen »rhythmische Bewegung« geschrieben hat. Seine Faust donnert auf die Seite nieder. Ein paar feige, konservative Wörter geben Ruhe, doch schon die nächsten stimmen mit Radau höhnisches Gelächter an. Herr Petrowitsch muss Atem holen und erhebt sich vom Schreibtisch.
So groß sind die Folterqualen seines Gemüts, dass die Prüfung eines Manuskripts ein ganzes Jahr dauern kann, mitunter auch fünf Jahre, wenn nicht fünfundzwanzig.
Daran liegt es, dass etliche Texte, ganz speziell aber Liebesgeschichten, auf dem langen Marsch durchs Ministerium für Kultur und islamische Führung Wunden davontragen, Gliedmaßen einbüßen oder gar unwiderruflich vom Leben zum Tod befördert werden.
Die Liebesgeschichte, die ich schreiben will, dürfte zwar anfangs kaum Schwierigkeiten bereiten, da ich in der Eröffnungssequenz die Schönheit der Frühlingsblumen, die duftende Brise und die strahlende Sonne am blauen Himmel thematisiere. Sobald ich jedoch den Mann und die Frau dieser Geschichte auftreten lasse, von ihrem Umgang und ihren Gesprächen berichte, erscheint vor meinem geistigen Auge das schwitzende, gereizte, vorwurfsvolle Gesicht des Herrn Petrowitsch.
Wenn Sie mich fragen: »Was soll das heißen!«, entgegne ich: Für meine Liebesgeschichte brauche ich eine weibliche und eine männliche Person, eine Protagonistin und einen Antagonisten oder umgekehrt. Jetzt möchten Sie gewiss mit der Unerträglichen Leichtigkeit der Neugier fragen: Dürfen in einer iranischen Liebesgeschichte etwa nicht ein Mann und eine Frau auftreten?
Fragen Sie, und ich antworte: Im Iran herrscht die politisch-religiöse Überzeugung, dass jede Annäherung, jeder Kontakt zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht miteinander verheiratet oder verwandt sind, als Vorspiel zur Todsünde gelten. Wer solche Vorspiele in Texten gestaltet und diese sündigen Texte darbietet, den erwartet nicht nur im Jenseits Strafe, sondern er wird schon auf Erden von islamischen Gerichten zu Gefängnis, zum Auspeitschen oder gar zum Tod verurteilt.
Um aber solcherlei Vorstufen und Todsünden gar nicht erst aufkommen zu lassen, trennt man in Schulen, Universitäten, Fabriken, Autobussen und auf Hochzeitsfeiern die weibliche und die männliche Bevölkerung. Mit anderen Worten: Man schützt sie voreinander. Manche der hochwürdigen Geistlichen sind gar der Ansicht, dass auch der Fußgängerverkehr auf Bürgersteigen getrennt werden sollte. Da ihnen bekannt ist, dass Gesetzesvorlagen in der modernen Welt wissenschaftlich zu begründen sind, stützen sie ihre Eingabe auf Expertengutachten und schlagen Folgendes vor: Morgens gehen die Männer, beispielsweise, auf der rechten Straßenseite, nachmittags die Frauen; umgekehrt sind Gehsteige der linken Seite morgens den Frauen, nachmittags den Männern vorbehalten. Auf diese Weise können beide Geschlechter die Geschäfte auf jeder Seite erreichen. – Einige Geistliche haben sogar vom Ministerium für Kultur und islamische Führung für die Kinos freigegebene Filme kritisiert und daran Anstoß genommen, dass in gewissen Szenen der Schauspieler und die Schauspielerin, die ein Ehe- oder Geschwisterpaar spielen, allein miteinander in der Küche oder im Wohnzimmer gezeigt werden. Jene Herren argumentierten, dass ein Mann und eine Frau, die nicht mahram sind – also weder verheiratet noch nah verwandt –, sich niemals in einem geschlossenen Raum allein miteinander aufhalten dürfen.
Sachverständige des Ministeriums reagierten auf die Kritik, ebenso Filmemacher, Kameraleute und andere Angehörige der Filmindustrie. In ausführlichen Aufsätzen und Interviews legten sie dar: »Ehrwürdige Eminenzen! Machen Sie sich keine Sorgen. Bei den Szenen, in denen ein Darsteller und eine Darstellerin scheinbar allein sind, befinden sich in Wirklichkeit hinter den Kulissen, nur knapp außerhalb des Aufnahmebereichs, Dutzende Mitarbeiter am Set – vom Regisseur über die Regieassistenten, das Beleuchterteam und …«
Die unzufriedenen geistlichen Herren wandten ein: »Selbst wenn es sich so verhält, sieht das Publikum einen Mann und eine Frau allein in einem Raum. Dies aber verleitet die Zuschauer zu sündhaften Gedanken.«
Ich hoffe, meine Einleitung hilft Ihnen zu verstehen, warum die Veröffentlichung einer Liebesgeschichte kein leichtes Unterfangen ist.
Sie werden jetzt fragen, wie ich erwarten kann, eine solche Geschichte nicht nur zu schreiben, sondern auch zu veröffentlichen. Ich erläutere: Da ich ein erfahrener Autor bin, wird es mir wohl gelingen, meine Erzählung so zu schreiben, dass sie dem Fallbeil der Zensur entgeht. Ich habe in meinem Schriftstellerleben einiges über die iranische und islamische Symbolsprache gelernt. Außerdem stehen mir jede Menge Kunstgriffe zur Verfügung, die ich aber nicht ausplaudern will. Um ganz ehrlich zu sein: Eigentlich hatte ich mir vor langer Zeit vorgenommen, keine Liebesgeschichte mehr zu schreiben. Aber als jener junge Mann und jenes Mädchen sich unweit des Haupteingangs der Teheraner Universität begegneten und sich mitten im Chaos der Unruhen verliebt in die Augen sahen, habe ich beschlossen, ihre Geschichte aufzuzeichnen.
Die beiden kennen sich seit etwa einem Jahr und haben manches Wort gewechselt. Doch an diesem Frühlingstag erblickt das Mädchen zum ersten Mal das Gesicht des jungen Mannes … Über das Paradox meiner letzten beiden Sätze dürfen Sie sich nicht wundern. Der Iran ist ein Land voller Widersprüche.
Falls Sie jetzt wissen wollen, ob die beiden sich von einer Eheanbahnungswebsite her kennen, antworte ich mit Nachdruck: Nein! Entschieden betone ich: Diese zwei Figuren sind viel zu unschuldig und fiktiv, als dass sie sich auf einer Ehevermittlungswebsite oder auf Websites, wo Sexpartner gesucht werden, kennengelernt haben können. Übrigens sind solche Websites de facto verboten. Aber lassen Sie mich fortfahren.
Wie Sie bemerkt haben, heißt das Mädchen Sara. Der Name des jungen Mannes lautet Dara. Fragen Sie nicht; ich gestehe, dass es Pseudonyme sind. Ich möchte vermeiden, dass die wirklichen Personen wegen irgendwelcher Sünden oder illegaler Handlungen, die sie womöglich im Lauf der Handlung begehen werden, Ärger bekommen.
Wenn ich aus Tausenden Namen ausgerechnet diese wähle, so hat das natürlich eine eigene Geschichte, die ich erzählen muss.
Vor vielen, vielen Jahren, als ich zur Schule ging, waren Sara und Dara zwei Gestalten in unserer Fibel der ersten Klasse. Sara stand für den Buchstaben »S«, Dara fürs »D«. Seinerzeit herrschte kein islamisches Regime, sondern eine Monarchie. Aus deren Sicht gab es für Sara und Dara kein Hindernis, allein in einem Raum aufzutreten und in späteren Lektionen zum Beispiel über einen Papagei zu plaudern, um uns den Buchstaben »P« beizubringen. In jenen vergangenen Tagen wurde Sara mit langem schwarzem Haar in bunter Kleidung – Bluse, Rock und Söckchen – dargestellt; Dara trug Hemd und Hose. Beide waren hübsch, aber wir Schüler malten Sara einen Schnurrbart und Dara einen Vollbart ins Gesicht. Jahre später, als ich schon an der Teheraner Universität studierte, hatten wir die Monarchie satt und fingen eine Revolution an. Unsere Erweckung begann, als der Schah auf Zuraten des US-Präsidenten Jimmy Carter behauptete, er wolle dem iranischen Volk politische, Rede- und Meinungsfreiheit einräumen, und zum Beweis seiner Absicht die Rastachis auflöste – die politische Einheitspartei des Landes, die er selbst gegründet hatte. Wir riefen: »Freiheit!« Wir riefen: »Unabhängigkeit!« Und einige Monate nach Beginn der Revolution fügten wir hinzu: »Islamische Republik!« Im ganzen Land zündeten wir Banken an, denn nach verdeckter und offener Propaganda der Kommunisten waren sie Symbole der blutrünstigen Herrschaft von Handlangern der Bourgeoisie. Wir fackelten Kinos ab, weil sie laut verdeckter und offener Propaganda der Intellektuellen am kulturellen Niedergang, am Vordringen der dekadenten Verwestlichung und am zunehmenden Einfluss der amerikanischen Hollywoodkultur schuld waren. Wir brannten Kabaretts, Bars und Bordelle nieder, denn nach verdeckter und offener Propaganda der Frommen luden diese Brutstätten der Verderbnis zu Todsünden ein. Nun denn, ein paar Jahre nach dem Sieg der Revolution trug Sara in der Fibel der ersten Klasse ein Kopftuch und einen bodenlangen schwarzen Kittel über den bunten Kleidern. Dara war noch zu klein für einen Bart, weshalb nur seinem Vater einer spross. Nach unserer Religionslehre soll nämlich ein Muslim Bart tragen und sein Gesicht nicht mit einem Rasiermesser pflegen, damit er keiner Frau gleicht.
Wenn ich mich recht entsinne, waren Sara und Dara wenige Jahre später ganz aus den Lesebüchern verschwunden und hatten einem anderen Mädchen und Jungen Platz gemacht – Geschwistern, die in nichts ans korrupte, despotische Regime des Schahs erinnerten. Ich denke, Sie verstehen jetzt, dass die Wahl der Namen Sara und Dara zur List eines iranischen Geschichtenerzählers gehört. Ohne dass ich Herrn Petrowitsch Anlass zu Strafmaßnahmen gebe, werden meine Leser an Saras und Daras Verschwinden aus den Fibeln erinnert, ähnlich wie sowjetische Zensoren Herrn Clementis als Persona non grata aus einem Foto wegretuschierten, während sein Hut, den er jemandem geliehen hatte, auf dem Kopf jenes Mannes sitzen blieb.
Um die Zeit der Verwandlung von Sara und Dara kam meine Tochter in die erste Klasse. Damals wollte mir an manchen Abenden beim besten Willen keine neue Geschichte für sie einfallen. Also kaufte ich ihr Märchenbücher. Die Geschichten waren besser als meine, denn sie hatten Bilder. Eines Abends, als ich Schneewittchen und die sieben Zwerge aufschlug, um es ihr vorzulesen, sah ich entsetzt, dass Schneewittchen ein Kopftuch trug und seine bloßen Arme von zwei schwarzen Balken verdeckt waren.
Meine Kleine fragte: »Warum liest du nicht?«
Ich klappte das Buch zu und sagte: »Heut Abend gibts keine Geschichte. Schlaf und träum was Schönes, mein Kind … Schlaf, Bārān.«
So nannten wir zu Hause unsere Tochter, obgleich auf ihrer Geburtsurkunde ein anderer Name steht, den weder ihre Mutter noch ich ihr hatten geben wollen. Daher ist auch der Name Bārān mit einer Geschichte verbunden, die ich Ihnen an einem der nächsten Abende erzähle. Vorerst will ich, wenn Sie gestatten, zu meiner Liebesgeschichte zurückkehren.
Sie werden fragen, wieso Sara und Dara sich kennen, da doch im Iran Begegnungen von Frau und Mann so unwahrscheinlich sind.
Wie ich schon sagte: Obwohl die beiden sich hier am Rand der Studentendemonstration zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten, haben sie ihre Liebesgeschichte bereits vor einem Jahr zu schreiben begonnen. Und diese Geschichte möchte ich nun erzählen:
Sara studiert iranische Literatur an der Universität von Teheran.Nach einem ungeschriebenen Gesetz ist es jedoch an Schulen und Universitäten des Landes verboten, zeitgenössische iranische Literatur zu behandeln.Wie alle anderen Studenten und Studentinnen muss sie Hunderte von Versen und Lebensdaten der vor tausend, siebenhundert, vierhundert … Jahren gestorbenen Dichter auswendig lernen. Sara liebt aber auch die moderne iranische Literatur, denn sie regt ihre Fantasie an.
Solche Bücher lassen in ihren Gedanken Szenen und Wörter entstehen, die sie nie gewagt hat sich vorzustellen oder gar auszusprechen. Selbstverständlich riskiert auch diese Literatur nicht, dergleichen unverhüllt zu schreiben. Bekommt Sara eine moderne Erzählung in die Hand, liest sie denn auch zwischen den Zeilen. Wann immer ein Satz unvollendet bleibt und mit drei Punkten wie diesen endet: »…«, beginnt ihre Vorstellungskraft rege zu arbeiten, und sie überlegt sich, was da wohl ausgelassen wurde. Mitunter geht ihre Fantasie nackter und gewagter über das hinaus, was der Autor im Sinn hatte. Mit dem Spürsinn eines Geheimagenten vermag sie die Codes zu entziffern, die sich hinter den versteinerten Floskeln und dem konventionellen Flüsterton zeitgenössischer iranischer Belletristik verbergen, und wird genau das finden, was ihr gefällt. Sara mag die drei Punkte, weil sie ihr erlauben, selbst zur Autorin zu werden … Niemals aber leiht sie sich moderne Literatur aus der Bücherei ihres Instituts oder der zentralen Universitätsbibliothek. Nebenbei gesagt, ich glaube nicht, dass sie dort Titel von Autoren wie mir finden würde, auch wenn sie wollte.
Fragen Sie mich, warum dem so ist, und ich werde es Ihnen erklären.
In Ländern, wo die Menschen stolz sind auf ihre Demokratie und vertrauensvoll einer gesicherten Zukunft entgegensehen, muss sich, wie ich hoffe, niemand wegen der aus Bibliotheken entliehenen Titel Sorgen machen. Ich wünsche mir jedenfalls sehnlich, dass dort jeder, wann immer er will, ohne Angst vor künftigen Schikanen wenigstens Upton Sinclairs Der Sumpf lesen kann, von mir aus sogar jene öde, kunstlose Utopie Die eiserne Ferse, ein schlechtes Buch von einem relativ guten Autor, der zu viel Whisky trank und die amerikanische Demokratie durch ein System à la Farm der Tiere ersetzen wollte.
Wie schon gesagt, lebten wir zweitausendfünfhundert Jahre lang unter despotischen Königen. In dieser langen Zeit haben wir großes Geschick darin entwickelt, unter keinen Umständen irgendwelche dokumentierten Spuren zu hinterlassen. Wir fürchten stets, dass die Zukunft noch grausamere politische Verhältnisse bereithält, weshalb wir sehr vorsichtig auftreten und uns vor allem hüten, was unser Tun und Lassen verraten könnte. Aus diesem Grund findet man in den Quellen zur iranischen Geschichte denn auch hauptsächlich Reiseberichte westlicher Besucher und Aufzeichnungen ausländischer Spione. Sara weiß, dass das Ausleihsystem der Teheraner Universitätsbibliothek digitalisiert ist und jeder Titel eines Tages gegen sie verwendet und sie relegiert werden kann. Freilich erlauben die Umstände in meinem teuren Iran noch immer ein paar Zipfelchen Freiheit, aber Sara zieht es doch vor, sich ihre Lieblingsbücher aus einer öffentlichen Bücherei zu holen, und ist bei einer davon in ihrer Nachbarschaft Mitglied. Genau ein Jahr vor der Demonstration, von der ich Ihnen erzählte, an einem Frühlingstag – die meisten altiranischen Liebesgeschichten spielen an einem wunderschönen Frühlingstag, und ihre Sprache lässt die klingenden Lieder der Nachtigall und anderer Singvögel widerhallen – betritt Sara die Stadtteilbücherei. Deren kleiner Lesesaal ist durch die Katalogschränke in zwei Räume unterteilt, sodass die an den Tischen sitzenden Burschen und Mädchen einander nicht sehen können.
Nun möchten Sie vermutlich fragen: Was tun die jungen Leute, wenn sie eine Hausaufgabe besprechen oder Gedanken austauschen wollen?
Sollten Sie auf dieser Frage beharren, sehe ich mich gezwungen, Ihnen Folgendes zu sagen:
Meine Dame! Mein Herr! Weshalb können Sie sich keine andere Kultur als Ihre eigene vorstellen? Welch eine Frage! Selbstverständlich führen Jungen und Mädchen keine unterrichtsbezogenen Gespräche und brauchen den Lehrstoff nicht zu diskutieren. Wie den jungen Leuten überall auf der Welt würden ja auch ihnen Plaudereien über Derridas »différance«, Plancks Strahlungsgesetz, die Chaostheorie oder den Schmetterlingseffekt nur als absichtlicher oder unbewusster Vorwand dienen, private Beziehungen anzuknüpfen, die am Ende zur Sünde führen. Darum erhalten sie, wenn sie auf dem Universitätscampus miteinander reden, einen schriftlichen Verweis des Disziplinarausschusses. Auch in Bibliotheken sind ihnen nicht nur Gespräche verboten, sondern sie können nicht einmal mit der Sprache ihrer Augen über Plancks Wand klettern, um Informationen auszutauschen. Also lassen Sie mich weitererzählen.
Sara ging zum Ausgabeschalter der Bücherei … Damit setze ich die Geschichte fort, die ich schreiben und dem Herrn Petrowitsch vorlegen möchte.
Sie fragte die Bibliothekarin: »Haben SieDie blinde Eule?«
Die Bibliothekarin antwortete mit fester Stimme: »Nein, mein Fräulein, Die blinde Eule haben wir in dieser Bücherei keineswegs!«
Sara gab nicht klein bei. »Klar, ich weiß ja, dass sie nicht im Regal steht. Ich meinte, ob sie bei den Sachen ist, die Sie aussortiert haben, und ob Sie vielleicht eine Ausnahme machen und mir das Buch für ein paar Tage leihen würden. Ich studiere Literatur und soll Die blinde Eule für eine wichtige Seminararbeit lesen.«
Diesmal noch strenger, sagte die Bibliothekarin: »Junge Dame! Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, dass es solche verbotenen Titel hier nicht gibt.Übrigens bin nicht ich blöd, sondern Sie. Mir ist nämlich bekannt, dass die Uni nie und nimmer eine Seminararbeit über Die blinde Eule vergibt.«
Sara ließ die Hoffnung auf ein Exemplar des Romans fallen und verließ die Bücherei. Sie bemerkte nicht, dass zugleich mit ihr ein junger Mensch aus der geschützten Männerabteilung trat und ihr in einigem Abstand bis zu ihrer Wohnung folgte. Folglich erkannte sie ihn auch nicht, als sie ihn bald darauf in der Nähe ihres Hauses sah. Der junge Mann verkaufte antiquarische Bücher, die er auf Zeitungspapier am Boden des Gehwegs ausgelegt hatte. Zweifellos war Die blinde Eule dabei. Aber Sara, das stolze, schöne Mädchen, schaute wie gewohnt nicht rechts und nicht links, würdigte niemanden eines Blickes und ging schnurstracks in die Universität. Der Metzger nebenan häutete gerade einen grünen Jungdrachen, der an einem von der Decke hängenden Haken baumelte …
Am nächsten Tag saß der junge Mann wieder am selben Fleck. Natürlich waren seine Bücher weniger geworden. Das gleiche Schauspiel wiederholte sich an den folgenden Tagen.
Bücherfreunde im Iran misstrauen aller Welt und sind argwöhnisch geworden. Ein solcher Straßenhändler mit seltenen oder verbotenen Büchern könnte ja ein Agent sein, der Leser identifizieren und bespitzeln soll.
Erst am siebenten Tag blieb Sara endlich vor der Auslage des Händlers stehen und stöberte darin, als sie plötzlich Die blinde Eule entdeckte. Sie fragte nach dem Preis. Gewöhnlich wird für verbotene Bücher weit mehr als der reguläre, auf der Rückseite des Umschlags gedruckte Ladenpreis verlangt, doch der junge Mann wollte nur wenig Geld und fügte mit bebender Stimme hinzu: »Der Preis einer Winston-Zigarette, mein Fräulein. Unter der Bedingung, dass Sie es aufmerksam lesen. Bitte hegen Sie dieses Buch … Lesen Sie es sehr, sehr sorgfältig, viel gründlicher als andere Bücher … Aufmerksam, genau …«
Kein Straßenhöker oder Buchhändler hatte je in diesem Ton mit Sara gesprochen. Sie dachte: Das ist wohl wieder so ein gestörter Typ, die werden auch immer mehr bei uns. Glücklich kaufte sie das Buch und schob es in ihre Mappe. Eine geheimnisvolle Kraft ging von ihm auf sie über. Während ihrer ersten Vorlesung, als der Professor ein langes, vor siebenhundert Jahren geschriebenes Gedicht voll komplizierter, unbekannter arabischer Wörter interpretierte, schlug Sara unterm Pult ihr Buch auf und begann den surrealistischen Roman zu lesen, von dem es heißt, er raube jungen Leuten jede Hoffnung und treibe sie in den Selbstmord – so wie sein Autor Sadeq Hedayat sich in Paris umgebracht hatte. Doch abgesehen von der seltsamen Macht der opiumrauschhaften, sinnlichen Sprache schien der Band ein weiteres Geheimnis zu enthalten, Sara glaubte, dies im Blick des Straßenhändlers erkannt zu haben. An diesem Tag eilte sie schneller als sonst nach Hause. Sie schloss die Tür ihres Zimmers, legte sich aufs Bett und las das Werk von Anfang an.
Ich vermute, Ihnen ist unterdessen klar, dass das Durchstreichen gewisser Textpassagen mein Werk ist. Sie müssen aber wissen, dass derlei exzentrische Schrullen nichts mit Postmoderne oder Heideggerei zu tun haben. Tatsächlich …
Und inzwischen haben Sie gewiss auch die Bedeutung des »…« in der heutigen iranischen Literatur erkannt.
Auf Seite sieben bemerkte Sara mehrere rote Punkte. Sie achtete nicht weiter darauf und las gierig weiter. Der Roman Die blinde Eule beginnt mit albdruckartigen Ereignissen im Leben eines iranischen Malers, der Federkästen bemalt. Eines Tages sucht der Künstler die Abstellkammer seines Hauses auf, um eine Flasche alten Wein zu holen, den er von seiner Mutter geerbt hat – einer indischen Tänzerin, die in einem Lingamtempel mit einer Naga-Schlange tanzte. Als er nach dem Wein greift, erblickt er durch die kleine Luke in der Wand das Ödland hinterm Haus, wo an einem Bach unter einer Zypresse ein gebeugter Alter sitzt; am andern Ufer aber steht ein schönes Mädchen, so lieblich wie die Frauen persischer Miniaturen, beugt sich vor und reicht dem alten Mann eine dunkelblaue Windenblüte. Tags darauf muss der Künstler feststellen, dass die Luke seiner Vorratskammer zugemauert ist. Aber er hat sich in die zarte Mädchengestalt verliebt und verbringt fortan seine Tage mit Wanderungen übers Ödland hinter seinem einsamen Haus auf der Suche nach ihr, nach dem Bach und der Zypresse … Auf Seite siebzehn angekommen, dachte Sara: Derjenige, dem dies Buch früher gehörte, hat es wohl nicht besonders gemocht oder war einfach ein Schmierfink, so wie er die Seiten mit roten Punkten verunstaltet hat … Und Blinde Eule, der Künstler, der jene ätherische Frau nicht vergessen kann, sucht immerfort nach ihr. Eines Abends, als er von einer seiner erfolglosen Wanderungen heimkehrt, sieht er sie vor seiner Haustür sitzen. Er lässt sie ein und bietet ihr ein wenig von dem alten Wein an. Der Leser erfährt, dass der Wein mit dem Gift der Schlange versetzt ist. Die Frau stirbt mit anklagendem Blick in den Augen, und dieser Blick gräbt sich für alle Zeiten ins Gedächtnis des Malers ein. Blinde Eule zerstückelt ihren Körper, der von zwei schillernden Fliegen umsummt wird, und legt die Teile in einen Koffer. Draußen scheint sich die Welt in einen Albtraum verwandelt zu haben. In der Dunkelheit wartet jener Alte mit einem klapprigen, von Pferden gezogenen Leichenwagen auf ihn. Der Karren bringt sie in die alte Stadt Rey. Als sie dort den Koffer begraben, finden sie einen jahrhundertealten Krug, auf dem ein Bild des schönen Mädchens mit den rätselhaften Augen gemalt ist …
Bei Seite sechsundsechzig ging Sara auf, dass die roten Punkte nicht willkürlich verteilt, sondern sehr genau unter bestimmte Buchstaben in bestimmten Wörtern gesetzt worden waren. Sie blätterte zurück zu den ersten Punkten auf Seite eins. Sie standen unter den Buchstaben S, A, R, A, H, A, L, L, O. Sie brauchte nicht lange, um herauszufinden, dass die ersten vier Buchstaben ihren Namen bildeten und die übrigen das Wort »hallo« … Das Verwirrspiel des Romans Die blinde Eule übte einen aufreizenden Zauber aus, doch Sara war nun von den Markierungen in ihrem Exemplar gefesselt. Seite für Seite überflog sie und sammelte alle Buchstaben sorgfältig ein. Sie schrieb sie auf ein Blatt Papier und machte sich daran, sie zu verbinden. Manchmal brachte sie zu viele zusammen, dann wieder zu wenige. Aber schließlich, acht Stunden später, lag der vollständige Brief vor ihr.
»Sara, hallo,
während ich diese roten Punkte setze, kann ich nur hoffen, dass du meinen Geheimcode herausbekommst. Als du die Bibliothekarin fragtest, ob sie ›Die blinde Eule‹ hätte, war ich auch da. Schon seit Langem bin ich oft in der Bücherei, wenn du hingehst. Den Blick in dein Gesicht verbieten mir die Katalogkästen, aber zwischen deren Beinen kann ich deine Schuhe sehen. Ich kenne all deine Schuhe. Ich habe jedem Paar einen Namen gegeben. Beispielsweise die braunen mit dem Kratzer, vermutlich von einem Stacheldraht oder von den Dornen einer Rosenstaude: Sie heißen Regentag, weil du sie an regnerischen Tagen trägst. Die Stadtbücherei hat ›Die blinde Eule‹ wirklich nicht. Auch viele andere bedeutende Romane fehlen da. Wie die neue Bibliothekarin sagte, haben sie alle unzüchtigen Sachen ausgemistet. Bei mir zu Haus hatte ich selbst eine kleine Bibliothek, an der ich hing. Aber jetzt lege ich sie in der Nähe deiner Wohnung aus, weil ich dir Die blinde Eule‹ geben will. Damit die Leute auch glauben, dass ich ein echter Straßenhändler bin, muss ich manche meiner Bücher verkaufen. Ich habe schon ›Hundert Jahre Einsamkeit‹ und ›Anna Karenina‹ verkauft, auch ›Der große Gatsby‹ und ›Schlachthof 5‹. Sie haben mir sogar Italo Calvinos ›Die unsichtbaren Städte‹ abgenommen. Ich bin Gedichtsammlungen von Lorca, Pablo Neruda und Forough losgeworden. Aber für ›Die blinde Eule‹ setze ich einen so hohen Preis fest, dass man mich auslacht. Falls dir dieser Brief nichts bedeutet, halte wenigstens das Buch in Ehren. Um sich aus unserer ewigen Heuchelei zu befreien, floh der Autor nach Paris und nahm sich dort das Leben. Ich wollte, ich wäre ein ebenso begnadeter Dichter wie er, dann würde ich dir einen wunderschönen, einmaligen Brief schreiben. Wenn ich dir einen so herrlichen Brief schicken könnte, wie ihn nie zuvor ein Liebender je geschrieben hat, wüsste ich nichts, was ich mir in diesem Leben noch wünschen sollte, und sterben fiele mir leicht … Bitte hab keine Angst. Ich liebe dich schon lange, ohne dass du mich je bemerkt hättest, und so, glaub mir, soll es auch bleiben, du wirst meine Nähe niemals spüren, außer du selbst gestattest es. Wenn du nächsten Donnerstag in die Bücherei gehst, hol dir ›Der kleine Prinz‹, wenn du magst …«
Sara versuchte, sich an die Gesichtszüge des jungen Mannes zu erinnern oder wenigstens an seine Stimme. Aber es war wie verhext: Sie hatte kein Bild von ihm im Kopf. Als hätte eine Hand es ausgelöscht.
Sie entlieh Der kleine Prinz. Beim ersten Durchblättern bekam sie von der bezaubernden Erzählung wenig mit, weil sie sich völlig auf den Code konzentrierte. Der Brief lautete:
»Hallo Sara,
warum drehst du dich jetzt immer plötzlich um und schaust hinter dich, seit du meinen Brief gelesen hast? Du wirst mich unter den Leuten auf der Straße auf keinen Fall erkennen. Ich versteh was von Maskenbildnerei! An dem Tag, als du das Buch von mir gekauft hast, hatte ich mein Aussehen total verändert.
Ich bin immer ziemlich weit hinter dir. Aber auch wenn ich diesen Abstand einhalten muss, macht es mich froh, dir nachzugehen und die Luft zu atmen, die du ausgeatmet hast. Manchmal, natürlich nicht oft, gehe ich dir auf der andern Straßenseite entgegen, um einen Blick in dein Gesicht zu werfen, damit ich sehe, ob du glücklich oder traurig bist. Jeder deiner Züge ist mir vertraut. Ich erkenne sogar an der Art, wie deine langen schönen Finger die Bücher halten, ob du müde bist oder unternehmungslustig. Wenn ich nachts durch die Straßen wandere, streife ich mitunter an deinem großen Haus vorbei. Keine Sorge, ich bleib nicht stehen, nicht mal einen Moment. Ich spaziere nur vorüber und blicke zu deinem Fenster hoch. Die schweren Vorhänge mag ich gar nicht. Warum hast du sie meistens zugezogen? Öffne sie doch, lass den Mond in dein Zimmer scheinen! Sein ultramarinblaues Licht wird einen wunderschönen neuen Farbton auf deine Wände zaubern. Abends, wenn bei dir Licht brennt und ich weiß, dass du da bist, wird dein Zimmer zu meinem Stern. Er gleicht für mich keinem andern Stern im All, denn hier habe ich ja eine rote Rose, die mir mehr bedeutet als alle Rosen der Welt und deren Glück ich mir von Herzen wünsche. Das hat mich ›Der kleine Prinz‹ gelehrt. Jetzt gibt es in meinem Leben ein Wesen, dessen Glück ich mit meinem ganzen Dasein ersehne. Selbst wenn ich niemals dazu beitragen kann, hat doch mein Leben einen köstlichen neuen Sinn gewonnen. Auf einmal komme ich auch mit den Menschen zurecht. Ich habe sie neuerdings sogar recht gern, denn ich vermute, es gibt unter ihnen welche, die du magst und die dich erfreuen … Wer ich bin und wie ich heiße, spielt keine Rolle. Früher habe ich auch an der hiesigen Uni studiert, und zwar Film. Aber sie haben mich rausgeschmissen. Mein Name? Denk dir einfach: Dara. Der Schriftsteller, der eines Tages mein Leben beschreibt, wird ohne viel Nachdenken dieses Pseudonym aus dem Ärmel schütteln. Bei keiner Firma, in keiner Fabrik bekomme ich eine feste Stellung. Ich lebe von dem bisschen, was ich als Anstreicher verdiene. Jedes Mal, wenn ich eine Wand streiche, male ich vorher deinen Namen in Ultramarinblau hin, bevor ich ihn mit der für die Wand bestimmten Farbe überdecke. Erst letzten Monat hatte ich auf einem Neubau zu tun, aber da tauchte unerwartet der Unternehmer auf und sah, dass auf allen Wänden SARA stand … Klar gab es Streit! Er hat mich gefeuert … Den nächsten Brief schreibe ich dir in Bram Stokers ›Dracula‹. Die Typen, die den Bibliotheksbestand kontrollieren, übersehen manche Bücher, vielleicht kennen sie sich mit derartiger Literatur auch nicht so aus. Wenn du antworten möchtest, markiere die Buchstaben in diesem Band mit Blaustift. Wenn nicht, schreib ich dir im Dracula, wo du meinen nächsten Brief findest …«
Sara musste drei Wochen warten, bis sie Dracula ausleihen konnte. Darin las sie den dritten Brief, antwortete aber nicht. Wer immer ihr diese Botschaften schrieb, meinte es ehrlich: Er bewegte sich so geisterhaft am Rand ihres Lebens, dass sie ihn trotz aller Neugier nicht entdecken konnte. Oft, wenn sie auf dem gewohnten Weg von der Universität oder der Bücherei heimgegangen war, sauste sie nach oben in ihr Zimmer und spähte durch den schmalen Spalt der schweren Vorhänge hinaus, um zu sehen, wer ihr gefolgt war. Alle möglichen Fußgänger, junge und alte, eilten vorbei, aber keiner von ihnen schaute mit besonderem Interesse zu ihr hoch … An sieben aufeinanderfolgenden Abenden hockte sie am Fenster und starrte auf den Bürgersteig. Aber vergeblich.
Die Geschichte von Dracula gefiel ihr.
»Hallo Sara,
ich mag deine Turnschuhe mit den blauen Streifen. Dein Gang ist so beschwingt, wenn du sie anhast. Ich nenne sie: Schirin wandelt auf dem Wasser, manchmal auch Ophelia. Hat sich an der Uni was geändert, dass ihr jetzt farbige Schuhe tragen dürft? Wenn ich dir auf der Straße folge, versuche ich mitunter, in deine Fußstapfen zu treten.
Ich wollte, ich hätte die magischen Kräfte des Grafen Dracula. Nicht um nachts in dein Zimmer zu schleichen und dein Blut auszusaugen, sondern damit ich dich dein Leben lang beschützen könnte, ohne dass du je was davon merken würdest.
Der Direktor der Stadtbücherei hat Verdacht geschöpft. Er warnte mich: Wenn ich mich nicht zurückhielte, würde er dafür sorgen, dass die Sittenwächter mich festnehmen. Ich habe auf keine seiner Beleidigungen reagiert. Obwohl ich vor Wut kochte, brachte ich es sogar fertig, mich bei ihm zu entschuldigen. Wäre ich Dracula, würde ich sein Blut saufen! Darum warte ich jetzt immer eine Weile, wenn du gehst. Dann renne ich los und hole dich in der Nähe deiner Wohnung ein. Wie gern käme ich in deine Vorlesungen, bloß um in einer Ecke zu sitzen und dich anzusehen. Aber an der Uni gelten Leute wie ich als ordinäre, eklige Monster! In Francis Ford Coppolas ›Dracula‹-Film, den du leicht auf dem Schwarzmarkt kriegst, gibt es eine Szene, wo der verliebte Dracula Minas Tränen in seiner Hand auffängt und in Smaragde verwandelt. Auch wenn ich früher ein Scheusal war, ein Dracula sogar, habe ich mich geändert, seit ich dich kenne. Zwischen den Seiten von ›Der kleine Prinz‹ entdeckte ich eine Haarsträhne von dir. Ich glaube nicht, dass du sie absichtlich hineingelegt hast. Aber sie ist jetzt mein Schatz … Diese paar schwarzen Haare sind die Welt für mich. Du bist meine Schirin; könnte ich doch dein Farhad sein! Ich wollte, ich hätte einen Berg, den ich dir zu einem Palast zurechtmeißeln würde mit nichts als einer Spitzhacke. Leih dir ›Chosrou und Schirin‹!«
Manche unserer mystischen Dichtungen sind fast tausend Jahre alt. In ihnen spricht der Sufi-Dichter – fast alle klassischen Poeten waren Sufis – von einer irdisch-himmlischen Geliebten, einer Frau und doch zugleich einer Verkörperung Gottes. Wortreich stellt er die Schönheit der Geliebten derjenigen der Natur, der Früchte und Blumen gegenüber; nicht direkt, versteht sich, sondern in allbekannten Gleichnissen. Den Auftakt macht ihre Gestalt, die oft mit einer Zypresse verglichen wird. Um diese Anspielung zu verstehen, dürfen Sie nicht an die enorme Höhe der Zypressen denken, sondern daran, wie breit sie unten sind und wie schmal an der Spitze. Sodann vergleicht unser Lyriker die Augen der Liebsten mit Narzissen oder Gazellenaugen, und wenn es sich um orientalische Augen handelt, auch mit Mandeln. Ihre Brauen sind Bogen, von denen sie die Pfeile ihrer Wimpern direkt ins Herz ihres Verehrers sendet. Hat sie schmale Lippen, so erblickt er darin aus Seide geflochtene Stränge; schwellende Lippen sind Rubine, zuckersüß natürlich. Schließlich kommt er zu den Granatäpfeln ihrer Brüste. Weiter hinab traut sich der persische Sufi-Dichter gewöhnlich nicht. Die übrigen Vergleiche unterwirft er einer Selbstzensur und überlässt es der Fantasie des Lesers, sich nach Süden zu begeben. Die wenigen, die sich weiter als bis zu den Brüsten der Geliebten hinabwagten, wählten wieder Metaphern der Natur oder erotischer Speisen. Es versteht sich, dass damalige Iraner weder die Banane noch die Orchidee kannten oder gar die Blume aus dem Film The Wall. Vor etwa neunhundert Jahren schuf der große neupersische Dichter Nizami zwei wundervolle und doch rätselhafte Szenen in seinem berühmten Epos Chosrou und Schirin. Die Verserzählung handelt von Chosrou, einem der bedeutendsten Könige Persiens, und der armenischen Prinzessin Schirin. Sie hat sich entkleidet und badet in einem Quellweiher. Chosrou, der in der Gegend jagt, kommt zufällig dazu, verbirgt sich im Gebüsch und starrt gebannt zu ihr hin.
Die Braut erblickte er, reif wie der volle Mond …
…
Wie Lotsblume saß die holde Frau
bis an den Nabel im azurnen Blau.
…
Ihr Wesen färbte diesen Quellenteich,
der Mandelblüte, Mandelherzen gleich.
….
Zu beiden Seiten kämmte sie ihr Haar,
die Veilchenkrone blühte wunderbar.
…
Juwelenkästlein sie aus purem Gold,
die Locken schlangengleich herabgerollt.
…
Der Wächter konnt’ des Gartentors nicht warten,
granatne Äpfel sah der Fürst im Garten.
…
Jasmin erblühte, den der König sah,
doch Hyazinth verstellt’ den Blick ihm da.
…
Der Mond trat aus der dunklen Wolkenwand,
da hatte Schirin seinen Blick erkannt.
…
Die Süße wusst’ vor Scham nicht hin noch wider,
Sie senkt’ die Nacht der Haare vor sich nieder.
…
Wie in allen Liebesgeschichten verhindern etliche Zwischenfälle und Ereignisse ein Zusammenkommen der beiden und machen es ihnen unmöglich, allein zu sein, außer Sichtweite der gnadenlos Frommen, die sich ganz wie unsere heutigen Zensoren verhalten.
Zuletzt aber trifft Schirin doch in Madayin ein, der Residenz ihres Geliebten. In jenen Tagen war Madayin die reichste und prunkvollste Hauptstadt der Welt. Überreste des massiven Tonnengewölbes ihres Königspalasts kann man noch heute im Irak besichtigen – ich meine jenes Land, das einst zum Perserreich gehörte. Wegen des brutalen Kriegs, der in letzter Zeit dort tobt, verwechseln es Amerikaner, deren geografische Kenntnisse zu wünschen übrig lassen, inzwischen wohl nicht mehr mit dem Iran.
Lange Zeit ist vergangen, seit Schirin und Chosrou sich begegnet und in Liebe zueinander entbrannt sind, aber sie haben noch immer nichts getan. Endlich, vor der lang erwarteten Hochzeitsnacht, ermahnt Schirin ihn: Sosehr du dich auch stets dem Wein ergabst, an diesem einen Abend trinke nicht! Dennoch beginnt Chosrou, erregt in Erwartung der Erfüllung seiner Liebe, schon am frühen Nachmittag zu trinken. Am Abend wartet er, hoffnungslos betrunken, in der Brautkammer darauf, dass Schirin eintritt, gebadet, geschminkt, parfümiert und in einem Nachtgewand, von dem heutige Modemacher nur träumen können … Stellen Sie sich nun die Brautkammer vor, nicht mit Ihrer eigenen sachlichen, historisch korrekten Fantasie, sondern in den albernen, unwissenschaftlichen Bildern eines Films wie Oliver Stones Alexander, also mit ägyptisch-arabisch-indisch-iranisch-chinesischem Dekor, mit einem derart von Gold und Edelsteinen überladenen Bett, dass kaum jemand mehr darin Platz findet. In einem Winkel steht ein indischer Schiwa, in einem andern die Figur des ägyptischen Gottes Ra, und irgendwo kräuselt sich Rauch aus einem chinesischen Opfergefäß. Und da, mitten auf dem Bett, rekelt sich Chosrou, der Herrscher Persiens. Mir fällt keine iranische Metapher für ihn ein, sodass ich den Hollywoodfilmen folge, die alles in einen Topf werfen, und ihn mit Ganescha vergleiche, dem Schutzpatron der Hindus für Kunst und Wissenschaft, ihrem Gott der Bildung und Weisheit, den ich sehr gernhabe. Ganescha hat einen Elefantenkopf und einen menschlichen Leib. Er liebt Süßigkeiten, und auf Farsi bedeutet der Name Schirin »die Süße«. Ich habe dieses Gleichnis jedoch deswegen gewählt, weil Ganeschas Rüssel doch wohl eine gewisse Ähnlichkeit mit Chosrous Mannesteil aufweist.
Lassen wir aber den Elefantenrüssel beiseite. Als Schirin merkt, dass Chosrou an diesem historischen Abend betrunken ist, geht sie nicht selbst in die Kammer, sondern schickt ihre Pflegemutter hinein. Die alte Frau wird folgendermaßen beschrieben:
Sie gleicht einer Wölfin, keiner jungen, sondern einer alten Wölfin oder Füchsin; ihre beiden Hängebrüste erinnern an Schaflederbeutel; ihren Rücken beugt seit Langem ein Buckel; das Gesicht ist so runzlig wie eine indische Walnuss, der Mund mit den wenigen gelben Zähnen so breit wie ein Grab; an den Augenlidern hat sie keine Wimpern mehr … Die Alte tritt also ein. Chosrou wundert sich: Nanu? Wie hat sich die bezaubernde Schirin denn auf einmal verändert? Er schiebt es auf eine Sinnestäuschung wegen seines berauschten Zustands und macht sich über sie her. Die alte Frau schreit vor Schmerz: Schirin, komm! Rette mich! Die Prinzessin erscheint, und Chosrou erkennt seinen Irrtum.
An dieser Stelle ergeht sich der Dichter abermals in langen Beschreibungen. Er vergleicht Schirins Körper mit allerlei Blumen, seltenem Konfekt und erlesenen Speisen. Unter dem Gesichtspunkt literarischer Erfindungskraft und poetischen Einfallsreichtums sind die Passagen äußerst reich und von großer Schönheit.
Nizami schreibt, dass Schirins Lippen und Zähne das Wesen der Liebe widerspiegeln: Ihre Lippen haben niemals Zähne gekannt, ihre Zähne keine Lippen. Dieses halbe Reimpaar ist ein Beispiel für die Mehrdeutigkeit der iranischen Lyrik, denn es lässt sich auf unterschiedliche Weise interpretieren. Sind ihre Lippen so voll und vorgewölbt, dass sie die Zähne nicht berühren? Oder sind sie, wie wir auf Farsi sagen, ein fein geflochtenes Band, so schmal, dass kein Zahn hineinbeißen kann? Andererseits könnte die Zeile andeuten, dass kein Mann je ihre Lippen gekostet hat, dass ihre Lippen nie die Zähne eines Mannes spürten oder gar, dass ihre Zähne nie an Männerlippen knabberten. Was meinen Sie: Gibt es eine feinere Art, die Unberührtheit einer Frau zu beschreiben, als anzudeuten, dass ihr noch nie auch nur ein flüchtiger Kuss geraubt wurde?
Von alters her bis heute suchen heiratswillige Männer eine Braut, deren Lippen keine Zähne und deren Zähne keine Lippen kennen. Wenn sie aber eine Geliebte nehmen, wünschen sie sich eine Frau mit reicher Bisserfahrung. Zu ihrem Bedauern finden sie nicht immer die Gewünschte oder müssen mit dem Gegenteil vorliebnehmen …
In weiteren Versen wird uns Schirins Erscheinung wie folgt vor Augen geführt: Ihr Antlitz gleicht einem Rosengarten … Vorder- und Rückseite ihres Körpers sind so weich wie weißer Hermelin, ihre Finger zehn lange Hermelinschwänze … Ihr Leib ist Milch und Honig, die Bögen ihrer Brauen wölben sich bis an die Ohrläppchen, die Rundung ihres Doppelkinns legt sich in sanften Falten an die Schultern.
Wie uns der Dichter wissen lässt, stammt sie aus Armenien, das zu manchen Zeiten Teil des Perserreichs war, zu anderen nicht. Da nun aber iranische Männer hellhäutige, blonde Frauen vorziehen, galten – und gelten bis heute – Armenierinnen als Schönheitsideal. Bedenkt man die Merkmale, die ich zitierte, entspricht Schirins Aussehen allerdings nicht der gängigen Mode unserer Tage.
Jedenfalls flieht die Alte aus der Kammer, und Schirin zeigt sich ihrem Bräutigam. Dem fallen fast die Augen aus dem Kopf angesichts von so viel Schönheit und Sex-Appeal. Dies ist denn auch die Klimax, auf die sich das epische Geschehen hinbewegt. Chosrou und Schirin enthält sechstausendfünfhundert Verse. Etwa vier Fünftel handeln davon, wie Chosrou die Prinzessin rühmen hört und sie begehrt, wie Schirin aus Armenien in den Iran reist, wie sich die beiden begegnen, in Liebe entbrennen und danach lechzen, einander in die Arme zu sinken. In einer eingeschobenen Episode wird von einem unschuldigen jungen Mann namens Farhad erzählt, der, arm und verachtet, weder über den Rang und die Macht des Herrschers Chosrou verfügt noch über dessen männliche Ausstrahlung. Auch er verliebt sich in Schirin. Die Romanze entwickelt sich zu einer Dreiecksbeziehung. Um das Ausmaß seiner Liebe zu beweisen – oder vielleicht seine Manneskraft –, schlägt Farhad mit nichts als einer Spitzhacke durch ein Bergmassiv einen Kanal zu Schirins Palast. Was glauben Sie nun: Welchen ihrer beiden Verehrer wird die armenische Prinzessin erhören – den verschlafenen Säufer oder den Felsbezwinger?
Wie gesagt stellen sich einer Umarmung von Chosrou und Schirin zahlreiche Schwierigkeiten, Zwischenfälle und sogar längere Trennungen in den Weg. Zuletzt aber bricht auch für sie, wie für alle Liebenden auf Erden, ob in Mogadischu oder Sarajevo, Teheran, Bagdad oder Paris, dann doch die Nacht ihrer lang ersehnten Vereinigung an, und sie widmen sich dem Blumenpflanzen, dem Nippen von mit Honig gesüßter Milch … Mit anderen Worten: Der Dichter hat fünftausendzweihundert Verse verfasst und unzählige Hindernisse erdacht, bis er die beiden in der Brautkammer zusammenführt und sich lieben lässt.
Erraten Sie, was in dieser Nacht geschieht?
In einem halben Reimpaar deutet Nizami an, dass Chosrou, als er Schirins Sinnlichkeit erblickt, sich in eine Bestie verwandelt, die den Neumond sieht – oder, um eine westliche Metapher zu bemühen, in einen Werwolf angesichts des Vollmonds.
Raten Sie!
Gehen Sie bitte nicht von Ihrer eigenen Erfahrung aus.
Ich fürchte, Sie haben falsch geraten. Nein, Chosrou stürzt sich nicht auf Schirin. Vielmehr plumpst er aufs Bett zurück und schläft ein. Ja, in diesem zärtlichen und schicksalsschweren Augenblick …
Wahrhaftig, ich denke, der Grund, warum mazedonische, arabische, turkmenische, mongolische, afghanische und britische Invasoren so leicht und erfolgreich die prächtigen Reiche Irans besetzen konnten, liegt hier. Unsere Könige hatten die Gewohnheit, in jenen heiklen, entscheidenden Augenblicken einzuschlafen, da sie Männer hätten sein müssen, stark und hart; da sie etwas Kleines, Süßes hätten erringen sollen. Und als sie erwachten, war alles verloren. Nicht nur ihr Königreich, sondern auch ihre Frauen, Sklavinnen und Schwestern waren erobert.
Zum Glück jedoch erwacht der König in unserem Liebesepos nicht, um das wütende Gesicht eines Mazedoniers, Mongolen oder Afghanen vor sich zu sehen. Er erblickt Schirin, die neben ihm liegt und wie eine Blüte schlummert. So erfüllt er zu guter Letzt doch noch seine Pflicht.
In einem anderen Text, der vor etwa vierhundert Jahren entstand, als die Zensur noch nicht so allmächtig und institutionalisiert war, verwendete der Autor für die Darstellung des Liebesakts sehr wirkungsvoll kriegerische Metaphern und schrieb: Er hob die fleischliche Keule und stieß sie gegen den Talgschild.
Nizami aber, dieser feinsinnige Poet, wählte keine derart gewaltsamen Bilder. Er stellte die Liebesszene so dar: Ungestüm beginnt Chosrou seine Braut zu küssen und zu streicheln, das heißt, er schleckt Süßigkeiten und Konfekt. Mit mancherlei Bildern verzögert der Dichter den Handlungsablauf – man denkt an die in Zeitlupe wiederholten Tore bei Sportübertragungen – und zieht wiederum Vergleiche aus dem Gartenbaubereich:





























