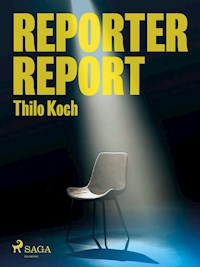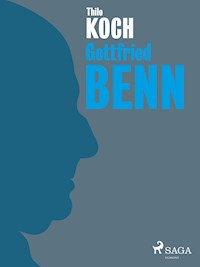Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem spannenden Buch setzt sich Thilo Koch mit der schwierigen Fragen der Verquickung von Opfer- und Täterschaft, dem gespaltenen Verhältnis mancher Leute zur NS-Ideologie, dem Krieg und dem sich daraus ergebenden Konflikt auseinander. Ein solches Werk war zu der Zeit seiner Erscheinung in 1947 noch sehr gewagt, da die damalige politische Situation noch sehr unsicher war. Trotz allem behandelt dieser Nachkriegsroman die ausgewählten Themen meisterhaft und ist auch für heutige Leser interessant geschrieben.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thilo Koch
Eine Jugend war das Opfer
Saga
Eine Jugend war das OpferCoverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1947, 2019 Thilo Koch und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788711836224
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
— a part of Egmont www.egmont.com
ERSTER TEIL
1.
Brösenheim hatte an warmen Tagen in der Mittagszeit etwas sehr Trauliches. In allen Winkeln schien sich die Behaglichkeit zu sonnen. Auch die Hauptstraße war dann menschenleer, und nur manchmal huschte ein schneller Wagen vorbei, der weither kam und weithin wollte, denn durch Brösenheim führte eine Fernverkehrsstraße. Sonst aber war es ein Städtchen, in dem noch viel verwunschene Romantik lebte und sich mancher Zug erhalten hatte, der ans deutsche Mittelalter erinnerte. Es war ein friedlicher Ort, sauber und fleißig.
In der Hauptstraße, von der Kirche nur, durch einige alte Linden getrennt, hinter denen das Pfarrhaus lag, bezeichnete ein Schild in ehrwürdiger Fraktur einen hübschen kleinen Laden als die „Buchhandlung Wilhelm Frey“. Das Häuschen war alt, aber ordentlich mit hellgrauem Kalk verputzt und mit freundlichen grünen Läden an den Fenstern Ein großes und modernes Schaufenster wies den Besitzer als fortschrittlichen Mann aus, und — was mehr besagen wollte — die Auslagen in diesem Fenster waren von einer liebevollen Hand geschmackvoll angeordnet. Wilhelm Frey, der Inhaber, war ein begeisterter Diener des Buches, hierin aller Konkurrenz in Brösenheim überlegen, während er ihr in der geldbringenden Geschäftstüchtigkeit freilich nachstand.
Wenn Frey ein Buch verkaufte, das etwas wert war, so hatte der Käufer den Eindruck; er mache es ihm zum Geschenk, und wirklich kostete es den Buchhändler jedesmal Ueberwindung, wenn er einen seiner Lieblinge aus dem Laden gab. Er genoß deshalb auch ein hohes Ansehen unter denjenigen Brösenheimern, die zum Buch ein mehr als oberflächliches Verhältnis hatten. Nachdem er den Laden von seinem Vater übernommen hatte, gab er den Handel mit Papier und Schreibwaren auf, weil er es als seine Lebensaufgabe betrachtete, eine Buchhandlung mit eigener Note einzurichten. Obwohl dieser Versuch in Brösenheim ein Wagnis war, blieb das Geschäft schuldenfrei, und der Umsatz stieg langsam. Es schien, als machten die Brösenheimer allmählich Fortschritte in der Veredelung ihres literarischen Geschmacks — fast unmerklich erzogen durch die kleine Buchhandlung in der Hauptstraße.
Noch einen nicht bibliophilen Anziehungspunkt gab es dort. Dieser wirkte namentlich auf die älteren Schüler und jungen Lehrer und lebte wie eine bunte Blume unter den vielen gedankenschweren Bänden. Es war Christa, Freys Tochter, die ihm seit ihrem Abgang aus der Schule im Laden half. Was sie dem Vater an Sachkenntnis nachstand, das ersetzte sie durch den Scharm ihrer Bedienung, und je nach Alter und Eigenart wandten sich die Kunden lieber an sie oder an ihn.
Eben jetzt saß Christa hinter dem alten dunkelbraunen Holzpult und schrieb Rechnungen aus, denn einige der nicht ganz zuverlässigen Kunden mußten erinnert werden.
Es war ganz still in dem kleinen Raum. Ein Abglanz der Mittagssonne lag ausgebreitet über den vielen Buchrücken an den Wänden und auch über dem Mädchen, das dort saß und schrieb. Manchmal hob Christa den Kopf und hielt ein mit schreiben, um zu dem Nebenfenster hinauszuschauen, von dem man auf den Kirchgarten mit seinen schönen, alten Linden sehen konnte. Das Rechnungenschreiben gefiel ihr nicht sonderlich. Ein Kunde war nicht zu erwarten, weil Brösenheim jetzt Mittagsruhe hielt. So lehnte sie sich in dem Kontorstühlchen zurück und träumte vor sich hin. Die Sonne flutete durch das Glas in der Ladentür und durch den oberen Teil des Schaufensters, zeichnete mit dicken, warmen Strahlenbündeln Muster auf den Linoleumfußboden und umspielte auch das Mädchen selbst aufs lieblichste. Nur manchmal unterbrach ein vorbeisausender Wagen die Mittagsruhe. Mit dem eigentümlich dunklen Singen schneller Gummireifen auf Asphalt näherte sich wieder ein Auto — und war auch schon vorbei. Christa sah nur ein Aufblinken von schwarzem Lack, blitzenden Chromteilen und zwei weiße Autokappen. Ihre Brust hob sich zu einem kleinen Seufzer, und sie trat an die Ladentür in Erwartung, daß bald wieder so ein schöner Wagen vorbeiführe. — Wer doch auch so in die herrlich sonnige Welt hinausfahren dürfte! In so einem blitzenden Kabriolett! Und am Steuer müßte einer sitzen, den man liebhaben könnte . . .
Langsam wendete sie sich um und schritt zum Pult zurück. Sie hatte einen besonders schönen Gang und trug deshalb gern hohe Absätze; ihre Bewegungen waren weich. Die Kopfwendung, mit der sie jetzt eine blonde Locke zurückwarf, zeigte, daß sie sich ihrer Reize bewußt war. Ihr kurzes Faltenröckchen strich nicht sehr freundschaftlich an den Büchern hin. Gewiß, Brösenheim war ein liebes Nest, und sie hing daran. Sie hing auch an Vater und Mutter und besonders an dem Bruder. Aber der Vater sah nur seine Bücher, die Mutter war lieb und gut, ahnte aber nichts von ihrer unbändigen Sehnsucht nach dem Leben, weil sie von Natur aus still und bescheiden war und sich auch mehr um Thomas, den einzigen Sohn, kümmerte. Dieser aber lebte eingesponnen in die Musik, hatte Schulkameraden um sich, und im stillen erfüllte ihn ganz und gar eine Neigung für Gisela, ihre Freundin aus dem Pfarrhause. Mit Gisela Machenberg verstand sie sich gut; doch auch sie schien nicht dieses ganz starke, übermächtige Drängen nach etwas Ungewöhnlichem, nach dem brausenden, wilden, schönen Leben zu kennen, dieses heiße Wollen, das manchmal so betäubend aufwallte. Gab es überhaupt jemanden, der so etwas in ihr ahnte?
Nicht immer indessen war Brösenheim so verschlafen wie an warmen Sommertagen. Zwischen sechs und sieben abends glich die Hauptstraße ganz im Gegenteil einem weltstädtischen Korso. Das war die Zeit des „Bummels“ — Höhepunkt des Tages für Brösenheims Jugend. Es gehörte zu Christas größten Schmerzen, daß sie nur selten „auf den Bummel gehen“ konnte, denn gerade dann wurde sie im Laden gebraucht. Es war ja die allgemeine Einkaufszeit kurz vor dem Abendessen, und viele der Vorbeigehenden wurden durch eine neue Auslage verlockt, andere erledigten ihre laufenden Anliegen in der Buchhandlung. Die ständigen Kunden kamen freilich in den stilleren Stunden, weil sie mit dem alten Frey allein sprechen wollten oder — die anderen — mit der schönen Christa. Seit Thomas, der Bruder, nun Primaner war, duldete es der Vater nicht mehr, daß er Christa um diese Zeit einmal vertrat, wozu er früher immer gern bereit gewesen war. „Als Primaner gehört er auf den Bummel“, meinteVater Frey schmunzelnd. „Wenn er nicht zu arbeiten hat“, setzte er vorsichtshalber hinzu.
Thomas selbst ging jetzt auch wirklich gern auf den „Bummel“, während er sich noch bis zu diesem Frühling wenig daraus gemacht hatte. Er brauchte nicht lange in sich zu forschen, um die Ursache zu finden. Dabei mußte er dann meistens ganz heimlich lächeln, weil ein seltsames Glücksgefühl in ihm aufkam — ein wenig bang und doch so erwartungsfroh.
Heute herrschte wieder reges Treiben. Die Hitze des Tages war einer linden Abendluft gewichen, und jeder erging sich gern darin. Das Bild war bunt und bewegt. Die Jungen trugen meistens kurze Hosen und leichte Hemden, die Mädchen helle Waschkleider oder farbige Blusen mit Röcken, die — der Mode folgend — jedes Jahr kürzer wurden. Eingehenkelt, zu zweit oder zu dritt, oft auch in breiter Kette, die immer wieder vor einem hupenden Auto oder einem Radfahrer zerstob, um sich lachend erneut zu verbinden, schlenderten sie die Hauptstraße auf und ab. Die Kirche am einen Ende und die Apotheke jenseits des Marktes am anderen waren nach uralter Ueberlieferung die Grenzen des Bummels. Hier traf und fand sich das ganze Jahr hindurch, mit Ausnahme der Ferien, allabendlich zwischen sechs und sieben, was sich treffen und finden wollte. „Wir müssen auf den Bummel!“ Das war auch für die strengste Mutter ein Entschuldigungsgrund, denn „der Bummel“ war für sie selbst eine Jugenderinnerung, die sie um keinen Preis hätte missen mögen. Da wurden Blicke getauscht, oder man fühlte sich auch nur angesehen und traute sich nicht aufzuschauen; da erzählte man sich die neuesten Ereignisse und Erfahrungen, Liebschaften und Zerwürfnisse, da wurden die Lehrer durchgenommen, und unter den älteren Schülern kam es auch wohl zu einer Diskussion.
Meistens schickten die Mütter, um den Bummel mit etwas Nützlichem zu verbinden, die Töchter und Söhne gerade um diese Zeit einkaufen, wozu das junge Volk stets und sofort mit ungeduldigem Eifer bereit war. Dadurch waren die Bürgersteige und oft auch der Fahrdamm der Hauptstraße abends so überfüllt, daß manch ungeduldiger Autofahrer über „diese Gesellschaft von Nichtstuern“ fluchte. Aber den zornigen Signalen antworteten nur kichernde Mädchen, die behend zur Seite sprangen. Immer gleichmäßig gelassen schauten die alten Fachwerkhäuser mit ihren vorragenden Stockwerken und Erkern auf das fröhliche Gewühl herab.
Thomas traf sich meistens mit Karl Machenberg, dem Klassenkameraden und Freund. Manchmal war Karls Schwester Gisela dabei. Gisela wurde aber immer nur zu schnell von ihren Freundinnen mitgezogen, die laut schwatzend und lachend die ernsthafteren Jungen in ihrer Primanerwürde stehen ließen.
Heute kam Karl allein. Er wirkte immer etwas bedrückt. Nur in Thomas Gesellschaft wurde er freier und sprach auch nicht so gehemmt wie sonst. In der Schule brachte er oft kein Wort heraus, obwohl er meistens die Antwort wußte. Aehnlich ging es ihm auch sonst; er war ein Pechvogel. Dennoch verzagte er nicht und versuchte sich nützlich zu machen, wo er nur konnte. Jeder Entschluß fiel ihm schwer, hatte er ihn aber gefaßt, brachte ihn nichts mehr davon ab. Er wurde von seinen Mitschülern als guter Kamerad geschätzt.
„Gisela ist zu Hause geblieben“, sagte er gleich, als er Thomas’ enttäuschtes Gesicht sah, „es geht der Mutter heute wieder sehr schlecht. Der Vater wurde erneut abgeholt.“
„Was, schon wieder?“ fragte Thomas erschrocken.
„Ja, heute nachmittag. Mutter ist völlig erschöpft von der Aufregung. Wir müssen das Schlimmste für sie befürchten.“
Die beiden Freunde gingen schweigend nebeneinander her, wie von selbst hinaus in die Felder, denn nach dem Betrieb in der Hauptstraße war ihnen jetzt nicht zumute.
„Und man kann nichts dagegen tun?“ sagte Thomas. „Was mag denn dein Vater wieder gesagt haben?“
„Ich weiß nicht, Thomas. Er spricht mit Rücksicht auf die Mutter nicht von seinen Sorgen. Aber seit er damals dem Konzentrationslager knapp entronnen ist, war er vorsichtig in seinen Predigten. Schwer genug ist es ihm geworden, das weiß ich. Er tat es auch nur um der Mutter willen, denn er muß es ihr unbedingt ersparen, daß sich die damalige Demonstration wiederholt. Du wirst dich entsinnen, wie die SS den Vater in Sprechchören beschimpfte, wie man uns die Fenster mit Steinen einwarf, unsere Haustür besudelte und am liebsten uns alle gelyncht hätte. — Was man ihm jetzt wieder zur Last legt? Vielleicht ist es ein Vorwort, das er neulich für ein Buch schrieb. Darin äußert er sich gegen eine Gewaltherrschaft, die dem Menschen Freiheit des Glaubens verspricht, während sie in Wahrheit jeden vernichtet, der eine andere Meinung als die befohlene hat.“
„Das darf man heute aber auch nicht laut sagen“, entgegnete Thomas gedrückt. „Warum vermeidet er solche Herausforderungen nicht, wo er doch weiß, daß er als einzelner nichts ändern kann! Wir müssen uns eben alle fügen, bis der erste Eifer sich gelegt hat und das Gute an der neuen Idee reiner in Erscheinung tritt.“
Karl nickte: „Ich habe es ihm oft gesagt, man müsse sich über Fehler im Kleinen hinwegsetzen, wenn dafür das Große gedeiht. Und es gedeiht ja wirklich: Ueberall ein Erstarken und Aufblühen, keine Arbeitslosen mehr. Das sind Tatsachen. Er gibt das auch zu; er freut sich von Herzer über jeden Aufschwung unseres Volkes, aber er sagt, wenn jemand die Religion angreife und unterdrücke, dann sei das sein Feind.“
„Er hat natürlich recht, aber er richtet sich damit zugrunde. Will er denn die Zahl der kirchlichen Märtyrer vergrößern?“
„Du kennst ihn ja, Thomas, er ist alles andere als ein Fanatiker. Er gibt auch nach um der Familie willen; aber seit Mutters Krankheit, die durch jene Demonstration ausgelöst wurde, ist er manchmal bitter und unbeherrscht.“
„Es war furchtbar damals. Aber meinst du nicht auch, daß es nur von unmaßgeblichen Lümmeln ausging?“
„Ich bin davon überzeugt, sonst müßte man ja an allem zweifeln. Man kann doch nicht glauben, daß solche Vorgänge befohlen werden und mit Einverständnis der Regierung geschehen. Es ist eben ein Unglück für unsere Familie, daß Vater es zu ernst nimmt und nicht mit der Zeit geht.“
Thomas dachte an Gisela und ihre Mutter. Was mochte bevorstehen?
Ihren Gedanken nachhängend, kehrten beide in die Stadt zurück. Nicht wie sonst hatte ihnen die Natur Freude gemacht, obwohl doch die Sonne gerade hinter dem kleinen blauen Höhenzug, der die weiten Felder begrenzte, untergegangen war.
Der Bummel verebbte bereits, als sie die Hauptstraße wieder erreichten. Nur Peter Möhlen in der Uniform eines HJ-Gefolgschafts führers, die er auch meistens in der Schule trug, stand noch mitten auf der Hauptstraße, von einer Schar Jungen umgeben, die ihm zuhörten.
„Also ich sage euch jetzt zum letztenmal, daß der Bummel für uns nicht in Frage kommt. Das ist eine Sache von vorgestern. Ueberholt für uns. Ich will keinen von euch wieder hier treffen, sonst setzen wir eben öfter Dienst an, wenn ihr noch zuviel Freizeit habt.“
Mit kurzer Wendung drehte er sich um und sah dabei seine Klassenkameraden Karl und Thomas.
„Na, wo kommt ihr her?“ begrüßte er sie. „Freue mich, euch nicht auf dem Bummel gesehen zu haben. Blödes Getue hier.“
„Ach, ich weiß nicht. Ich finde es nicht schlecht. Du bist etwas radikal, Peter.“ Thomas sah sinnend die Straße hinunter. An einigen Giebeln glühten Butzenscheiben in den letzten Sonnenstrahlen rot auf, als brenne es in den Häusern.
„Das muß man, wenn ein neues Reich gebaut wird. Dieser Schlendrian ist absolut unproduktiv. Wir werden viele liebe Gewohnheiten aufgeben müssen.“ Peter blickte Thomas mit seinen scharfen, hellen Augen an. Kurz geschoren, aber nicht ganz gehorsam, standen seine rotblonden Haare von dem schmalen Kopf ab.
„Ehrlich gesagt“, erwiderte Thomas leise, „oft sehne ich mich nach jener ruhigen, freien Zeit, zu der dieser Schlendrian paßte. Es geschieht heute alles so schnell, so rauh und rücksichtslos.“
Peter schüttelte den Kopf: „Du neigst zu solchen Stimmungen, Thomas, aber du mußt sie unterdrücken. Später, wenn wir stark und groß in der Welt dastehen, magst du sie wieder hervorholen.“
Thomas nickte. „Ja, ja, aber manchmal zweifle ich sogar, daß es jemals ruhige und freie Zeiten gab, außer in den Wunschträumen der Dichter. — ‚Das goldene Zeitalter‘! Ist es mehr als eine erbauliche Legende, erfunden zur Verklärung der Vergangenheit und der Zukunft, damit die niemals goldene Gegenwart erträglicher werde?“
„Philosophieren wir nicht so viel.“ Peter sah nach der Uhr. „In fünf Minuten habe ich Führerbesprechung. Uebrigens, was höre ich, Karl, dein alter Herr ist wieder verhaftet worden? Tut mir aufrichtig leid. Er ist ein tadelloser Mensch und ein aufrechter Mann, wie wir welche brauchen im neuen Reich. Daß er christlich denkt und redet, ist schließlich seine Pflicht als Pastor. Ich bedaure nur, daß er überhaupt Pastor ist. Das führt ihn zu immer neuen Konflikten. Dabei kämpft er für eine Sache, die kaum noch lebendig ist. — Trotzdem sollte man ihn in Ruhe lassen. Ich werde mich für ihn einsetzen.“
Karl hob die Schultern: „Ich zweifle, daß du etwas erreichst. Er selbst erträgt ja alles; sein Glaube macht ihn stark. Aber die Mutter . . .“
2.
Im Brösenheimer Gymnasium herrschte eine Stimmung freudiger Erwartung. Die großen Ferien waren nicht mehr weit. Das bedeutete fünf Wochen goldene Freiheit — keine Schulsorgen, frohe Fahrten, vielleicht eine große Reise.
In der Prima äußerte sich die Hochstimmung gedämpfter, weil man doch nicht vergessen durfte, daß der obersten Klasse eine gewisse überlegene Würde zukommt. Aber die Hoffnungen auf die Ferien waren nicht weniger hochgespannt, handelte es sich doch gerade für die Primaner um die letzten großen Ferien.
Dr. Melk, ihr Klassenlehrer, sagte: „Nützt diese fünf Wochen Freiheit noch einmal recht aus. Ihr werdet höchstwahrscheinlich nie wieder im Leben eine so lange Zeit frei sein — ausgenommen ihr würdet Lehrer werden. Aber davon muß ich abraten, es sei denn, bis dahin behandeln Primaner ihren Klassenlehrer netter, noch netter, als ihr mich. Macht in den Ferien meinetwegen eine schöne Reise oder geht in ein Lager der HJ, aber wenn ich euch meine ganz persönliche Meinung sagen soll: Wandert hinaus in das schöne deutsche Land, fühlt euch frei in der freien Natur und laßt euch nicht einspannen für irgendeinen Zweck. Dienen müßt ihr früh genug, später im Beruf und auch sonst als erwachsener Staatsbürger. Wandern solltet ihr, nicht marschieren. Schweift frei hinaus und öffnet der Schönheit Auge und Herz. Ihr seid in ein nüchternes Zeitalter hineingeboren, aber schämt euch deshalb nicht, auch einmal ein wenig schwärmerisch zu sein. Macht euch noch einmal von allem frei, von Mädchen und Bier, Zigaretten und Büchern — — — und von Uniformen, hätte ich beinahe gesagt . . . aber nur beinahe, oder haben Sie etwas gehört, Brinkmann? — — — Macht euch frei, geht in die Natur und lernt in ihr zugleich die Welt und das menschliche Leben begreifen. Ob ihr nun weit hinausschweift oder in der Nähe bleibt, das Wesentliche findet ihr überall gleichermaßen, die Schönheit ist in der einzelnen Blüte so gut wie in den gewaltigsten Alpenlandschaften. Verachtet mir nicht das Kleine, scheinbar Geringe, das langsam Werdende, das Leise und Stille. Man neigt heute zu lauten Tönen, zur großen Geste, und während man sich über das Pathos der Goethezeit oder gar das des Barock lustig macht, gewöhnt man sich an ein viel Gefährlicheres, an ein leeres und phrasenhaftes. Wie seelenlos die neue heldische Pose ist, das könnt ihr in jeder Ausstellung bildender Kunst der Gegenwart sehen.“
Nach dieser kleinen Rede ging er dann wieder zum eigentlichen Unterrichtsstoff über.
Anschließend erhob sich, wie immer nach solchen Aussprüchen Melks, eine hitzige Diskussion. Gern hatten sie ihren Klassenlehrer alle, oder doch fast alle, und daß er ein überdurchschnittlicher Kopf war, wußten sie. Wenn sie über ihn spotteten, geschah es mit einem Unterton der Genugtuung, daß gerade sie einen so wunderlichen, aber bedeutenden Klassenlehrer hatten. In seinem Aeußeren konnte der Studienrat Dr. Melk wohl einen Karikaturisten reizen. Der unvermeidliche Knotenstock, der schwarze Schlapphut im Winter — denn im Sommer genügte ihm die lange graue Mähne als Kopfbedeckung — die leicht gebeugte Haltung, das stets ein wenig aus einer Seitentasche des Jaketts hervorschauende Bändchen Lyrik und die erstaunliche Vergeßlichkeit in allen Dingen des alltäglichen. Alltags, alles das schwankte um jene Grenze, wo das Erhabene ins Lächerliche übergeht. Dennoch genoß er die Achtung auch des Kollegiums, denn seine sokratische Art zu fragen war gefürchtet. Den Herrn Oberschulrat hatte er sich damit freilich zum Feind gemacht. Man munkelte von einer Direktorenstelle, die er darum nicht bekommen habe, zumal er nicht Pg. sei und auch keiner werden wolle.
Melk galt als der beste Pädagoge am Gymnasium. Der Buchhändler Frey, der in ihm den überlegenen Buchkenner verehrte, hatte oft ausgerufen, der Dr. Melk müsse an eine Universität mit seiner Belesenheit. Wenn Melk das hörte, lachte er nur und versicherte, es gefiele ihm just in Brösenheimund just als Schulmeister. Ganz aber kannte sich niemand mit dem Studienrat Melk aus. Es gab Bezirke in ihm, dort war er unzugänglich. Dazu gehörte sein Privatleben. Alle Zudringlichkeiten und auch gutgemeinte Versuche, ihn für die Geselligkeit zu retten, lehnte er mit ironischer Gelassenheit ab. Man raunte sich allerlei zu von einer unglücklichen Liebe, von Scheidung und Abbruch einer großen Laufbahn als Wissenschaftler. Schließlich gehört der Dr. Melk zum gewohnten Stadtbild, und man fand anderen Gesprächsstoff als sein vermutliches Geschick.
Die Primaner kannten ihren Lehrer am besten, aber trotzdem waren sie oft geteilter Meinung über die Anschauungen, die er ihnen vermittelte.
„Es ist unverschämt, wie er sich über alles Neue, besonders die HJ, immer lustig macht.“ — „Er ärgert sich nur, weil er in ein Lehrerschulungslager muß!“ — „Es ist auch eine Gemeinheit, daß man ihn in seinem Alter dorthin schickt!“ — „Laßt ihn reden, er ist aus einer anderen Zeit.“ — „Nein, er hat recht, wir wollen noch einmal unsere Freiheit genießen! Beim Arbeitsdienst und Militär stehen wir dann noch früh genug unter Aufsicht und Befehl!“ — So gingen die Meinungen auseinander.
Mittags, auf dem Heimweg, gesellte sich Peter Möhlen zu Thomas und Karl, die zusammen gingen.
„Na, was haltet ihr davon: Wandern oder marschieren? — Du bist natürlich für wandern“, wandte er sich an Thomas. „Oder nein, für die große Reise, denn du hast doch deinen Plan, als Austauschschüler für die Ferien nach England zu gehen, nicht aufgegeben?“
„Keineswegs“, lachte Thomas, „ich verspreche mir ein wunderbares Erlebnis davon.“
„Hm, du solltest dich lieber mit dem Gedanken an unser Zeltlager vertraut machen . . . Und du, Karl? Hast du dich endlich für das Lager entschieden?“
„Ich würde schon gern“, sagte Karl verlegen, „aber mit Mutter geht es immer schlechter, und man weiß nicht . . .“
„Laß die vielen Bedenken, Mann. Dein Vater ist aus der Untersuchungshaft entlassen; du mußt also zugeben, daß man den Irrtum einsah und keine Ungerechtigkeit beging. Und dir tut es not, einmal aus der Krankenstubenluft da in der Pfarre herauszukommen. Im übrigen hält dich wohl auch noch etwas anderes, wenn ich mich nicht irre, oder wie ist das mit der schönen Christa vom Buchhandel, hm?“
„Mit der Christa, das laß nur ganz meine Angelegenheit sein!“ Karl wurde rot und brachte es darum doppelt zornig heraus.
„Oder die Sache des forschen Ferdi Pellke“, fiel ihm Peter ins Wort.
„ . . . meine Sache sein“, beharrte Karl, „und was meinen Vater betrifft, so wäre ihm das KZ sicher gewesen, wenn sich nicht merkwürdigerweise plötzlich ein einflußreicher Mann für ihn verwandt hätte. Das sind ja alles so dunkle Beziehungen! Ich will gewiß nicht rückständig sein, gerade weil ich ein Pastorensohn bin. Ich stehe zur neuen Sache wie du, Peter. Aber wenn man in der eigenen Familie immer wieder die Schattenseiten erlebt, dann kann man eben manchmal an allem verzweifeln. Es ist vieles faul!“
„Gerade darum müssen wir besonders viel guten Willen aufbringen!“ rief Peter. „Wenn wir dann etwas zu sagen haben werden, soll unsere Gesinnung das Faule ausschalten. Kritik leistet gar nichts, Bessermachen gilt!“
„Recht gut“, bestätigte Thomas, „aber wer Kritik verbietet, gesteht der nicht damit ein, daß er Kritik zu fürchten hat?“
„Man kann auch alles negativ sehen“, sagte Peter ärgerlich. „Du bist von Melk angesteckt! Mit dieser Haltung wirst du es im neuen Reich noch sehr schwer haben. Begreift ihr denn nicht, daß jeder sich unterordnen muß, damit wir das große Ziel erreichen: eine schöneres, starkes Deutschland mit Raum und Arbeit für alle Volksgenossen! Daß man da eben gehorchen können muß und die eigenen Wünsche zurückzustecken hat?“
„Wir sind so gut bereit wie du, für eine schöneres, starkes Deutschland persönliche Wünsche zu opfern.“
„Wenn es sein muß, noch mehr“, bekräftigte Karl erregt. Thomas fuhr fort:
„Aber wenn alles erzwungen werden muß, wenn die Methoden unsauber sind, wenn man die Gewalt als oberstes Prinzip ansieht, dann machen mich auch die größten wirtschaftlichen und politischen Erfolge nicht froh.“
Peter Möhlen widersprach: “Unsere Bewegung ist jung. Ihr könnt von ihr noch keine weise Mäßigung erwarten. Zuerst müssen wir mächtig sein, um jeden Preis, auch wenn darüber erst einmal manches andere zugrunde geht. Vieles ist sowieso reif dafür. Zuerst müssen wir wieder eine Weltmacht werden.“
Sie waren inzwischen bei der Buchhandlung angelangt, und Thomas sagte:
„Wir sprechen nicht das erstemal darüber, Peter. Deinen persönlichen guten Willen verkennt keiner. Aber ob dein guter Wille auch Gutes bewirkt, bezweifle ich manchmal. Wir werden unsere Lage nicht verbessern, wenn wir ein Rachegeschrei anstimmen, das alte Gegensätze nur immer tiefer aufreißt. Man kann kein Unrecht wiedergutmachen, indem man selbst ein neues und größeres Unrecht begeht. Damit wird man schuldig. Und erfährt man nicht auch im kleinen an sich selbst, im persönlichen Leben, daß jede Schuld sich rächt? Ich glaube daran, daß nicht skrupellose Berechnungen den wahren Erfolg bringen, sondern daß es eine große, ausgleichende Gerechtigkeit gibt, die jedem sein Teil zumißt. Diese ausgleichende Gerechtigkeit zeigt sich selten sofort und nie ganz deutlich für uns Menschen. Selbst glänzende Erfolge können täuschen. Bei dem allgemeinen Taumel von Ueberheblichkeit kann ich nicht mit.“
Verdrossen, wenn auch etwas nachdenklich geworden, wandte sich Peter zum Gehen: „Du gehörst auch zu den ewigen Meckerern“, sagte er, „und fast tut es mir leid, daß ich für dich eintrat, als man bei mir nachfragte, ob seitens der HJ Bedenken bestünden, daß du als Austauschschüler nach England gehst. Man hält dich für politisch unsicher und nicht für geeignet, das neue Deutschland im Ausland zu vertreten.“
Thomas war betroffen: „Wieso? Macht man denn Schwierigkeiten? Will man mich nicht fahren lassen?“
„Ich sagte es“, entgegnete Peter kurz und ging.
Mutter Frey merkte es ihrem Sohne gleich an, daß ihn etwas bedrückte. Sie wußte sich ihm in einer besonderen Weise verbunden. Die musikalische Begabung und eine damit zusammenhängende Empfindsamkeit hatte er von ihr. Sie war sehr abhängig von der Umwelt. Alle Feindseligkeit scheuend, war sie nur froh in einer Atmosphäre reinen Wohlbehagens. Nicht, daß sie sich leicht umwerfen ließ von kleinen oder großen Unerfreulichkeiten — aber sie war dann gedrückt und konnte nicht frei atmen. Heitere Helligkeit sollte um sie sein, und diese hatte sie sich in ihrem Haushalt immer zu schaffen gewußt, ohne daß sie dafür besondere Anerkennung forderte. Die Zufriedenheit ihres Mannes und ihre Kinder waren ihr Belohnung genug. Immer gab es viel Blumen im gemütlichen Obergeschoß des alten Hauses der Buchhandlung Frey, in dem die Familie wohnte. Immer auch hatte sie für Ruhe gesorgt, wenn ihr Mann über den Büchern saß, hatte an manchen Tagen mehr in der Buchhandlung gestanden als er, wenn er einmal ganz verlesen war. Ihr Haushalt lief mit lautloser Selbstverständlichkeit. Doch was sie über eine gute Hausfrau hinaus noch war, galt der Musik. Im Wohnzimmer stand das alte Klavier, das sie von ihrem Vater geerbt hatte, welcher Lehrer und Kantor gewesen war. An dieses Klavier knüpften sich für sie viele liebe Erinnerungen. Thomas hatte darauf von ihr die ersten Unterweisungen — noch im Kindesalter — bekommen, hatte dann lange darauf geübt und auch schon recht hübsch gespielt, bis er zur Orgel fand, der er dann ganz verfiel. Jetzt spielte er nur noch manchmal darauf, um der Mutter eine Freude zu machen. Meistens saß er an der Orgel der Brösenheimer Kirche. Manchmal, wenn sie Zeit hatte, folgte ihm die Mutter dahin, ohne daß er es merkte, und freute sich seiner Fortschritte. Dann setzte sie sich still in eine Kirchenbank und lauschte. Ueberhaupt tat sie all das in der Stille, wovon andere Menschen viel hermachen. Andererseits sprach sie sich gern einmal aus, wenn sie irgend etwas bewegte.
Auch Thomas hatte etwas von diesem Bedürfnis nach Resonanz. Er konnte schlecht mit sich allein abmachen, was ihn bedrückte oder freute. Wenn sich etwas nicht dazu eignete, um mit den Eltern oder Freunden besprochen zu werden, schrieb er seine Gedanken darüber in ein kleines Büchlein. Sein heimlichstes Du war dieses Tagebuch. Hatte er etwas in Worte gefaßt, was ihn bedrückte, fühlte er sich erleichtert, wenn die Formulierung auch unklar und unvollkommen war. Darüber hinaus gab es viel, was sich nicht gedanklich fassen lassen wollte. War es quälend, so fand er am ehesten bei der Orgel Beruhigung und Klärung, nicht zuletzt dadurch, daß er sich jedes sentimentale Schwelgen in Akkorden versagte und sich auch in der freien Improvisation streng an das innere Gesetz seines Instruments hielt.
Für die Frage allerdings, die ihn im Augenblick bewegte, konnte er weder bei Tagebuch noch Orgel Antwort finden. Was hatte die Bemerkung Peter Möhlens zu bedeuten, und welche Folgen konnte es haben, wenn die HJ ihn für unwürdig erklärte, als Austauschschüler nach England zu gehen? Darüber besprach er sich nun mit der Mutter. Sie war noch bestürzter als Thomas selbst, denn alle Konflikte scheute sie mit einem geradezu körperlichen Unbehagen. Alles sollte friedlich sein.
Vater Frey blätterte in einer. Fachzeitschrift und meinte, man müsse erst abwarten, was daran wahr sei. Er traue den Bengels schon zu, daß sie sich erst einmal spreizten, um ihre Macht zu beweisen.
„Peter Möhlen hat es befürwortet, Vater“, bemerkte Thomas.
„Ach, geh mir mit Möhlen.“ Der Vater stand auf und trat ans Fenster. „Der junge Mann fühlt sich schon jetzt als General. Soll warten, bis er wirklich einer ist.“
„Nein, Vater, Peter ist kein schlechter Kerl. Er ist eben durch und durch eine soldatische Natur. Darum hat er Freude an dem Lebensstil, den man heute will.“
„Ja, mein Junge, du bist in die verkehrte Zeit hineingeboren. In ein musisch betontes Zeitalter gehörst du. Etwas fehlt eben immer: Mein Vater und ich, wir standen zu schwer im materiellen Lebenskampf, als daß wir hätten entwickeln können, was in uns war an Sehnsucht nach schöpferischer geistiger Arbeit. Es blieb beim Lesen. Zum Studieren reichte das Geld nicht; vielleicht auch nicht die Gaben. Du bist nun so weit, Thomas. Du hast die geistigen Voraussetzungen, und für die materiellen kann ich sorgen. Das ist die schönste Erfüllung meines Lebens.“
Elisabeth Frey lehnte den Kopf an die Schulter ihres Mannes. Sie waren noch immer zärtlich zueinander wie ein Liebespaar. Er legte den Arm um sie.
„Ja, Mutter, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Aber nun sind wir über den Berg. Nur die Zeit macht mir manchmal Sorge. Wird Thomas in ihr so leben können, wie wir es wünschen? Es sieht recht günstig aus, aber ob nicht wieder ein Krieg alles zerstört?“
„Vater, wie kannst du das denken?“ Elisabeth Frey richtete sich erschrocken auf. „Wir wollen doch keinen Krieg. Wissen wir nicht, wie furchtbar er ist? Zwanzig Jahre liegt er erst zurück. Auch die Männer an der Spitze kennen ihn; auch sie können ihn nicht wollen.“
Vater Frey strich ihr begütigend über das Haar. „Natürlich nicht. Ich glaube auch nicht daran. Es kann nicht sein.“
Zu Thomas gewendet fuhr er fort: „Stelle dich nur nicht zu schlecht mit der HJ. Du mußt hindurch, um später in die Partei zu kommen, denn wenn du ins Berufsleben treten wirst, kannst du ohne Parteigenossenschaft nicht einmal mehr Straßenkehrer werden. Ich überlege sogar, ob ich deinetwegen nicht auch noch in die Partei gehe, obwohl mir der ganze Kram nicht liegt. Aber es soll doch nichts versäumt werden, was dein Fortkommen unterstützt.“
„Ach, Vater“, sagte Thomas, „sorge dich nicht zu sehr. Ich will schon aus eigener Kraft durchkommen, wenn du mir am Anfang hilfst.“
Der alte Frey lächelte mit heimlichem Stolz. „Aber verfall mir nicht zu sehr der Musik, hörst du! Vergiß nicht, daß mal ein Literaturoder Philosophieprofessor aus dir werden soll!“
„Er wird es schon recht machen“, schloß die Mutter.
3.
Die letzte Schulwoche vor den großen Ferien neigte sich dem Ende zu. Ueber Brösenheim lag noch immer freundlicher Sonnenschein. Das kleine Städtchen inmitten von Wiesen, Forststreifen und Feldern, unweit kleiner Höhenzüge, stand in inniger Beziehung zur Natur. Nur über die Flußbrücke brauchte man zu gehen, um in den Feldern zu sein, die jetzt golden glänzten und in der Sommerhitze der letzten Reife zuwuchsen. Kleine Feldwege schlängelten sich hindurch, an deren Rande der rote Mohn und die Kornblume blühten. Unweit begann ein Wald hoher Kiefern mit helleren Laubbeständen dazwischen. An einer Waldecke vorbei konnte sich der Blick ungehindert in die Weite verlieren. Zartblau erhob sich fern der kleine Höhenzug als belebender Abschluß der Ebene.
Im warmen Schein der untergehenden Sonne war Thomas oft zwischen diesen Feldern gegangen oder im Walde, wo die Kiefernstämme dunkelrot, wie von innen heraus, im Abendlicht glühten. Diese Wege hatten ihm die Heimat erst so ganz lieb und vertraut gemacht. Jede Blume hätte er streicheln mögen und jede der hellen schlanken Birken umarmen. Oft lag er stundenlang in den Wiesen oder auf dem warmen Waldboden und atmete den kräftigen Duft der Erde und des Baumharzes, der Tannennadeln und Gräser, lauschte dem Rauschen der Baumkronen, die sich langsam und gleichmäßig auf ihren hohen, schlanken Stämmen wiegten. Er sah den kleinen Wölkchen nach, die schnell vorüberzogen, und er betrachtete mit lächelnder Aufmerksamkeit den großen schwarzen Käfer mit glänzendem Panzer, der seine Gewichtigkeit durch das Heidekraut schob. Sein ganzes Entzücken galt den Schmetterlingen, diesen zartesten Gebilden eines lichten Sommers. Wenn ein Falter die Farne umgaukelte wie ein Hauch, dann konnte er ganz in die Betrachtung dieses Spiels versinken. Oft wußte er nicht mehr wohin mit all seinem Gefühl, mit dem Dank für all diese Schönheit. Manchmal hatte ihn Karl begleitet; aber der Freund empfand nicht so tief, was ihn selbst trunken und selig machen konnte.
So ging Thomas diese Wege meistens allein. Kennengelernt hatte er sie mit dem Vater, an dessen Hand er zuerst hinausgekommen war in die große Natur. Manchmal war auch die Mutter mit ihm gewesen oder Christa, mit der er hier gespieltl hatte; auch dann und wann andere Kinder. Aber seit Thomas das Nachdenken liebte, störten ihn laute Spiele und ein Redenmüssen in diesem idyllischen Reich. Bald hatte er seine eigenen Winkel und kleinen Steige, wo er vor allen Menschen sicher war.
Und doch, sein einsames Glücklichsein in der Natrur blieb nicht immer so ungetrübt. Langsam erwachte in ihm die Sehnsucht, seine Gefühle und Gedanken mitteilen zu können — leise und in vertrautem Gespräch mit . . . ja, mit wem? — Erst ziemlich spät nahm für ihn dieses ersehnte Du die Gestalt eines Mädchens an. Zunächst war es ein reines Wunschbild mit unbestimmten Zügen.
Nach solchen Nachmittagen in der Natur ging er oft noch in die Kirche und versuchte in der Orgel aufklingen zu lassen, was ihn bewegte. Oft spielte er, bis es ganz dunkel war in dem hohen, kühlen Raum. Aber immer weniger glücklich verließ er das geliebte Instrument. Je älter er wurde, desto stärker zeigte sich ihm eine schmerzende Spannung zwischen der seligen Verträumtheit draußen in den Feldern und der kühlen Klarheit seiner Orgelmusik.
Einmal geschah es dann, daß an einem Abend, da er bei der Orgel seine zerfließenden gegensätzlichen Stimmungen fassen wollte, plötzlich ein Mädchen hinter ihm stand, als er die Hände von den Tasten nahm, den verschwebenden Klängen nachlauschend.
Ein kleines Geräusch machte ihn aufmerksam. Das Mädchen hatte sich heimlich wieder entfernen wollen. Nun blickten sie einander an; er erstaunt, sie verlegen. Zögernd kam sie einige Schritte zurück und sagte:
„Verzeih bitte! Ich — — — ich habe die Musik gehört draußen, und es war so schön. Ich wollte wissen, wer da spielte und habe dich nun belauscht.“
Sie schien noch weitersprechen zu wollen, aber dann blieb sie doch stumm, sah vor sich nieder und strich nur mit der Hand leise über das Holz der nächsten Kirchenbank. Thomas war so verwirrt, daß er nur wie gebannt auf diese Hand blickte, die das dunkle Holz streichelte. Er raffte sich endlich zu einer Antwort auf, aber als er herausbekam: „Ich — das ist — —“, da sagte sie gleichzeitig leise „Auf Wiedersehen“ und war verschwunden.
Lange machte sich Thomas Vorwürfe, daß er sich so täppisch und unbeholfen benommen hatte. Was mußte Gisela Machenberg — denn sie war es gewesen — nun von ihm denken? Sie kannten sich freilich schon seit ihrer Kindheit, aber seit Jahren war Thomas nicht mehr mit Gisela zusammengekommen.
In den letzten drei Jahren hatte Thomas Gisela nur flüchtig gesehen, wenn sie in den Ferien nach Hause kam, denn sie war bei ihrem Onkel gewesen, einem Bruder Pastor Machenbergs, der Direktor eines berühmten Lyzeums war, durch das auch Gisela gehen sollte. Schließlich hatte es die Krankheit der Mutter nötig gemacht, daß sie zurückkam, damit sie die Mutter pflegen und ihr einen Teil des Haushalts abnehmen konnte.
Nachdem Thomas sie nun wiedergesehen hatte, bat er Karl, die Schwester zu grüßen, aber von der Begegnung an der Orgel mochte er nicht sprechen. Bald besuchte er dann wieder einmal wie gewöhnlich den Freund in der Pfarre, und dabei traf er auch Gisela. Er konnte sie aber nicht allein sprechen. Sie war freundlich wie immer, aber er fühlte sich ihr gegenüber befangen, und es schien ihm, als habe auch sie etwas gegen ihn. Es wollte ihm nun nicht mehr gelingen, so wie früher, im Innersten bewegt, auf seiner Orgel zu spielen. Das kam dem Tagebuch zugute. Die ersten Verse entstanden, aber er war kritisch genug, sie selbst schlecht zu finden. Allmählich wurde ihm klar, daß es Gisela war, die ihm seine Ruhe raubte. Aber hatte er denn ein Recht oder auch nur eine Möglichkeit, sich ihr zu nähern, nachdem er so unhöflich und unbeholfen gewesen war? Außerdem traf er sie ja nie allein. Auf dem Bummel nicht, in der Buchhandlung nicht, bei Machenbergs selbst auch nicht, denn da besuchte er ja Karl, und Gisela war meistens bei der Mutter oder mußte sich um den Haushalt kümmern.
Heimlich wuchs seine Neigung, was ihn ihr gegenüber immer verlegener machte. Von beglückenden Phantasiebildern stürzte er in tiefe Schwermut; manchmal erfüllte ihn überschäumende Lebenslust, oft aber mußte er alle Kräfte aufbieten, um nur die einfachsten Tagespflichten zu erfüllen. Am liebsten stürmte er hinaus in die Natur — auch an trüben Tagen —, um in ihrer erhabenen Ruhe sich wiederzufinden. Bald vernachlässigte er die Orgel, bald zwang er sich zu vielstündigen Uebungen. Manchmal glaubte er, Wärme und Verheißung in Giselas Blicken zu erkennen, manchmal schien es ihm, als sehe sie ihm mit verwunderter Gleichgültigkeit nach. Wenn er die Mutter oder andere das Pastorentöchterlein loben hörte, war er stolz auf sie, um gleich darauf um so trauriger zu werden, weil er einsah, daß alle Beziehungen zwischen ihr und ihm ja nur in seiner erhitzten Phantasie bestanden. Ob sie ihn überhaupt leiden mochte? Sie war freundlich zu ihm wie zu jedermann, aber er bemerkte, daß sie mit anderen freier umging. Fast mied sie ihn ein wenig.
Christa hatte lange durchschaut, wie es um ihren Bruder und ihre Freundin stand und beschloß, ein wenig Vorsehung zu spielen. Als Gisela Geburtstag hatte, nahm Christa sie beiseite und flüsterte ihr zu, Thomas wollte ihr gern eine Freude machen, und sie möge doch am Abend zu der gleichen Stunde wie damals, als sie ihn belauscht habe, in der Kirche sein. Alles andere werde sie hören. Zu Thomas aber sagte sie, Gisela habe gefragt, ob er ihr nicht zum Geburtstag einen Gefallen tun wolle. Sie wünsche sich, daß er ihr gegen Abend in der Kirche etwas vorspiele. Er solle nur gar nicht auf sie achten und einfach so spielen wie damals. Von dieser Begegnung der beiden wußte Christa durch Gisela, die in einer vertrauten Stunde einmal darüber gesprochen hatte.
Thomas wurde erst blaß und dann rot; schließlich versprach er alles und wollte sich gleich ans Ueben begeben. Christa hielt ihn indessen zurück; Gisela habe besonders gebeten, er solle ganz so spielen wie damals, keine Glanzstücke, sondern wie es ihm einfalle, aus sich heraus.
Mit banger Erwartung ging er abends in die Kirche, begann erst ein wenig unsicher über ein Bachsches Thema zu improvisieren, dann aber entzückte ihn die Gewalt dieser Klänge, und allmählich vergessend, weshalb er spielte, verlor er sich ganz in den Zauber dieser Musik.
Und wieder war es wie damals. Er lauschte dem letzten Akkord und wendete sich, durch ein kleines Geräusch aufgeweckt, um. Da reichte ihm Gisela die Hand, ohne etwas zu sagen.
Christas List hatte die Spannung zwischen ihnen aufgehoben; sie begegneten sich nun unbefangener. Aber wenn sie jetzt wußten — jeder von sich selbst gewiß, vom anderen mit banger Hoffnung —, daß sie einander gut waren, so ließen sie es sich doch nicht anmerken, wenn sie jetzt auch öfter zusammentrafen. Auch Gisela spielte recht gut Klavier und wagte sich nun, unter Thomasʼ Anleitung, an die große Orgel. Da sie eine schöne Stimme hatte, musizierten sie manchmal auch gemeinsam. So wurden sie gute Freunde, fühlte sich aber gleichwohl nicht für immer glücklich in diesem Zustand, und jeder erwartete irgendeine Entwicklung vom anderen.
Da kam jene Schulwoche vor den großen Ferien, in denen Thomas nach England fahren wollte.
4.
Dieser letzte Sonntag vor den Ferien schien alle Sonnenpracht des Sommers in sich zu vereinigen. Wie jeden Sonntagmorgen, hatte Thomas zum Gottesdienst gespielt. Der alte Kantor Herse, bei dem er die ersten Orgelkenntnisse erlernt hatte, war gestorben, und da der Kirchenrat einverstanden war, übte Thomas das Organistenamt an der kleinen Kirche aus. Zu seinem Unterricht mußte er immer über Land nach Hellwedel zu Professor Gehrmann. Gehrmann hätte ebensogut in der Großstadt eine berühmte Kantorenstelle haben können, aber er liebte das Land, die Muße und die kleine Silbermannorgel in der Kirche von Hellwedel. Für Thomas war das ein Glück, denn sonst hätte er schwerlich einen solchen Lehrer gefunden.
An diesem ersten Sonntage im Juli stand er nach dem Gottesdienst noch plaudernd mit Gisela und Karl Machenberg unter den mächtigen Linden des Kirchgartens. Auf der Hauptstraße gingen sonntäglich gekleidete Menschen spazieren, und ein warmer Friede lag in der Luft. Durch das dichte Blätterdach der Linden fiel gedämpft das Sonnenlicht und zeichnete lustige Kringel auf den sauber geharkten Boden und auch auf die drei jungen Menschen. Giselas helles Lachen klang oft auf, weil die beiden Freunde in bester Laune miteinander scherzten.
„Ach, Kinder“, sagte Gisela und klatschte froh in die Hände, „heute ist ein herrlicher Tag. Mutti geht es wieder ein bißchen besser, die Ferien stehen vor der Tür und dieses Wetter . . .“
„Ja, wir sollten am Nachmittag einen Spaziergang machen“, fiel Karl ein.
„Großartig“, lobte Thomas, „Christa muß unbedingt mit. Die Eltern werden gewiß nichts dagegen haben.“
„Ich freue mich so“, sagte Gisela, „aber nun muß ich mich schnell ums Mittagessen kümmern. Ihr beide könnt ja alles besprechen. — Bis nachher!“ Sie berührte schnell und ein wenig verschämt Thomasʼ Arm und hüpfte davon.
Thomas sah ihr nach. Das Kleid, was sie heute trug, gefiel ihm über die Maßen. Es paßte zu diesem Sonnentag. Auf hellblauem Grunde hatte es viele bunte Blumen, und der Schnitt paßte sich reizend der schlanken Mädchengestalt an. Alles an ihr, das glänzend braune Haar, die kleinen blanken Schuhe, die helle Haut — alles atmete eine köstliche Frische und Anmut.
Zerstreut verabredete er sich mit Karl für drei Uhr nachmittags und ging zu Christa, um ihr den Plan mitzuteilen. Dabei fühlte er wieder übermächtig diese große Sehnsucht in sich, die ihn quälte, seit — ja seit Gisela damals hinter ihm gestanden hatte, an jenem Abend in der Kirche. Nein, eigentlich war sie schon länger in ihm, diese Sehnsucht . . . Aber seit Gisela da war, hatte sie Gestalt angenommen und überwältigte ihn, machte ihn oft ganz krank. Was war das für eine Macht, die ihn trieb, sich das Mädchen immer wieder vorzustellen in seinem Liebreiz? Ihre frischen Lippen, hinter denen die kleinen weißen Zähne schimmerten, wenn sie lachte; die Augen, in denen tausend Lichter glänzten und an deren Grund eine so gute Wärme schlummerte; die zarten Schläfen, hinter denen man ganz feine blaue Aederchen sah. Er hätte sie nur immer, immer ansehen mögen, und doch ahnte er, daß im verehrenden und begehrenden Ansehen kein Genügen lag. Alle Sinne trieben ihn zu ihr, nicht nur die Augen. Aber er schrak vor dieser Erkenntnis zurück; fast spürte er manchmal etwas wie eine dunkle Angst vor der Glut, die da in ihm erwachte, der er in schmerzlicher Lust nachzugeben begann.
Er beherrschte sich und besann sich auf die unmittelbare Gegenwart. Zugleich stieg eine heiße Freude in ihm auf; heute nachmittag würde er vielleicht mit ihr allein sein können! Aber . . . würde ihm auch etwas einfallen, womit er sie unterhalten konnte? — Zunächst mußte er Christa Bescheid sagen.
Christa war nicht erbaut von dem Plan. Thomas wunderte sich.
„Ich gehe ja gern mit Gisela und auch mit euch, aber — ihr seid langweilig“, erklärte sie.
„Langweilig?“ staunte Thomas. „Ja, hast du denn etwas Besseres vor?“
„O ja, ich wüßte schon etwas, aber das versteht ihr alle nicht.“
„Du bist manchmal sonderbar, Schwesterlein“, scherzte Thomas, „komm, sei lieb und fröhlich, zerstör uns nicht diese gute Stimmung — komm mit!“
„Aber ich bin verabredet“, beharrte sie.
„Aha, der Herr Ferdinand Pellke. Mit dem also gehst du lieber, der ist nicht langweilig. Hoffentlich hat er auch seine schöne schwarze Uniform an, damit er recht glänzt und du neben ihm.“
„Ihr seid häßlich und ungerecht.“ Christa war verstimmt. „Warum bist du so gegen Ferdi? Nur weil er SS-Mann ist und aus der Kirche austrat. Das beleidigt euch, denn du gehörst ja schon halb zur Pfarrersfamilie.“
„Red nicht solchen Unsinn“, fuhr Thomas auf. „Es ist mir völlig gleichgültig, wie deine Liebhaber zur Kirche stehen. Aber daß sie ausgerechnet zu dem Gesindel gehören, was damals vor der Pfarre . . .“
„Es ist gar nicht bewiesen, daß er dabei war!“ Christa begann laut zu sprechen.
„Nein, er war nur der Anführer“, lachte Thomas spöttisch.
„Und wenn schon! Jeder macht einmal Dummheiten im Leben, auch mein Herr Bruder! Und außerdem will ich es dir endlich sagen: Auch ich empfinde nichts mehr in der Kirche. Das Christentum ist mir eine leere Form, die ich nur noch halb aus Gewohnheit und halb aus Rücksicht auf die Eltern mitmache. Ich will es dir endlich genau sagen: Auch ich bekenne mich zu unserem neuen Reich, ich lebe für die neuen Ideale. Das alte Muckertum soll aufhören. Wir wollen eine frische, frohe Jugend werden, die sich ihres Leibes und Lebens freut, mutig in die Zukunft blickt nnd nicht nur dichtet und denkt. Ihr aber? Ihr hängt am alten und scheut die Opfer, die das Neue fordert.“
Thomas hatte mit wachsendem Erstaunen zugehört.
„Du bist ja schon beachtlilch ausgerichtet worden in eurer BDM-Führerinnenschulung! Und durch den vortrefflichen SS-Pelke, deinen Ferdi, wie du den Laffen nennst.“
„Nimm das zurück“, brauste Christa auf, „ich lasse ihn nicht beschimpfen.“
Fast hätte es jetzt auch Thomas die Sonntagsfreude verschlagen, doch da rief die Mutter Christa in die Küche. Sie ging, indem sie mit einem energischen Ruck eine lose blonde Locke zurückwarf. Thomas folgte langsam. Als er in die Küche kam, rührte Christa eifrig in einem Topf. Wie beiläufig erzählte er nun der Mutter von dem Plan, am Nachmittag zu Viert spazieren zu gehen.
„Das macht nur, Kinder“, nickte sie, während sie noch einmal die Suppe abschmeckte. „Geht doch nach Heidequell, Kaffeetrinken und ein bißchen tanzen!“
„Ja, Mutti, du bist die beste aller Mütter“, Thomas faßte sie — wieder Hoffnung schöpfend — um die Schulter, „aber unsere Christa mag nicht. Sie ist verab . . .“
„Ja“, fiel Christa ihm ins Wort, „ich habe keine Lust.“ Dabei zwinkerte sie Thomas zu, der langsam begriff, daß die Mutter wohl von der Verabredung mit Ferdi nichts wissen sollte.
„Was, Christelkind, du keine Lust, tanzen zu gehen? Das ist aber ganz neu. Unsinn — du gehst mit, wirst doch den drei anderen nicht die Freude verderben wollen!“
„Ich bin doch dazu nicht nötig“, wich sie aus.
„Natürlich bist du es“, widersprach Thomas, „sonst geht es doch nicht auf . . . ich meine . . .“
Die Mutter lächelte, und auch Christa lachte jetzt über die Verlegenheit Thomasʼ, der rot wurde, als er bemerkte, daß er da zu viel gesagt hatte.
Christa ging mit einem Vorwand aus der Küche. Thomas folgte ihr. Draußen faßte sie ihn beim Arm und sagte:
„Ich komme mit, Bruderherz, dir kann ich ja doch nichts abschlagen. Aber Spaß macht es mir nicht. Karl ist wirklich furchtbar langweilig und noch so . . . so . . . wenig männlich. Aber dir zuliebe und noch mehr Gisela zuliebe komme ich mit, obwohl du genau so ein unentschlossener Zauderer bist wie dein Freund Karl. Merkst du denn gar nicht, daß Gisela dich lieb hat? Ich möchte wetten, du hast sie noch nicht einmal geküßt. — Ja, also euch zuliebe, und weil du mich eben nicht verraten hast. Mutti darf nichts von Ferdi wissen.“
Thomas war ziemlich verblüfft aber die schnell geflüsterten Erklärungen, hatte aber keine Zeit, etwas zu erwidern, denn Christa war bereits in die Küche zurückgehuscht.
Die „Pfarrkinder“, wie Christa die Nachbargeschwister nannte, kamen pünktlich. Christa war wie immer noch nicht ganz fertig. Endlich ging man unter Lachen und in bester Stimmung. Die beiden Mädchen faßten sich unter, und die Jungen gingen an beiden Seiten — anfangs betont lässig und etwas verloren. Gisela hatte ein sandfarbenes Kleid aus einfachem, grob gewebtem Leinen an. Auch Christa hatte sich geputzt, ein wenig zu auffällig für Thomasʼ Geschmack. Karl dagegen fand sie reizvoll und zauberhaft wie einen bunten Schmetterling, dem man wohl nachjagen kann, der aber viel zu schön und zu flink ist, um sich fangen zu lassen.
Schon bald bewegten sich die Vier nicht mehr so brav wie sonntägliche Spaziergänger. Wie ausgelassene Kinder — endlich ohne Aufsicht — tollten sie umher. Dort gab es Brombeeren, von denen genascht werden mußte und in denen sich die Mädchen die nackten Beine zerkratzten, da mußte man plötzlich ganz still sein, weil Gisela, die sehr gute Augen hatte, ein Eichhörnchen entdeckte, welches man beobachtete, bis es nicht mehr zu sehen war. Den beiden Jungen klang immer wieder das helle Lachen der Mädchen in den Ohren. Selbst Karl wurde ganz ausgelassen und schlug die schönsten Purzelbäume auf dem weichen Waldboden.
Wie Mutter Frey geraten hatte, trank man in Heidequell Kaffee. Das wurde wieder lustig. Gisela spielte die Hausfrau, weil sie darin schon Uebung hatte und verteilte große Kuchenberge. Dazwischen wurde getanzt. Die kleine Tanzfläche im Freien war nicht allzu überfüllt. Drei Musikanten bemühten sich eifrig, eine möglichst großstädtische Tanzmusik zu erzeugen. Karl war selig, wenn er auch gehörig schwitzte vor Anstrengung. Christa machte es ihm zwar leicht, denn sie tanzte gut und hatte Uebung, aber er traute sich gar nicht recht, das Mädchen anzufassen, denn immer dachte er an sein Bild von einem Schmetterling, und Schmetterlinge verletzt man ja mit einem festen Griff nur zu leicht . . . Ach, wenn ihm doch bewußt gewesen wäre, daß er gerade mit einem ganz festen Griff diesen Schmetterling für immer gehalten hätte, um ihn damit zugleich vor der Flamme zu bewahren, die er mit gefährlicher Lust umgaukelte.