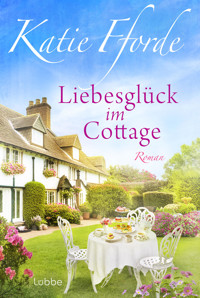5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach einem furchtbaren Streit mit ihrem Freund fährt Jenny nach Schottland, um für einen ihrer Klienten eine Spinnerei auf Vordermann zu bringen. Doch der Aufenthalt auf dem Lande entpuppt sich bald als unerwartet turbulent. Jenny wird nicht nur für tausenderlei Arbeiten eingespannt, auch die häufigen Begegnungen mit dem unsympathischen Ross Grant bringen Jenny zusätzlich durcheinander ...
Eine romantische Komödie mit Witz und Herz von Bestsellerautorin Katie Fforde.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Danksagung
Über das Buch
Nach einem furchtbaren Streit mit ihrem Freund fährt Jenny nach Schottland, um für einen ihrer Klienten eine Spinnerei auf Vordermann zu bringen. Doch der Aufenthalt auf dem Lande entpuppt sich bald als unerwartet turbulent. Jenny wird nicht nur für tausenderlei Arbeiten eingespannt, auch die häufigen Begegnungen mit dem unsympathischen Ross Grant bringen Jenny zusätzlich durcheinander …
Eine romantische Komödie mit Witz und Herz von Bestsellerautorin Katie Fforde.
Über die Autorin
Katie Fforde hat bereits zahlreiche Romane veröffentlicht, die in Großbritannien allesamt Bestseller waren. Ihre romantischen Beziehungsgeschichten werden erfolgreich für die ZDF-Sonntagsserie »Herzkino« verfilmt. Katie Fforde lebt mit ihrem Mann, drei Kindern und verschiedenen Katzen und Hunden in einem idyllisch gelegenen Landhaus in Gloucestershire, England.
Offizielle Website: http://www.katiefforde.com/
Katie Fforde
Eine Liebe in denHighlands
Aus dem Englischen vonMichaela Link
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Titel der englischen Originalausgabe: Highland Fling
© 2002 by Katie Fforde
Für die deutschsprachige Ausgabe© 2003/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Kozhadub Sergei | Simon Bratt | Helen Hotson | alicja neumiler
Datenkonvertierung eBook: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4816-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Kapitel 1
Meine Güte, ich habe dir ein Zuhause gegeben!«, sagte Henry.
Jenny stellte ihren Koffer in den Kofferraum und knallte den Deckel zu. »Denk mal scharf nach, Henry. Du hast mich bekniet, zu dir zu ziehen, und zwar mehrere Monate lang, bevor ich mich schließlich habe breitschlagen lassen. Und dann hat sich herausgestellt, dass du eigentlich eine Haushälterin gesucht hast!«
»Trotzdem hattest du damals kein Dach überm Kopf.«
»Ich musste meine Wohnung verkaufen. Das ist etwas ganz anderes, als auf der Straße zu stehen.« Sie runzelte die Stirn. Sie wollte sich nicht gerade dann mit Henry streiten, wenn sie wegfuhr. »Lass uns eine Tasse Kaffee trinken. Ich muss noch nicht sofort los.«
Henry folgte ihr ins Haus und sah zu, wie sie die Bohnen mahlte und das Pulver in die Kaffeemaschine füllte. Jenny wäre eine schnelle Tasse Instantkaffee lieber gewesen, aber Henry bestand auf richtigem Kaffee, und dies war nicht der Zeitpunkt, um ihn zu der anderen Variante zu bekehren.
»Ich finde nur«, erklärte er, während sie die schwere, dunkelgrüne und mit Goldrand verzierte Tasse und den Unterteller vor ihn hinstellte und ein selbst gebackenes Plätzchen auf den Unterteller legte, »ich finde, du solltest familiäre Verpflichtungen an die erste Stelle setzen, vor deine … deine …«
Jennys Vorsatz, es nicht auf einen Streit ankommen zu lassen, wurde arg auf die Probe gestellt. Sie nippte an ihrem Kaffee und fand, dass er bitter schmeckte. »Es ist ein Geschäft, Henry. Kein sehr großes, aber es ist mir wichtig. Und es ist deine Familie, die Verwandtenbesuch aus Amerika erwartet, nicht meine.«
»Das ist doch praktisch das Gleiche«, murmelte er in seinen Keks.
Jenny fühlte sich stark versucht, den Ringfinger an ihrer linken Hand zu heben, um festzustellen, dass sie weder verheiratet noch verlobt waren, aber sie tat es nicht, weil sie vermutete, dass er viel mehr darauf aus war als sie, ihrer Beziehung einen festen Rahmen zu verleihen. Seine Verwandtschaft betrachtete sie in der Tat als Teil ihrer Familie, aber sie sah das etwas anders. Es hatte viele Gründe gegeben, warum sie zu Henry gezogen war, einschließlich ihrer damaligen Gefühle für ihn, aber seither fragte sie sich immer häufiger, ob die tiefe Zuneigung, die sie für ihn empfand, und seine häusliche Abhängigkeit von ihr wirklich Grund genug waren, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten.
»Warum musst du ausgerechnet dieses Wochenende fahren? Wäre nächste Woche nicht immer noch früh genug?«
»Ich habe es dir doch erklärt. Mein Kunde möchte, dass ich jetzt fahre. Ich habe die Fahrt schon wegen des Hochzeitstages deiner Eltern letztes Wochenende aufgeschoben. Ich kann es mir nicht leisten, diesen Kunden zu verlieren, Henry; so viele Kunden habe ich nämlich nicht.«
»Du könntest dir irgendwo einen Job suchen, wie normale Frauen es tun.«
Jenny hätte ihn gern gefragt, warum er ausgerechnet mit ihr zusammenlebte, wenn er eigentlich die Art von Frau wollte, die er für normal hielt. Aber stattdessen entgegnete sie: »Das könnte ich tun, ja, aber ich will es nicht. Ich möchte auf eigene Rechnung arbeiten und mein Schicksal nicht in anderer Leute Hände legen. Ich werde nie wieder nach der Pfeife irgendeines verdammten Managementberaters tanzen, vielen Dank. Außerdem ist es doch sehr praktisch, dass ich von zu Hause aus arbeite. Auf diese Weise kann ich das Mittagessen kochen und deine Anzüge aus der Reinigung holen.«
Der Sarkasmus war an Henry vollkommen verschwendet. »Ich finde, das ist nur fair - wenn du doch sowieso den ganzen Tag zu Hause bist …«
»Entscheide dich, Henry. Entweder findest du es gut, dass ich von zu Hause aus arbeite, oder du möchtest, dass ich mir einen richtigen Job besorge. Wie ›normale Frauen‹ es tun.« Für Henry hatte eine »normale Frau« gesträhntes, blondes Haar, trug Kleidergröße achtunddreißig und kleidete sich, wie die Modezeitschriften es vorschrieben. Was er je an ihr gefunden hatte mit ihrer Körpergröße, die eine Spur unter dem Durchschnitt lag, ihrem dunklen Haar und dem eher unterentwickelten Modebewusstsein, war ihr schleierhaft. In einem Anfall von Zynismus befand sie, dass es wohl mit ihren Brüsten zu tun haben musste, die zu üppig waren, um sich in einer Bluse von Größe achtunddreißig unterbringen zu lassen.
»Es gefällt mir einfach nicht, dass du nach Schottland saust, nur weil ein Mann, den du nicht einmal kennst, mit den Fingern schnippt! Das ist doch einfach lächerlich! Warum kann er seine Schmutzarbeit nicht selbst erledigen? Herrgott, wir haben fast Winter!«
»Weil er sich im Ausland aufhält! Was auch der Grund ist, warum er meine Dienste in Anspruch nimmt. Er hat keinen Stützpunkt hier und braucht eine Assistentin. Außerdem ist erst Oktober.«
»Ende Oktober, und in Schottland wird dir das wie tiefster Winter vorkommen, glaub mir. Und ›Assistentin‹ ist nur ein beschönigender Ausdruck für ›Sekretärin‹, wie du genau weißt. Du magst dich ja eine ›virtuelle Assistentin‹ nennen, aber außer dir hat noch nie jemand von so etwas gehört. Ich sage dir, du wirst das nicht durchhalten. Du bist in einer Woche wieder hier. Du bist viel zu weich, um einem Betrieb auf die Sprünge zu helfen, der in Schwierigkeiten steckt. Du wirst sämtliche Arbeiter als Schoßtiere behalten wollen.«
Jenny ignorierte diese letzte Bemerkung, um nicht doch noch die Beherrschung zu verlieren. »Glücklicherweise haben die Leute, die einen virtuellen Assistenten brauchen, sehr wohl schon von so etwas gehört. Und wenn viel von dem, was ich tue, Sekretariatsarbeit ist, ist es doch wenigstens eine ehrliche Arbeit, die andere Menschen nicht um ihren Job bringt. Außerdem wird es diesmal keineswegs nur Sekretariatsarbeit sein, nicht wahr? Mein Kunde hat mich beauftragt, einen Blick auf einen kränkelnden Betrieb zu werfen und ihm Bericht zu erstatten. Du könntest es als eine Art Beförderung ansehen.«
»Er nutzt dich aus, Jenny.«
»Ja, ein Privileg, für das er mich großzügig bezahlt! Du solltest dich für mich freuen, Henry, statt an allem herumzunörgeln. Ich bekomme einen Haufen Geld dafür und kann sogar etwas auf die hohe Kante legen.« Dies war nicht der geeignete Augenblick, um zu erwähnen, dass sie das Geld ganz gut als Kaution für eine eigene Wohnung gebrauchen konnte.
»Du wirst über den Tisch gezogen, Jen. Der Mann hat in dir eine preiswerte Managementberaterin.«
Jenny warf ihm einen finsteren Blick zu. Er wusste, dass sie bei dem Ausdruck »Managementberatung« die Wände hochging. »Ich werde nicht über den Tisch gezogen. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann von einer Sekunde auf die andere aufhören, für ihn zu arbeiten.«
»Du bist gutherzig und impulsiv. Man braucht bloß an den Bettler zu denken, dem du heute Morgen auf dem Rückweg vom Schreibwarengeschäft dein ganzes Kleingeld gegeben hast. Genauso gut hättest du es zum Fenster hinauswerfen können; der Kerl wird sich nur Drogen davon kaufen.«
»Ich würde das nicht impulsiv nennen; ich nenne es barmherzig. Nur weil du lieber sterben würdest, als ein Pfund für die Wohlfahrt zu spenden, heißt das nicht, dass wir alle genauso sein müssen! Und jetzt mache ich mich besser auf den Weg. Ich möchte heute zumindest die Hälfte der Strecke hinter mich bringen. Es ist eine lange Fahrt.«
»Eine Fahrt, die du nicht unternehmen müsstest. Mach dir keine Gedanken wegen der schmutzigen Tassen; ich werde sie abwaschen.«
Jenny starrte Henry an und fragte sich, wie oder warum sie sich nur je mit ihm eingelassen hatte. Dann lächelte er, sein Haar fiel ihm in die Stirn, und da wusste sie es wieder: Er erinnerte sie unwiderstehlich an Hugh Grant.
Sie trat neben ihn an die Spüle, wo er das Kaffeemehl in den Ausguss kippte. »Lass uns nicht streiten, bevor ich wegfahre.« Sie küsste ihn auf die Wange.
Er zog sich zurück. »Auf Wiedersehen, Jenny. Aber ich wünschte wirklich, du würdest es dir noch einmal überlegen.«
Jenny seufzte. Hugh Grant wäre jetzt sicher etwas Witziges und Liebevolles eingefallen, irgendeine Bemerkung, die in ihr den Wunsch geweckt hätte zu bleiben. »Ich bin mir ganz sicher, dass deine Mutter deine amerikanische Verwandtschaft auch ohne mich blendend bewirten wird. Ich habe ihr mein Apfelkuchenrezept gegeben.«
Er antwortete ihr nicht. Nun, dann eben nicht. Sie unternahm einen letzten Ausflug zur Toilette, zog ihren Mantel an und versicherte sich dann noch einmal, dass sie alles eingepackt hatte.
Als sie auf die Autobahn kam, hatten sich ihr schlechtes Gewissen und ihr Kummer, dass sie Henry allein ließ, so weit gelegt, dass ihre Abenteuerlust wieder durchbrach. Sie war im Begriff, ihrem einsamen Leben für ein Weilchen zu entkommen, und sie würde endlich ein wenig praktische Arbeit leisten können. Es war eine Herausforderung, und sie war dankbar dafür.
Am nächsten Nachmittag und siebenhundert Meilen später hielt Jenny kurz vor ihrem Ziel an einem in Schottenmuster gestrichenen Imbisswagen an. Er hieß »The Homely Haggis«. Jenny bestellte sich eine Tasse heiße Schokolade. Immer noch wütend auf Henry hatte sie sich geschworen, nie wieder Kaffee zu trinken.
Die hübsche, überwältigend schwangere junge Frau schob ihr eine Plastiktasse über die Theke. »Bitte schön. Und hier ist Ihr Wechselgeld. Autsch«, fügte sie hinzu, als Jenny die Tasse in Empfang nahm, und drückte sich eine Hand ins Kreuz.
Jenny stellte die heiße Schokolade hastig wieder auf die Theke und sah die Frau ängstlich an. »Sie werden doch nicht etwa genau jetzt Ihr Baby bekommen, oder?«
Die Frau lachte. »Oh, nein. Ich glaube nicht. Ich bin erst in vierzehn Tagen fällig. Das war nur ein kleiner Piepser.«
Ihr schottischer Akzent passte gut zu dem fröhlichen Optimismus, den sie verbreitete. Ihr ungebärdiger Haarschopf war kastanienbraun, ihr Mund breit und offenbar stets zu einem Lächeln bereit. Sie nahm einen Lappen und wischte die Theke ab. »Es heißt ja, das erste Kind ließe sich immer Zeit.«
»Tatsächlich? Ich weiß nichts über Geburten, abgesehen von dem, was man aus dem Fernsehen kennt.« Jenny biss sich auf die Lippen. »Und das läuft darauf hinaus, dass die Babys immer dann kommen, wenn im Umkreis von hundert Meilen weder ein Krankenhaus noch ein Arzt zu finden sind, und deshalb jemand bei der Geburt helfen muss, der keine Ahnung hat, was zu tun ist. Genauso, wie es jetzt wäre.«
Die Frau lachte wieder; es schien sie nicht weiter zu beunruhigen, dass sie sich auf einer Parkbucht in einer, wie es Jenny schien, sehr entlegenen Ecke Schottlands befanden. »Und ist Ihnen auch aufgefallen, dass Sie niemals ihren Slip ausziehen? Jetzt mal im Ernst, ich weiß, dass es hier ziemlich einsam ist. Aber im nächsten Dorf gibt es einen praktischen Arzt.«
»Und das ist nur fünfzehn Meilen entfernt. Ich bin durch den Ort gekommen. Das ist ja nun wirklich keine Entfernung«, gab Jenny lächelnd zurück und nippte an ihrem heißen Kakao.
»Hier in der Gegend sind fünfzehn Meilen praktisch gleichbedeutend mit ›nebenan‹. Es besteht also kein Anlass zur Sorge.« Die Frau sah Jenny mit strahlenden Augen an. »Und was führt Sie in unsere Breiten? Abgesehen natürlich von der Lust auf eine heiße Schokolade? Ich weiß zwar, dass die Heide immer noch blüht und die Mücken inzwischen größtenteils verschwunden sind, aber außer für Wanderer und Bergsteiger liegen wir doch etwas abseits der üblichen Touristenroute. Hier gibt es meilenweit keinen Laden, in dem Sie ein Andenken an Nessie kaufen könnten.«
Jenny zögerte. In dieser so weit vom Rest jeglicher Zivilisation entlegenen Gegend, in der schon ein neues Gesicht ein guter Gesprächsstoff war, würde sie nicht viel verheimlichen können. Sie würde irgendetwas preisgeben müssen. Also versuchte sie möglichst offen zu wirken. »Ich bin für eine Weile im Haus Dalmain zu Besuch.«
Das schien das Interesse der jungen Frau noch weiter anzufachen. »Ah? Eine Freundin der Familie?«
Jetzt wurde es brenzlig. Jenny hatte nicht die Absicht zuzugeben, dass sie von einem Kunden hergeschickt worden war, um sich eine eigene Vorstellung vom Zustand des Strickwarenherstellers Dalmain zu machen. Andererseits wollte sie auch keine Freundschaft mit Leuten vortäuschen, die sie überhaupt nicht kannte, vor allem, da diese Leute wahrscheinlich gezwungen waren, sie zu hassen. Philip Dalmain hatte sie in seinem Brief mehr oder weniger angewiesen, seiner Mutter gegenüber vorzugeben, sie käme, um ein neues Computersystem zu installieren. Zwischen den Zeilen hatte sie herausgelesen, dass seine Mutter entweder hysterische Anfälle bekommen, einen Schlaganfall erleiden oder Jenny hinauswerfen würde, falls sie damit herausrückte, dass mit der Firma Dalmain Mills irgendetwas nicht stimmte. »Eigentlich nicht.«
Die junge Frau seufzte. »Ich sollte mich wohl besser vorstellen. Ich bin Meggie Dalmain. Ich bin mit dem jüngeren Sohn verheiratet.«
Das war eine kleine Überraschung. Jenny hatte inzwischen vermutet, die Dalmains seien eine ziemlich alte, aristokratische und wahrscheinlich snobistische Familie. Sie hatte nicht damit gerechnet, ein Mitglied dieser Familie als Bedienung einer Imbissbude kennen zu lernen. Aber es war eine ermutigende Entdeckung. Sie hielt Meggie die Hand hin. »Genevieve Porter, genannt Jenny.«
»Sie haben völlig Recht«, fuhr Meggie fort, nachdem sie ihr die Hand geschüttelt und ihre Gedanken gelesen hatte. »Sie halten wirklich nichts von mir. Iain und ich gehen fast nie mehr hin - es sei denn, die Matriarchin lädt uns vor, und dann auch nur, weil ich nicht einsehe, warum Iain nur wegen dieser alten Kuh seine Familie nicht mehr sehen sollte.«
Das ließ nicht gerade auf Wochen voller Harmonie und Kooperation hoffen. Aber Jenny konnte auch nicht einfach kehrtmachen, denn das wäre genau das gewesen, was Henry so selbstsicher vorhergesagt hatte. »Die Matriarchin?«
»Die alte Dame. Sieht sich als die Herrin des Schlosses - oder würde das tun, wenn es denn ein Schloss wäre und nicht nur ein düsteres, altes Haus. Vergisst bequemerweise, dass ihr eigener Vater auch nicht gerade aus der obersten Schublade kam.«
Jenny hatte gelernt, diskret zu sein. Meggie Dalmain dagegen hatte offensichtlich viel auf dem Herzen, und jede kleine Information, die für Jenny dabei abfiel, konnte sich als sehr nützlich erweisen. Also warf Jenny ein fragendes »Ach?« ein. Es war keine direkte Aufforderung, aber es gab der jungen Frau die Gelegenheit, etwas abzuladen, wenn sie nur wollte.
Meggie wollte. »Hören Sie, warum kommen Sie nicht zu mir hinter die Theke? Hier sind ein paar Hocker. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Es wäre nicht fair, Sie in das große Haus zu schicken, ohne Sie vorher ein wenig ins Bild zu setzen. Haben Sie etwas Zeit?«
Jenny nickte. »Ich bin eigentlich ziemlich früh dran; deshalb habe ich auch Halt gemacht, um noch etwas zu trinken. Ich möchte nicht eintreffen, bevor ich erwartet werde.«
Meggie nickte. »Sehr klug. Es würde denen gar nicht gefallen, wenn Sie kämen, bevor sie fertig wären. In ihren besten Zeiten sind sie schwierig, und ich bin sicher, Sie wissen, dass dies nicht die besten Zeiten sind.«
Jenny zwängte sich durch eine Tür an der Seite in den Imbisswagen. Als sie sich bereit erklärt hatte, für ihren wichtigsten Kunden Nachforschungen vor Ort zu betreiben, hatte sie zunächst ein wenig gehofft, ein paar Wochen im schottischen Hochland würden so etwas wie ein netter Arbeitsurlaub sein. Und wenn dem nicht so war, könnte sie Henry damit immer noch beweisen, dass sie doch mehr war als eine bessere Sekretärin. Nachdem sie allerdings einige Erkundigungen eingezogen hatte, hatte der Mythos vom Arbeitsurlaub sich in Luft aufgelöst - dennoch würde ihr Stolz sie davon abhalten, auch nur eine Sekunde eher wieder heimzufahren, bis sie ihre Arbeit erledigt hatte.
Leider hatte Henry Recht gehabt, was die Kälte in Schottland betraf. Der Hosenanzug, den sie trug und der ihr in der Gegend von London ziemlich praktisch erschienen war, erwies sich umso weniger passend, je weiter sie nach Norden kam, und ihr naturkrauses Haar kringelte sich in der feuchten Luft ganz ungebärdig. Sie fühlte sich wie zerknittert, und ihr war kalt; beides entsprach nicht dem Bild einer effizienten Geschäftsfrau, der sie zu entsprechen versuchte. Gestern war sie in England im Frühherbst losgefahren - aber jetzt herrschte ein früher Winter. Sie würde sich bei nächster Gelegenheit ein paar Pullover kaufen müssen.
»Setzen Sie sich«, bat Meggie und quetschte sich auf einen Klappstuhl. »Wenn ich noch weiter zunehme, werde ich den ganzen Tag lang stehen müssen.«
»Ich weiß gar nicht, wie Sie das schaffen. Diese Arbeit ist doch furchtbar anstrengend. Das weiß ich noch aus meinem Studium.«
»Na ja, viel länger halte ich es auch nicht mehr durch - oh, verdammt, jetzt muss ich erst mal für kleine Mädchen. Würden Sie wohl die Sache hier im Auge behalten, solange ich weg bin? Der nächste Baum ist da drüben - also meilenweit entfernt, wenn man hochschwanger ist. Das Baby liegt schlecht und drückt mir auf die Blase, sobald ich mich hinsetze. Wären Sie wohl so lieb, mich einen Moment zu vertreten?«
»Natürlich. Es sind ja doch keine Kunden da.«
»Oh, hm - vielleicht kommt ja mit dem Landrover, der gerade vorfährt, ein Kunde. Das hieße dann, dass ich noch weiter gehen muss, bis zu den beiden Bäumen dort hinten. Verdammt.« Meggie zwängte sich durch die Tür und verschwand Richtung Heide.
Jenny hatte kaum Zeit, um ein »Oh, mein Gott!« in ihren Bart zu murmeln, als auch schon ein Mann zielstrebig an die Theke trat.
»Ein Schinkenbrot und eine Tasse Tee bitte.«
Jenny versuchte sich an einem einnehmenden Lächeln. Sie hoffte zumindest, dass es einnehmend wirkte. Da sie keine Möglichkeit hatte, es zu überprüfen, konnte sie sich auch nicht sicher sein, dass es sie nicht einfach etwas einfältig erscheinen ließ. »Sie könnten nicht vielleicht eine Minute warten? Ich bin hier eigentlich nicht zuständig und …«
»Ich möchte nur ein Schinkenbrötchen und eine Tasse Tee. Aber ich habe es etwas eilig.« Er sprach mit der Autorität eines Mannes, der eher gewohnt ist, nach einer Weinkarte zu fragen und seine Kreditkarte auf einen Teller zu werfen, als in der nächsten Imbissbude etwas Frittiertes zu bestellen. Trotz der Sonnenbräune und der Wanderkleidung, die deutliche Benutzungsspuren aufwies, klang er für Jennys Ohren mehr wie ein befehlsgewohnter Geschäftsmann, eine Spezies, mit der sie nur allzu vertraut war.
Sie beschloss, es einfach zu probieren. Was konnte schon so schwer daran sein, eine Scheibe Schinken zu braten und ein Brötchen zu schmieren? Selbst Henry gab zu, dass sie kochen konnte. Und es würde für Meggie leichter sein, wenn der Kessel mit Wasser schon aufgestellt war und der Schinken bereits in der Pfanne lag, wenn sie wieder hinter den Bäumen hervorkam.
Jenny brauchte eine Weile, bis sie den Schinken gefunden hatte, und noch länger, um den Herd in Gang zu setzen. Wo blieb Meggie nur? Bitte, bitte, mach, dass sie nicht jetzt ihr Baby bekommt, auf dem Torfmoos hockend wie eine Indianerin! Der Kunde beäugte Jenny mit deutlichem Zweifel und Argwohn - vielleicht, weil ein marineblauer Hosenanzug mit Seidenbluse für die Bräterin in einer Imbissbude nicht unbedingt die optimale Arbeitskleidung war. Nun, er hatte ja selbst Schuld. Er hatte darauf bestanden, seine Bestellung aufzugeben, und er hatte ihr keine Gelegenheit gegeben, zu erklären, dass sie selbst nur eine Kundin war.
»Wo zum Teufel ist der Kessel?«, murmelte Jenny lauter, als sie es vorgehabt hatte.
»Was zum Teufel ist denn los?« Ihr Kunde beugte sich über die Theke und warf Jenny einen missbilligenden Blick zu. »Der Job ist ja vielleicht neu für Sie, aber Sie sind doch sicher in der Lage, eine Tasse Tee aufzubrühen?«
»Ich bin mir sicher, dass ich das kann, doch da ich nur ein Laufkunde bin, genauso wie Sie, braucht es seine Zeit.«
»Wie meinen Sie das? Wenn Sie nicht hier arbeiten, was tun Sie dann hinter der Theke?«
Jenny, die inzwischen den Kessel gefunden hatte und zu ihrer Erleichterung entdeckte, dass das Wasser darin für eine Tasse Tee reichen würde, zuckte die Schultern und hielt Ausschau nach den Zündhölzern.
»Ich habe mich mit der Besitzerin unterhalten. Sie ist mal eben kurz zur Toilette. Ich versprach, solange ein Auge auf alles zu haben. Sie ist jetzt schon furchtbar lange weg. Ich hoffe, dass es ihr gut geht.«
»Was könnte ihr denn zugestoßen sein?«
»Nichts, hoffe ich, aber sie ist hochschwanger. Sie sind nicht zufällig Arzt, oder?«
»Nein.«
»Oder, besser noch, eine Hebamme? Selbst eine Krankenschwester in der Ausbildung wäre besser als nichts.« Sie wollte ihm seinen Spott über ihre Versuche, Tee zu kochen, heimzahlen. Sie hatte sich in letzter Zeit entschieden zu oft verspotten lassen.
»Ich bin Geschäftsmann, und ich mache Urlaub. Und wenn Sie nichts von alldem verstehen und auch nicht in der Lage sind, ohne Hilfe eine Tasse Tee zu kochen, was wollen Sie dann hier?«
Jenny hätte ihm leicht sagen können, er solle seine Nase nicht in Angelegenheiten stecken, die ihn nichts angingen, aber es wäre wenig professionell gewesen, Meggies Kunden zu beleidigen. Irgendetwas an ihm ließ sie sehnsüchtig an Henrys kultivierte Eleganz denken. Henry würde nie etwas Unerwartetes oder Ungehöriges tun. Dieser Mann schien eine Energie zu verströmen, etwas Ungezähmtes, das beunruhigend war, und seine Stimme hatte ein Timbre, das von Henrys mildem Ton Lichtjahre entfernt war.
»Wie ich bereits erwähnte«, erklärte sie fest, »trank ich gerade einen heißen Kakao …«
»Aber warum haben Sie ihn hier getrunken? Sie sehen nämlich nicht aus, als wären Sie im Urlaub.« Er musterte sie kurz von oben bis unten, als wollte er seine Behauptung überprüfen. »Ein Designer-Hosenanzug ist nicht gerade die passende Freizeitkleidung für die Highlands.«
Jenny widerstand dem zwanghaften Wunsch, zu überprüfen, ob sie auch nicht zu viele Knöpfe geöffnet hatte. »Genau gesagt, Marks and Spencer, aber danke für das Kompliment. Möchten Sie übrigens Zwiebeln zum Speck?« Sie hatte gerade einige entdeckt und wollte ihn davon abhalten, zu viele direkte Fragen zu stellen. Ihre Wimperntusche war inzwischen wahrscheinlich bereits unter den Augen angelangt, und ihr Lippenstift hatte bestimmt auch nicht länger als eine Stunde gehalten.
»Ja, bitte. Und Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet.«
Sie hätte sich weiter weigern können, darauf einzugehen, kam aber zu dem Schluss, dass Geheimnistuerei seine Neugier nur steigern würde.
»Ich habe hier in der Gegend zu tun. Nur vorübergehend. Vielleicht sollte ich mir einen Tweedrock oder einen Kilt kaufen, wenn blaues Kammgarn mich hier so deplatziert erscheinen lässt?«
»Wo arbeiten Sie denn?«
Jetzt war sie wirklich versucht zu erwidern, er solle sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Es war den Dalmains gegenüber nicht fair, wenn sie einem vollkommen Fremden erzählte, dass sie von weither hierhin geschickt worden war, um deren Firma unter die Lupe zu nehmen. »Das ist vertraulich. Wie stehts mit einer Tomate?«
»Ich verstehe. Nun, Sie brauchen es mir nicht zu erzählen, wenn Sie es nicht wollen.«
»Ich weiß. Was ist nun mit der Tomate?«
»Ja, bitte. Wenn Sie das schaffen, natürlich.«
Seine Neugier und seine Bemerkungen über ihre Kleidung waren verständlich, wenn auch nicht hinnehmbar, aber dies war definitiv ein Tiefschlag. »Ich bin mir sicher, dass ich es schaffe. Wie lange möchten Sie sie denn gekocht haben?«
Er runzelte die Stirn, atmete tief ein, hörbar wieder aus und schüttelte den Kopf. »Wir scheinen beide einen schlechten Start miteinander gehabt zu haben …«
»Nun, Sie haben einen schlechten Start gehabt. Ich behandele Sie mit dem Takt und der Geduld, für die ich bekannt bin.«
Widerstrebend lachte er. »Ich sehe ein, dass ich Ihnen dankbar sein sollte, dass Sie wenigstens versuchen, mich zu bedienen …«
»Aber Sie sind es nicht«, half sie ihm aus. »Sie sind zu sehr daran gewöhnt, Befehle zu erteilen und zu bekommen, was Sie wollen, ohne sich dafür bei jemandem bedanken zu müssen.«
Er zog eine Augenbraue hoch. »Nun, vielen Dank für die Charakteranalyse.«
»War mir ein Vergnügen. Und sie ist im Gegensatz zu dem Schinkenbrötchen umsonst.«
»In den Genuss der Charakteranalyse bin ich ja nun wenigstens gekommen. Mit dem Schinkenbrötchen hatte ich noch nicht das Vergnügen.«
Jenny atmete tief durch. Es war ärgerlich, dass sie nicht in der Lage war, etwas so Einfaches zu servieren, aber weiterer Widerspruch würde sie jetzt nur noch unfähiger erscheinen lassen. Sie war drauf und dran, dem Mann nahe zu legen, einfach zu gehen und es in einer halben Stunde noch einmal zu versuchen, als Meggie wieder auftauchte.
»Ah, hier ist die Besitzerin«, erklärte Jenny erleichtert. Zwar war die Versuchung groß, einfach in ihren Wagen zu springen und mit quietschenden Reifen davonzufahren, aber sie fühlte sich verpflichtet, sich zu vergewissern, dass es Meggie gut ging. »Alles okay?«
»Absolut. Und wie kommen Sie zurecht?«
»Also ich hoffe, Sie haben nicht vor, sie hier auf Dauer einzustellen«, mischte sich Jennys Kunde ein. »Sie scheint für die Arbeit vollkommen ungeeignet zu sein.«
Jenny warf ihm einen bösen Blick zu. Er war außerordentlich unfair, und jetzt konnte sie auch nicht mehr gehen, ohne dass es wie eine Flucht gewirkt hätte.
»Tatsächlich?«, fragte Meggie fröhlich, aber abschätzig. »Warum gehen Sie nicht und setzen sich an einen der Tische, und wir bringen Ihnen dann, was Sie bestellt haben?«
»Warum bin ich darauf bloß nicht gekommen?«, murmelte Jenny, sobald er außer Hörweite war. »Er hing hier rum, hat mir zugesehen und mir dumme Fragen gestellt, und ich hatte keine Ahnung, wo ich hier irgendetwas finde.«
Meggie hatte den Schinken aus dem Bräter geholt und die Zwiebeln zugegeben. »Ach, was solls? Sie scheinen ja alles großartig hingekriegt zu haben.«
»Ich habe so etwas nicht mehr gemacht, seit ich studiert habe. Das liegt schon mehrere Leben zurück.«
»So lange kann das doch sicher noch nicht zurückliegen. Wie alt sind Sie denn?«
»Siebenundzwanzig. Und Sie?«
Meggie lachte. »Fünfundzwanzig, und es tut mir Leid, dass ich so neugierig bin. Ich bringe mich immer in Schwierigkeiten, weil ich so freimütig bin. Unhöflich nennt mein Mann das.«
Jenny erwiderte ihr Lachen. »Unhöflich würde ich es nun wirklich nicht nennen.«
Meggie seufzte. »Iain sagt, ich kann so unhöflich sein wie ich will, sobald ich den Laden dichtgemacht habe. Dann hätte ja nur noch er darunter zu leiden.«
»Sie machen den Laden dicht? Das ist aber ein Jammer!« Der fröhliche kleine karierte Imbissstand erschien ihr plötzlich wie ein sicherer Hafen in der trostlosen Kälte des Nachmittags.
»Also theoretisch nur für diese Saison. Das Problem ist nur, wenn ich zu früh aufhöre, und das muss ich vielleicht wegen dieses kleinen Bündels«, sie klopfte sich auf den Bauch, »dann kann ich mir diesen Platz für nächstes Jahr vielleicht nicht sichern. Es ist noch jemand scharf darauf, und ›The Homely Haggis‹ würde sich für mich nicht mehr lohnen, wenn die Anfahrt zu lang wäre.«
Meggie seufzte wieder. »Wie lange geht die Saison denn noch?« Es schien für ein Geschäft, das auf Touristen ausgerichtet war, schon ziemlich spät im Jahr zu sein.
»Nur noch ein paar Wochen. Im Dezember ist endgültig Schluss.«
»Könnte Sie denn niemand vertreten? Es wäre doch schade, wenn Sie das Geschäft nur deswegen verlören, weil Sie schwanger sind.«
»Ja, das wäre es, nicht wahr?« Meggie war froh, dass irgendjemand ihre Gefühle verstand. »Aber ich habe alle hier in der Gegend gefragt, und keiner kann.«
»Ich wäre beinahe versucht einzuspringen, wenn ich nicht gerade so jämmerlich daran gescheitert wäre, ein Schinkenbrötchen und eine Tasse Tee zuzubereiten. Ich würde Ihnen nur die Kunden verjagen.«
»Sie würden nicht vielleicht wirklich …?« Jenny biss sich auf die Lippen. Meggie sah sie an, als hätte sie im Kaffeesatz ihren Erlöser gesehen. Aber Jenny hatte ihr Angebot nicht ernst gemeint, sondern nur ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen wollen.
»Also …«
»Das wäre echt toll, wenn Sie das könnten. Würde es denn überhaupt gehen? Es wären nur die Wochenenden und gelegentlich mal abends, wenn gutes Wetter ist. Aber Sie haben ja Ihre andere Arbeit.«
Jetzt war der Augenblick gekommen, um zu sagen, nein, sie könne das nicht anbieten. Aber sie sagte nicht Nein. Henrys Sticheleien über ihre Impulsivität und ihre eigene Beteuerung, dass es sich eher um Mitleid handelte, gingen ihr durch den Kopf. Warum sollte sie nicht impulsiv und Anteil nehmend sein, wenn sie wollte? Es war ihr Leben, und eine kleine Abwechslung konnte sie gut vertragen.
»Es reizt mich irgendwie, teils, weil ich Ihnen helfen möchte, und teils, weil es vielleicht … einfach Spaß macht.«
»Oh, es macht Spaß! Es ist toll! Und es ist ja nur für ein kleines Weilchen. Ich denke, dass ich im nächsten Sommer schon zurechtkomme, selbst mit einem Säugling, und Iain und ich sind auf die Zusatzeinnahmen angewiesen.«
Meggie legte all ihre Überredungskunst in einen einzigen flehenden Blick.
»Und Sie können wirklich niemand anderen finden, der den Job solange für Sie übernehmen kann?«
»Das ist mir bisher nicht gelungen. Bis Sie des Weges kamen.«
»Meggie!«
»Vielleicht erzählen Sie mir besser, was Sie im Haus Dalmain wollen. Und wie lange Sie wahrscheinlich dort bleiben werden. Aber vorher bringen Sie Ihrem Lieblingskunden das hier. Richten Sie ihm aus, es ginge aufs Haus, weil er so lange hat warten müssen.«
»So lange nun auch wieder nicht! Ich habe mein Bestes getan.«
»Bringen Sie es ihm einfach. Dann kommen Sie zurück und holen den Tee. Bitte!«
Mehr als nur ein wenig widerstrebend überquerte Jenny die mit Kieseln bestreute Parkbucht. Die Absätze ihrer Stiefel waren in Surrey schön und gut, aber für die schottischen Highlands viel zu hoch.
»Bitte sehr«, sagte sie abweisend und stellte dem Mann den Teller hin. »Meggie meint, es ginge aufs Haus.«
Er kniff die Augen zusammen. Das wirkte gleichzeitig finster und attraktiv. »Heißt das, auf das Haus Dalmain?«
Jenny spürte, wie ihr Mund plötzlich trocken wurde. »Was meinen Sie damit?«
Er zögerte einen Augenblick, als hätte er auf die Frage antworten wollen, sich dann aber eines Besseren besonnen. »Nichts. Ich habe nur überlegt, dass Sie vielleicht dort arbeiten, im Haus Dalmain.«
»Was um Himmels willen hat Sie auf die Idee gebracht?«
»Nun, ist es nicht so?«
»Es geht Sie nichts an, wo ich arbeite!«
Wütend und etwas wackelig auf ihren hohen Absätzen stolzierte sie zurück zu dem Imbisswagen. »Blöder Kerl! Versucht doch wirklich, mich dazu zu bringen, ihm auf die Nase zu binden, dass ich im Haus Dalmain arbeite, und dabei soll es doch ein Geheimnis bleiben!«
»Ach, warum das denn? Nimmt er Zucker?«
»Jedenfalls gehört er bestimmt nicht zu der Sorte ›Ich bin schon süß genug‹.«
Meggie drückte Jenny ein paar Tütchen Zucker und einen Rührer in die Hand. »Ich würde es ihm selbst bringen, aber dann muss ich wieder für kleine Mädchen. Und wir müssen uns unbedingt unterhalten.«
Mit grimmigem Gesicht brachte Jenny den Tee hinüber. »Bitte sehr!« Sie stellte den Tee auf den Tisch und war sehr zufrieden, dass der Zucker inzwischen in einer kleinen Pfütze schwamm.
»Danke schön. Ach, Fräulein?«
»Was denn?«
»Fräulein« schien ihr der Gipfel der Unverschämtheit zu sein.
»Sie haben einen Fettfleck auf der Bluse. Das wird in dem großen Haus keinen guten Eindruck machen.«
Jenny verstauchte sich beinahe den Fuß, während sie quer über den Parkplatz zurückeilte. »Ach, verpiss dich doch!«, murmelte sie vor sich hin. »Sie bitten mich besser nicht, den Imbiss für Sie zu übernehmen!«, erklärte sie Meggie. »Ich werde Ihre Kunden beschimpfen.«
Meggie schüttelte den Kopf. »Nein, das werden Sie nicht. Die meisten sind wirklich nett. Und sie sind so dankbar! Ich arbeite hier wirklich gern. Es ist so leicht, die Menschen glücklich zu machen!«
Jenny seufzte. Das konnte sie über ihren Job bestimmt nicht sagen - wenigstens nicht über den Aspekt, mit dem sie hier zu tun haben würde.
»Ich serviere Ihnen noch eine heiße Schokolade, und dann erkläre ich Ihnen, wer im Hause Usher wer ist. Falls Sie mir verraten, was Sie dort vorhaben. Hat Philip die Bücher frisiert?«
»Das möchte ich nicht annehmen, aber deswegen bin ich auch nicht hier.«
Meggie zog zweifelnd eine Augenbraue hoch, und Jenny spürte, dass sie am besten so offen war, wie es eben ging. »Ich bin von einem meiner Kunden hergeschickt worden, um mir einen Eindruck zu verschaffen, wie das Geschäft läuft. Ich werde keine Entscheidungen treffen, sondern nur berichten. Aber man hat mir nicht angedeutet, dass es irgendwelche Unregelmäßigkeiten gibt.«
Meggie seufzte. »Schade. Philip ist der Sonnyboy seiner Mama. Wäre schön gewesen, wenn er bloß ein einziges Mal etwas wirklich Schlimmes getan hätte. Aber vermutlich ist er sich selbst treu geblieben, immer einnehmend, immer charmant.«
»Mögen Sie ihn nicht?« Wenn Meggie schon bereit war, ihr Informationen zukommen zu lassen, dann sollte sie auch das Beste daraus machen.
»Es ist praktisch unmöglich, ihn nicht zu mögen. Er ist furchtbar nett‹.« Sie wechselte in eine übertrieben vornehme Aussprache. »Aber er ist so unselbstständig. Er wäre als der jüngere Sohn die perfekte Besetzung gewesen. Und mein Iain, der hätte liebend gern das Familiengeschäft in die Hand genommen.« Meggie seufzte. »Arbeiten Sie denn für den Mann, dem Dalmain Mills all das Geld schuldet?«
Jenny fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, leicht entsetzt angesichts der Tatsache, dass so viele Firmeninterna der Dalmains allgemein bekannt zu sein schienen. »Es ist etwas komplizierter. Es handelt sich um ein Syndikat, das in die Firma investiert hat. Und ich arbeite für eines der Mitglieder dieses Syndikats. Genauer gesagt, eines der Syndikatsmitglieder ist einer meiner Kunden.«
Meggie ging über diese feineren Einzelheiten hinweg. »Aber wenn das Syndikat Geld investiert hat, dann will es das irgendwann zurückhaben, oder?«
Zu einem horrenden Zinssatz, fügte Jenny im Stillen hinzu. »Im Endeffekt ja. Aber nicht notwendigerweise alles auf einen Schlag.«
Meggie zuckte die Schultern. »Sie erzählen Iain und mir sowieso nie etwas. Wir zählen einfach zwei und zwei zusammen und schnappen so hier und da was auf. Also, was ist denn genau Ihre Aufgabe?«
»Ich bin das, was man eine virtuelle Assistentin nennt. Es ist so, als wäre ich Sekretärin, nur dass ich meinen Chef nie zu sehen bekomme und dass ich verschiedene habe. Leute, für die ich arbeite, heißt das.«
»Klingt kompliziert.«
»Das ist es eigentlich nicht. Mit dem Internet geht alles ganz einfach. Gewöhnlich arbeite ich von zu Hause aus, aber als mein Kunde« - es war nicht nötig, seinen Namen zu nennen - »mich bat, hier heraufzukommen und selbst nach dem Rechten zu sehen, hat mich die Aussicht gereizt, mich einmal ein wenig ins echte Leben hinauszuwagen. Es hat ja keine Auswirkungen auf meine Arbeit für meine übrigen Kunden, und immer nur zu Hause zu arbeiten ist manchmal etwas einsam.« Und man erwartet ständig von einem, dass man nebenbei den Haushalt erledigt, fügte sie für sich hinzu.
»Ich bin mir nicht sicher, dass Haus Dalmain sehr viel an anregender Gesellschaft zu bieten hat, aber schließlich bin ich ja auch noch da.« Meggie lachte. »Solange ich hier bin. Wie sagten Sie noch, war Ihr Name?«
»Genevieve Porter. Genannt Jenny.«
»Vermutlich wird die Matriarchin darauf bestehen, Sie Genevieve zu nennen, wenn Sie nicht gleich bei Miss Porter bleibt.«
»Mir gefällt Genevieve ganz gut. Es ist nur ein bisschen lang.«
»Also dann, Jenny oder Genevieve, wie wärs, wenn du für mich die Stellung hältst, solange ich ausfalle? Nur für die Zeit, die du ohnehin hier bist?« Meggie war wie selbstverständlich zum Du übergegangen und sah sie mit ihren braunen Augen flehentlich an.
»Theoretisch würde es mir wirklich gut gefallen, aber ich wäre völlig nutzlos! Sieh dir doch an, wie es mir gerade mit diesem Mann ergangen ist.«
»Er war ungewöhnlich schwierig. Und du wärst bestimmt nicht nutzlos, wenn du kurz eingewiesen würdest. Außerdem wirst du irgendeine Zuflucht brauchen. Haus Dalmain ist eine Art Kreuzung zwischen einem Museum und einem Bestattungsinstitut - nur nicht so fröhlich.«
Großer Gott, sag nicht, dass Henry auch darin Recht behalten sollte - wie in allem anderen. »Tatsächlich? Vielleicht sollte ich die Sache einfach abschreiben und wieder heimfahren …«
»Nein, auf keinen Fall!« Meggie trat schleunigst den Rückzug an. »Es wird ganz nett werden, da bin ich mir sicher. Und ich werde deine Gesellschaft genießen. Eine Frau in meinem Alter, das wird wunderbar sein. Du hast doch auch erwähnt, du seiest etwas einsam.«
Jenny lachte. »Habe ich das? Aber hier tanzt im Augenblick auch nicht gerade der Bär, oder?«
Meggie zuckte mit den Schultern. »Ja, ich weiß. Und es ist reichlich unverschämt von mir, dir überhaupt diesen Vorschlag zu unterbreiten. Doch du hast es gewissermaßen selbst angeboten, und du hast erzählt, du hättest mal in einem Café gearbeitet.«
»Ja, das stimmt.«
»Das Schönste an dieser Arbeit ist«, fuhr Meggie fort, die spürte, dass Jenny versucht war zuzusagen, »dass die Leute sich immer so freuen, einen zu sehen. Sie kommen ja oft direkt von den Bergen.« Sie deutete auf den mit Heide bedeckten Hügel, der hinter ihnen anstieg. »Und sie sind im strömenden Regen stundenlang unterwegs gewesen. Sie sterben für irgendetwas Heißes, und du bist die Frau, die es ihnen vorsetzen kann.«
»Ich verstehe, dass das befriedigend sein muss.«
»Und man braucht sich keine Gedanken mehr darum zu machen, wenn man heimfährt. Entweder hat man viele heiße Getränke und Schinkenbrötchen verkauft oder nicht. Man schließt einfach ab und vergisst es.«
Jenny seufzte. Sie ertappte sich oft dabei, bis spät in die Nacht zu arbeiten und Probleme nicht immer hinter sich lassen zu können. »Ich muss zugeben, das klingt verlockend.«
»Und die Berge sind berühmt. In dieser Gegend sind immer Wanderer und Bergsteiger unterwegs. Die meisten davon sind sehr nett.«
»Meiner heute war es nicht.«
»Die Ausnahme, das verspreche ich. Außerdem war er trotzdem ziemlich attraktiv. Die Männer von hier sind alle in festen Händen, und du brauchst auch mal jemanden, mit dem du ein bisschen schäkern kannst.«
Jenny lachte. »Du meinst also, ich sollte ›The Homely Haggis‹ übernehmen, um Männer aufzugabeln, wie?« Was würde Henry davon halten?
»Es gibt Schlimmeres. Es sei denn, du bist selbst bereits vergeben?«
»Das bin ich, um es so zu sagen, aber selbst wenn ich es nicht wäre, würde ich nicht gern Geschäft mit Vergnügen verbinden. Es würde ja keinen Sinn machen, hier einen fröhlichen Schotten kennen zu lernen, den ich dann nicht mit nach Hause nehmen kann.«
Meggie zuckte die Schultern. »Kannst du deinen Job nicht von jedem beliebigen Ort aus machen?«
»Ja, doch der Job ist ja nicht mein ganzes Leben! Ich meine, nichts für ungut, aber ich komme aus dem Dunstkreis von London, und von hier bis zur Bondstreet ist es ein ziemlich weiter Weg, oder?«
Meggie kicherte. »Hier, ich schreib dir meine Adresse und meine Telefonnummer auf. Wenn du lange genug bleibst und mir helfen möchtest, ruf mich einfach an. Wenn nicht, dann komm ruhig trotzdem auf ein Schwätzchen und ein Schlückchen vorbei. Ich werde dich nicht weiter bedrängen.«
Das bezweifelte Jenny. Meggie war offensichtlich sehr entschlossen. Und der gemütliche Imbisswagen führte Jenny tatsächlich in Versuchung. »Ich werde mich so oder so schnellstmöglich melden.« Sie hielt inne. »Ich würde dich in gewisser Weise gern vertreten. Nur um zu beweisen, dass ich dazu fähig bin.« Und zwar nicht nur sich selbst. Irgendetwas in ihr, tief in ihrem Innern und für sie selbst kaum wahrnehmbar, wollte diesem Mann beweisen, dass sie mit einem Schinkenbrötchen und einer Tasse Tee nicht überfordert war - aber Gott allein mochte wissen, warum sie eigentlich kümmerte, was er von ihr dachte.
»Schön. Mehr kann ich wirklich nicht verlangen.«
Jenny sah auf ihre Uhr. »Ich mache mich jetzt wohl besser auf den Weg. Was meinst du, sollte ich anrufen und genau ankündigen, wann ich eintreffe?«
»Wie willst du das bewerkstelligen? Mit einem Handy kannst du hier nichts ausrichten.«
Jenny zog eine Grimmasse. »Großer Gott! Wie hinterwäldlerisch!«
»Fort mit dir! Brauchst du eine Wegbeschreibung?«
Jenny fischte ein zusammengeknülltes Stück Papier aus ihrer Jackentasche. »Etwa eine Meile von hier entfernt zweigt eine kleine Straße ab, und danach geht es weiter einen langen Weg links hinauf?«
Meggie nickte. »Und dann bist du auch schon da. Viel Glück.«
Kapitel 2
Die Türglocke war von der Sorte, die man draußen nicht hört, wenn man sie bedient. Jenny stand vor der Tür, zitterte und fragte sich, ob die Klingel, deren Zug sie nur mit Mühe hatte bewegen können, überhaupt angeschlossen oder vielleicht nur zur Zierde da war. Vielleicht läutete sie ja auch in einem weit entlegenen Dienstbotenquartier, und das Läuten verhallte dort ungehört.
Sie hatte die Zeit bereits genutzt, um ihr Gepäck aus dem Auto zu laden. Inzwischen hatte sie es um sich herum aufgestapelt und mochte es nun auch nicht mehr im Stich lassen. Jenny wollte nicht noch einmal klingeln und dadurch womöglich jemanden bedrängen, der bereits auf dem Weg zur Tür war - falls es denn diesen Jemand gab. Und wenn nicht? Sie konnte auch nicht ewig vor der Tür stehen bleiben.
Sie sah sich um und versuchte, optimistisch zu bleiben, musste aber feststellen, dass die Umgebung noch weniger verheißungsvoll erschien, als Meggie angedeutet hatte. Das Haus war aus großen, grauen Granitblöcken erbaut, deren Farbe ganz hübsch gewesen wäre, hätte man nicht das reichlich - um nicht zu sagen: im Übermaß - vorhandene Fachwerk dunkelrot gestrichen. Eine Vielzahl rustikaler Pfosten trug offensichtlich das zweite Geschoss. Aus den Pfosten ragten noch die Enden abgeschnittener Äste hervor wie blutige Dornen. Die überhängenden Fenster waren an ihrer Unterkante mit Windfedern versehen, und Windfedern umrandeten auch die kleinen Türme und Fensterleibungen. Tatsächlich, dachte Jenny grimmig, sah das Ganze aus wie ein übergroßes Knusperhäuschen, dessen Bewohner sich entschlossen hatten, ihre Grausamkeit durch einen blutfarbenen Anstrich noch herauszustellen, statt ihre bösen Absichten durch die Dekoration ihres Hauses mit Süßigkeiten zu verschleiern.
In sehnsüchtige Gedanken an ihr warmes, kleines Auto und den malerischen, wenn auch langen Rückweg in die Zivilisation versunken, wollte sie gerade die Klingel noch einmal betätigen, als sie endlich jemanden kommen hörte.
Zuerst waren es Schritte, die sie wahrnahm, dann jemand, der mit einem Hund schimpfte. Es dauerte lange, bis die Tür schließlich aufgeschlossen war.
»Guten Tag - Sie müssen …« Die Frau war eine Mittvierzigerin und wäre hübsch gewesen, hätte sie nicht so erregt gewirkt. Sie trug ihr dichtes, dunkelblondes Haar hoch aufgetürmt; an ihren Ohren baumelten sehr schöne Goldohrringe.
»Genevieve Porter, genannt Jenny.«
»Ich bin Felicity Dalmain.« Die Frau reichte Jenny die Hand. Sie war kalt.
»Sie haben mich erwartet?«, fragte Jenny, nachdem sie einander die Hand geschüttelt hatten.
»Oh ja, meine Mutter erwartet Sie. Wir alle erwarten Sie. Kommen Sie doch herein.« Die Frau nahm einige von Jennys Aktenmappen auf. »Stören Sie sich nicht an den Hunden. Sobald sie Sie erst mal beschnüffelt haben, sind sie zufrieden. Vorher sollten Sie sie jedoch nicht streicheln.«
Mit einer Tasche, die sie unter den Arm geklemmt hatte, und Gepäckstücken in beiden Händen war das keine große Versuchung, aber selbst wenn sie gekonnt hätte, wäre sie vermutlich nicht auf die Idee gekommen. Rein theoretisch mochte Jenny Hunde, doch die Vorstellung einer ganzen Meute, die sie beschnüffelte, ließ ihr den Schweiß ausbrechen. Und Hunde rochen, wenn jemand Angst hatte. Sie hätte davonlaufen sollen, solange sie noch die Gelegenheit dazu gehabt hatte, bevor die Tür geöffnet worden war, jedenfalls, bevor sie sich selbst mit dem Gepäck beladen hatte. Es schienen ungefähr fünf Hunde zu sein. Ganz gleich, ob sie nun groß und grau oder klein und braun waren, sie alle strichen mit ihren Nasen interessiert über ihre Kleider. Vermutlich hatten sie noch nie zuvor marineblaues Kammgarn von Marks & Spencer beschnuppert, überlegte Jenny. Und es war vielleicht nur ihre Art, ihre Meinung dazu kundzutun, wenn sie Jenny komplett einhaarten. Das schafften sie erstaunlicherweise, ohne dass sie sich irgendwie an ihr gerieben hätten.
»Lassen Sie ihre Taschen hier«, schlug Felicity Dalmain vor und setzte die ab, die sie selbst trug. »Sie scheinen ziemlich viel Gepäck dabeizuhaben. Wir bringen es später hinauf. Kommen Sie in die Küche. Möchten Sie etwas trinken?«
Jenny lechzte nach einer Tasse Tee, aber noch vordringlicher war ein anderes Bedürfnis. Anders als Meggie hatte sie keinen Gebrauch von dem einsamen Baum und der Heide gemacht.
»Könnten Sie mir bitte zuerst die Toilette zeigen?«
»Oh ja. Eine befindet sich gleich hinter dieser Tür - nein, hinter der nächsten. Ich bin dann in der Küche.«
Jenny fand die Toilette - eine Kloschüssel und ein Waschbecken in der Ecke eines großen Raumes voller alter Radmäntel, Regenjacken, Angelzubehör und wahrscheinlich Spinnen, aber ohne ein Schloss an der Tür. Nicht besonders gemütlich, doch vermutlich, so überlegte sie, immer noch besser als der scharfe Wind auf der Heide. Sie wusch sich die Hände; das Wasser blieb eiskalt, auch nachdem sie es einige Minuten lang hatte laufen lassen. Vielleicht ist es in der Küche richtig warm, dachte sie, im Mittelpunkt des Hauses, wo es sicherlich eine heiße Suppe, frisch gebackenes Brot und andere Verlockungen gab.
Natürlich immer vorausgesetzt, sie würde die Küche jemals finden. Das Haus war kein Palast, aber die Vielzahl von Türen, die sie zur Auswahl hatte, beeindruckte sie dennoch. Hinter den beiden ersten verbargen sich Speisekammern mit Stellplatten aus Granit, grausam wirkenden Haken und zerfledderten Fliegengittern vor den Fenstern; hinter der dritten fand Jenny eine Kammer voller Flaschen und Krüge, das vierte Zimmer beherbergte Hundekörbe, Knochen und zerrissene Decken, und hinter der fünften Tür erwartete sie schließlich die Küche.
Dort war es zwar etwas wärmer als im Rest des Hauses, aber es war lange nicht die warme Zuflucht, nach der sie sich gesehnt hatte. Jenny blickte sich in der Hoffnung um, eine Art Herd zu entdecken, irgendetwas, was auf heißes Wasser hoffen ließ oder zumindest etwas Warmes, an das man sich anlehnen konnte. Doch nach der Anzahl der Katzen zu urteilen, die darauf saßen, war die einzige Wärmequelle ein betagter Boiler - und nicht einmal den Katzen schien darauf besonders behaglich zu Mute zu sein.
Die Frau, die ihr geöffnet hatte - Felicity, rief Jenny sich in Erinnerung -, kam ihr entgegen. Sie hielt ein Glas in der Hand. Eine Haarsträhne hatte sich aus ihrem Dutt gelöst. »Möchten Sie einen Whisky? Ich weiß, es ist noch früh, aber ich bin etwas rappelig. Ich erwarte einen Freund - eigentlich einen Freund von früher - zum Essen.«
Da Felicity den Whisky bereits eingoss, konnte Jenny wohl kaum noch um eine Tasse Tee bitten, denn damit hätte sie sowohl die schlechten Angewohnheiten ihrer Gastgeberin bloßgestellt als auch deren Erregung noch gesteigert. »Wie schrecklich. Kein Wunder, dass Sie etwas zu trinken brauchen, aber für mich bitte nur einen kleinen. Ich bin schließlich noch bei der Arbeit.« Sie lachte leicht nervös. War Felicitys Ängstlichkeit ansteckend, oder stieg in Jenny langsam das Gefühl auf, dass sie einen schweren Fehler begangen hatte, mehr als siebenhundert Meilen zu fahren und sich darauf festzulegen, vielleicht bis zu einigen Monaten in diesem eiskalten Mausoleum zuzubringen, und zwar hauptsächlich, um Recht zu behalten? »Ist er eine alte Flamme von Ihnen?«
»Eigentlich nicht, eher ein Funke, dem nie die Möglichkeit gegeben wurde, zu mehr zu werden.« Felicity hielt kurz inne. »Ich habe meiner Mutter noch nicht erzählt, dass er kommt.«
»Oh. Und wird sie die Lammkoteletts strecken müssen, um einen zusätzlichen Esser satt zu bekommen? Wird sie sich vielleicht darüber ärgern?«
»Sie wird sich auf jeden Fall ärgern, aber nicht, weil sie für das Essen zuständig ist. Es ist schlicht so, dass er vor über zwanzig Jahren nicht ihre Billigung gefunden hat, und daran wird sich auch jetzt nichts ändern.«
»Oh.«
Felicity strich sich die Haarsträhne aus dem Gesicht. »Tut mir Leid. Ich sollte Ihnen all das gar nicht erzählen. Wir haben uns ja gerade erst kennen gelernt.«
»Es ist manchmal leichter, Fremden etwas zu erzählen als Menschen, die einem nahe stehen.« Die Leute vertrauten sich Jenny relativ schnell an - entweder wirkte sie wie jemand, der gut zuhören konnte oder nicht leicht zu schockieren war.
»Ja«, sagte Felicity zaghaft - noch nicht dazu bereit, sich ihrer Last vollständig zu entledigen. Vielleicht brauchte sie nur noch ein wenig Zeit.
Jenny nippte an ihrem Whisky. »Soll ich mich zuerst Lady Dalmain vorstellen? Oder erst meine Sachen nach oben bringen?« Jenny wusste, dass sie im Haus nur geduldet war, und hatte das Gefühl, dass es Lady Dalmain nicht gefallen würde, wenn der Flur voller Koffer stand.
»Ich denke, ich sollte Ihnen jetzt Ihr Zimmer zeigen. Meine Mutter ist in ihrem Arbeitszimmer. Sie schreibt ein Buch.«
»Ach? Einen Roman?«
Felicity schüttelte den Kopf. »Sie verachtet Romane, das heißt, zumindest alle Romane, die nach neunzehnhundert erschienen sind. Nein, sie schreibt etwas Historisches. Und sie mag es nicht, wenn man sie stört. Ihre Arbeit ist ihr heilig.«
»Werden Sie ihr erzählen, dass Ihr Freund kommt?«
»Oh ja. Das werde ich müssen. Ich schiebe es nur auf. Prost.« Felicity nahm einen Schluck Whisky, der ein Pferd umgeworfen hätte.
Jenny versuchte, es ihr gleichzutun, und erstickte beinahe daran. »Aber Ihre Mutter weiß doch, dass ich komme?« Jennys Ängstlichkeit wurde von Felicitys angefacht, und langsam überlegte sie, ob diese Arbeit vor Ort nicht sehr überbewertet wurde. Es ging doch nichts über einen schönen, anspruchslosen Computer, mit dem man alles in seinen eigenen vier Wänden erledigen konnte. Kommunikation nur über E-Mail. Menschen machten die Dinge so kompliziert.
»Oh ja. Wir wissen es alle seit Wochen.«
Jenny nahm noch einen Schluck. »Miss Dalmain, Sie können mich nicht vielleicht über Ihre Familie ins Bild setzen, bevor ich sie alle persönlich kennen lerne? Dann bleiben mir vielleicht einige furchtbare Schnitzer und Verwechslungen erspart.«
Damit entlockte sie Felicity ein Lächeln. Jenny sah jetzt auch, wie hübsch Felicity einst gewesen sein musste und auch wieder sein könnte, wäre sie nicht so ein Nervenbündel. »Also, da bin einmal ich. Nennen Sie mich Felicity. Ich bin die Älteste; hätte eigentlich ein Junge werden sollen. Den Namen hat mein Vater ausgesucht; meine Mutter war über meine Ankunft überhaupt nicht froh. Ich habe Vater angebetet.« Sie seufzte. »Der Nächste ist Philip, er ist der älteste Sohn. Für meine Mutter geht die Sonne auf, wenn sie ihn sieht. Er ist auch wirklich nett, aber ich habe langsam die Nase voll davon, dass er praktisch nichts falsch und ich nichts richtig machen kann. Dann ist da noch Iain. Er ist der Jüngste und wohnt nicht mehr hier. Er hat den Absprung geschafft. Er ist mit Meggie verheiratet, die …« Felicity musterte Jenny, um herauszufinden, ob ein Hinweis auf die Klassenzugehörigkeit akzeptabel sein würde. Sie kam zu dem Schluss, dass dem nicht so war, und sagte: »Nun, sie ist nicht wie wir. Sie kann ziemlich direkt sein. Meine Mutter ist mit ihr nicht einverstanden, weil sie mit schottischem Akzent spricht. Scotch nennt meine Mutter das.«
»Ach, und ich dachte, es gelte als furchtbar diskriminierend, etwas oder jemanden als ›Scotch‹ zu bezeichnen, es sei denn, es handelt sich um einen Whisky.«
Felicity lachte ausgelassener, als Jenny es auf Grund ihrer Bemerkung erwartet hätte. »Tut mir Leid, es ist nur die Vorstellung, dass Mama sich jemals bemüht haben sollte, niemanden zu diskriminieren. Sie werden schon verstehen, was ich meine, wenn Sie sie kennen lernen.«
»Oh.« In Felicitys Darstellung wirkte die Matriarchin noch düsterer als in der Meggies. »Meggie habe ich schon kennen gelernt. Ich habe auf dem Weg hierher Halt gemacht, um etwas zu trinken, an ihrem Café, dem ›Homely Haggis‹.«
Felicity versteifte sich leicht. »Ach?«
»Sie fragte mich, wohin ich unterwegs sei, und als ich es ihr erzählte, hat sie sich mir vorgestellt.«
»Nun ja, Meggie war schon immer nur allzu bereit, sich anderen aufzudrängen.«
Jenny spürte, dass Snobismus vielleicht eine Familienkrankheit war und nicht nur eine Schwäche Lady Dalmains allein. »Oh, sie hat sich mir nicht aufgedrängt«, versicherte sie. »Sie fragte mich nur, wo ich hinwolle, und erzählte mir dann, dass sie zur Familie gehöre.«
Felicitys Blick war mehr als nur leicht ungläubig. »Und sie hat Ihnen nicht erzählt, dass wir ein seltsamer Haufen seien?«
Jenny blickte in ihr Glas, das immer noch genügend Alkohol enthielt, um die schmerzfreie Amputation eines Armes oder Beines zu ermöglichen. »So in etwa. Jetzt erzählen Sie mir schnell von Ihrer alten Flamme, bevor der Herr persönlich hier erscheint.« So eine vertrauliche Frage war zwar ein Risiko, aber Jenny wollte gern das Thema wechseln, und die meisten Frauen sprechen gern von ihren Männern.
»Wie ich schon erwähnte, bekam er nie die Gelegenheit, zu einer Flamme zu werden. Mama erklärte mir damals, er sei gewöhnlich und ich dürfe mich nicht auf ihn einlassen. Mit Anfang zwanzig hatte ich keine andere Wahl. Ich fürchte, sie ist ein wahnsinniger Snob.«
Über diese Feststellung des Offensichtlichen ging Jenny hinweg und erkundigte sich: »Und wie haben Sie den Kontakt wieder neu geknüpft?«
»Eine Freundin von mir hält auf der anderen Seite des Tales Alpakas. Lachlan ist eine Art fahrender Alpakascherer. Sie hat seinen Namen einmal erwähnt, und da kam mir die Idee, es könne der gleiche Lachlan sein, den ich damals gekannt habe. Schließlich brachte ich den Mut auf, mich bei ihm zu melden, und habe ihm gesagt, er müsse unbedingt einmal herkommen, wenn er wieder in der Gegend sei.« Felicity leerte ihr Glas. »Ich habe keine Ahnung, warum er zugestimmt hat. Ich bin sicher, er ist verheiratet oder hat eine Freundin oder so was. Entweder das oder er muss denken, dass ich eine totale Schlampe bin, ihn einzuladen.«
»Ich bin sicher, dass er das nicht denkt.«
»Denn eigentlich bin ich, was immer meine Mutter auch behaupten mag, keine totale Schlampe. Ich bin nur sehr allein. Und wenn ich nicht bald etwas unternehme, um mein Leben zu ändern, dann werde ich für den Rest meines Lebens hier festsitzen und mich um Mama kümmern können. Für den Rest ihres Lebens und meines - denn sie ist gesund wie ein Ochse.«
»Ich verstehe«, murmelte Jenny, der etwas unbehaglich zu Mute war. »Nun, gut, dass Sie etwas unternommen haben.«
Felicity seufzte. »Kommen Sie. Ich werde Ihnen Ihr Zimmer zeigen. Sie können dort Ihre Sachen auspacken und so weiter und dann so gegen sieben hinunter in den Salon kommen, um vor dem Essen noch einen Schluck zu trinken. Lachlan kommt ungefähr um halb acht. Es wird besser sein, wenn Sie bei seiner Ankunft anwesend sind. Dann wird Mama nicht in der Lage sein, allzu viel Theater zu machen.«
Jennys Zimmer war groß und befand sich in einem der kleinen Türme. Das bedeutete eine Vielzahl von Fenstern mit Panoramablick. Und es hieß, dass es zog wie Hechtsuppe, wie ihre Mutter es formuliert hätte. Wie gewünscht stand ein als Schreibtisch benutzbarer Tisch im Zimmer, dazu ein hohes, altmodisches Bett, eine Kommode und ein Kleiderschrank.
»Ich habe eine der Schubladen leer geräumt, und im Kleiderschrank ist auch etwas Platz«, erklärte Felicity. »Wir haben eine separate Telefonleitung legen lassen, wie gewünscht.« Das fügte sie mit einem sichtbaren Schaudern hinzu. »Mama war außer sich! Wir sind immer angehalten, sparsam …«
»Aber die Firma hat doch gezahlt?«, unterbrach Jenny sie.
»Oh, ja, doch Mama hasst es, Geld zu verschwenden, selbst wenn es nicht ihr eigenes ist, es sei denn, für irgendetwas, das ihre Billigung findet, zum Beispiel Bücher oder Antiquitäten. Nichts, was mit Elektronik auch nur entfernt zu tun hat, gehört dazu. Trotzdem hoffe ich, dass alles recht ist. Zum Badezimmer geht es über den Flur. Meine Mutter hat ihr eigenes Bad, und wir anderen teilen uns das auf dem Flur.«
»Zeigen Sie mir einfach, wo es ist. Das Haus ist so groß, ich werde mich sicher verlaufen.«
»Oh, kein Problem.« Felicity ging ihr durch den Flur voraus. »Hier ist es. Benutzen Sie die Dusche erst gar nicht; sie funktioniert nicht. Und in der Wanne ist es immer kalt, weil nie genug heißes Wasser da ist, um sie ganz zu füllen. Ich lasse normalerweise einen Eimer mit heißem Wasser voll laufen, mit dem ich mich, in der Badewanne stehend, wasche, und dann spüle ich mich mit einem Plastikkrug ab. Meine Mutter hat einen eigenen Heißwasserbereiter in ihrem Bad.«
»Oh. Ja, gut«, sagte Jenny und schwor sich, ihre Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen. Es hatten sie zwar alle, vor allem Henry, gewarnt, dass es in Schottland viel kälter als in England sei, aber niemand hatte erwähnt, dass sich das auch auf das Wasser bezog.
»Also, wir sehen uns dann um sieben Uhr unten im Salon?«
»Wenn ich es schaffe, ihn zu finden, ja.«
Jenny lief wieder hinunter, um ihre restlichen Taschen und ihren Laptop zu holen. Sie hätte nicht unbedingt erwartet, dass jemand anders sie für sie trug, aber es wäre doch freundlich von Felicity gewesen, ihr etwas abzunehmen, und wenn es nur die Tragetasche mit den Pralinen und der Pflanze gewesen wäre, den Geschenken für ihre Gastgeber.
Endlich auf ihrem Zimmer, schloss sie als Erstes ihren Laptop an. Zum Auspacken hatte sie noch keine rechte Lust. Es war fast so, als glaubte sie, die Kleider in ihrem Koffer nähmen in dem Augenblick die Kälte des Raumes an, in dem sie sie auspackte. Außerdem konnte sie sich nicht erinnern, irgendetwas Wärmeres eingepackt zu haben als ihren Hosenanzug. Allerdings war Lady Dalmain, wenn Felicity auch nichts davon gesagt hatte, sicherlich eine Frau, die erwartete, dass man sich zum Abendessen umzog, und da Jenny nun schon ziemlich lange in ihren Sachen steckte, hätte sie ganz gern etwas anderes angezogen.
Jedenfalls würde sie sich nicht ausziehen, bevor sie nicht irgendetwas als Ersatz herausgesucht hatte. Also loggte sie sich zunächst einmal in ihr E-Mail-Konto ein. Sie las aber nichts von dem, was dort ihrer Aufmerksamkeit harrte - Mails von anderen, weniger anspruchsvollen Kunden als dem, der sie hierher geschickt hatte -, sondern schrieb nur rasch eine Nachricht an ihre Mutter.
Liebste Mama, nun, ich bin inzwischen angekommen. Wie du es vorhergesagt hast, herrschen hier Minus-Temperaturen. Du hattest völlig Recht, was die warme Unterwäsche angeht, ich brauche sie hier wirklich. Und um mir die stundenlange Suche im Internet zu ersparen, wo ich mir welche bestellen könnte: Wärst du wohl ein Schatz und schicktest mir etwas? Unterhemden, Unterröcke, Nachthemden, ich glaube, es wäre am einfachsten, du ließest mir einmal das ganze Sortiment aus dem Otto-Katalog zusenden. Aber erzähl um Gottes willen Henry nichts davon, er würde sich totlachen. Ach, und ein Heizkissen brauche ich. Fürs Erste kann ich mir, wenn ich Glück habe, vielleicht eine Wärmflasche organisieren. Die Landschaft allerdings ist sehr schön. Doch die Familie scheint aus lauter Verrückten zu bestehen. Habe die Mutter bisher noch nicht kennen gelernt. Sie scheint, nach dem, was ich bisher gehört habe, die Schlimmste zu sein. Warum habe ich mich breitschlagen lassen, hierher zu kommen? Darauf erübrigt sich wohl eine Antwort! Mit lieben Grüßen, deine Tochter Jenny.
Während sie noch online war, fiel ihr ein, dass sie ihre Ankunft auch ihrem Kunden melden konnte. Sie tippte:
Fahrt ohne besondere Ereignisse, bin sicher angekommen. Habe die Familie bisher noch nicht kennen gelernt. Weiterer Kurzbericht folgt.
Mit freundlichen Grüßen G. Porter
Henry schickte sie keine E-Mail. Damit wollte sie warten, bis sie etwas Positives zu berichten hatte. Alles, was sie ihm jetzt schrieb, würde ihn nur - unter dem Mantel des Mitleids - zu einer ätzenden Bemerkung veranlassen: »Ein bisschen ins Schwimmen geraten, Schätzchen? Ich habe dich ja gewarnt …« Sie würde Henry ein oder zwei Sachen klar machen müssen.
Um sieben Uhr begab sie sich nach unten. Im Winter ist es völlig normal, wenn man aussieht, als hätte man sich warm eingepackt. Im Oktober dagegen wirkt es irgendwie rüde, wenn man jedes einzelne Kleidungsstück am Leib trägt, das man mit zu seinen Gastgebern gebracht hat. Andererseits wirkte es auch nicht besonders kultiviert, wenn einem die Zähne klapperten, während man mit seiner Gastgeberin zu plaudern versuchte. Außerdem hatte Jenny gar keine richtigen Wintersachen mitgenommen und musste daher ohnehin improvisieren.