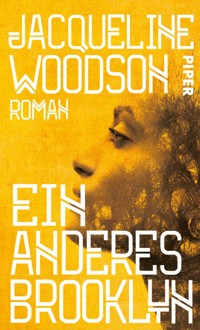6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die »Miah und Ellie«-Reihe
- Sprache: Deutsch
Als Ellie und Miah sich an ihrem ersten Tag an einer New Yorker Privatschule begegnen, berühren sich ihre Herzen
Ellie träumt von Miah, seit er ihr das erste Mal in die Augen gesehen hat. Miah denkt ständig an das Mädchen, dessen Namen er nicht kennt. Denn ihnen widerfährt gerade die erste ganz zarte und doch große Liebe. Beiden ist regelrecht schwindelig von dem, was sie da miteinander erleben, denn es ist mit nichts zu vergleichen, was ihnen je widerfahren ist. Sie sind so in ihrer gemeinsamen Welt versunken, dass sie nur am Rande wahrnehmen, was andere scheinbar wichtig finden: Die Tatsache, dass Ellie weiß ist und Miah Schwarz. Doch ihre Herzen sprechen eine Sprache und das ist alles, was für sie beide zählt.
Eine zutiefst berührende, poetische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des alltäglichen Rassismus. Für Fans von Jason Reynolds und Angie Thomas
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JACQUELINE WOODSON
EINE
WEILE
BLEIBT
DIE
ZEIT FÜR
UNS
STEHEN
Aus dem Amerikanischen von Eva Riekert unter Mitarbeit von Chantal-Fleur Sandjon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 1998 und 2018 Jacqueline Woodson
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel:
»If You Come Softly« bei Nancy Paulsen Books,
einem Imprint der Verlagsgruppe
Penguin Random House LLC, New York
Übersetzung: Eva Riekert
Überarbeitung und Lektorat: Chantal-Fleur Sandjon
Umschlagkonzeption: buxdesign, Lisa Höfner
unter Verwendung der Abbildungen von
© Shutterstock (Travellaggio; Summer loveee)
MP · Herstellung: UK
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-29652-0V002
www.cbj-verlag.de
Für alle Jeremiahs
Wenn du kommst so leise,
Wie Blätter rascheln im Wind,
Dann hörst du, was ich höre,
Weißt, wo der Schmerz beginnt.
Meine Mutter ruft aus dem unteren Stockwerk nach mir und ich wache langsam aus einem tiefen Schlaf auf. Es ist Juni. Der Himmel draußen ist tiefblau und klar. In der Ferne kann ich den Central Park sehen, die Bäume heben sich leuchtend grün vom Himmel ab. Ich habe von Miah geträumt.
»Elisha«, ruft Marion wieder. Sie klingt besorgt, und ich weiß, dass sie am Fuß der Treppe steht. Ihre Hand streicht dabei langsam über das Geländer, rauf und runter, sie wartet auf eine Antwort von mir. Aber ich kann jetzt nicht antworten. Noch nicht.
Gibt es einen Jungen?, hatte Marion mich im Herbst gefragt, als Miah gerade aufgetaucht war. Und ich habe gelogen und gesagt, Nein, es gibt keinen.
Jetzt steht sie mit verschränkten Armen in der Tür.
»Zeit zum Aufstehen, Liebes. Alles in Ordnung?«
Ich nicke und starre weiter aus dem Fenster, das Haar fällt mir über die Augen, mein Pyjama fühlt sich heiß an und klebt mir auf der Haut.
Nein, Marion, es gibt keinen Jungen. Jetzt nicht. Nicht mehr.
Sie tritt ans Bett und setzt sich neben mich. Ich spüre, wie das Bett von ihrem Gewicht einsinkt, rieche ihr Parfüm.
»Ich hab heute Nacht von Miah geträumt«, sage ich leise und lege den Kopf an ihre Schulter. Draußen hupen die Taxis. In den Sekunden der Stille, zwischen dem Lärm, kann ich Vögel hören. Und meinen eigenen Atem.
Marion streicht mir mit der Hand über den Kopf. Langsam. Sanft. »War es ein schöner Traum?«
Ich ziehe die Stirn kraus. »Ja … ich glaube schon. Aber ich kann mich nicht an alles erinnern.«
»Behalte so viel in Erinnerung, wie du kannst, Elisha«, flüstert Marion und küsst mich auf die Stirn. »So viel, wie du nur kannst.«
Ich schließe die Augen.
Und versuche, mich an alles zu erinnern.
TEILEINS
1
Jeremiah war Schwarz. Er konnte es richtig spüren. Die Art, wie die Sonne im Sommer auf seine Haut brannte. Manchmal kam es ihm so vor, als wären selbst seine Schweißtropfen schwarz. Er fühlte sich warm in seiner Haut, geborgen. Und in Fort Greene in Brooklyn – wo jede und jeder eine der vielen Schattierungen von Schwarz zu sein schien –, da fühlte er sich wohl.
Aber nur einen Schritt nach draußen. Nur einen Schritt und seine Hautfarbe bekam ein anderes Gewicht. Ein schweres.
Allein die Freunde mit hellem Hautton aus seinem Viertel, light-skinned, wie sie waren … Zuweilen ertappte er sich dabei, dass er sich über sie lustig machte. Aber alle lachten. Jeder machte sich über jeden lustig. Wer verspottet wurde, schlug – bam! – mit Worten zurück. Sein Freund Carlton – dämlicher Name –, weiße Mama, Schwarzer Papa, aber will allen erzählen, er sei durch und durch Schwarz. Manchmal warfen sie ein paar Körbe, und Carlton fing plötzlich an, darüber herzuziehen, wie Schwarz Jeremiah sei. Aber da war nichts Gemeines dabei. So gingen sie eben miteinander um. Manchmal lachten sie, bis ihnen die Tränen übers Gesicht liefen. Lachten und zeigten aufeinander und versuchten, sich mit witzigen Bemerkungen zu übertreffen. So war es immer mit ihnen. Wenn Jeremiah mit seinen Kumpels rumhing, dann konnte er einfach sein. Genau wie all die anderen. Ein paar waren heller, ein paar dunkler, manche mit Locs, andere mit Locken, sogar ein paar Kahlköpfe – so hingen sie miteinander rum und lachten. In diesen Momenten fühlte er sich frei – frei in seiner Schwarzen Haut. Als könnte er sie feiern, die Arme ausbreiten und jubeln.
Manchmal dachte er an seine Großmutter, daran, wie sie immer aufpasste, dass er sich in den Schatten setzte. Damit du nicht zu Schwarz wirst, sagte sie. Das war, lange bevor sie an Krebs starb. Damals war er noch klein und pendelte zwischen Brooklyn und dem Süden hin und her. Damals hatte er noch keine Ahnung. Für ihn gab es nur Mama und Daddy am Flughafen, die sich mit einem Kuss von ihm verabschiedeten; Mama hielt seine Hand so lange und so fest, dass es ihm peinlich wurde; dann nahm ihn eine Stewardess bei der Hand und setzte ihn ganz nach vorne, wo sie ihn gut im Auge behalten konnte, seine Mama hatte sie darum gebeten. Er erinnerte sich an ein Paar silbriger Flugzeugflügel, das ihm ein Pilot schenkte, und an sein erstes richtiges Menü auf einem kleinen weißen Plastiktablett. Kuchen gab es im Flugzeug, immer so süßen Kuchen, wie er ihn zu Hause nie bekam. Und dann schlief er ein und war plötzlich im Süden, und da war seine Großmutter, weinte schon. Sie weinte jedes Mal, wenn sie ihn sah – weinte und lachte gleichzeitig. Jeremiah lächelte beim Gedanken daran, wie er ihr immer in die weichen Arme gesunken war und vom Duft ihres Rosenwassers umfangen wurde.
Das war lange her.
Jeremiah balancierte seinen Basketball auf der linken Handfläche und hielt ihn mit gestrecktem Arm von sich. Er starrte ihn einen Moment lang an, dann ließ er ihn dreimal kurz auf dem Randstein aufspringen. Wenn seine Großmutter doch noch am Leben wäre, damit er es ihr sagen könnte – dass es nichts Schlechtes war. Dass man nicht zu Schwarz sein konnte. Sein Vater hatte ihn mal in einen Film über die Black-Panther-Bewegung mitgenommen. All die Afros und erhobenen Fäuste. Jeremiah lächelte. Er wünschte, seine Großmutter hätte sie rufen gehört, Black is beautiful. Hatte sie aber nicht. Sie hatte geglaubt, was sie damals sagte – dass man auch zu Schwarz werden konnte. So wie sein Vater daran glaubte, wenn er sagte: »Miah, du bist ein Schwarzer Mann. Du bist ein Krieger.«
Aber wo wurde denn gekämpft?, fragte er sich dann. Wo war der Krieg? Später mal hatte Jeremiah einen Cartoon gesehen, in dem ein Affe Basketball spielte, und er hatte sich geschämt; irgendwie kam es ihm so vor, als sollte der Affe ihn darstellen. Da begriff er, der Krieg war überall. Der Krieg, das waren die Leute und die gesamte Werbung, sie schienen ihm zu sagen: Du zählst nicht. Daran, Schwarz zu sein, ist immer etwas falsch.
Und wenn er jetzt auf dem Basketballplatz war, wurde ihm jedes Mal bewusst, wie Schwarz er war. Es war, als würde er seinen Körper verlassen und auf den Seitenstreifen hinüberlaufen, um sich selbst zuzusehen. Er sah, wie sich die Muskeln seiner dunklen Schenkel anspannten, sah seine langen braunen Arme nach dem Ball greifen, sah, wie sich seine Waden wölbten, wenn er über das Spielfeld rannte. Der Gedanke, für die Percy-Schule spielen zu müssen, war ihm zuwider. Nein, nicht das Spielen an sich, er war begeisterter Basketballspieler, schon immer gewesen, konnte sich nicht erinnern, dieses Gefühl, die Hände um den Ball zu schließen, nicht geliebt zu haben. Aber er hasste es, jetzt für Percy zu spielen, diese superweiße Privatschule. Beim Training vor der Spielsaison hatte er sich manchmal umgesehen – nichts als weiße Gesichter! Na gut, es gab Rayshon und Kennedy, sie waren Schwarz. Und trotzdem anders. Rayshon und Kennedy kamen aus einer anderen Welt. Klar, sie klatschten sich ab und warfen sich Blicke zu, wenn andere im Team was Dämliches sagten. Aber abends verschwanden sie in eine andere Welt. Kennedy wohnte in der Albany-Siedlung draußen in Brownsville. Rayshon wohnte in Harlem. Jeremiah verzog das Gesicht. Er wollte kein Snob sein.
Ich hab die halbe Welt gesehen, dachte er. Ich war in Indien, in Mexiko, auf Mauritius. Deshalb bin ich anders. Anders als sie. Anders als eine Menge Leute – Schwarze und weiße.
Und er wusste, was in diesem Winter kommen würde – seine erste Spielzeit in dem Team. Er wusste, er würde auf die Tribüne schauen und noch mehr weiße Gesichter sehen – Hunderte; sie würden ihm und der Percy-Schule zujubeln. Es kam ihm irgendwie falsch vor – so klischeehaft. Warum konnte er nicht Tennis spielen? Warum hatte man ihm keinen Tennisschläger oder Golfschläger in die Hand gedrückt? Nicht dass es in seiner Umgebung einen Tennisklub oder einen Golfplatz gegeben hätte. Okay, im Fort Green Park gab es Tennisplätze, aber man musste Mitglied sein und einen Partner haben. Und überhaupt, man musste schon spielen können, bevor man sich dort überhaupt hinwagte. Und als er noch klein war, trieb es keinen von seinen Freunden zu den Tennisplätzen. Ein Basketball hingegen war immer greifbar, und man spielte einfach, mit ein paar Jungs im Park. Oder jemand stellte eine leere Mülltonne an den Straßenrand zum Freiwürfe-Üben, oder es hing irgendwo eine Feuerleiter runter, deren Sprossen genau den richtigen Abstand hatten, dass ein Basketball durchpasste.
Jeremiah legte den Ball auf den Boden und starrte auf seinen Handrücken, auf die Stellen um seine Knöchel, die dunkler waren als die restliche Haut. Als er klein war, hatte seine Mutter immer gesagt: »Wo ist denn mein schöner kleiner braunäugiger Schwarzer Junge?« Und er war auf sie zugerannt. »Hier bin ich«, rief er dann, wenn sie ihn hoch in die Luft hob.
Die Leute sagten immer, was für schöne Augen er hätte. Selbst Fremde. Vor allem Mädchen. Seine Augen waren hellbraun, fast grün. Er fand schon immer, sie sahen eigenartig aus, bei seiner dunklen Haut. Manchmal starrte er sein Spiegelbild an. Sah er tatsächlich gut aus? Klar, Mädchen bemerkten ihn meistens, das wusste er, aber die Auswahl in Fort Greene war ja auch nicht so toll, deshalb starrten sie wahrscheinlich jeden an. Black is beautiful.Werd nicht zu Schwarz. Schwarzer Affe. Wo ist mein schöner kleiner Schwarzer Junge? Du bist ein Schwarzer Mann. Du bist ein Krieger.
Jeremiah seufzte und blickte die Straße herab. Die ganzen Sprüche, die er immer zu hören bekam – wirklich, er kannte sie in- und auswendig. Aber manchmal, wenn er in den Spiegel sah, dann hatte er keine Ahnung, wer er war oder warum er auf der Welt war.
Und jetzt – als Zugabe zu allem anderen – hatte er ein Mädchen kennengelernt.
2
Es regnete an dem Nachmittag, als ich Miah kennenlernte. Es schüttete richtig, vier ganze Tage lang. Langsam lief ich im Regen heim, der Vier-Dollar-Schirm, den ich unterwegs gekauft hatte, konnte ihn kaum abhalten.
Henry, unser Portier, winkte, als er mich sah; dann kam er mit einem übergroßen Schirm angelaufen, den er über meinen hielt. Wir wohnen auf der Achtundachtzigsten, Ecke Central Park West, solange ich mich erinnern kann. Und solange ich mich erinnern kann, läuft uns Henry jedes Mal, wenn es regnet, mit einem riesigen Schirm entgegen. Selbst wenn wir unseren eigenen Schirm dabeihaben.
Ich lächelte Henry zu. Er ist groß und schweigsam. Sein Haar ist braun mit Grau drin und lockig, und seine Haut so hell, dass man die Adern unter seinen Schläfen sehen kann.
»Der erste Tag in der neuen Schule«, sagte Henry.
Ich nickte. Er fragt nie, sondern er macht eher Feststellungen. »Woher wissen Sie das?«
»Die Uniform. Du siehst darin ja aus wie ich.«
Ich sah an meiner Percy-Uniform hinunter. Ob die Schulverwaltung wohl wusste, dass die burgunderfarbenen Jacken und die grauen Röcke, die wir tragen mussten, die gleichen Farben hatten wie die Uniformen der meisten Portiers in der Stadt? »Muss mich erst dran gewöhnen.«
Henry zwinkerte mir zu. »Du wirst überrascht sein, wie schnell das geht. Percy, stimmt’s?«
»Ich komm mir wie eine wandelnde Werbeanzeige für die Schule vor«, sagte ich.
Henry lachte und kehrte auf seinen Posten bei der Tür zurück. »Bis später, Ellie.«
Die Fahrstuhltür glitt geräuschlos auf. Ich trat ein und wartete, dass sie sich wieder schloss. Dabei zählte ich stumm vor mich hin. Als sich die Kabine in Bewegung setzte, schloss ich die Augen und dachte an Jeremiah.
Ich hatte meinen Stundenplan studiert und war auf der Suche nach Zimmer 301 oder so ähnlich. Mein Blick ging vom Stundenplan zu den Zahlen an den Türen – und dabei lief ich regelrecht in ihn rein. Meine Mathe- und Physikbücher flogen auf den Boden. Er fing an, sich zu entschuldigen, und ich entschuldigte mich, und wir bückten uns gleichzeitig, um die Bücher wieder aufzuheben. Und dann – hielten wir beide inne und mussten furchtbar lachen.
Er sagte seinen Namen – Jeremiah –, und mir kam dieses lächerliche alte Lied mit dem Ochsenfrosch in den Sinn, so unvermittelt, dass ich rausplatzte: »Wie der Ochsenfrosch?«
»Ja.« Er lächelte. »Wie der Ochsenfrosch.«
Ich konnte den Blick nicht von ihm wenden, von seinem Lächeln und von seinem Haar. Noch nie hatte ich Dreadlocks aus der Nähe gesehen. Seine waren dick und schwarz und fielen in Spiralen über seine Schultern. Ich wollte sie berühren, wollte sein Gesicht berühren. Ich wollte ihn noch mal seinen Namen sagen hören. Einen Augenblick lang starrten wir uns an und keiner sagte ein Wort. Etwas an ihm kam mir vertraut vor, etwas, das ich schon mal gesehen hatte. Auf einmal verlegen, blinzelte ich und wandte mich ab.
Dann erhoben wir uns beide wieder.
»Also … Tschüs. Wahrscheinlich … wahrscheinlich sehen wir uns ja noch«, sagte er leise. Er sah mich einen Moment lang an, dann ging er den Gang hinunter. Seine Locs wippten sanft an seine Schultern.
»Jeremiah«, flüsterte ich vor mich hin, während ich weiterging. Ich konnte seinen Namen spüren, er umgab mich, als liefe ich durch einen feinen Nebel, gebildet von ihm, Jeremiah.
Ich blieb stehen und warf einen Blick zurück. Er sah mir irgendwie verwirrt nach. Jeremiah,dachte ich und lächelte. Jeremiah lächelte zurück, winkte mir dann zu und verschwand in dem Klassenzimmer am Ende des Ganges.
Unsere Wohnung geht über zwei Stockwerke. Von innen wirkt sie fast wie ein Haus. Sie hat hohe Fenster, einen offenen Kamin im Wohnzimmer und eine Treppe, die zu den Schlafzimmern oben führt. Ich öffnete die Wohnungstür ganz leise und schlich nach oben in mein Zimmer. Draußen donnerte es heftig. Der Regen klang jedoch beruhigend, gleichmäßig. Als ob er nie mehr aufhören wollte. Als ob es ab jetzt immer regnen würde.
Vor dem Schrank zog ich die Schuhe aus, dann setzte ich mich aufs Bett, um die nassen Socken abzustreifen. Wenn ich auf dem Bett liege, kann ich von meinem Zimmer aus die Autos durch Central Park West brausen sehen. Schnell irgendwohin. In New York will jeder immer schnell irgendwohin. Man sieht Geschäftsleute im Laufschritt, mit gesenkten Köpfen, ihre Hosenaufschläge schlagen gegen ihre Knöchel. Sie sehen keinen an. Einmal bin ich einem Mann gefolgt, lief so dicht neben ihm, dass ich seine Tochter hätte sein können – aber er wandte kein einziges Mal den Kopf und nahm mich gar nicht wahr. Zwei Blocks lang bin ich so neben ihm hergelaufen. Er tat mir leid – wie er so durch die Welt lief, ohne nach rechts oder links zu sehen.
Einsam.
Ich seufzte und legte mich auf das Bett zurück. Manche Leute waren immer von Freundinnen und Freunden umgeben. Manchmal, wenn mir ein paar kichernde, Händchen haltende Mädchen entgegenkamen, dann zog sich mein Magen zusammen. Ich wollte auch so sein. Und wollte es zugleich auch nicht. Marion sagt, das liegt daran, dass ich das Nesthäkchen bin. Anne und Ruben, die Zwillinge, waren schon zehn, als ich geboren wurde, und mein älterer Bruder Marc und meine Schwester Susan waren sogar schon auf der Universität. Marion sagt, ich sei es schon früh gewohnt gewesen, allein zu sein. Und dann unsere Wohnung hier – mit all den leeren Zimmern und so ausgestorben. Manchmal ging ich langsam durch alle Räume, berührte die Wände der alten Zimmer meiner Geschwister und überlegte, wie es wohl wäre, in einem Haus aufzuwachsen, das voller Menschen war. Und manchmal saß ich nachmittags im Bistro an der Ecke, aß eine Portion Pommes frites, las und war rundum zufrieden. An solchen Tagen fand ich es genau richtig, allein zu sein.
Jeremiah. Was für ein Zuhause hatte er? Dachte er noch an mich? Hatte er es auch bemerkt, was »es« auch sein mochte? Das, was mir aufgefallen war, als wir uns angesehen hatten – was war es?
Einmal hatte ich einen Jungen geküsst – einen Jungen namens Sam, in der siebten Klasse. Er trug eine Spange und lispelte deswegen. In meiner Gegenwart war er nervös und unbeholfen, er wollte meine Schultasche tragen oder mich zu einer Limo einladen. Ich mochte ihn, es gefiel mir, wie er herumstotterte und mich nicht richtig ansah. Eines Tages gab ich ihm einfach einen Kuss, ich beugte mich rüber, als er neben mir saß und mir stotternd irgendwas vom Segelboot seines Vaters erzählte. Ich hatte noch nie jemanden auf den Mund geküsst und Sams Lippen fühlten sich trocken und fest an. Und gleichzeitig warm und süß. Wir saßen im Park und pressten die Lippen aufeinander, bis Sam zurückwich. Danach ging er mir aus dem Weg.
Ich lag quer über meinem Bett, überlegte, wo er wohl jetzt war, der gute Sam, der plötzlich Angst vor mir bekommen hatte, Angst vorm Küssen. Wann ich wohl wieder jemanden küssen würde? Ob es Jeremiah sein würde?
»Elisha!« Meine Mutter rief von unten nach mir. »Hast du vor, den ganzen Nachmittag in deinem Zimmer zu verbringen?«
»Vielleicht, Marion«, rief ich zurück.
Ich setzte mich auf und strich mit der Hand über die Falten meines grauen Percy-Rocks, dann zog ich ihn aus. Bisher hatte ich nie eine Schuluniform getragen. Diese hatte den ganzen Sommer unter einer dünnen Reinigungsfolie im Schrank gehangen. Einmal hatte ich sie Marion und meinem Vater vorgeführt, sie hatten gelächelt und ich musste mich nach allen Seiten umdrehen. Es war schon merkwürdig, in eine Schule zu gehen, wo alle genauso gekleidet waren wie ich.
»Elisha«, rief Marion noch mal. »Komm runter und erzähl mir vom ersten Schultag.«
Ich hab einen Jungen kennengelernt, wollte ich rufen. Er heißt Jeremiah.
»Ich zieh mich nur um, Marion. Zum Essen komm ich runter.«
»Na dann, das Essen ist gleich fertig.«
Marion hatte im Esszimmer gedeckt, für zwei. Eine dünne weiße Kerze brannte in einem silbernen Leuchter. Ich starrte lange in die Flamme. Jeremiahs Gesicht flackerte kurz darin auf, dann verschwand es.