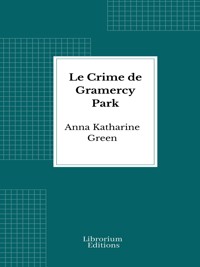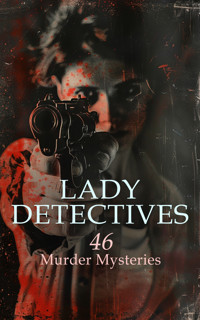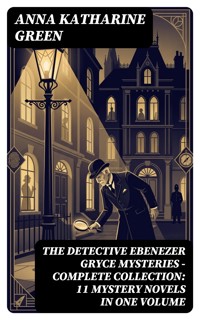Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Als Arthur Outhwaite eines Abends die Straßen New Yorks entlang geht, tritt ein kleines Mädchen aus dem Eingang eines Hauses, in dem augenscheinlich wohlhabende Menschen leben, und bittet den wildfremden Mann, mit hineinzukommen, denn dem Großvater gehe es schlecht und er habe dem Mädchen aufgetragen, einen Fremden ins Haus zu holen. Arthur folgt dem Mädchen und nimmt einen Umschlag entgegen, der die letzte Botschaft des alten Mannes enthält, ehe dieser infolge eines heimlich verabreichten Gifts tot zu Boden sinkt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einer meiner Söhne
Anna Katharine Green
Erstes Buch
Erstes Kapitel.
An einem rauhen Herbstabend ging ich schnellen Schrittes die Avenue hinauf, als ich an der Ecke der Fünfzigsten Straße plötzlich zum Stillstehen veranlaßt wurde. Eine Kinderstimme hatte mich von der Straßentreppe eines der schönen Häuser aus angerufen, an denen mein Weg mich vorüberführte.
O lieber Herr! hörte ich ängstlich rufen, bitte, kommen Sie doch herein! Bitte, kommen Sie zu Großpapa! Er ist krank und braucht Sie!
Ueberrascht, denn ich kannte keinen von den Bewohnern dieses und der Nachbarhäuser, sah ich mich um. In der offenen Tür stand die zitternde Gestalt eines kleinen Mädchens, dessen liebreizendes, aber aufgeregtes Antlitz von einer Fülle goldener Locken umrahmt war.
Du irrst dich, liebes Kind! rief ich zu der Kleinen hinauf. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich kenne euer Haus gar nicht. Sage mir, wen du holen sollst, und wenn er hier in der Nähe ist, so will ich ihm sagen, daß er sofort zu deinem Großpapa gehen soll.
Aber damit war sie nicht zufrieden. Sie lief die Treppe herunter, packte mich mit kindlichem Ungestüm am Arm und rief: Nein, nein! Dazu ist keine Zeit! Großpapa sagte mir, ich solle den ersten Mann hereinbringen, den ich vorübergehen sähe. Sie sind der erste Mann. Kommen Sie!
Es lag etwas Eindringliches in ihrem Ton, und unwillkürlich gab ich ihrer Aufforderung nach und ließ mich von ihr nach der Treppe hinziehen. Aus der prunkvollen Ausstattung der Fassade konnte ich schließen, daß das Haus von einem sehr reichen Mann bewohnt war; ich fragte die Kleine:
Wer ist dein Großpapa? Wenn er krank ist, so sind doch die Dienstboten da ...
Aber weiter kam ich nicht; ungeduldig stampfte ihr kleiner Kinderfuß auf, und sie rief:
Großpapa wartet niemals! – Damit zogen ihre Händchen mich die Stufen der Treppe hinauf und zur offenen Tür hinein. »Wenn Sie nicht schnell machen, wird er glauben, ich hätte nicht getan, was er mir befahl.«
Wer hätte da nicht nachgegeben? Wie ich vom Eingang aus bemerkte, war das Treppenhaus mit verschwenderischer Raumentfaltung und mit großer Pracht angelegt. Die ganze Art der Einrichtung verriet sofort eine strenge Solidität und ungewöhnlichen Reichtum; so sonderbar das Erlebnis auch war, ich sah nichts dabei, was mich mit irgendwelchem Mißtrauen hätte erfüllen können. Ich trat also mit dem Mädchen in das Haus und machte die Tür hinter mir zu. Im Nu war das Kind durch die Halle gelaufen; vor einer Tür dicht an deren Ende blieb es stehen und rief mir zu:
Hier! Hier!
Ich habe mir schon manchmal die Frage vorgelegt, ob in meinem Aeußeren etwas besonders Vertraueneinflößendes liege. Das Vertrauen, womit mich die Kleine anrief, und ihr hübsches Bild in dem Lichtschein, der aus der geöffneten Tür des Zimmers herauskam, dies alles rührte mich und zog mich unwillkürlich an ihre Seite. Da hatte ich nun einen Anblick, der mich ihre ganze Angst begreifen ließ; ich verstand, warum sie einen ganz unbekannten Straßenpassanten herbeigerufen hatte.
In der Mitte eines kleinen Zimmers, das ebenso schmucklos und einfach wie das Kontor eines Geschäftsmannes eingerichtet war, erblickte ich einen alten Herrn, der offenbar – auch meine unerfahrenen Augen erkannten dies – nicht bloß krank war, sondern sogar an der Schwelle des Todes stand.
Etwas so Ernstliches hatte ich nicht erwartet; der Anblick regte mich auf, und ich wollte mich umwenden, um schnell Hilfe herbeizurufen; aber das Mädchen eilte an mir vorüber, umfaßte seines Großvaters Knie und sah mich mit einem so flehenden Blick an, daß ich's nicht übers Herz bringen konnte, sie mit dem Sterbenden allein zu lassen.
Es wäre auch grausam von mir gewesen, wenn ich gegangen wäre. Selbst mir, der ich doch ein Mann bin, schnürte der Anblick des Kranken die Kehle zusammen. Obwohl dem Tode nahe, lag er nicht, sondern stand aufrecht da. An den großen Schreibtisch sich anklammernd, bot seine hochgewachsene Gestalt ein Bild seelischen und körperlichen Leidens, wie ich es nie zuvor gesehen hatte und wie es mir unvergeßlich in der Erinnerung bleiben wird. Die eine Hand hielt er gegen das Herz gepreßt, die andere klammerte sich mit ausgespreizten Fingern in verzweifelter Anstrengung an den Tisch an, und auf sie stützte sich das ganze Gewicht seines Körpers, so daß er nur schwankte, aber nicht fiel. Sein Blick war auf die Tür gerichtet, und als ich in das Zimmer eintrat, ging plötzlich ein Zittern durch die zusammensinkende Gestalt, die geballte Hand, die er gegen sein Herz gepreßt hielt, öffnete sich ein wenig, und ich bemerkte zwischen seinen Fingern einen zerknitterten Papierfetzen.
Mich rührte der Anblick dieses augenscheinlich sonst starken und kräftigen Mannes, der jetzt so hilflos war, und ich murmelte einige bedauernde und aufmunternde Worte. Hierauf – in der Annahme, daß er mit seiner Enkelin allein im Hause sei – erkundigte ich mich, ob ich ihm einen Dienst erweisen könne.
Er sah mit einem bedeutungsvollen Blick auf seine Hand hinunter; da er jedoch bemerkte, daß ich ihn nicht verstand, machte er eine übermenschliche Anstrengung und streckte diese Hand aus. Hierbei brachte er einige unzusammenhängende Worte hervor, die ich so auslegte, daß ich ihm den Zettel abnehmen möchte, den seine erstarrenden Finger nicht mehr loslassen konnten.
Um ihm in seinen Todesnöten jeden in meiner Macht liegenden Beistand zu gewähren, tat ich, was er wünschte, und zog das Papier zwischen seinen Fingern hervor. Dabei bemerkte ich zweierlei: der Zettel war ein Teil eines Briefbogens, und er war zusammengefaltet.
Was soll ich damit machen? fragte ich, indem ich mit einem Blick zugleich sein sich schnell mit einem trüben Schleier überziehendes Auge befragte.
Er suchte mit einem schnellen Blick auf dem Tisch umher; dann ließ er sein Auge an einem bestimmten Punkt haften. Ich verstand ihn. Ich sollte den Zettel in einen Umschlag stecken.
Ich zog einen Umschlag aus dem Gestell heraus, schob den Papierfetzen hinein und verschloß die Klappe. Dann befragte ich ihn mit einem lächelnden Blick, ob ich recht getan habe und was er weiter wünsche. Er antwortete mit einem Blick, in dem sich Dankbarkeit und Vertrauen so deutlich aussprachen, daß ich mich ganz beschämt fühlte, denn mein kleiner Dienst war doch nicht der Rede wert. Es lag etwas ganz Eigentümliches in jenem Blick, und ich wollte gerade fragen, welchen Namen ich auf den Umschlag schreiben solle, als es ihm mit größter Anstrengung gelang, ein paar schwache Worte zu flüstern.
Ich hörte ihn sagen:
Keinem ... keinem anderen Menschen ... nur –
Gerade in diesem kritischen Augenblick, als der Name schon auf seinen Lippen schwebte, verließ ihn seine Kraft. Er bemühte sich, das Wort zu bilden, aber er brachte keinen Ton mehr hervor.
Seine Verzweiflung machte einen furchtbaren Eindruck auf mich, und angstvoll suchte ich ihm zu Hilfe zu kommen, indem ich ihn fragte:
Ist der Brief für Ihren Anwalt bestimmt? Und als er kein Zeichen machte, fuhr ich hastig fort: Für Ihren Arzt? Für Ihre Frau? Für irgend jemanden hier im Hause?
Er sah mich noch einmal an, richtete dann seine Augen nach oben und stand einige Sekunden lang mit einer so ausdrucksvollen Gebärde hoffnungsreicher Erwartung da, daß ich vor Erstaunen keine Worte mehr finden konnte und einen Augenblick lang vergaß, daß ich mich in Gegenwart des Todes befand. Aber dies dauerte nur wenige Augenblicke. Während ich mich noch verwundert fragte, was wohl die plötzliche Veränderung im Gesichtsausdruck des Mannes bedeuten könne, stieß plötzlich das Kind, das seine Knie umklammert hielt, einen Schrei des Entsetzens aus und ließ seine Aermchen sinken. Ich sah ihn nach Atem ringend zusammensinken und dann vornüberfallen; ich sprang hinzu und fing ihn in meinen Armen auf, ehe er den Fußboden erreichte. Leider war dies der letzte Dienst, den ich ihm erweisen konnte. Als ich ihn behutsam auf die Diele niedergleiten ließ, hatte er bereits ausgeatmet, ich war allein mit einem zitternden kleinen Mädchen und einem Toten, der mir mit dem letzten Lebenshauch einen mir völlig unverständlichen Auftrag gegeben hatte. Ich wußte nichts weiter, als daß ich unter keinen Umständen den mir anvertrauten Brief an eine andere Person ausliefern durfte, als an die, für welche er ihn bestimmt hatte.
Aber wer war diese Person?
Zweites Kapitel.
Inzwischen war das Kind in die Halle hinausgelaufen und sprang mit ängstlichen Rufen: Papa! Papa! die Treppe hinauf.
Es mußte also doch jemand in diesem Hause sein, in dem ich geglaubt hatte, mich mit dem Mädchen und dem Toten ganz allein zu befinden. Ueberrascht eilte ich ihr nach in das erste Stockwerk, wo sie vor einer geschlossenen Tür stehen blieb. Eine seltsame Scheu schien die Kleine zurückzuhalten, denn in leisem Flüsterton sagte sie mir:
Hier drinnen ist Papa.
Wenn dies richtig war, so befand er sich jedenfalls nicht allein. Gelächter, lautes hastiges Sprechen und Gläserklingen ließ sich deutlich durch die Tür hindurch vernehmen. Der Gegensatz zwischen diesem lustigen Gelage und dem feierlichen Augenblick, den ich unmittelbar vorher durchlebt hatte, fiel mir schwer aufs Herz; ich zögerte, das Zimmer zu betreten, und sah mich um, ob ich nicht irgend jemand vom Dienstpersonal bemerken könnte; denn soviel war mir jetzt klar, daß in diesem reichen Hause unbedingt Diener anwesend sein mußten. Plötzlich aber rief das Kind, das sich angsterfüllt an meinem Rock festhielt:
Papa ist doch wohl nicht hier. Papa mag keine Karten leiden. Aber Onkel George spielt gern. Bitte, bitte – wir wollen Papa suchen!
Sie zog mich nach einer anderen Tür hin; ich öffnete sie, aber das Licht war ausgedreht, und der Papa der Kleinen war nicht da.
Vielleicht ist er bei Onkel Alph! stammelte sie weinerlich. Damit sprang sie eine zweite Treppe hinauf, indem sie sich mehreremal umsah, ob ich ihr auch folgte.
Was sollte ich anders machen? Ich mußte mit ihr gehen, bis ich irgendeiner Menschenseele begegnete. Ich eilte also ebenfalls die Treppe hinauf; doch als ich oben ankam, war sie bereits in ein Zimmer eingetreten.
O, Onkel Alph! hörte ich sie weinend rufen, Großpapa liegt unten auf dem Fußboden. Ich kann Papa nicht finden. Ich hab' solche Angst!
Und schluchzend lief sie auf den jungen Mann zu, der von seinem Stuhl am Schreibtisch aufstand. Merkwürdigerweise schienen ihre Worte gar keinen Eindruck auf ihn zu machen, denn er starrte sie wie geistesabwesend an. Dieses Verhalten war natürlich sehr auffallend, und ich musterte dabei die Erscheinung des jungen Mannes auf das genaueste. Er war schön und auf den ersten Blick als Lebemann zu erkennen. In seiner ganzen Erscheinung lag etwas Anziehendes, aber man fühlte dies mehr, als daß man vermocht hätte, sich im einzelnen darüber Rechenschaft zu geben. Freunde, die öfter mit ihm die Avenue entlang geschlendert waren, erzählten mir später, daß er stets aufzufallen pflegte. In seinen Zügen, in der Haltung, in den Bewegungen von Kopf und Schultern läge etwas, was einen veranlasse, sich den Mann nicht nur anzusehen, sondern sich auch nach ihm umzusehen. In diesem Augenblick fiel mir allerdings weniger seine stattliche Erscheinung auf, als der unruhige, fieberhaft erregte Ausdruck seiner Züge.
Bei unserem Eintritt war er beschäftigt gewesen, einen Brief zu schreiben, den er, als das Kind ihn so ängstlich anrief, zerknüllte und in den Papierkorb warf. Mir fiel auf, daß er dies mit einer gewissen Hast tat, und ich fragte mich unwillkürlich, was wohl in dem von ihm vernichteten Briefe stehen möchte.
Inzwischen war er anscheinend bemüht, sich zusammenzunehmen und zu begreifen, was die Kleine von ihm wolle. Mich hatte er offenbar noch gar nicht bemerkt, obwohl ich in der weitgeöffneten Tür stand. Ich hielt es daher für angebracht, mich ihm selber vorzustellen, und sagte:
Ich bitte um Verzeihung – mein Name ist Arthur Cleveland, von der Anwaltfirma Robinson und Cleveland. Ich kam an Ihrem Hause vorbei und wurde von der Kleinen hier hereingerufen, um ihrem Großvater Hilfe zu leisten, den ich leider in sehr bedenklichem Zustand in seinem Arbeitszimmer fand. Wenn er Ihr Vater ist, so gestatten Sie mir, Ihnen zu seinem plötzlichen Verscheiden mein Beileid auszusprechen. Er starb vor wenigen Minuten in meinen Armen, und da ich Zeuge seiner letzten Augenblicke war, so konnte ich das Haus nicht verlassen, ohne seinen Angehörigen den Grund meiner Anwesenheit mitzuteilen.
Tot! Vater?! rief der junge Mann aus.
Kein Schmerz, kaum ein leichtes Erstaunen lag in diesem kurzen Ausruf, aber etwas anderes lag darin, was mich mit Entsetzen erfüllte. Welch seltsamer Ausdruck in seinem Ton! Welch eigentümliches Feuer sprühte aus seinen Augen! Doch dies war in einem Augenblick vorüber. Er nahm das Kind auf seine Arme, verbarg sein Antlitz hinter den blonden Mädchenlocken und stürzte nach der Tür. Von mir nahm er fast keine Notiz. Er schien gar nicht auf meine Worte gehört zu haben, denn er fragte:
Wo ist er?
Das Kind antwortete ihm:
In der Hinterstube, Onkel Alph. Aber ich will nicht mitkommen. Ich hab' solche Angst! Bitte laß mich los; ich will Hope suchen.
Hastig setzte er sie nieder, und das Kind sprang davon. Dann erst schien er sich meiner Gegenwart bewußt zu werden und fragte mit verwunderter Miene:
Sie wurden von der Straße hereingerufen? Das verstehe ich nicht! Wo waren denn meine Brüder? Sie waren doch nahe genug, um ihm Beistand leisten zu können. Warum also einen Fremden ins Haus rufen?
Auf diese Frage konnte ich keine Antwort geben; ich schwieg also. Doch schien er mein Schweigen gar nicht zu bemerken, denn nach kurzem Besinnen sagte er:
Wir wollen hinuntergehen.
Ich öffnete die Tür, die die Kleine hinter sich zugeschlagen hatte, und ging dem jungen Mann voran auf die Treppe zu. Während unseres kurzen Gespräches hatte ich mehrmals unbestimmte Geräusche wie von Stimmen gehört; ich erwartete daher, das ganze Haus in Aufruhr zu finden, denn der Tod des Hausherrn mußte es doch alarmieren. Aber die Spieler im ersten Stock saßen noch bei ihren Karten. Mein Begleiter blieb stehen und tat ein paar scharfe Schläge gegen die Tür, hinter welcher ein so unziemlicher Lärm laut wurde.
Vater ist krank! rief er mit vor Aufregung heiserer Stimme. Eine Antwort wartete er nicht ab, sondern eilte an mir vorüber und die Treppe hinab; ihm nach stürzten sechs oder sieben halbwegs ernüchterte junge Leute.
Einer von diesen fiel mir besonders auf; nach dem Aussehen zu schließen, mußte er ein Bruder des von der Kleinen als »Onkel Alph« angeredeten jungen Mannes sein. Er hatte dieselbe imponierende Gestalt, merkwürdigerweise aber auch die gleiche, fast geistesabwesende Miene. Doch ich hatte nicht lange Zeit, über diese physiognomische Beobachtung nachzudenken. Nachdem so unbegreiflich lange alles still gewesen war, hatte sich jetzt plötzlich die alarmierende Nachricht wie ein Lauffeuer in den unteren Räumen des Hauses verbreitet, und wir fanden ein Halbdutzend Dienstboten in und vor dem kleinen Zimmer, in welchem der Herr des Hauses auf dem Fußboden ausgestreckt lag. Einige von ihnen rangen die Hände, andere weinten, und noch andere starrten, regungslos vor Entsetzen, auf das bleiche Antlitz, das sie kurz vorher noch von den Farben der Gesundheit belebt gesehen hatten.
Als die Dienstboten uns bemerkten, zogen sie sich natürlich in die Halle zurück, und auf einmal befand ich mich zwischen der von ihnen gebildeten Gruppe und den drei oder vier jungen Gästen, die nicht mit den Brüdern in das Zimmer gegangen waren. Ich bemerkte unter ihnen einen, dessen Gesichtszüge mir nicht ganz unbekannt waren, und von diesem erhielt ich die erste Auskunft über den Mann, dessen Todeskampf ich mit angesehen und von dem ich den seltsamen Auftrag empfangen hatte, der mich zwang, in dem fremden Hause in der peinlichen Lage eines Eindringlings zu verbleiben.
Der Tote war der allgemein bekannte Börsenkönig und Eisenbahnfürst Archibald Gillespie, dessen Name in jedermanns Munde war, seitdem er mit einem einzigen Geschäft in kaum zwei Monaten zwei Millionen Dollars verdient hatte.
Während ich mich noch mit dem jungen Mann unterhielt, kam einer von den Herren, die mit den Söhnen des Verstorbenen in das Zimmer gegangen waren, mit sehr bleichem Gesicht wieder heraus. Er war Arzt, doch allem Anschein nach nicht der Hausarzt.
Will einer von euch den Doktor Bennett holen? fragte er. Er muß sofort und auf alle Fälle kommen. Herr Gillespie darf nicht angerührt werden, bevor er da ist.
Doktor Bennett war offenbar der Hausarzt.
Warum darf er nicht angerührt werden? fragte einer der Herren, die neben mir standen. Ist irgend was nicht in Ordnung? Herr Gillespie war vor ungefähr einem Monat schwer krank. Wahrscheinlich ist er zu früh wieder aufgestanden!
Aber der junge Arzt antwortete nicht, sondern ging in das kleine Zimmer zurück. Wir alle hätten ihn gerne noch näher befragt, aber nur wenige von uns murmelten ein paar Worte, worauf kein Bescheid erfolgte. Einer von den jungen Herren entfernte sich eilig, um dem von seinem Freund soeben ausgesprochenen Wunsche Folge zu leisten.
Lebt Frau Gillespie noch? fragte ich nach einigem Zögern meinen Bekannten.
Was für 'ne Frage! lautete die von einem verwunderten Blick begleitete Antwort. Sie ist ja schon volle fünfzehn Jahre tot!
Für seine Frau war also der Brief nicht bestimmt.
Plötzlich bemerkte ich, daß ein Auge mich scharf fixierte. Es war einer von den Dienern, die auf einen Klumpen zusammengedrängt auf der anderen Seite der Halle in einer offenen Tür standen, welche, wie es mir vorkam, in einen großen Speisesaal führte. Als der Mann sah, daß er meine Aufmerksamkeit erregt hatte, machte er mir ein kaum bemerkbares Zeichen. Ich glaubte seinem Wink folgen zu müssen, denn er war ein grauhaariger alter Mann. Kaum war ich bei ihm, so flüsterte er mir mit einem vertraulichen Lächeln zu:
Sie scheinen der einzige hier zu sein, der noch bei Besinnung ist. Lassen Sie sie nichts machen, bis der junge Herr Leighton Gillespie nach Hause kommt. Der ist der einzige in dieser Familie, der noch religiöse Grundsätze hat!
Ist er der Vater des kleinen Mädchens? fragte ich.
Der Mann nickte.
Nicht nur das, sondern auch ein guter Mann! setzte er mit Nachdruck hinzu. Ein sehr guter Mann!
War dies die aufrichtige Meinung des alten Dieners oder Spott? Ich hatte gehört, daß alle drei jungen Gillespies ihrem Vater unendliche Sorge bereitet hätten.
Ein tiefes Schweigen der Trauer hatte sich inzwischen in dem prachtvollen Hause verbreitet. In einem seltsamen Widerstreit der Gefühle – denn ich fühlte mich als Eindringling und zugleich als eine wichtige Person in dem Drama, das ich soeben miterlebt hatte – zog ich mich in einen möglichst stillen Winkel zurück und wartete wie die anderen auf die Ankunft des Hausarztes.
Endlich ertönte die Hausglocke. So gespannt war unsere Erwartung, daß wir alle sofort in Bewegung kamen, und ein paar von uns eilten auf die Haustür zu. Diese wurde jedoch bereits von dem grauhaarigen Diener mit jener mechanischen Pünktlichkeit geöffnet, die eine langjährige Gewohnheit zur zweiten Natur macht. In der ruhigen Verbeugung des gutgezogenen Dieners lag aber doch etwas, woraus wir sofort schließen konnten: der sehnlich Erwartete ist endlich da!
Ich hatte den Doktor Bennett mehr als einmal gesehen, niemals aber in solcher Aufregung wie in diesem Augenblick. Mochte diese Aufregung ihren Grund in der Plötzlichkeit der Mitteilung oder in einer anderen Ursache haben – genug, der alte erfahrene Arzt befand sich in ebensolcher Erregung wie wir selbst. Der junge Arzt erwartete ihn bereits auf der Schwelle der Hinterstube und zeigte ihm durch eine Handbewegung den Ort an, wo die Leiche lag. Ich bemerkte an Bennett ein seltsames Zögern, das in eigentümlichem Widerspruch stand zu der Hast, womit er der Handbewegung seines jungen Kollegen Folge leistete. Ich würde dies unter anderen Umständen Wohl kaum beobachtet haben, und ich bin sicher, daß keinem von den übrigen Anwesenden in dem Gehaben des Hausarztes auch nur das Geringste auffiel; aber mir war jeder noch so kleine Umstand merkwürdig, von dem ich annehmen konnte, daß er mir den Schlüssel zur Lösung des Rätsels bieten würde, in welches ich mich auf so sonderbare Art tief verstrickt sah.
Doktor Bennett verweilte einige Minuten bei dem Toten; die Tür der Hinterstube hatte der junge Arzt verschlossen, so daß sich außer den beiden Kollegen nur die jungen Gillespies im Sterbezimmer befanden. Dann trat der alte Arzt zu uns heraus. Augenblicklich erkannte ich an seinem Gesichtsausdruck, daß unsere oder vielmehr die von dem jungen Doktor ausgesprochenen Befürchtungen nicht unbegründet gewesen waren. Indessen war Bennett augenscheinlich bemüht, keinen unnötigen Alarm zu erregen und sagte in kühlem, berufsmäßigem Ton:
Ein trauriger Fall, meine Herren! Herr Gillespie hat eine zu große Dosis Chloral genommen. Wir müssen ihn liegen lassen, wo er ist, bis der Coroner In Amerika und England der Beamte, der bei verdächtigen Todesfällen die sofortige Untersuchung zu leiten hat. kommt.
Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, so hörte man aus dem Speisesaal einen schweren, seufzenden Atemzug und das Klirren von zerbrechendem Glas. Der grauhaarige alte Diener hatte ein Weinglas fallen lassen, das er gerade von dem Kaminsims fortzuräumen im Begriff war. Im Nu war Bennett an seiner Seite und fragte:
Was ist das?
Der Diener beugte sich nieder, um die Scherben aufzuheben und antwortete:
Nur das Glas, woraus Herr Gillespie trank. Er forderte vor einer halben Stunde ein Glas Wein. Ihre Worte haben mich erschreckt, Herr Doktor!
Er sah allerdings durchaus nicht erschrocken aus, aber alten Dienern, die lange in großen Häusern gewesen sind, ist ja freilich eine seltsame Unbeweglichkeit der Gesichtszüge eigentümlich.
Ich will diese Scherben an mich nehmen, sagte der Arzt, indem er sich neben dem Diener niederbeugte.
Der Mann zog sich zurück, und der Arzt las die Glasscherben zusammen. Sie waren alle trocken. Offenbar war das Glas ausgewischt worden.
Als Bennett den Speisesaal wieder verließ, musterte er mit einem scharfen aber nicht unfreundlichen Blick die Gruppe der jungen Leute, die sich in der offenen Tür drängten, und fragte:
Wer von Ihnen war bei Herrn Gillespies letzten Augenblicken zugegen?
Ich verbeugte mich. Ich befürchtete, daß er mich ausfragen würde, sah aber keine Möglichkeit, mich seinen Fragen zu entziehen. Hätte doch der alte Gillespie das eine Wort noch hervorbringen können, das mich von aller Verantwortlichkeit in dieser Angelegenheit würde entbunden haben!
Sie sind der Herr, der von Herrn Gillespies Enkelin ins Haus gerufen wurde? fragte der Doktor.
Ja, antwortete ich. Hierauf erzählte ich meine Erlebnisse einfach und sachlich, wie die Umstände es erforderten. Nur von dem Brief, der mir zur Aushändigung an eine unbekannte Person anvertraut worden war, von diesem Brief sagte ich nichts. Wie hätte ich auch anders handeln können? Auf Herrn Gillespies Gesicht war nicht das geringste Zeichen der Bejahung zu lesen gewesen, als ich ihn fragte, ob der Brief für seinen Arzt bestimmt sei.
Mein Bericht schien den Arzt in der Ansicht zu bestärken, die er sich durch die Untersuchung der Leiche bereits gebildet haben mußte. Er führte die vor dem Kamin des Speisesaals aufgelesenen Glasstücke an seine Nase und beroch sie lange und sorgfältig. Die beiden jungen Gillespies sahen ihm immer erstaunter zu. Als Doktor Bennett die Scherben wieder hinlegte, konnten wir alle kaum unsere Neugierde zurückdrängen.
Sie haben uns irgend etwas Furchtbares mitzuteilen, murmelte der ältere Sohn.
Der Doktor zauderte mit der Antwort; er ließ den Blick vom einen zu dem anderen der beiden hübschen Gesichter wandern und versetzte endlich:
Ihr Bruder ist nicht hier. Wissen Sie vielleicht, ob er bald nach Hause kommen wird?
Wo ist mein Bruder Leighton? fragte Alfred, zu den Dienstboten gewandt. Ich glaubte, er wollte heute abend zu Hause bleiben.
Der alte Diener trat in ehrerbietiger Haltung näher und sagte:
Herr Leighton ging vor ungefähr einer Stunde aus. Er und Herr Gillespie hatten ein kurzes Gespräch in der Hinterstube, gleich darauf zog er seinen Ueberzieher an, setzte den Hut auf und ging fort.
Haben Sie bei dieser Gelegenheit Ihren Herrn gesehen? fragte der Arzt.
Nein, Herr Doktor, ich hörte nur seine Stimme.
Und kam die Stimme Ihnen wie gewöhnlich vor?
Der alte Diener schien ungern antworten zu wollen, da er aber den befehlenden Blick des Arztes auf seinen niedergeschlagenen Augen haften fühlte, so gab er zögernd zu:
Die Stimme war nicht ruhig – wenn Sie mit Ihrer Frage darauf hinaus wollen. Herr Gillespie schien ärgerlich oder sehr aufgebracht zu sein. Er sprach sehr laut.
Wo waren Sie? forschte der Arzt weiter.
Im Speisesaal, Herr Doktor. Ich räumte den Eßtisch ab.
Hörten Sie, was Ihr Herr sagte?
Nein, Herr Doktor. Es war irgend was von Religion; von zu viel Religion.
Mein Bruder besucht ja viele religiöse Versammlungen, und das gefiel meinem Vater nicht, erklärte Alfred leise.
Der Doktor nickte, verwandte aber kein Auge vom Gesicht des Alten und fragte weiter:
Fand dieses Gespräch statt, bevor Herr Gillespie das Glas Wein trank, das er, wie Sie vorhin sagten, verlangt hatte?
Jawohl, Herr Doktor; einen Augenblick vorher. Herr Leighton bestellte es selber. Er sagte, sein Vater sehe angegriffen aus.
So – und wie kommt es denn, daß das Glas nachher auf dem Kaminsims im Eßzimmer stand?
Das weiß ich nicht, Herr Doktor. Vielleicht hat Herr Gillespie es selbst dorthin gestellt. Er konnte es niemals leiden, wenn auf seinem Schreibtisch etwas stand, was nicht dahingehörte.
Ich bemerkte, daß nach dieser Erklärung der ältere Bruder den Mund öffnete; aber er sagte nichts. Es war jetzt keine Spur mehr an ihm zu bemerken, daß er gezecht hatte.
Zeigen Sie mir die Flasche, woraus Sie den Wein eingeschenkt haben!
Der Diener – wie ich später erfuhr, hieß er Hatson – ging dem Doktor voraus in das Speisezimmer zu dem großen Anrichteschrank, der die ganze Hälfte der einen Wand einnahm. Von meinem Platz in der Halle konnte ich sehen, wie er auf eine Flasche deutete, allem Anschein nach eine Sherryflasche. Plötzlich fuhr er zusammen und rief so laut, daß ich seine Worte hören konnte:
Das ist nicht die richtige! Die Flasche, woraus ich den Wein für Herrn Gillespie einschenkte, war halb leer; diese hier ist ja aber ganz voll!
Wieder sah ich, wie des älteren Bruders Lippen sich bewegten; aber wieder schloß er den Mund, ohne zu sprechen.
Es wäre mir lieb, wenn diese Flasche gefunden würde, sagte der Arzt. Aber für den Augenblick braucht niemand danach zu suchen. Es ist besser, wir enthalten uns aller weiteren Schritte, bis Herr Leighton wieder da ist. George und Alfred – wenn ich bitten darf, lassen Sie mich ein paar Minuten mit Ihrem Vater allein! Und sorgen Sie dafür, daß niemand in den Speisesaal geht. Ich möchte nicht nötig haben, mich hinterher bei dem Coroner entschuldigen zu müssen. Ihr Vater ist keines natürlichen Todes gestorben!
Wir waren schon durch das ernste Benehmen des jungen Doktors auf diese Mitteilung vorbereitet gewesen. Trotzdem schien es mir auffallend, einen wie geringen äußerlichen Eindruck sie auf die beiden machte. Sie sahen sich nicht an, sie wechselten in diesem ernsten Augenblicke kein Wort des Trostes, der Aufmunterung untereinander. Standen sie nicht gut miteinander?
Ich muß jetzt telephonieren, fuhr Bennett fort. Sie müssen verzeihen, wenn ich dadurch scheinbar die einem Toten schuldige Ehrfurcht verletze. Die Umstände erfordern es.
Er warf noch einen schnellen Blick in den Speisesaal, um sich der Ausführung seiner Anordnungen zu vergewissern, und ging dann in die sogenannte Hinterstube, deren Tür er hinter sich verschloß.
Einen Augenblick darauf hörten wir seine Stimme am Fernsprecher.
Ich verstehe Doktor Bennetts sonderbares Benehmen nicht, hörte ich eine Stimme neben mir flüstern. Es war George, der diese Worte in leisem Tone zu seinem Bruder sprach. Dieser aber antwortete nicht, sondern sah sich mit merkwürdigem Ausdruck nach der zum ersten Stocke führenden Treppe um, als ob er dort jemand zu sehen erwartete.
Vater nahm regelmäßig Chloral, fuhr George flüsternd fort. Ich war aber immer des Glaubens, daß er damit bis zum Schlafengehen wartete. Ich habe nie gehört, daß er das Mittel hier unten eingenommen hätte.
Diesmal antwortete Alfred:
Heute abend hat er eine Ausnahme gemacht. Als ich um halb neun nach deinem Zimmer ging, begegnete ich Claire, die mit einem Fläschchen in der Hand aus Vaters Schlafstube kam. Sie war hinaufgeschickt worden, um das Chloral zu holen und brachte es ihm.
George sah seinen Bruder mit einem mißtrauischen Blick an und fragte:
Sagte sie das?
Ja.
Das arme Mädchen! Sie wird ihren Großpapa sehr vermissen. Ob sie wohl schon alles weiß?
Ich fühlte, daß ich nicht das Recht hatte, diesem Gespräch zuzuhören. Aber ich stand immer noch auf demselben Platz, wo ich mit dem Doktor gesprochen hatte, und ich wagte nicht eher fortzugehen, als bis ich von einer dazu befugten Person Erlaubnis erhalten. In dem Augenblick, wo ich mich wenigstens von den beiden Brüdern entfernen wollte, kam Bennett wieder aus der Hinterstube heraus und sagte zu mir:
Es wird Ihnen wohl sehr schlecht passen, daß Sie hier warten müssen. Aber ich muß Sie bitten, noch eine kleine Weile länger hier zu bleiben. Wollen Sie nicht im Salon Platz nehmen?
Ich dankte ihm für seine Freundlichkeit, blieb aber auf meinem Platze stehen, indem ich einen Blick auf die beiden jungen Gillespie warf.
Mit einer Feinfühligkeit, die mich überraschte, verstand George sofort meinen Wink. Er ging nach links, hob einen schweren Plüschvorhang zur Seite, so daß ein reich ausgestatteter Salon sichtbar wurde, und bat mich mit einer Verbeugung, einzutreten und Platz zu nehmen. Kaum aber hatte ich einen Schritt auf den Vorhang zu getan, als die Haustür sich öffnete, und ein Herr eintrat, in welchem ich sofort den sehnlichst erwarteten dritten Bruder vermutete.
Auch er war schön, sogar sehr schön, doch ähnelte er seinen Brüdern in keiner Weise. Anscheinend hatte er mehr Charakter und weniger – nun, ich kann den Eindruck, den er in jenem Augenblick auf mich machte, nicht recht beschreiben. Genug, ich fühlte auf den ersten Blick, daß er keine Alltagsnatur war.
Er sah niedergeschlagen und beinahe todmüde aus; doch raffte er sich zusammen, als er einen Unbekannten bemerkte, und warf sodann einen fragenden Blick auf den Doktor und die Dienstboten, die in einer dichten Gruppe im Hintergrund der Halle standen.
Augenscheinlich hielt er mich für einen von den Zechgenossen seiner Brüder.
Was ist denn los? rief er. – Es kam mir vor, als ob er ärgerlich wäre über die Anwesenheit der vielen Menschen, und ich hoffte im stillen, dies als ein gutes Zeichen für ihn auslegen zu dürfen; denn der Aerger ließ sich so erklären, daß er von den entsetzlichen Vorgängen keine Ahnung hatte. Was ist denn los, George? Was gibt's, Alph?
Das Schlimmste! antworteten beide gleichzeitig.
Vater ist tot! sagte George in dumpfem Ton.
Er hat zuviel Chloral genommen! fügte Alfred hinzu.
Leighton Gillespie stand einen Augenblick wie gebannt da. Dann warf er seinen Hut weit von sich und eilte auf die Hinterstube zu. Aber auf der Schwelle des Sterbezimmers stand Doktor Bennett in einer Haltung, die den jungen Mann zwang, stehen zu bleiben.
Warten Sie einen Augenblick! rief der alte Herr. Meine erste Meinung ist irrig gewesen. Ihr Vater ist nicht an einer zu großen Dosis Chloral gestorben, wie ich zuerst annahm, sondern an einer unbedingt tödlich wirkenden Menge Blausäure. Der Geruch, der von seinen Lippen strömt, beweist das. Und nun, Leighton, können Sie eintreten.
Drittes Kapitel.
Es war eine niederschmetternde Mitteilung; auf allen Gesichtern prägte sich deutliches Entsetzen aus. Und doch waren die drei Söhne augenscheinlich nicht überrascht. Der Börsenfürst mußte doch wohl geheime Sorgen gehabt haben, da sein plötzliches Ende den ihm am nächsten Stehenden als etwas beinahe Natürliches erschien.
Meine Lage begann mir als höchst peinlich zu erscheinen, und der verschlossene Brief in meiner Tasche lastete mir bleischwer auf der Brust.
Doktor Bennett und die drei Brüder waren in das Totenzimmer eingetreten, und hier sagte Leighton in gepreßtem Tone, dem er vergebens einen natürlichen Klang zu verleihen suchte:
Kann sich der Doktor nicht vielleicht irren? Da steht ja das Chloralfläschchen auf dem Kaminsims. Das ist ungewöhnlich – auf diesem Platz ist es sonst nicht zu finden. Da es aber hier ist – können wir daraus nicht schließen, daß Vater das Bedürfnis fühlte, dies Beruhigungsmittel zu sich zu nehmen? Blausäure kann man nur durch Vermittelung eines Arztes erhalten, und ich bin gewiß, daß Sie, Herr Doktor Bennett, ihm niemals ein so gefährliches Gift verschrieben haben!
Nein – denn die Anwendung desselben bei einem Leiden wie dem Ihres Vaters ist gänzlich ausgeschlossen. Aber Sie werden sehen, Leighton, daß er daran gestorben ist; alle Symptome sprechen dafür, und wir haben uns nunmehr bloß darüber klar zu werden, ob er es im Chloral zu sich nahm oder in dem zuletzt getrunkenen Glas Wein, oder auf sonst eine, uns bis jetzt noch unbekannte Weise. Es tut mir leid, daß ich so unzweideutig sprechen muß, aber in meinem Beruf kenne ich kein Vertuschen. Außerdem würde der Coroner keine solche Rücksicht bezeigen, selbst wenn ich aus Zartgefühl schweigen wollte. Die Tatsache liegt klar zutage.
Leightons Antwort konnte ich nicht hören, aber als sie alle wieder herauskamen, sah ich, daß er nicht nur des Doktors Ansicht als richtig anerkannt, sondern inzwischen auch erfahren hatte, in welcher Weise ich an dem Ereignis beteiligt war. Dies war deutlich an der Herzlichkeit seines Grußes zu erkennen, auch ging es aus den Fragen hervor, mit denen er sich bei mir nach seinem Kinde erkundigte.
Hierbei hatte ich Gelegenheit, mir sein Gesicht genauer anzusehen. Es war das melancholischste, das ich je in meinem Leben gesehen hatte, und besonders fiel mir dabei auf, daß diese Traurigkeit anscheinend immer auf seinem Antlitz lag und nicht erst durch den letzten Schicksalsschlag hervorgerufen war.
Es ist mir ein Rätsel, bemerkte Leighton in höflichem Tone zu mir, warum mein Vater in seinen letzten Schmerzen jemanden von der Straße hereinrufen ließ, da doch seine Söhne zu Hause waren. Indessen muß er es wohl für notwendig erachtet haben, und da sein Ruf befolgt wurde, so freue ich mich, daß der Zufall ihm und uns in Ihrer Person einen so menschenfreundlichen und dienstwilligen Helfer zugeführt hat.
Ich antwortete ihm nur mit einer Verbeugung; in der Tat hatte ich auf seine Worte kaum geachtet. Mich beschäftigte immer wieder der Gedanke an den Brief. Sollte ich ihn Leighton übergeben? Ein gewisser Instinkt hielt mich davon zurück – oder mehr noch vielleicht die Vorsicht, die mir in meinem Beruf als Anwalt zur zweiten Natur geworden war und zum Glück als Gegengewicht gegen den ersten Antrieb wirkte. Nach allem, was ich bis jetzt gesehen hatte, konnte ich nicht mit Sicherheit annehmen, daß der alte Gillespie den Brief für einen seiner Söhne bestimmt hatte.
Wollen Sie uns die Freundlichkeit erweisen, bis zur Ankunft des Coroners hier zu warten? fuhr Leighton Gillespie fort. Er hat telephoniert, er werde sofort hier sein.
Ich werde warten, antwortete ich. Er machte eine einladende Handbewegung, und ich betrat jetzt den Salon.
Es verstrich eine viertel – eine halbe Stunde; endlich ließ sich wiederum die Hausklingel vernehmen. Ich hörte verworrenes Stimmengeräusch und Hinundherlaufen und konnte daraus entnehmen, daß der Erwartete endlich eingetroffen war. Indessen mußte ich mich noch eine gute Weile in Geduld fassen, bis der Coroner sich bei mir im Salon einfand. Endlich hörte ich einen Schritt; ich blickte auf und gewahrte einen hageren alten Herrn, der sehr ernst auf mich zukam und sich dicht an meine Seite setzte, so daß er leise mit mir sprechen konnte und nicht zu befürchten brauchte, daß unser Gespräch belauscht würde.
Sie sind Herr Cleveland, begann er. Ich habe von Ihrer Firma gehört und bin mit Ihrem Partner, Herrn Robinson, mehr als einmal zusammengewesen. Kannten Sie Herrn Gillespie oder seine Angehörigen bereits vor dem heutigen Abend?
Nein, ich kannte Herrn Gillespie nur vom Hörensagen.
Es war also reiner Zufall, daß Sie seinen letzten Augenblicken beiwohnten?
Reiner Zufall – wenn wir nicht etwa ein Wirken der Vorsehung annehmen wollen.
Er sah mich mit einem scharf musternden Blick an und fuhr fort:
Erzählen Sie den Hergang!
Hier geriet ich in ein Dilemma. Verlangte die Pflicht von mir, einen Umstand zu enthüllen, den ich bisher sogar vor den Söhnen des Verstorbenen geheimzuhalten mich verpflichtet gefühlt? Diese heikle Frage vermochte ich mir nicht so im Handumdrehen zu beantworten; ich beschloß daher, mich noch ablehnend zu verhalten, und beschränkte mich darauf, meine bereits einmal vorgetragene Darstellung von Herrn Gillespies Ende einfach zu wiederholen. Als ich damit fertig war, fragte der Coroner, ob das kleine Mädchen in dem Augenblick, wo ihr Großvater den letzten Atemzug getan, noch im Zimmer gewesen sei.
Sie hielt seine Knie umklammert, solange er noch aufrecht stand, antwortete ich. Im Augenblick aber wo er hinsank, erschrak sie und lief hinaus.
Sprach er mit ihr? fuhr der Coroner fort.
Soviel ich gehört habe – nein.
Sagte er überhaupt irgend etwas?
Er stammelte ein paar unartikulierte Töne – Namen nannte er nicht.
Verlangte er nicht nach seinen Söhnen?
Nein.
Nach keinem von den dreien?
Nein.
Wie verbreitete sich die Todesnachricht im Hause?
Ich ging mit dem Kinde nach oben und sagte den jungen Herren Bescheid.
Coroner Frisbie rieb sich nachdenklich das Kinn; sein scharfes Auge wandte sich keine Sekunde von mir.
Lag auf dem Schreibtisch oder auf dem Fußboden in dem Augenblicke, als Sie das Zimmer betraten, ein leeres Fläschchen oder ein Stück Papier? frug er weiter.
Ein Papier? wiederholte ich. Was für ein Papier?
Nun, Papier, wie es Apotheker und Aerzte verwenden, um Arzneiflaschen einzuwickeln. Die Blausäure, die Herr Gillespie offenbar eingenommen hat, muß in flüssiger Form gekauft worden sein. Wir müssen also annehmen, daß zum mindesten das Fläschchen und vielleicht sogar das Einwickelpapier irgendwo im Zimmer herumlagen. Das heißt, wenn er dies Gift absichtlich zu sich genommen hat.
Ich erinnerte mich sehr gut, wie das von mir auf Geheiß des alten Herrn in den Briefumschlag gesteckte Papier ausgesehen hatte. Es war nicht von der Sorte, die zum Einwickeln von Arzneimitteln verwandt wird, und ich fühlte mich wesentlich erleichtert, antworten zu können:
Ein derartiges Papier habe ich nicht gesehen.
Wo ist das kleine Mädchen? fragte er weiter. Wenn die Kleine aussagte, ihr Großvater habe mir ein Stück Papier gegeben, so wollte ich dies einräumen und den Umschlag ausliefern. Hatte sie aber den Umstand vergessen, oder in ihrer Angst vielleicht gar nichts davon bemerkt, so wollte ich noch etwas länger darüber schweigen, in der Hoffnung, daß sich mir ein gangbarer Ausweg aus der Schwierigkeit zeigen würde. Es war mir daher ganz lieb, daß der Coroner nach dem kleinen Mädchen fragte.
Ich nehme an, daß Sie nicht gerade gern noch länger hier bleiben würden, fuhr er fort. Wenn Sie mir Ihre Adresse angeben und mir zusichern wollen, sich auf meinen Wunsch sofort zur Verfügung zu halten, so kann ich Sie für heute abend entlassen.
Ich überreichte ihm meine Karte, denn ich sah, daß ich keinen Vorwand hatte, mich noch länger im Sterbehause aufzuhalten, obwohl ich es, in Rücksicht auf meinen geheimen Auftrag, gern getan hätte. Ich ging daher auf die Tür zu. In diesem Augenblick kam der Doktor Bennett eilig in den Salon hinein und rief:
Ich habe was gefunden! ...
Dann schwieg er aber plötzlich, indem er einen schnellen Blick auf mich warf. Er schien im Zweifel zu sein, ob es angebracht wäre, in meiner Gegenwart von seinem Funde zu sprechen. Doch der Coroner schien derartige Bedenken nicht zu haben; er ging eilends auf den alten Hausarzt zu und rief:
Sie haben das Fläschchen gefunden? Oder etwa nur das Papier, worin es eingewickelt gewesen ist?
Bennett zog ihn auf die Seite, und ich sah, wie er dem Coroner einen Gegenstand übergab, der wie ein kleiner Stöpsel aussah.
Haben Sie das in Herrn Gillespies Schreibstube gefunden? fragte der Coroner. Ich glaubte in jenem Zimmer jedes Eckchen und Fleckchen durchsucht zu haben!
Bennett antwortete im leisesten Flüstertöne; trotzdem verstand ich mit meinem ungewöhnlich scharfen Gehör jedes Wort.
Er lag im Speisezimmer auf dem Fußboden, sagte er, unter dem Rand des Kaminteppichs. Ein sehr verdächtiger Umstand, meinen Sie nicht auch? Der alte Gillespie kann ihn auf keinen Fall dorthin geworfen haben. Also irgendein anderer – wer? weiß ich nicht – und! ich sage vorläufig auch nichts – mir wär's sehr unangenehm, wenn ich die Polizei im Hause haben müßte.
Die beiden Herren tauschten einen eigentümlichen Blick miteinander aus, wie ich in dem gegenüberhängenden Spiegel sah. Ich ließ mir aber nicht merken, daß ich es gesehen; ich war mir nur zu wohl bewußt, in welcher delikaten Lage ich mich in diesem Hause befand. In der nächsten Minute gingen wir zusammen hinaus. Im Augenblick, als wir die Schwelle überschritten hatten, hielt der Coroner uns noch einmal zurück und sagte ernst:
Ich bitte um Schweigen! Wir wollen heute abend die jungen Gillespies nicht mehr aufregen, als leider ohnehin nötig ist.
Er wurde durch einen lauten Ruf unterbrochen.
Wo ist Fräulein Meredith? Hat jemand Fräulein Meredith gesehen? Ich kann sie in keinem von den oberen Zimmern finden!
Und eine andere Stimme rief leidenschaftlich:
Hope, Hope! Wo bist du, Hope?
Durch das ganze Haus eilten Männer und Frauen von einem Zimmer zum anderen, und ich hörte nicht nur »Hope Meredith« rufen, sondern auch »Claire«. Dies mußte wohl der Name des kleinen Mädchens sein.
Ist denn auch das Kind nicht zu finden? fragte ich unruhig den Coroner, der noch wartend unten in der Halle stand.
Offenbar. Wer ist Fräulein Meredith?
Der alte Diener, Hatson, nahm das Wort und sagte:
Sie ist eine Cousine der jungen Herren. Herr Gillespie hielt große Stücke auf sie, und sie lebt hier wie die Tochter des Hauses. Man wird sie wohl in einem der Zimmer oben finden.
Darin täuschte der Mann sich aber. Allmählich kamen alle Dienstboten wieder nach der Halle herunter, wo sie sich flüsternd und mit ängstlichen Gesichtern in eine Ecke zusammendrängten. Nach ihnen kam George, ärgerlich dreinschauend und kopfschüttelnd, langsam die Treppen herunter. Ihm folgte Leighton, der sich in einer unbeschreiblichen Aufregung befand. Sein Kind, das ihm über alles ging, war verschwunden!
Sie muß hier sein! rief er wild. Claire! Claire!
Damit rannte er durch den großen Salon, wo sie doch nicht sein konnte, wie er selber gut genug wußte.
Alfred war oben geblieben.
Auf einmal kam mir eine Erinnerung an eine Wahrnehmung, die ich selber gemacht hatte, als ich mit der Kleinen im oberen Stockwerk war, und ich fragte Doktor Bennett:
Sind die Leute schon oben im vierten Stock gewesen? Als ich in Herrn Alfred Gillespies Zimmer im dritten Stock war, hörte ich auf der Treppe Kleider rauschen. Es war ein hastiges Laufen; ich glaubte damals, die betreffende Person eilte nach unten. Es kann aber auch sein, daß sie treppauf lief!
Wir wollen doch nachsehen! sagte der Doktor.
Ich schloß mich ihm ohne Besinnen an. Als wir an Alfreds Tür vorbeikamen, sahen wir ihn in seinem Zimmer stehen. Er war in einem solchen Zustande von Wut, daß er uns gar nicht bemerkte, und riß ein Blatt Papier in Fetzen; es war wieder ein Briefbogen wie jener, den er vorher in den Papierkorb geworfen hatte. Dabei murmelte er Worte vor sich hin, von denen ich nur einige verstand.
Warum denn schreiben? sagte er. Wenn sie mich liebte, würde sie warten. Sie würde nicht in einem solchen Augenblick fortgehen, wenn er nicht ...
Doktor Bennett legte den Zeigefinger auf seine Lippen und ging leise an der offenen Tür vorüber. Ich eilte ihm nach, und wir stiegen zusammen die letzte Treppenflucht hinauf.
Wir befanden uns jetzt in einem Teil des Gebäudes, der auch dem Doktor nicht bekannt war, geschweige denn mir. Hier oben war alles dunkel; nur ein schwacher Lichtstrahl drang durch eine Türspalte; wir sahen nach und fanden in einer der Dachstuben eine niedrig geschraubte Gasflamme brennen. Aber das Zimmer war leer. Auch in einigen anstoßenden Kammern war keine Menschenseele zu finden. Wir gingen wieder auf den Flur und bemerkten beim Schein eines Streichhölzchens, das der Doktor entzündete, zwei verschlossene Türen den bereits durchsuchten Zimmern gegenüber. Die eine führte zu einer gut möblierten Stube, die andere in eine Rumpelkammer, die halb mit Koffern und Kisten angefüllt war.
Nun, das muß ich sagen! rief Doktor Bennett aus, als sein Streichholz ausging, ehe wir noch die Kammer ordentlich hatten mustern können, diese ganze Geschichte steckt voll von Geheimnissen.
Pst! sagte ich. Wir wollen horchen! Wir müssen uns hier oben mehr auf unsere Ohren als auf unsere Augen verlassen!
Mit angehaltenem Atem lauschten wir beide. Und wirklich, wir hörten etwas. Es klang wie das Atmen eines in unserer Nähe versteckten Menschen. Oder konnte es etwas anderes sein? Der Doktor zündete ein neues Streichholz an.
Diesmal sahen wir etwas, aber wieder erlosch das schwache Flämmchen, ehe wir hatten unterscheiden können, was es war. Wir mußten uns unbedingt Klarheit verschaffen, und dazu gehörte vor allem ordentliches Licht. Ich hatte in einer der anderen Kammern eine Kerze bemerkt; ich eilte hin, entzündete sie an der Gasflamme und kehrte, so schnell ich konnte, nach der Rumpelkammer zurück.
Dort hatten wir einen seltsam rührenden Anblick.
An der Wand stand eine weibliche Gestalt. Weit aufgerissene Augen starrten uns an aus einem bleichen Antlitz, das vor Entsetzen über irgend etwas Unerhörtes, Ungeahntes völlig versteinert zu sein schien. Und dies Gesicht war schön, von jener rührenden weiblichen Schönheit, die zu Herzen geht. Rührend war auch der Anblick des im ganzen Hause vergeblich gesuchten kleinen Mädchens – es lag in sanftem Schlummer zu ihren Füßen!
Wer ist das? fragte ich. Ist es Fräulein Meredith?
Der Doktor drückte mir die Hand und flüsterte:
Wir müssen vorsichtig sein. Sie ist in einem Zustande, daß ein plötzliches Erschrecken sie um ihren Verstand bringen kann.
Das Kind scheint aber keine Angst vor ihr zu haben, murmelte ich.
Der Doktor war inzwischen auf das junge Mädchen zugeschritten, das noch immer wie gebannt sich gegen die Wand anpreßte, und lächelnd sagte er:
Warum sind Sie denn in einem so kalten Zimmer? Claire wird sich erkälten. Wollen Sie nicht lieber mit herunterkommen?
Zusammenfahrend sah sie auf die Kleine hernieder, die noch immer, ohne sich zu rühren, zu ihren Füßen lag, und rief:
Wie ist sie denn zu mir gekommen? Ich habe sie nicht gerufen.
Und wie kommen Sie denn selber hier herein? war des lächelnden Doktors Gegenfrage. Mit Ihrem weißen Kleide passen Sie doch nicht in diese Rumpelkammer!
Sie richtete sich kerzengerade auf; von der Bewegung erwachte Claire und fing an zu weinen.
Ich hörte, daß Herr Gillespie tot sei, antwortete kaum hörbar das junge Mädchen mit starren, blassen Lippen. Ich hatte ihn lieb, und in meinem Schmerz flüchtete ich in diese Kammer.
Sie stand noch immer gegen die Wand gepreßt, die Hände hinter ihrem Rücken verbergend. Ich bemerkte, wie ihre Zähne klapperten; das konnte nicht von der Kälte allein herrühren, selbst der plötzliche Tod eines väterlichen Freundes und Wohltäters reichte zur Erklärung einer Aufregung, wie das junge Mädchen sie zeigte, nicht aus. Was mochte sie nur haben?
Wollen Sie nicht mit hinuntergehen? sagte der Doktor eindringlich, indem er Claire zärtlich wie ein Vater auf seine Arme nahm.
Niemals! schienen ihre Lippen rufen zu wollen, aber ich hörte keinen Laut. Und als Bennett, nachdem er mir das Kind gegeben, seinen Arm um sie schlang und sie sanft mit fortzog, da folgte sie ganz fügsam. Doch heftete sie einen seltsam starren Blick auf den alten Mann, einen Blick, den ich damals nicht verstand, und der mir noch lange Zeit nachher ein Rätsel war.
Auf dem Treppenabsatz begegneten wir Alfred. Vielleicht hatte er uns nach oben gehen hören, vielleicht war er von selbst auf den Gedanken gekommen, die Dachkammern zu durchsuchen. Sowie er uns sah, rief er aus:
Sie haben sie gefunden!
Auf das Kind bezog dieser Aufruf sich nicht; denn in vorwurfsvollem Tone setzte er hinzu:
Hope, wie konntest du uns solche Angst machen? Haben wir nicht schon genug zu tragen? Mußtest du noch mit einer neuen entsetzlichen Befürchtung unsere Herzen peinigen?
Ihre Antwort war nur ein unverständliches Flüstern. Sowie sie den jungen Mann erblickt hatte, war ihr Antlitz starr geworden wie eine Maske.
Viertes Kapitel.
Indem ich diese Beobachtung mitteile, möchte ich bemerken, daß ich kein Vorurteil gegen Alfred zu erwecken wünsche. Ich hätte kein Recht dazu, denn als ein paar Sekunden darauf Leighton, der seines Kindes Stimme vernommen hatte, die Treppen hinaufgeeilt kam, bemerkte ich an ihr dasselbe Zurückschaudern, dem ein gleicher Ausdruck von Starrheit folgte. Und abermals dieselbe Beobachtung machte ich unten in der Halle, als George auf sie zueilte und sie mit eindringlichen, aber doch ganz natürlichen Fragen bestürmte, wo sie denn so lange gewesen sei. Dabei war ihr anzusehen, wie sehr sie litt, und daß sie sich krampfhaft bemühte, dieses unwillkürliche Zurückschaudern zu verbergen, das ja auch ihren nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zu den drei Brüdern durchaus nicht entsprach. Aber es wurde natürlich bemerkt und erregte in Alfred eine Aufregung, die er vergeblich zu beherrschen suchte, in Leighton Ueberraschung und in George einen wilden Zorn, der sich in jähestem Wechsel der Gesichtsfarbe von Leichenblässe zu dunklem Rot und von dunkelrot zu Leichenblässe äußerte.
Wie hat sie nur von ihres Oheims Tod so bald Kenntnis haben können? flüsterte Bennett mir ins Ohr. Sie sagten doch, Sie hätten sie die Treppe hinaufeilen hören, während Sie in Alfreds Zimmer gewesen seien. Das war doch ganz wenige Augenblicke, nachdem der alte Herr in Ihren Armen verschieden war! Ist es möglich, daß Sie Fräulein Meredith bereits begegnet waren? Hatte sie zu allererst im ganzen Hause Kenntnis von dem Tode ihres Onkels?
Meines Wissens nicht! versetzte ich. Ich habe sie oben in der Dachkammer zum erstenmal gesehen. Es wäre ja aber ganz wohl denkbar, daß sie hier in der großen Halle oder in einem der vielen Zimmer hier unten gewesen ist.
Ich konnte meine Augen nicht von ihrer Schönheit abwenden; das heißt, ich nenne es »Schönheit«, weil ich keinen anderen passenden Ausdruck dafür weiß. Ich glaube, sie war nicht eigentlich schön in dem Sinne, den man diesem Wort gewöhnlich beilegt. Sie brauchte aber auch solche Schönheit nicht; ihr bezaubernder Reiz war auch ohne diese unbestreitbar – zu unbestreitbar, fürchte ich, für Alfred und George Gillespie.
An ihrer Haltung, an dem geradeaus gerichteten Blick ihrer Augen, an den festgeballten Händen, die sie immer noch auf dem Rücken hielt, konnte ich bemerken, daß sie alle ihre Geisteskräfte aufbot, um zu einem bestimmten Entschlusse zu kommen. Und ich fürchte, dieser Entschluß stand wenig im Einklang mit der Haltung einfacher Trauer, die sie an den Tag zu legen bemüht war. Leighton schien dies ebenfalls zu bemerken, denn er setzte das Kind nieder, das er bis dahin gegen seine Brust gepreßt gehalten hatte, trat an seine Cousine heran und richtete ein paar hastige Fragen an sie.
Doch ehe sie antworten konnte, trat der Coroner heran und sagte seinerseits:
Wenn Sie Fräulein Meredith sind, Herrn Gillespies Nichte und Mitarbeiterin, so ist Ihr tiefer Kummer und Schmerz begreiflich. Der alte Herr ist unter höchst seltsamen Umständen verschieden.
Plötzlich bewegte sie ihre beiden Hände nach vorn, die sie bis dahin krampfhaft auf dem Rücken gehalten hatte, aber ihre Augen blickten starr immer auf denselben Punkt. Vielleicht fürchtete sie, den Blicken der drei Brüder zu begegnen, die hinter dem Coroner standen.
Sind die näheren Umstände Ihnen mitgeteilt worden? fragte Frisbie in freundlichem und ermutigendem Tone weiter.
Nein.
Die Antwort kam schnell und scharf heraus; man sah, sie war ein Weib von festem Willen, was ich nach der Art, wie wir sie aufgefunden, nicht von ihr erwartet hatte.
Dann hat also die Kleine nichts gesagt? fuhr er fort, mit einem Blick auf Claire, die sich wieder zu Fräulein Merediths Füßen hingesetzt hatte.
Claire? rief sie, offenbar überrascht. Claire?
Und ihre Augen folgten dem Blick des Coroners, bis sie das Mädchen bemerkte, von deren Anwesenheit sie bis dahin augenscheinlich nichts gewußt hatte.
Nein! erwiderte sie. Sie hat nichts gesagt. Wenigstens habe ich nichts von ihr gehört.
Dabei streckte sie die Hand aus, als wolle sie bitten, das Kind hinwegzubringen. Aber sie vollendete die Bewegung ihres Armes nicht, und ich bezweifle, ob von den Anwesenden jemand außer mir deren Bedeutung ahnte.
Der Coroner hatte offenbar den Wunsch, ihre Gefühle zu schonen und sagte:
Doktor Bennett wird Ihnen mitteilen, zu welchen Schlußfolgerungen wir bis jetzt gekommen sind. Ich wünsche von Ihnen nur zu erfahren, wann Sie Herrn Gillespie zum letztenmal gesehen haben.
Bei Lebzeiten? fragte sie und warf dabei einen verstohlenen Blick auf die Tür der kleinen Hinterstube.
Ja, Fräulein Meredith. Als Toten haben Sie ihn doch ganz gewiß nicht gesehen.
Ich war mit ihm bei Tisch, erwiderte sie. Wir waren alle da – und bei diesen Worten sah sie zum erstenmal ihre drei Vettern einen nach dem andern an. Mein Onkel schien so wohl zu sein, wie er seit seiner letzten Krankheit nur je gewesen ist. Er aß mit gutem Appetit und trank ...
Und trank ... wiederholte der Coroner mit einem ernsten Blick auf die hinter ihm stehenden drei jungen Leute, die alle drei emporfuhren.
... sein gewohntes Glas Wein zum Nachtisch. Er trank allein! rief das Mädchen mit starker Betonung und in plötzlich hervorbrechender Erregung. Niemals kann ich das vergessen, daß er allein trank.
Ein Seufzer oder ein seufzergleicher Hauch antwortete ihr. Einer ihrer Vettern hatte ihn ausgestoßen, aber wer es war, das habe ich niemals erfahren. Als sie den Ton vernahm, fuhr sie zusammen, als wäre sie ins Herz getroffen, hob ihre Hände empor und hielt sich die Ohren zu. Aber sofort ließ sie sie wieder sinken und sah mit unbeschreiblich traurigem Blick langsam die jungen Leute der Reihe nach an.
Wie gern hätte ich nach alter guter Sitte ihm Bescheid getan, hätte ich gewußt, daß dies sein letzter Trunk war, rief sie aus, und dann ließ sie mit einem Seufzer wieder ihr Haupt auf die Brust sinken.
Ich verstehe Sie nicht ganz, sagte der Coroner nach einer kurzen Pause allgemeinen atemlosen Schweigens. Trank Herr Gillespie sonst für gewöhnlich sein Glas zusammen mit seinen Tischgenossen, oder warum erregt Sie der Umstand, daß er es heute abend allein trank, in so hohem Maße?
Ja. Sonst verging keine Mahlzeit, ohne daß zum Schluß einer seiner Söhne irgendeinen Trinkspruch ausgebracht hätte. Das eigentümliche Zusammentreffen der Umstände geht mir so zu Herzen. Aber ich weiß nicht, warum ich davon spreche – niemand konnte voraussehen, daß dies das letztemal sein sollte, wo wir alle vereinigt wären.
Sie sah bei diesen Worten gerade vor sich hin. Es klingt fast unglaublich, aber sie war sich offenbar nicht bewußt, über den Häuptern ihrer drei Vettern das schwarze Banner des Verdachtes aufgepflanzt zu haben. Erst als ein drückendes Schweigen ihren Worten folgte, schien ihr die Tragweite ihrer Aussage klar zu werden, denn plötzlich fuhr sie zusammen, ihre Züge verzerrten sich in einer mich erschreckenden Weise, und mit vorgestreckten Armen rief sie aus:
Sie verbergen mir etwas! Woran ist mein Onkel gestorben? Sagen Sie's mir – sagen Sie's mir sofort!