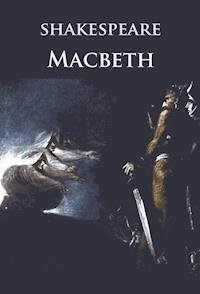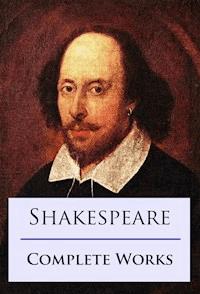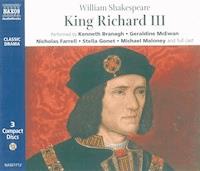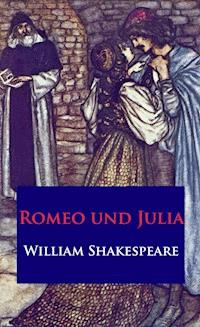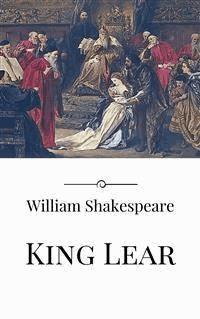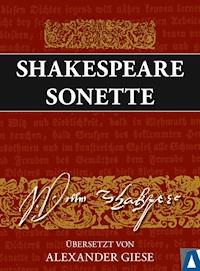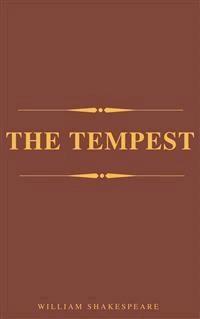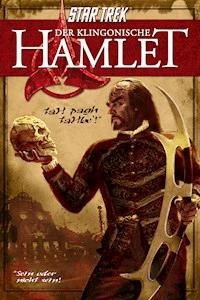Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marix Verlag ein Imprint von Verlagshaus Römerweg
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literatur (Leinen)
- Sprache: Deutsch
Ein modernes Shakespeare Lesebuch – versehen mit zahlreichen Kommentaren, Anekdoten und interessanten Hintergrundinformationen zu Szenen und Stücken. Dieser Band versammelt romantische, tragische und lustige Dialoge, eine Auswahl der berühmten Monologe, Sonette und prägnanten Sottisen aus dem Gesamtwerk des großen englischen Dichters.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
»Er hat nichts übriggelassen, dem man noch etwas hinzufügen müsste.«JOHN KEATS
Seit jeher fasziniert William Shakespeare Literatur- und Theaterbegeisterte. Neben seinen Dramen zählen auch seine Komödien und seine Lyrik seit Jahrhunderten zur Weltliteratur. In diesem Band kommen nicht nur Hamlet, Puck und Ariel zu Wort, sondern auch der Dichter selbst in seinen eindrucksvollen Sonetten und Sottisen. Gepaart mit fundierten Einführungen ist dieser Band ein Kleinod für alle Shakespeare-Verehrer und vermittelt Einblick in das Werk eines der größten Genies aller Zeiten.
Dieses Lesebuch bietet Auszüge aus den bekanntesten shakespeareschen Monologen und Dialogen, ausgewählte Lyrik des Weltdichters und interessante Hintergrundinformationen, die den Kosmos Shakespeares unter anderem mit der heutigen Popkultur verbinden.
Die ganze Welt ist eine Bühne,
Und alle Frauen und Männer bloße Spieler.
Sie treten auf und geben wieder ab,
Sein Leben lang spielt einer manche Rollen
Durch sieben Akte hin …
WILLIAM SHAKESPEARE; WIE ES EUCH GEFÄLLT (II, 7)
EinfachShakespeare
EinfachShakespeare
Szenen, Sottisen und Sonette
Herausgegeben von Sabine Anders
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttps://dnb.d-nb.de abrufbar.
Es ist nicht gestattet, Abbildungen und Texte dieses Buches zu scannen, in PCs oder auf CDs zu speichern oder mit Computern zu verändern oder einzeln oder zusammen mit anderen Bildvorlagen zu manipulieren, es sei denn mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © by marixverlag GmbH, Wiesbaden 2014Der Text basiert auf der Ausgabe marixverlag, Wiesbaden 2014Lektorat: Eva SchröderCovergestaltung: Groothuis. Gesellschaft der Ideen und Passionen mbHHamburg BerlinBildnachweis: © marqs/fotolia.comeBook-Bearbeitung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
ISBN: 978-3-8438-0434-9
www.marixverlag.de
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
Den Augenblick, da ich euch sahe …Erste Begegnungen zwischen Liebenden
Willst du schon gehn?Von Abwesenheit, Trennung und Sehnsucht
Vielleicht sind beide falschVon Eifersucht und Treue
O wir sind alle der Versuchung Erben!Versuchung und Verführung
Liebt’ ich sie je, die Lieb ist längst vorüberVom Ende der Liebe
Freundschaft hält StandÜber die Freundschaft
Wer möchte Vater sein?Familienbande
Mein Falsch besiegt dein WahrIntrigen und Ränke
Mit würd’ger StaatskunstVon Politik und Macht
Wer das Leben läßtBerühmte Sterbeszenen//Vom Sterben
Und eine Stunde lacht’ ich ohne RastVom Lachen und Humor
Schicksal! Wir wollen sehn, was dir beliebtDas Schicksal und Prophezeiungen
Sein oder NichtseinDie berühmten Monologe
Nichts ist so, wie es istSchein und Sein
Ein Sonett zu seinem RuhmSonette
Voll weiser Sprüch’Sentenzen und Aussprüche
Alphabetisches Verzeichnis der Stücke
EINLEITUNG
Die Frage, die einem am häufigsten zu Shakespeare gestellt wird, ist: Wer hat die Stücke eigentlich geschrieben? Die Autorschaftsfrage, auch bekannt als Shakespeare-Verschwörung, ist gleichzeitig das Thema, mit dem sich wahrscheinlich die meisten Fernsehdokumentationen über Shakespeare beschäftigen. Erst 2011 wurde ihr ein großer Kinofilm gewidmet: Anonymous von Roland Emmerich. Das Interessante an dieser Diskussion ist nicht die »Wahrheit« über eine mysteriöse Autorfigur, die hinter einer Verschwörung um Shakespeares Stücke verborgen sein soll, sondern wie diese Diskussion überhaupt entstanden ist und warum sie sich so hartnäckig hält.
Niemand, nicht einmal Anhänger der Verschwörungstheorien, bezweifeln, dass es einen Mann namens William Shakespeare wirklich gegeben hat, der in Stratford-upon-Avon geboren und gestorben ist und dazwischen einen Großteil seines Lebens als Schauspieler in London verbracht hat. Freunde der Verschwörungstheorie bezweifeln lediglich, dass dieser Mann von bescheidener Herkunft, der nur eine durchschnittliche Schulbildung genossen hat, die literarischen Werke verfasst hat, die ziemlich unangefochten zu den besten der Welt zählen. Sie behaupten, dieser William Shakespeare wurde von dem wahren Autor der Stücke nur vorgeschoben, weil letzterer seine wahre Identität verbergen wollte.
Die Kandidaten, die Shakespeares Stücke geschrieben haben sollen, sind nicht gerade wenige und reichen von dem Earl of Oxford über Francis Bacon (der die Stücke von Christopher Marlowe gleich mitgeschrieben haben soll) bis hin zu Königin Elizabeth I und König James I. Alle diese Kandidaten haben jedoch eines gemeinsam: Sie sind hochrangige Mitglieder des Adels (oder eben sogar Könige). Das sei, so die Verschwörungsanhänger, auch der Grund für die Verschleierung ihrer Identität: Es schickte sich angeblich nicht für einen Aristokraten, Theaterstücke zu schreiben. Es gibt jedoch einige Adelige unter Shakespeares Zeitgenossen, die durchaus Theaterstücke geschrieben und keinen Hehl daraus gemacht haben. Sie haben ihre Stücke nur nicht auf der Bühne aufführen lassen. Die Suche nach einem adeligen »wahren« Autor hat also eher sozio-historische Gründe.
Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts kam niemand auf die Idee, dass Shakespeares Stücke aus einer fremden Feder stammen könnten, weil Shakespeare damals noch nicht so verehrt wurde wie zu späterer Zeit und als Autor nicht wichtig genug war, als dass diese Frage irgendjemanden interessiert hätte. Seine Texte wurden damals ziemlich sorglos geändert, um sie an die Gepflogenheiten der Bühne beziehungsweise den literarischen Konventionen der Zeit anzupassen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts jedoch wurde Shakespeare nicht nur als Genie, sondern sogar als »Gott« apostrophiert und entwickelte sich zum englischen Nationaldichter. Einige Leute verdienten in dieser Zeit viel Geld mit gefälschten Manuskripten, Briefen, Testamenten und anderen Dokumenten, die angeblich von Shakespeare stammten, zum Beispiel Briefe von ihm an Königin Elizabeth und seine Frau.
Das Aufkommen der Verschwörungstheorien um Shakespeares Autorschaft hängt einerseits eng damit zusammen, dass die viktorianische Mittelklasse, das kulturelle Establishment, voller aristokratischer Ideale war und große Angst vor sozialen Aufsteigern aus den unteren Klassen hatte. Um Shakespeare für sich zu vereinnahmen, mussten sie ihn zu einem Adeligen machen. Und andererseits wandelte sich in dieser Zeit, der Epoche der literarischen Romantik, die Auffassung über die Bedeutung von Schriftstellern und insbesondere schriftstellerischen Genies.
In der Romantik hatte Schreiben sehr viel mit Inspiration und der Person des Autors zu tun. Er saß, so die idealisierte Vorstellung, allein im stillen Kämmerlein und brachte sein Werk in einem einzigartigen Moment, wenn die Inspiration, die er nicht willentlich beeinflussen konnte, über ihn kam, in seiner vollendeten Form zu Papier. Und was er zu Papier brachte, entsprang seiner eigenen, persönlichen Gefühlsund Erfahrungswelt. Unter solchen Umständen spielte das handschriftliche Manuskript eine unschätzbare Rolle, bildete es doch die übernatürlich anmutende Inspiration ab. Von Shakespeare sind keine handschriftlichen Manuskripte seiner Stücke erhalten. Das ist aber nicht weiter verwunderlich: Shakespeare schrieb seine Stücke (ab und zu auch mit anderen Autoren zusammen) für verschiedene Schauspieltruppen. Das »Copyright« lag bei der Schauspieltruppe und wurde manchmal zusammen mit dem Manuskript an einen Drucker verkauft, der das handschriftliche Dokument nach der Drucklegung nicht zurückgab, sondern wahrscheinlich einfach wegwarf.
Da die Verschwörungstheoretiker Shakespeare als romantischen Autor sehen, gehen sie davon aus, dass auch er in seinen Werken über seine eigene Erfahrungswelt geschrieben hat. Deswegen bringen sie immer wieder das Argument vor, dass er die Stücke gar nicht geschrieben haben kann, wenn er kein Adeliger war, weil so viele Szenen am Königshof spielen. Alle Dramenschreiber zu Shakespeares Zeit haben jedoch über das Leben am Hof geschrieben, so wie sie es von Gerüchten, ihrer Anwesenheit dort während Theateraufführungen, anderen Texten und Theaterstücken her kannten. Viel weniger vorstellbar ist, dass ein Aristokrat so überzeugend den Zungenschlag der einfachen Bevölkerung nachahmen konnte, wie Shakespeare es in seinen Stücken tut. Fest steht auch, dass ein Kenner des Theaters die Stücke geschrieben haben muss.
Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Shakespeare als Kind und Jugendlicher die Grammar School in Stratford besucht. Da die Lehrpläne vergleichbarer Institutionen überliefert sind, wissen wir, dass Shakespeare dort übte, auf Latein und Englisch Textvorlagen klassischer Autoren umzuschreiben: Er änderte Fließtexte in Dialoge, fasste die Sichtweise und Argumente verschiedener Figuren in eigene Worte und verwandelte Prosa in Vers. Viele Zeilen aus Shakespeares Werk, die wie Sprichwörter klingen (siehe Kapitel 16 in diesem Buch), lassen sich auf Erasmus’ Sammlung von Sprichwörtern (»Adagia«) zurückführen, die Shakespeare in der Schule gelesen hat.
Das heißt nicht, dass er deswegen nicht das Genie war, für das er gemeinhin gehalten wird. Ob ein Kunstwerk gut oder schlecht ist, darüber lässt sich streiten, und manche sagen, es sei reine Geschmackssache. Nur bei Shakespeare gilt es als allgemein anerkannte Tatsache, dass er ein Genie war. Das liegt, wie Jonathan Bate in The Genius of Shakespeare (London: Picador, 1997) erklärt, jedoch unter anderem daran, dass die literarische Szene den Begriff »Genie« in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hauptsächlich dazu benutzt hat, um auszudrücken, was das Besondere an Shakespeare im Vergleich zu anderen Schriftstellern ist. Er war der erste Schriftsteller in der westlichen Welt, der dafür gelobt wurde, dass er so »natürlich« und »originell« schrieb, anstatt »künstlich« und frühere Autoren imitierend. Bis dahin galt beides – natürliches, lebensnahes Schreiben und die Nachahmung anerkannter Autoren – als ein und dasselbe. Es gibt schriftliche Äußerungen von Shakespeares Zeitgenossen, zum Beispiel von Ben Jonson, die ganz klar eine Verbindung zwischen dem William Shakespeare aus Stratford und dem Schauspieler und Stückeschreiber in London herstellen, und die ihn für seine guten Stücke trotz seiner fehlenden »Gelehrtheit« loben. Am Ende des 18. Jahrhunderts wird er für die fehlende Gelehrtheit gelobt.
Dabei spielten auch politische Gründe eine Rolle, unter anderem der Wunsch Englands, sich bewusst von Frankreichs kultureller Vorherrschaft abzugrenzen. Während in Frankreich nur Dramen als gut galten, die sich streng an klassizistische Regeln hielten – in denen also zum Beispiel Tragödien streng von Komödien getrennt waren, die Handlung an einem Ort spielte, maximal 24 Stunden dauerte und plausibel sein musste, und Personen unterschiedlicher Stände nicht gleichzeitig auf der Bühne waren – mischte Shakespeare unbekümmert komische mit tragischen Elementen (zum Beispiel durch den Narr in König Lear), transportierte seine Figuren von England nach Frankreich (zum Beispiel in König Heinrich V), übersprang Zeiträume von mehreren Jahren (zum Beispiel ganze 16 Jahre in Das Wintermärchen), brachte Könige und einfache Leute zusammen auf die Bühne und ließ übernatürliche Wesen wie Elfen und Geister in seinen Stücken auftreten.
Die Stücke, die Aristokraten zu Shakespeares Zeit geschrieben haben, ähnelten dagegen eher den französischen Regeldramen – ein weiterer Grund, warum es unwahrscheinlich ist, dass jemand wie der Earl of Oxford Shakespeares Stücke geschrieben hat (genauso wie die tatsächlich von Francis Bacon verfasste Dichtung in keiner Weise Shakespeares Stil gleicht). Ebenso unwahrscheinlich ist, dass der Earl of Oxford sich zu der unterwürfigen Widmung herabgelassen hätte, die Shakespeare in seinen längeren Versdichtungen an den Earl of Southampton richtet. Dazu kommt, dass der Earl of Oxford zu früh gestorben ist, um alle von Shakespeares Stücken geschrieben zu haben. Und die ganzen Anspielungen auf andere zeitgenössische Adelige, die Anhänger der Oxford-Theorie in Shakespeares Stücken vermuten, hätten Shakespeare vermutlich ins Gefängnis gebracht oder ihn sogar sein Leben gekostet.
Wenn Sie trotzdem daran glauben wollen, dass Shakespeare seine Stücke nicht selbst geschrieben hat, befinden Sie sich in illustrer Gesellschaft: Sigmund Freud, Henry James und Mark Twain zum Beispiel waren ebenfalls fest davon überzeugt. Das muss Sie jedoch nicht davon abhalten, seine Texte zu genießen – letztlich ist dafür ja unerheblich, wer sie geschrieben hat. Sollten Sie Anhänger einer ganz anderen Shakespeare-Verschwörung sein – nämlich dass Shakespeare maßlos überschätzt wird und gar nicht so gut ist, wie alle behaupten – sind Sie ebenfalls nicht allein, sondern einer Meinung mit – zum Beispiel – Leo Tolstoi, Bernard Shaw und Ludwig Wittgenstein. Das Buch, das Sie in den Händen halten, gibt Ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit, sich anhand der interessantesten Textstellen in Shakespeare selbst ein Bild zu machen.
Das 1. Kapitel (»Den Augenblick, da ich euch sahe ...«) schildert erste Begegnungen zwischen Liebenden. Das 2. Kapitel (»Willst du schon gehen?«) enthält Szenen, in denen Liebende mit Abwesenheit, Trennung und Sehnsucht konfrontiert sind. Themen des 3. Kapitels (»Vielleicht sind beide falsch«) sind Eifersucht, Untreue und Unaufrichtigkeit. Kapitel 4 (»O wir sind alle der Versuchung Erben!«) handelt von Versuchung und Verführung. Kapitel 5 (»Liebt’ ich sie je, die Lieb ist längst vorüber«) zeigt das Ende der Liebe, Streit und Trennung. Das 6. Kapitel (»Freundschaft hält Stand«) erzählt Geschichten rund um wahre und falsche Freunde. Familienbande und Familienangelegenheiten bieten im 7. Kapitel (»Wer möchte Vater sein?«) ausgiebig Konfliktpotenzial. Kapitel 8 (»Mein Falsch besiegt dein Wahr«) führt die Meister-Intriganten in Shakespeares Stücken vor. Im 9. Kapitel (»Mit würd’ger Staatskunst«) kommen erstaunlich moderne politische Konflikte zur Sprache. Kapitel 10 (»Wer das Leben läßt«) enthält die berühmtesten Sterbeszenen. Kapitel 11 (»Und eine Stunde lacht’ ich ohne Rast«) steht ganz im Zeichen von Komik und Humor. Die Schwankungen des Schicksals, Prophezeiungen und Vorahnungen sind Inhalt von Kapitel 12 (»Schicksal! Wir wollen sehn, was dir beliebt«). Kapitel 13 (»Sein oder Nichtsein«) enthält die berühmtesten Monologe, Kapitel 14 (»Nichts ist so, wie es ist«) zeigt, dass sich in Shakespeares Stücken der äußere Anschein und die innere Wahrheit von Menschen und Geschehnissen häufig widersprechen. Kapitel 15 (»Ein Sonett zu seinem Ruhm«) versammelt ausgewählte Sonette und Kapitel 16 (»Voll weiser Sprüch’«) berühmte, kurze Zitate mit ihren englischen Originalen.
Die Zitate aus den einzelnen Stücken sind entnommen aus der Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel und Ludwig und Dorothea Tieck aus dem 19. Jahrhundert (Ausgabe erschienen im Warschauers Verlag, Berlin, ohne Jahresangabe). Die englischen Texte stammen aus The Complete Works of William Shakespeare, herausgegeben von W. J. Craig (Oxford University Press, London, 1926). Die Texte der Sonette stammen, wenn nicht anders angegeben, aus der Ausgabe Shakespeares Sonette, erläutert von Alois Brandl und übersetzt von Ludwig Fulda (Cottasche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart und Berlin, 1925). Die Textgrundlage für Die beiden edlen Vettern ist die Übersetzung von Ferdinand Adolph Gelbcke (in Die englische Bühne zu Shakespeares Zeit. Zwölf Dramen seiner Zeitgenossen, Band III, Brockhaus, Leipzig, 1890). Die Rechtschreibung und Interpunktion wurden behutsam modernisiert, wobei bewusst auf die neue Rechtschreibung verzichtet wurde.
DEN AUGENBLICK,DA ICH EUCH SAHE...
Wer liebte je und nicht beim ersten Blick?
Who ever loved that loved not at first sight?
(Wie es euch gefällt, III, 5)1
Verkleidung, du bist eine Schalkheit
In Was ihr wollt ist Orsino, Herzog von Illyrien, in Olivia verliebt, die jedoch um ihren verstorbenen Bruder trauert und Orsinos Liebe nicht erwidert. Viola wird durch einen Schiffbruch an die Küste Illyriens gespült, verkleidet sich als Mann und tritt als Page unter dem Namen Cesario in Orsinos Dienst. In seinem Auftrag wirbt sie bei Olivia für Orsino. Das hat jedoch zur Folge, dass Olivia sich in die als Cesario verkleidete Viola verliebt, während Viola selbst sich in Orsino verliebt. Wenn man dabei im Hinterkopf behält, dass zu Shakespeares Zeit alle Frauenrollen mit männlichen Schauspielern besetzt waren, nimmt die Mehrdeutigkeit zu: Ein männlicher Schauspieler spielt eine Frau, die sich wiederum als Mann verkleidet. Viola und Olivia begegnen sich das erste Mal, als Orsino Viola zu ihr schickt, um für ihn zu werben.
VIOLA
Ich seh euch, wie ihr seid: ihr seid zu stolz;
Doch wärt ihr auch der Teufel, ihr seid schön.
Mein Herr und Meister liebt euch; solche Liebe
Kann nur vergolten werden, würdet ihr
Als Schönheit ohne Gleichen auch gekrönt. [...]
O liebt’ ich euch mit meines Herren Glut,
Mit solcher Pein, so todesgleichem Leben,
Ich fänd in euerm Weigern keinen Sinn,
Ich würd es nicht verstehn.
OLIVIA
Nun wohl, was tätet ihr?
VIOLA
Ich baut’ an eurer Tür ein Weidenhüttchen,
Und riefe meiner Seel’ im Hause zu;
Schrieb’ fromme Lieder der verschmähten Liebe,
Und sänge laut sie durch die stille Nacht;
Ließ’ euern Namen an die Hügel hallen,
Daß die vertraute Schwätzerin der Luft
»Olivia« schrie. O ihr solltet mir
Nicht Ruh genießen zwischen Erd’ und Himmel,
Bevor ihr euch erbarmt! [...]
Steckt euern Beutel ein, ich bin kein Bote;
Mein Herr bedarf Vergeltung, nicht ich selbst.
Die Liebe härte dessen Herz zu Stein,
Den ihr einst liebt, und der Verachtung nur
Sei eure Glut, wie meines Herrn geweiht!
Gehabt euch wohl dann, schöne Grausamkeit! geht ab
OLIVIA
Wie ist eure Herkunft?
»Obschon mir’s wohl geht, über meine Lage:
Ich bin ein Edelmann.« Ich schwöre drauf;
Dein Antlitz, deine Zunge, die Gebärden,
Gestalt und Mut sind dir ein fünffach Wappen.
Doch nicht zu hastig! Nur gemach, gemach!
Der Diener müßte denn der Herr sein. Wie?
Weht Ansteckung so gar geschwind uns an?
Mich däucht, ich fühle dieses Jünglings Gaben
Mit unsichtbarer leiser Überraschung
Sich in mein Auge schleichen. Wohl, es sei! [...]
Ich tu, ich weiß nicht was; wofern nur nicht
Mein Auge mein Gemüt zu sehr besticht.
Nun walte, Schicksal! Niemand ist sein eigen;
Was sein soll, muß geschehn: so mag sich’s zeigen!
(I, 5)
Da Viola/Cesario für Orsino wirbt, muss Olivia »ihn« zurückweisen. Und doch will sie Cesario wiedersehen und schickt ihren Diener Malvolio hinter »ihm« her. Malvolio soll Cesario einen Ring geben, von dem Olivia behauptet, dass Cesario ihn Olivia als Geschenk von Orsino überbracht hätte. Außerdem soll Malvolio Cesario ausrichten, dass er sich nicht mehr blicken lassen soll, außer um Olivia zu berichten, wie Orsino die Zurückweisung des Ringes aufgenommen hätte. Viola entschlüsselt diese komplizierte Liebesbotschaft mühelos.
VIOLA
Ich ließ ihr keinen Ring. Was meint dies Fräulein?
Verhüte, daß mein Schein sie nicht betört!
Sie faßt’ ins Auge mich, fürwahr so sehr,
Als wenn ihr Aug’ die Zunge ganz verstummte:
Sie sprach verwirrt in abgebrochnen Reden.
Sie liebt mich – ja! Die Schlauheit ihrer Neigung
Lädt mich durch diesen mürr’schen Boten ein.
Der Ring von meinem Herrn? Er schickt’ ihr keinen;
Ich bin der Mann. Wenn dem so ist, so täte
Die Arme besser einen Traum zu lieben.
Verkleidung, du bist eine Schalkheit, seh ich,
Worin der list’ge Feind gar mächtig ist.
Wie leicht wird’s hübschen Gleißnern nicht, ihr Bild
Der Weiber weichen Herzen einzuprägen!
Nicht wir sind schuld, ach! Unsre Schwäch’ allein:
Wie wir gemacht sind, müssen wir ja sein.
Wie soll das gehen? Orsino liebt sie zärtlich;
Ich armes Ding bin gleich verliebt in ihn;
Und sie, Betrogne, scheint in mich vergafft.
Was soll draus werden? Bin ich Mann, so muß
Ich an der Liebe meines Herrn verzweifeln;
Und wenn ich Weib bin: lieber Himmel, ach!
Wie fruchtlos wird Olivia seufzen müssen!
O Zeit! Du selbst entwirre dies, nicht ich:
Ein zu verschlungner Knoten ist’s für mich.
(II, 2)
Und nicht bloß Trieb zu euch
Violas eineiiger Zwillingsbruder Sebastian hat den Schiffbruch ebenfalls überlebt, aber Viola weiß nichts davon. Sebastian wird von dem Seemann Antonio gerettet. Antonio fühlt sich trotz der kurzen Zeit, die er Sebastian kennt, so sehr zu ihm hingezogen, dass er ihm nach Illyrien folgt, obwohl er mit Orsino wegen eines Kampfes auf See verfeindet ist und es daher für ihn sehr gefährlich ist, illyrischen Boden zu betreten.
ANTONIO
Mög’ aller Götter Milde dich geleiten!
Ich hab’ am Hof Orsinos viele Feinde,
Sonst ging ich nächstens hin, dich dort zu sehn.
Doch mag’s drum sein! Du liegst mir so am Herzen,
Ich will zu dir und mit Gefahren scherzen.
(II, 1)
SEBASTIAN
Es war mein Wille nicht, euch zu beschweren,
Doch da ihr aus der Müh’ euch Freude macht,
Will ich nicht weiter schmälen.
ANTONIO
Ich konnt’ euch so nicht lassen; mein Verlangen,
Scharf wie geschliffner Stahl, hat mich gespornt:
Und nicht bloß Trieb zu euch (obschon genug,
Um mich auf einen längern Weg zu ziehn,)
Auch Kümmernis, wie eure Reise ginge,
Da ihr dies Land nicht kennt, das einem Fremden,
Der führerlos und freundlos, oft sich rauh
Und unwirtbar erzeigt. Bei diesen Gründen
Der Furcht ist meine will’ge Liebe euch
So eher nachgeeilt.
SEBASTIAN
Mein güt’ger Freund,
Ich kann euch nichts als Dank hierauf erwidern,
Und Dank, und immer Dank; oft werden Dienste
Mit so verrufner Münze abgefertigt:
Doch wär’ mein Gut gediegen wie mein Sinn,
Ihr fändet bessern Lohn.
(III, 3)
Antonio leiht Sebastian seinen Geldbeutel, da Sebastian nach dem Schiffbruch mittellos ist. Später verwechselt Antonio Viola in ihrer Verkleidung als Cesario mit ihrem Zwillingsbruder Sebastian und bewahrt sie vor einem Duell mit Junker Andreas, einem Hausgast Olivias. Antonio wird daraufhin verhaftet und bittet Viola/Cesario, ihm den geliehenen Geldbeutel zurückzugeben. Viola hat natürlich keine Ahnung, wovon er redet – für sie ist es ja ihre erste Begegnung.
ANTONIO
Nun bringt die Not mich meinen Beutel wieder
Von euch zu fordern; und es schmerzt mich mehr
Um das, was ich nun nicht für euch vermag,
Als was mich selbst betrifft. Ihr steht erstaunt,
Doch seid getrost. [...]
Ich muß um etwas von dem Geld euch bitten.
VIOLA
Von welchem Gelde, Herr?
Der Güte wegen, die ihr mir erwiesen,
Und dann durch eure jetz’ge Not bewegt,
Will ich aus meinen schmalen, armen Mitteln
Euch etwas borgen: meine Hab’ ist klein,
Doch will ich teilen, was ich bei mir trage:
Da! Meine halbe Barschaft.
ANTONIO
Leugnet ihr mir ab?
Ist’s möglich, braucht denn mein Verdienst um euch
Der Überredung! Versucht mein Elend nicht,
Es möchte sonst so tief herab mich setzen,
Daß ich euch die Gefälligkeiten vorhielt,
Die ich für euch gehabt.
VIOLA
Ich weiß von keiner,
Und kenn euch nicht von Stimme noch Gesicht.
Ich hasse Undank mehr an einem Menschen
Als Lügen, Hoffahrt, laute Trunkenheit,
Als jedes Laster, dessen starkes Gift
Das schwache Blut bewohnt. [...]
ANTONIO
Sebastian, du entehrest edle Züge.
(III, 5)
Junker Andreas und Olivias Vetter Tobias verwechseln wenig später Sebastian mit Viola/Cesario und attackieren den nichtsahnenden Zwilling. Olivia, die Sebastian ebenfalls für ihren geliebten Cesario hält, geht dazwischen und entschuldigt sich für Tobias und Andreas. Wenig später macht sie Sebastian einen Heiratsantrag. Er ist natürlich komplett verwirrt, nimmt den Antrag aber ohne zu zögern an.
OLIVIA, zu Sebastian, den sie für Cesario hält
Ich bitt’ dich, lieber Freund,
Gib deiner Weisheit, nicht dem Zorn, Gehör
Bei diesem wilden ungerechten Ausfall
Auf deine Ruh. [...] Verwünscht sei er von mir,
Eins meiner Herzen kränkt’ er ja in dir.
SEBASTIAN
Wo weht dies her? Wie dünkt es meinem Gaum?
Bin ich im Wahnsinn, oder ist’s ein Traum?
Tauch meinen Sinn in Lethe, Phantasie!
Soll ich so träumen, gern erwach ich nie.
(IV, 1)
SEBASTIAN
Dies ist die Luft, dies ist die lichte Sonne,
Dies Kleinod gab sie mir, ich fühl’, ich seh’ es;
Und ob mich schon Bezauberung umstrickt,
Ist’s doch kein Wahnsinn. Wo ist wohl Antonio?
Ich konnt’ ihn nicht im Elefanten finden.
Doch war er da; man gab mir den Bescheid,
Er streife durch die Stadt, mich auszusuchen.
Jetzt eben wär sein Rat mir Goldes wert:
Denn überlegt mein Geist schon mit den Sinnen,
Daß dies ein Irrtum sein kann, doch kein Wahnsinn,
So übersteigt doch diese Flut von Glück
In solchem Grade Beispiel und Begriff –
Ich hätte Lust, den Augen mißzutrauen,
Und die Vernunft zu schelten, die ein andres
Mich glauben machen will, als ich sei toll,
Wo nicht, das Fräulein toll; doch wäre dies
Sie könnte Haus und Diener nicht regieren,
Bestellungen besorgen und empfangen,
Mit solchem stillen, weisen, festen Gang,
Wie ich doch merke, daß sie tut. Hier steckt
Ein Trug verborgen.
(IV, 3)
Den ärgsten Feind aufs Zärtlichste zu lieben
Als Romeo und Julia sich zum ersten Mal begegnen, ist Romeo noch in Rosalinde verliebt, die seine Liebe jedoch nicht erwidert. Als er Julia trifft, ist es hingegen von beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick. Ihre erste Begegnung findet bei einem Ball statt, zu dem Julias Familie, die Capulets, eingeladen haben, und auf den Romeo und seine Freunde maskiert als ungebetene Gäste eindringen. Das Familienoberhaupt der Capulets toleriert das wohlwollend, obwohl er Romeo als Familienmitglied der Montagues, seiner Todfeinde, erkennt. Julia erfährt von seiner Verwandtschaft erst, nachdem sie sich bereits in ihn verliebt hat. Die Verszeilen der ersten Unterhaltung zwischen Romeo und Julia ergeben zusammen ein Sonett.
ROMEO
O, sie nur lehrt den Kerzen, hell zu glühn!
Wie in dem Ohr des Mohren ein Rubin,
So hängt die holde Schönheit an den Wangen
Der Nacht; zu hoch, zu himmlisch dem Verlangen.
Sie stellt sich unter den Gespielen dar,
Als weiße Taub’ in einer Krähenschar.
Schließt sich der Tanz, so nah ich ihr: ein Drücken
Der zarten Hand soll meine Hand beglücken.
Liebt’ ich wohl je? Nein, schwör es ab, Gesicht!
Du sahst bis jetzt noch wahre Schönheit nicht.
[...]
Entweihet meine Hand verwegen dich,
O, Heil’genbild, so will ich’s lieblich büßen.
Zwei Pilger, neigen meine Lippen sich,
Den herben Druck im Kusse zu versüßen.
JULIA
Nein, Pilger, lege nichts der Hand zu Schulden
Für ihren sittsam-andachtvollen Gruß.
Der Heil’gen Rechte darf Berührung dulden,
Und Hand in Hand ist frommer Waller Kuß.
ROMEO
Hat nicht der Heil’ge Lippen wie der Waller?
JULIA
Ja, doch Gebet ist die Bestimmung aller.
ROMEO
O, so vergönne, teure Heil’ge, nun,
Daß auch die Lippen wie die Hände tun.
Voll Inbrunst beten sie zur dir: erhöre,
Daß Glaube nicht sich in Verzweiflung kehre.
JULIA
Du weißt, ein Heil’ger pflegt sich nicht zu regen,
Auch wenn er eine Bitte zugesteht.
ROMEO
So reg dich, Holde, nicht, wie Heil’ge pflegen,
Derweil mein Mund dir nimmt, was er erfleht. Er küßt sie.
Nun hat dein Mund ihn aller Sünd’ entbunden.
JULIA
So hat mein Mund zum Lohn sie für die Gunst?
ROMEO
Zum Lohn die Sünd’? O, Vorwurf süß erfunden!
Gebt sie zurück. Er küßt sie wieder.
JULIA
Ihr küßt recht nach der Kunst. [...]
Geh, frage, wie er heißt. Ist er vermählt,
So ist das Grab zum Brautbett mir erwählt. [...]
So ein’ge Lieb’ aus großem Haß entbrannt!
Ich sah zu früh, den ich zu spät erkannt.
O, Wunderwerk! Ich fühle mich getrieben,
Den ärgsten Feind aufs Zärtlichste zu lieben.
(I, 5)
Nach dem Ball verabschiedet Romeo sich eilig von seinen Freunden und kehrt zu Julias Haus zurück. Von Julia unbemerkt hört er, wie sie ihre Liebe zu ihm offenbart. Es folgt die berühmte »Balkonszene«, die unter dieser Bezeichnung bekannt geworden ist, obwohl Julia nach den Original Regieanweisungen Shakespeares »oben an einem Fenster« (»above at a window«) erscheint. In Verona gibt es heute sogar einen Julia-Balkon, in der Via Capello 23.
ROMEO
Doch still, was schimmert durch das Fenster dort?
Es ist der Ost, und Julia die Sonne!
Geh auf, du holde Sonn’! Töte den Mond,
Der neidisch ist und schon vor Grame bleich,
Daß du viel schöner bist, obwohl ihm dienend.
O, da er neidisch ist, so dien’ ihm nicht.
Nur Toren gehn in seiner blassen, kranken
Vestalentracht einher: wirf du sie ab!
Sie ist es, meine Göttin! Meine Liebe!
O, wüßte sie, daß sie es ist!
Sie spricht, doch sagt sie nichts: was schadet das?
Ihr Auge red’t, ich will ihm Antwort geben. –
Ich bin zu kühn, es redet nicht zu mir.
Ein Paar der schönsten Stern’ am ganzen Himmel
Wird ausgesandt und bittet Juliens Augen,
In ihren Kreisen unterdes zu funkeln. [...]
O, wie sie auf die Hand die Wange lehnt!
Wär ich der Handschuh doch auf dieser Hand
Und küßte diese Wange!
JULIA
Weh mir!
ROMEO
Horch! Sie spricht. O sprich noch einmal, holder Engel! [...]
JULIA
O Romeo, Romeo! Warum denn Romeo?
Verleugne deinen Vater! Deinen Namen!
Willst du das nicht, schwör dich zu meinem Liebsten,
Und ich bin länger keine Capulet!
ROMEO
Hör ich noch länger oder soll ich reden?
JULIA
Dein Nam’ ist nur mein Feind. Du bliebst du selbst,
Und wärst du auch kein Montague. Was ist
Denn Montague? Es ist nicht Hand, nicht Fuß,
Nicht Arm noch Antlitz, noch ein andrer Teil.
Was ist ein Name? Was uns Rose heißt,
Wie es auch hieße, würde lieblich duften.
So Romeo, wenn er auch anders hieße,
Er würde doch den köstlichen Gehalt
Bewahren, welcher sein ist ohne Titel.
O Romeo, leg deinen Namen ab,
Und für den Namen, der dein Selbst nicht ist,
Nimm meines ganz!
ROMEO
Ich nehme dich beim Wort!
Nenn Liebster mich, so bin ich neu getauft,
Und will hinfort nicht Romeo mehr sein.
JULIA
Wer bist du, der du, von der Nacht beschirmt,
Dich drängst in meines Herzen Rat?
ROMEO
Mit Namen
Weiß ich dir nicht zu sagen, wer ich bin.
Mein eig’ner Name, teure Heil’ge, wird,
Weil er dein Feind ist, von mir selbst gehaßt.
Hätt’ ich ihn schriftlich, so zerriss’ ich ihn.
JULIA
Mein Ohr trank keine hundert Worte noch
Von deinen Lippen, doch es kennt den Ton.
Bist du nicht Romeo, ein Montague?
ROMEO
Nein, Holde; keines, wenn dir eins mißfällt. [...]
Der Liebe leichte Schwingen tragen mich;
Kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren;
Und Liebe wagt, was irgend Liebe kann:
Drum hielten deine Vettern mich nicht auf.
JULIA
Wenn sie dich sehn, sie werden dich ermorden.
ROMEO
Ach, deine Augen drohn mir mehr Gefahr
Als zwanzig ihrer Schwerter; blick du freundlich,
So bin ich gegen ihren Haß gestählt. [...]
Liebst du mich nicht, so laß sie nur mich finden,
Durch ihren Haß zu sterben wär’ mir besser
Als ohne deine Liebe Lebensfrist. [...]
JULIA
Gut, schwöre nicht. Obwohl ich dein mich freue,
Freu ich mich nicht des Bundes dieser Nacht.
Er ist zu rasch, zu unbedacht, zu plötzlich;
Gleich allzu sehr dem Blitz, der nicht mehr ist,
Noch eh man sagen kann: es blitzt. Schlaf süß!
Des Sommers warmer Hauch kann diese Knospe
Der Liebe wohl zur schönen Blum entfalten,
Bis wir das nächste Mal uns wiedersehn.
Nun gute Nacht! So süße Ruh und Frieden,
Als mir im Busen wohnt, sei dir beschieden.
ROMEO
Ach, du verlässest mich so unbefriedigt?
JULIA
Was für eine Befriedigung begehrst du noch?
ROMEO
Gib deinen treuen Liebesschwur für meinen.
JULIA
Ich gab ihn dir, eh du darum gefleht.
Und doch, ich wollt’, er stünde noch zu geben.
ROMEO
Wollt’st du ihn mir entziehn? Wozu das, Liebe?
JULIA
Um unverstellt ihn dir zurückzugeben.
Allein ich wünsche, was ich habe, nur.
So grenzenlos ist meine Huld, die Liebe,
So tief ja wie das Meer. Je mehr ich gebe,
Je mehr auch hab’ ich: beides ist unendlich.
(II, 2)
Sie liebte mich, weil ich Gefahr bestand
Othello und Desdemona begegnen sich zum ersten Mal im Haus von Desdemonas Vater in Venedig. Othello erzählt ihrem Vater seine Kriegserlebnisse. Desdemona hört mit und verliebt sich in Othello. Die beiden heiraten heimlich. Als Desdemonas Vater davon erfährt, beschuldigt er Othello, seine Tochter »verhext« zu haben. Othello schildert ihm daraufhin, wie es dazu kam, dass Desdemona sich in ihn verliebt hat.
OTHELLO
Ihr Vater liebte mich, lud mich oft ein,
Erforschte fleißig meines Lebens Lauf,
Von Jahr zu Jahr, die Schlachten, Stürme, Schicksalswechsel,
So ich erlebt.
Ich ging es durch, vom Knabenalter her,
Bis auf den Augenblick, wo er gefragt.
So sprach ich denn von manchem harten Fall,
Von rührender Gefahr zu See und Land;
Wie ich ums Haar dem drohnden Tod entrann;
Wie mich der stolze Feind gefangen nahm,
Und mich als Sklav’ verkauft, wie ich erlöst,
Und meiner Reisen wundervolle Fahrt:
Wobei von weiten Höhlen, wüsten Steppen,
Steinbrüchen, Felsen, himmelhohen Bergen
Zu melden war im Fortgang der Geschichte;
Von Kannibalen, die einander schlachten,
Anthropophagen, Völkern, deren Kopf
Wächst unter ihrer Schulter: Das zu hören
War Desdemona eifrig stets geneigt.
Oft aber rief ein Hausgeschäft sie ab.
Und immer, wenn sie eilig dies vollbracht,
Gleich kam sie wieder, und mit durst’gem Ohr
Verschlang sie meine Rede. Dies bemerkend,
Ersah ich einst die günst’ge Stund’, und gab
Ihr Anlaß, daß sie mich recht herzlich bat,
Die ganze Pilgerschaft ihr zu erzählen,
Von der sie stückweis Einzelnes gehört,
Doch nicht mit rechter Folge. Ich begann,
Und oftmals hatt’ ich Tränen ihr entlockt,
Wenn ich ein leidvoll Abenteu’r berichtet
Aus meiner Jugend. Als ich nun geendigt,
Gab sie zum Lohn mir eine Welt von Seufzern.
Sie schwur: In Wahrheit seltsam! Wunderseltsam!
Und rührend war’s! Unendlich rührend war’s!
Sie wünschte, daß sie’s nicht gehört; doch wünschte sie
Der Himmel habe sie als solchen Mann
Geschaffen, und sie dankte mir und bat mich,
Wenn je ein Freund von mir sie lieben sollte,
Ich mög’ ihn die Geschicht’ erzählen lehren,
Das würde sie gewinnen. Auf den Wink
Erklärt’ ich mich.
Sie liebte mich, weil ich Gefahr bestand;
Ich liebte sie um ihres Mitleids willen.
Das ist der ganze Zauber, den ich brauchte.
(I, 3)
Noch farbenstrahlender, als jene Venus
Als Antonius und Kleopatra sich kennenlernen, hat Kleopatra bereits Liebesbeziehungen zu Julius Cäsar, Pompejus und anderen hinter sich – was Antonius ihr in Wut auch einmal vorwirft:
ANTONIUS
Ihr wart halb welk, eh ich euch kannte: Ha! [...]
Ich fand euch, einen kaltgeword’nen Bissen
Auf Cäsars Teller, ja ein Überbleibsel
Gnaeus Pompejus: and’rer heißer Stunden
Gedenk ich nicht, die eure Lust sich auflas,
Und nicht der Leumund nennt: denn ganz gewiß,
Wenn ihr auch ahnen mögt, was Keuschheit sei,
Ihr habt sie nie gekannt!
(III, 11)
Aus der Sicht von Antonius’ Gefolgsmann Enobarbus hört sich die erste Begegnung zwischen Antonius und Kleopatra jedoch ganz anders an. Die Textstelle ist berühmt, weil sie eng auf Shakespeares Quelle, einer Übersetzung von Plutarch, basiert. An den kleinen Veränderungen, die Shakespeare vorgenommen hat, sieht man gut, was an seinen Texten so besonders ist: Bei Shakespeare sind Wind und Segel, Wasser und Ruder ineinander verliebt und können nicht voneinander lassen, während sie miteinander kämpfen, so wie Antonius und Kleopatra.
ENOBARBUS
Die Bark’, in der sie saß, ein Feuerthron,
Brannt’ auf dem Strom: getrieb’nes Gold der Spiegel,
Die Purpursegel duftend, daß der Wind
Entzückt nachzog: die Ruder waren Silber,
Die nach der Flöten Ton Takt hielten, daß
Das Wasser, wie sie’s trafen, schneller strömte,
Verliebt in ihren Schlag: doch sie nun selbst –
Zum Bettler wird Bezeichnung: sie lag da,
In ihrem Zelt, das ganz aus Gold gewirkt,
Noch farbenstrahlender, als jene Venus,
Wo die Natur der Malerei erliegt.
Zu beiden Seiten ihr holdsel’ge Knaben,
Mit Wangengrübchen, wie Cupido lächelnd,
Mit bunten Fächern, deren Weh’n durchglühte
(So schien’s) die zarten Wangen, die sie kühlten;
Anzündend statt zu löschen. [...]
Die Dienerinnen, wie die Nereiden,
Spannten nach ihr, Sirenen gleich, die Blicke,
Und Schmuck ward jede Beugung: eine Meerfrau
Lenkte das Steuer: seid’nes Tauwerk schwoll
Dem Druck so blumenreicher Händ’ entgegen,
Die frisch den Dienst versahn. Der Bark’ entströmend
Betäubt’ ein würz’ger Wohlgeruch die Sinne
Der beiden nahen Ufer: sie zu sehn
Ergießt die Stadt ihr Volk: und Mark Anton,
Hochthronend auf dem Marktplatz, saß allein,
Und pfiff der Luft, die, wär’ ein Vakuum möglich,
Sich auch verlor, Kleopatra zu schau’n,
Und einen Riß in der Natur zurückließ. [...]
Als sie gelandet, bat Antonius sie
Zur Abendmahlzeit; sie erwiderte,
Ihr sei willkommner ihn als Gast zu sehn,
Und lud ihn. Unser höflicher Anton,
Der keiner Frau noch jemals Nein gesagt,
Zehnmal recht schmuck barbiert, geht zu dem Fest,
Und dort muß nun sein Herz die Zeche zahlen,
Wo nur sein Auge zehrte. [...] Nicht kann sie Alter
Hinwelken, täglich Sehn an ihr nicht stumpfen
Die immerneue Reizung; andre Weiber
Sätt’gen die Lust gewährend: sie macht hungrig,
Je reichlicher sie schenkt; denn das Gemeinste
Wird so geadelt, daß die heil’gen Priester
Sie segnen, wenn sie buhlt.
(II, 2)
Schöne neue Welt
In dem späten Stück Der Sturm wird Prospero, Herzog von Mailand und Magier, von seinem Bruder Antonio aus seinem Reich vertrieben und mit seiner dreijährigen Tochter Miranda in einem Boot auf dem Meer ausgesetzt. Vater und Tochter werden an eine einsame Insel gespült. Zwölf Jahre später fährt Antonio zusammen mit dem König von Neapel, Alonso, dessen Sohn Ferdinand und Gefolge mit dem Schiff nah an der Insel vorbei, auf der Prospero mit Miranda lebt. Mithilfe seines Luftgeists Ariel inszeniert Prospero einen Sturm, der die Schiffsbesatzung auf seine Insel spült. Er will späte Rache üben. Ariel trennt Ferdinand von den anderen und führt ihn zu Prospero. Dort begegnet Ferdinand Miranda, und Ariels Zauber sorgt dafür, dass die beiden sich auf den ersten Blick ineinander verlieben. Obwohl diese Entwicklung in Prosperos Sinne ist, tut er zunächst so, als wäre er gegen die Beziehung, um zu testen, wie standhaft die junge Liebe ist.
FERDINAND
Schönes Wunder,
Seid ihr ein Mädchen oder nicht?
MIRANDA
Kein Wunder,
Doch sicherlich ein Mädchen. [...] Dies ist
Der dritte Mann, den ich gesehn; der erste,
Um den ich seufzte. [...]
PROSPERO
Eins ist des andern ganz; den schnellen Handel
Muß ich erschweren, daß nicht leichter Sieg
Den Preis verringere. [...]
Du denkst, sonst gäb’ es der Gestalten keine,
Weil du nur ihn und Caliban gesehn.
Du töricht Mädchen! Mit den meisten Männern
Verglichen, ist er nur ein Caliban,
Sie Engel gegen ihn.
MIRANDA
So hat in Demut
Mein Herz gewählt; ich hege keinen Ehrgeiz,
Einen schöner’n Mann zu sehn.
(I, 2)
Prospero setzt Ferdinand gefangen und lässt ihn Holz stapeln. Miranda versucht, ihm die Arbeit abzunehmen.
FERDINAND
Es gibt mühevolle Spiele, und die Arbeit
Erhöht die Lust dran: mancher schnöde Dienst
Wird rühmlich übernommen, und das Ärmste
Führt zu dem reichsten Ziel. Dies nied’re Tagewerk
Wär’ so beschwerlich als verhaßt mir; doch
Die Herrin, der ich dien’, erweckt das Tote,
Und macht die Mühn zu Freuden. O sie ist
Zehnfach so freundlich als ihr Vater rauh,
Und er besteht aus Härte. Schleppen muß ich
Und schichten ein paar tausend dieser Klötze,
Bei schwerer Strafe. Meine süße Herrin
Weint, wenn sie’s sieht, und sagt: so knecht’scher Dienst
Fand nimmer solchen Täter. Ich vergesse;
Doch diese lieblichen Gedanken laben
Die Arbeit selbst; ich bin am müßigsten,
Wenn ich sie tue.
MIRANDA
Ach, ich bitte, plagt
Euch nicht so sehr! Ich wollte, daß der Blitz
Das Holz verbrannt, das ihr zu schichten habt.
Legt ab und ruht euch aus! Wenn dies hier brennt,
Wird’s weinen, daß es euch beschwert. Mein Vater
Steckt tief in Büchern: bitte, ruht euch aus.
Ihr seid vor ihm jetzt auf drei Stunden sicher.
FERDINAND
O teuerste Gebieterin! Die Sonne
Wird untergehn, eh ich vollbringen kann,
Was ich doch muß.
MIRANDA
Wenn ihr euch setzen wollt,
Trag’ ich indes die Klötze. Gebt mir den!
Ich bring’ ihn hin.
FERDINAND
Nein, köstliches Geschöpf!
Eh sprengt’ ich meine Sehnen, bräch den Rücken,
Als daß ihr solcher Schmach euch unterzögt,
Und ich säh’ träge zu.
MIRANDA
Es stände mir
So gut wie euch, und ich verricht’ es
Weit leichter, denn mich treibt mein guter Wille,
Und eurem ist’s zuwider. [...] Ihr seht ermüdet aus.
FERDINAND
Nein, edle Herrin,
Bei mir ist’s früher Morgen, wenn ihr mir
Am Abend nah seid. Ich ersuche euch
(Hauptsächlich um euch im Gebet zu nennen)
Wie heißet ihr?
MIRANDA
Miranda. O mein Vater!
Ich hab’ euer Wort gebrochen, da ich’s sagte. [...]
Was für Gesichter anderswo es gibt,
Ist unbewußt mir; doch bei meiner Sittsamkeit,
Dem Kleinod meiner Mitgift! wünsch ich keinen
Mir zum Gefährten in der Welt, als euch;
Noch kann die Einbildung ein Wesen schaffen,
Das ihr gefiele, außer euch. [...]
FERDINAND
Den Augenblick, da ich euch sahe, flog
Mein Herz in euern Dienst; da wohnt es nun,
Um mich zum Knecht zu machen; euretwegen
Bin ich ein so geduld’ger Tagelöhner.
MIRANDA
Liebt ihr mich? [...]
FERDINAND
Weit über alles, was die Welt sonst hat,
Lieb’ ich und acht’ und ehr’ euch.
MIRANDA
Ich bin töricht,
Zu weinen über etwas, das mich freut. [...]
FERDINAND
Warum weint ihr?
MIRANDA
Um meinen Unwert; daß ich nicht darf bieten,
Was ich zu geben wünsche [...] Fort, blöde Schlauheit!
Führ’ du das Wort mir, schlichte, heil’ge Unschuld!
Ich bin euer Weib, wenn ihr mich haben wollt;
Sonst sterb ich eure Magd; ihr könnt mir’s weigern,
Gefährtin euch zu sein, doch Dienerin
Will ich euch sein, ihr wollet oder nicht.
(III, 1)
Gegen Ende des Stücks begegnet Miranda zum ersten Mal Ferdinands Vater und seinem Gefolge. Dabei spricht sie die berühmten Worte »Schöne, neue Welt«, die der Schriftsteller Aldous Huxley als Titel für seinen 1932 veröffentlichten Roman Brave New World verwendete, der das Szenario einer totalitären Dikatur entwirft:
MIRANDA
O Wunder!
Was gibt’s für herrliche Geschöpfe hier!
Wie schön der Mensch ist! Schöne, neue Welt,
Die solche Bürger trägt!
(V, 1)
In typischer Shakespeare-Manier wird ihre Sicht der Dinge sofort durch eine andere relativiert. Ihr Vater Prospero kommentiert ihren Ausruf trocken: »Es ist dir neu.«
Wo zwei wüt’ge Feuer sich begegnen
In Der Widerspenstigen Zähmung sucht Petruchio eine Frau. Hauptsache, sie – beziehungsweise ihr Vater – ist reich und ihre Mitgift groß genug. Petruchio lässt sich daher nicht von Katharinas schlechtem Ruf als zänkische, widerspenstige Frau abschrecken. Er legt sich einen genauen Plan zurecht, wie er sich bei ihrer ersten Begegnung verhalten will.
PETRUCHIO
Ist sie unbändig, bin ich toll und wild:
Und wo zwei wüt’ge Feuer sich begegnen,
Vertilgen sie, was ihren Grimm genährt:
Wenn kleiner Wind die kleine Flamme facht,
So bläßt der Sturm Feuer und alles aus.
Das bin ich ihr, und so fügt sie sich mir,
Denn ich bin rauh und werbe nicht als Kind. [...]
Schmält sie, erwid’r ich ihr mit festem Ton,
Sie singe lieblich gleich der Nachtigall.
Blickt sie mit Wut, sag ich, sie schau so klar
Wie Morgenrosen, frisch vom Tau gewaschen.
Und bleibt sie stumm und spricht kein einzig Wort,
So rühm ich ihr behendes Sprechtalent,
Und sag, die Redekunst sei herzentzückend.
Sagt sie, ich soll mich packen, dank ich ihr,
Als bäte sie mich, Wochen da zu bleiben:
Schlägt sie mich aus, so frag ich nach dem Tag
Des Aufgebots, und wann die Hochzeit sei?
Da kommt sie schon! Und nun, Petruchio, sprich.
Guten Morgen, Käthchen, denn so heißt ihr, hör ich.
KATHARINA
Ihr hörtet recht, und seid doch hart geöhrt,
Wer von mir spricht, nennt sonst mich Katharina.
PETRUCHIO
Mein Seel, ihr lügt, man nennt euch schlechtweg Käthchen [...].
Erfahre denn, du Käthchen Herzenstrost:
Weil alle Welt mir deine Sanftmut preist,
Von deiner Tugend spricht, die reizend nennt,
Und doch so reizend nicht als dir gebührt:
Hat mich’s bewegt, zur Frau dich zu begehren.
KATHARINA
Bewegt? Ei seht! So bleibt nur in Bewegung
Und macht, daß ihr euch baldigst heimbewegt;
Ihr scheint beweglich.
PETRUCHIO
So! Was ist beweglich?
KATHARINA
Ein Feldstuhl.
PETRUCHIO
Brav getroffen! Sitzt auf mir.
(II, 1)
1Shakespeare zitiert diese Zeile aus Christopher Marlowes Gedicht Hero und Leander. Marlowe starb am 1. Juni 1593, Wie es euch gefällt hat Shakespeare aller Wahrscheinlichkeit nach 1599 verfasst.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!