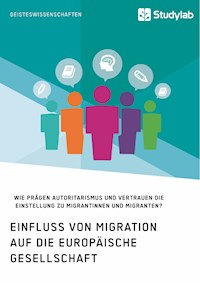
Einfluss von Migration auf die europäische Gesellschaft. Wie prägen Autoritarismus und Vertrauen die Einstellung zu Migrantinnen und Migranten? E-Book
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Studien zeigen, dass die Einstellung der Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen sehr gespalten ist: eine große Mehrheit spricht sich für die Aufnahme von Schutzsuchenden aus, andere nehmen Migration hingegen als Bedrohung war. Doch so einfach ist es nicht, denn die Einstellungen gegenüber Migrantinnen und Migranten sind vielfältiger als gemeinhin angenommen. Welche Auswirkungen hat die Flüchtlingskrise auf die Einstellung zu Migrantinnen und Migranten? Welche Rolle spielen hierbei die Prädiktoren aus Autoritarismus, interpersonellem Vertrauen und Institutionenvertrauen? Und inwieweit unterscheidet sich die Einstellung zu Flüchtlingen innerhalb der einzelnen europäischen Länder? Diese Publikation wirft einen Blick auf die Einstellung der Bevölkerung zu Migrantinnen und Migranten. Sie erläutert, wie Prädiktoren aus Autoritarismus, interpersonellem Vertrauen und Institutionenvertrauen diese Einstellung beeinflussen und welche Rolle dabei die Flüchtlingskrise spielt. Darüber hinaus leitet sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Wahrnehmung gegenüber Flüchtlingen innerhalb der einzelnen europäischen Länder ab. Aus dem Inhalt: - soziale Interaktion; - Mediationseffekte; - Right-Wing Authoritarianism; - Asylantrag; - European Social Survey
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Überlegungen zu Vertrauen, Autoritarismus und der Flüchtlingskrise
2.1 Komplexitätsreduktion und soziologische Kategorie –Konzepte des Vertrauens
2.1.1 Komplexe Systeme, Komplexitätsreduktion und Nichtwissen
2.1.2 Vertrauen als soziologische Kategorie und Einstellung
2.1.3 Arbeitsdefinition
2.2 Von der F-Skala zum RWA – Entwicklungen des Autoritarismuskonzeptes
2.2.1 Der Autoritarismus der Frankfurter Schule
2.2.2 Unterwürfigkeit, Aggression und Konventionalismus – der Right-Wing-Authoritarianism Altemeyers
2.2.3 Arbeitsdefinition
2.2.4 Vorurteile und deren zentrale Rolle
2.3 Die Rolle der „Flüchtlingskrise“
3 Hypothesen
4 Datenauswahl und Untersuchungsaufbau
5 Operationalisierung
6 Empirische Untersuchungen
6.1 Vorangestellte grundlegende Datenanalyse
6.1.1 Skalenreliabilität
6.1.2 Summenindizes
6.1.3 Zusammenführung
6.2 Strukturgleichungsmodell
6.2.1 Faktorenanalyse
6.2.2 Messmodelle
6.2.3 Globales Strukturgleichungsmodell
6.2.4 Ergebnisse des Strukturgleichungsmodells
6.3 Hypothesentest
6.4 Mediationseffekte
7 Vergleichende Betrachtung und Besonderheiten
8 Fazit, Kritik und Ausblick
Anhänge
Länderbetrachtung
Abbildungen
Tabellen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Asylanträge in EU-Mitgliedsstaaten zwischen 2012 und 2018
Abbildung 2: Kausale Wirkungsweisen der Hypothesen
Abbildung 3: Operationalisierte Items
Abbildung 5: Globales Strukturgleichungsmodell
Abbildung 6: Mediationsmodell
Abbildung 7: Human-Values Fragebatterie
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Cronbach's Alpha
Tabelle 2: Mittelwerte Items 2012
Tabelle 3: Mittelwerte Items 2016
Tabelle 4: Mittelwertdifferenzen von 2012 zu 2016
Tabelle 5: Invarianztests
Tabelle 6: Ergebnisse SEM
Tabelle 7: Direkte, indirekte und totale Mediationseffekte
Tabelle 8: STATA Output unrotierte Faktorladungsmatrix über alle für Belgien
Tabelle 9: STATA Output Faktormatrix über alle für Belgien
Tabelle 10: STATA Output rotierte Faktorladungsmatrix über alle für Belgien
Tabelle 11: STATA Output Eigenwerte Faktorenanalyse über alle für Belgien
Tabelle 12: STATA Output rotierte Eigenwerte des Institutionenvertrauens für Belgien
Eine vom biologischen Geschlecht gelöste Bedeutung der geschlechtlichen Identität ist wichtig und in unserer immer noch heteronormativen Gesellschaft mehr als erstrebenswert. Ich bitte dennoch um Verständnis für die nicht gendergerechte Sprache, auf die in dieser Arbeit auf Grund der einfacheren Lesart zurückgegriffen wurde.
1 Einleitung
Eine Masterarbeit nach einem Zitat des rechtsnationalistischen Ministerpräsidenten Ungarns, Viktor Orbán, zu benennen, scheint auf einen ersten Blick zunächst einmal genauso populistisch wie Orbáns Aussage selbst. Dennoch ist die Aussage für diese Arbeit von nahezu zentraler Wichtigkeit. Was Orbán mit der Kategorisierung der Flüchtlingskrise oder Flüchtlingswelle als Invasion bezwecken will, ist vollkommen klar und aus seiner Sichtweise und vor allem für seinen Zweck logisch und notwendig. Seinen Ursprung im lateinischen invadere kennend, ist der Begriff der Invasion heute streng mit feindseligen militärischen Operationen verknüpft, die auf fremdem Gebiet stattfinden. Einhergehend mit der Definition der Flüchtlingskrise als Invasion sieht Orbán dementsprechend die Flüchtlinge als Invasoren und zwar gezielt als muslimische Invasoren (vgl. welt.de 2018). Orbán unterstellt also den Flüchtlingen, dass diese im Rahmen einer gezielten Operation in das Hoheitsgebiet seines Landes und schlussendlich in den Raum der Europäischen Union eindringen. Die so in das Gebiet der EU eindringenden Flüchtlinge tun dies, wie bei einer Invasion üblich, aus einem bestimmten Grund, den Orbán in der Suche nach einem besseren Leben begründet sieht. Das Problem, das hierdurch entsteht ist, dass bei einer Invasion im Normalfall etwas weggenommen oder zerstört wird. In diesem konkreten Fall geht es dabei weniger um Areale oder Ländergrenzen wie in früheren Zeiten, vielmehr geht es um Besitz, Kultur oder den wie auch immer zu definierenden Begriff der Heimat.
Was für diese Arbeit wirklich bedeutsam ist, ist die Bedrohungslage, die durch Aussagen wie die Orbáns aufgebaut wird. Jene Bedrohungslage ist einer der Hauptgründe für eine autoritäre Unterwürfigkeit, die im weiteren Verlauf noch diskutiert wird. Es ist ebenfalls davon auszugehen ist, dass ob der Bedrohungslage, die durch eine bestimmte und gut abzugrenzende Gruppe hervorgerufen wird, jene Gruppe eine vorurteilsbehaftete Abwertung erfährt – was schlussendlich zum Inhalt dieser Arbeit führt. Hierbei soll sich vom populistischen Ansatz, der quasi von allen (rechts)populistischen Parteien der Europäischen Union vertreten wird, gelöst werden und eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung erstellt werden, die als Kern die Einstellung zu Migranten und deren Veränderung durch die Flüchtlingskrise untersucht. Hierzu werden im Rahmen der theoretisch zu begründenden Herleitung der Hypothesen drei Einflussfaktoren auf die Einstellung zu Migranten fokussiert. Die bereits erwähnte autoritäre Unterwürfigkeit wird hierbei ebenso in das Beobachtungsfeld aufgenommen, wie eine autoritäre Aggression und der Konventionalismus, die sich als Basis des rechtsgerichteten Autoritarismus im Sinne Altemeyers darstellen:
„By “right-wing authoritarianism” I mean the combination of the following three attitudinal clusters in a person: Authoritarian submission […]. Authoritarian aggression […]. Conventionalism […].” (Altemeyer 1988, S. 2)
Jener rechtsgerichtete Autoritarismus stellt sich in der modernen Vorurteilsforschung als stärkster Prädiktor von Vorurteilen dar, wie beispielsweise Ekehammar et al. (2004) zeigen.
Hinzu kommen zwei Arten des Vertrauens, die zunächst ob ihrer Art entlang der Ausführungen Luhmanns, und besonders derer Giddens, erarbeitet werden und mit moderneren Konzepten und Betrachtungsweisen des Phänomens Vertrauen verglichen und erweitert werden. Am Ende der Betrachtung des Vertrauens werden, eben jene hier wichtigen zwei Arten des Vertrauens, erkennbar. Dabei deckt das interpersonelle Vertrauen alle jene Bereiche, in denen ein direkter Kontakt zu der Person, der vertraut wird, ab. Das Institutionenvertrauen übernimmt diese Rolle in eben jenen Bereichen, wo über das interpersonelle Vertrauen hinaus zudem ein Vertrauen in eine Institution besteht. Hierbei zeigt das Institutionenvertrauen im Untersuchungsaufbau eine weitere Unterteilung in einen, hier nur verkürzt darzustellenden, Bereich von partikularen und einen Bereich der universalistischen Interessen. Schlussendlich soll die Rolle der Flüchtlingskrise und deren Auswirkung auf die Einstellung zu Migranten genauso untersucht werden, wie ihre Auswirkung auf Teile der verschiedenen Prädiktoren. Um der Größe des Kontextes Rechnung zu tragen, sollen all diese Beobachtungen in einem europäischen Vergleich betrachtet werden.
Das Ziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, wie die Flüchtlingskrise Einfluss auf die Einstellung zu Migranten genommen hat und welche Rolle hierbei die Prädiktoren aus Autoritarismus, interpersonellem Vertrauen und Institutionenvertrauen spielen, und all dies vor dem Hintergrund eines europäischen Vergleichs. Der Anspruch an die Ergebnisse, der hierbei besteht und der durch die äußerst diverse Struktur der europäischen Länder erschwert wird, definiert sich neben den üblichen Gütekriterien vor allem über die Vergleichbarkeit der betrachteten Länder untereinander. Am Ende der Arbeit sollte es somit möglich sein, konkrete Aussagen zur Wirkweise der Prädiktoren und der Flüchtlingskrise in einzelnen Ländern zu machen und diese Ergebnisse auf einem europäischen Niveau zu vergleichen, die in einem solchen Umfang bis hierher nicht bekannt sind.
Um den Gesamtkontext adäquat erfassen, darstellen und prozessieren zu können, werden verschiedene quantitative statistische Verfahren benötigt, die sich an dieser Stelle gegenüber qualitativen Verfahren ob der Verfügbarkeit der Empirie durchgesetzt haben. Hierbei stellt das in den Sozialwissenschaften eher selten verwendete Strukturgleichungsmodell als eine Kombination aus Pfad- und Faktorenanalyse eine sehr gute Möglichkeit dar, alle vermuteten Effekte gleichzeitig und in Relation zueinander abzubilden. Mit einem Strukturgleichungsmodell ist es möglich, sowohl latent, wie auch manifest auftretende Phänomene innerhalb eines gemeinsamen Modells zu verarbeiten. Hinzu kommt, als großer Vorteil einer quantitativen Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes, die Möglichkeit auf unter wissenschaftlichen Standards erhobene Datensätze zurückgreifen zu können und diese nicht selbstständig erfassen zu müssen, was den Rahmen dieser Arbeit deutlich überschreiten würde.
Der Datensatz, der in dieser Arbeit verwendet werden soll, entspringt dem European Social Survey (ESS) aus den Jahren 2012 und 2016, da der ESS als „biennial cross-national survey of attitudes and behaviour“ (ESS 2019) alle benötigten Items bereitstellt, um die Prädiktoren in guter Näherung abbilden zu können und in mehreren, je nach Runde teilweise variierenden, europäischen Ländern durchgeführt wird. Hierbei werden die Daten in computergestützten face-to-face-Interviews erfasst. Zudem ist der ESS im Sinne der Nachvollziehbarkeit kostenfrei zugänglich. Allerdings besteht das Problem, dass der ESS als Querschnittsstudie angelegt ist und somit immer nur Momentaufnahmen ermöglicht. Damit eine Beurteilung der Veränderung innerhalb der Prädiktoren und innerhalb des Modells erfolgen kann, werden die beiden Datensätze zusammengefügt und in dem bereits beschriebenen Strukturgleichungsmodell prozessiert. Hierzu werden zunächst die Daten der 20 Länder, die in beiden Datensätzen vorhanden sind, zu einem großen Datensatz zusammengeführt, der dann die Jahrgänge als kategoriale Variable kennt. Hierbei bildet der ESS Runde 6 (2012) den Betrachtungspunkt vor und der ESS Runde 8 (2016) den Betrachtungspunkt nach der Flüchtlingskrise ab. Mit diesem sodann neu erstellten Datensatz wird das Strukturgleichungsmodell geschätzt.
Um das Ziel dieser Arbeit, die Einflüsse von Autoritarismus und Vertrauen auf die Einstellung zu Migranten vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise betrachten und erarbeiten zu können, unterteilt sich diese Arbeit nach der Einleitung in weitere sieben Kapitel. Im zweiten Kapitel, das sich aus drei Unterpunkten zusammensetzt und die theoretische Grundlage dieser Arbeit bildet, werden die zwingend notwendigen Grundlagen des Vertrauensbegriffs, wie bereits angerissen, anhand der Ausführungen von Giddens (1996), Luhmann (2000) und Simmel (1992) dargestellt, wobei ein besonderer Fokus auf Giddens Konsequenzen der Moderne (1996) und Luhmanns Werk Vertrauen
2 Theoretische Überlegungen zu Vertrauen, Autoritarismus und der Flüchtlingskrise
Die zentralen Überlegungen dieser Arbeit funktionieren nur über ein tieferes theoretisches Verständnis der drei in der Kapitelüberschrift genannten Begrifflichkeiten des Vertrauens, des Autoritarismus und der Flüchtlingskrise. Das folgende Kapitel befasst sich deshalb mit eben jenen und hat als Ziel eine Arbeitsdefinition, die sich in einem weiteren Schritt als operationalisierbar zeigt. Hierzu werden verschiedene Konzepte, die sich teilweise stark, teilweise nur marginal unterscheiden, dargestellt und in Verbindung zueinander gesetzt.
Begonnen wird mit dem Komplex des Vertrauens, dem schon Luhmann zentrale Bedeutung für das soziale Zusammenleben zusprach:
„Der Mensch hat zwar in vielen Situationen die Wahl, ob er in bestimmten Hinsichten Vertrauen schenken will oder nicht. Ohne jegliches Vertrauen aber könnte er morgens sein Bett nicht verlassen.“ (Luhmann 2000, S. 1)
2.1 Komplexitätsreduktion und soziologische Kategorie –Konzepte des Vertrauens
Das Vertrauen, welches, wie bereits kurz in der Einleitung erwähnt und in mindestens einer der Hypothesen vertreten, mindestens in zwei verschiedenen Arten Einfluss auf die Einstellung zu Migranten haben sollte, bedarf einer konkreten sozialwissenschaftlichen oder soziologischen Bestimmung, welche sich keinesfalls trivial darstellt, was in besonderem Maße auf der „[…] trockenen Luft der theoretischen Abstraktion […]“ (Hartmann in Hartmann u. Offe 2001, S. 8) beruhe und Vertrauen generell empirisch nur schwer zu belegen sei, wie Hartmann feststellt (vgl. Hartmann in ebd., S. 8) und wie sich in einschlägiger Fachliteratur, zum Beispiel im Sammelband Vertrauen von Hartmann und Offe (2001), zeigt. Hierbei liegt die besondere Schwierigkeit in der korrekten Identifizierung bestimmter Subkategorien des Vertrauens, sowie in einem generellen Grundkonsens, was, ob oder wie Vertrauen ist. Dies sollte dennoch durch verschiedene theoretische Vorannahmen durchaus möglich sein.
Auf grundlegenden Konzepte, wie beispielsweise von Luhmann oder Giddens, aufbauend, werden sodann modernere Konzepte des Vertrauens, wie beispielsweise von Peter Preisdörfer oder Martin Hartmann dargestellt. Schlussendlich geschieht all dies vor dem Hintergrund einer eigenen, operationalisierbaren Definition des Vertrauens, die den Begrenzungen dieser Arbeit gerecht wird und dennoch alle wesentlichen und notwendigen Elemente einer belastbaren Arbeitsdefinition beinhaltet.
2.1.1 Komplexe Systeme, Komplexitätsreduktion und Nichtwissen
Um die Komplexität des Vertrauens, das elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft ist,[1] auf ein für diese Arbeit hinreichendes Niveau zu reduzieren, werden in der Folge dieses Unterkapitels zunächst drei grundlegende Theorien des Vertrauens dargestellt, die sich teilweise überschneiden, teilweise gänzlich verschiedene Facetten aufzeigen oder schlicht auf anderen Grundlagen beruhen. Hierfür wurden die Ausführungen von Anthony Giddens, Niklas Luhmann und Georg Simmel ausgewählt, da diese, wie zu zeigen sein wird, alle elementaren Bereiche des hier benötigten Verständnisses des Vertrauens abdecken.
Folgt man Giddens (1996) in seinen Konsequenzen der Moderne so unterscheiden sich zunächst zwei Formen von Bindungen – gesichtsabhängige und gesichtsunabhängige (vgl. Giddens 1996, S. 103). Hierbei beschreibt er gesichtsabhängige Bindungen als „[…] Vertrauensbeziehungen, deren Aufrechterhaltung oder Äußerung in sozialen Zusammenhängen erfolgt, die durch Situationen gemeinsamer Anwesenheit hergestellt werden“ (ebd., S. 103). Gesichtsunabhängige Bindungen hingegen betreffen abstrakte Systeme, die Giddens mit symbolischen Zeichen oder Expertensystemen beschreibt. Es besteht nach Giddens also eine Zweiteilung des Vertrauens auf einer persönlichen, individuellen und einer abstrakten, systembezogenen Ebene – wobei eine systembezogene Ebene auch individuelle Züge enthalten kann und, und das soll an dieser Stelle bereits herausgestellt werden, Giddens äußert die These, dass sich beide Bindungen oder Vertrauensarten beeinflussen könnten (vgl. ebd., S. 103).
Betrachtet man Giddens Ausführungen, eingebettet in sein Gesamtwerk, zu gesichtsabhängigen Bindungen, und besonders deren Veränderungen in der Moderne, so sind diese geprägt von den Vorannahmen des simmel’schen Fremden und der goffman’schen höflichen Nichtbeachtung (vgl. ebd., S. 103ff). Anders als in vormodernen Gesellschaften, in denen „[…] lokale Gemeinschaften stets die Grundlage der umfassenderen Gesellschaftsorganisation […]“ (ebd., S. 103) bildeten und in denen sich Fremder auf eine ganze Person bezöge, welche zudem als potentiell gefährlich einzustufen sei, zeigten sich in modernen Gesellschaften, und hier besonders in städtischer Umgebung, andere Muster (vgl. ebd., S. 103f). So sei die Interaktion mit anderen in einer städtischen Umgebung geprägt von Flüchtigkeit und beruhe auf der bereits erwähnten höflichen Nichtbeachtung, welche keineswegs mit Gleichgültigkeit zu verwechseln sei, vielmehr handele es sich um eine „[…] Darstellung verbindlicher Abstandhaltung […]“ (Giddens 1996, S. 104). Giddens beschreibt den Vorgang der höflichen Nichtbeachtung in Anlehnung an Goffman als Abblenden der Lichter und somit als „[…] Versicherung […], man habe keine feindlichen Absichten“ (ebd., S. 105).[2] Giddens erkennt die höfliche Nichtbeachtung als elementar für Vertrauen:
„Die Aufrechterhaltung der höflichen Nichtbeachtung ist offenbar eine ganz allgemeine Vorbedingung des Vertrauens, das bei normalen Begegnungen mit Fremden an öffentlichen Orten vorausgesetzt wird.“ (ebd., S. 105)
Während Giddens die höfliche Nichtbeachtung als grundlegendste Art seiner gesichtsabhängigen Bindungen beim Aufeinandertreffen mit Fremden erkennt und sie, erneut im goffman’schen Duktus, als nichtfokussierte Interaktion kennzeichnet, ändere sich deren Stellenwert bei der fokussierten Interaktion (vgl. ebd., S. 106). Kommt es zu einer Begegnung, also nicht zum bloßen flüchtigen Kontakt im Vorbeigehen, gleichen sich laut Giddens drei Mechanismen aus; Vertrauen, Takt und Macht (vgl. ebd., S. 106). Hierbei erkennt Giddens Takt und Höflichkeitsrituale als Schutzvorrichtungen, die stillschweigend gebraucht werden, während Machtunterschiede besonders in Begegnungen mit gesteigerter Vertrautheit „[…] zur Verletzung der Normen des Takts und Höflichkeitsritualen führen“ (vgl. ebd., S. 106f).
Giddens zweite Kategorie des Vertrauens, die gesichtsunabhängigen Bindungen, die abstrakte Systeme betreffen, setzen zunächst keine „[…] Begegnungen mit Individuen oder Gruppen voraus, die in irgendeiner Weise dafür verantwortlich sind“ (ebd., S. 107). Kommt es dennoch zu jenen Begegnungen, beschreibt Giddens diese als Zugangspunkt und verdeutlicht, dass es hier zu einer Berührung zwischen gesichtsabhängigen und gesichtsunabhängigen Bindungen kommt, wird dem abstrakten System doch gewissermaßen ein Gesicht verliehen, da es durch ein Individuum repräsentiert wird (vgl. ebd., S. 107).[3],[4] Giddens attestiert den Zugangspunkten eine große Wichtigkeit beim Vertrauen in abstrakte Systeme, da hier durch eine Laie-Experte-Begegnung und über das Vehikel der gesichtsabhängigen Bindung, Vertrauen in ein abstraktes System hergestellt wird (vgl. Giddens 1996, S. 109f). Elementarer Bestandteil dieser Begegnung und des Aufbaus von Vertrauen in abstrakte Systeme sind zwei Faktoren – Auftreten und Beruhigung. Dem Auftreten des Repräsentanten des abstrakten Systems misst Giddens dabei Bedeutung bei, da dieser eben jenes vertritt und somit durch sein Auftreten[5] entscheidend am Vertrauensaufbau mitwirkt. Die Beruhigung ist von Nöten, da der Laie das abstrakte System, inklusive seines im Verborgenen liegenden Expertenwissens und der daran gekoppelten Praktiken, nicht durchblicken kann, er aber dennoch das Gefühl benötige, sich in guten Händen zu befinden (vgl. ebd., S. 109f).
Das grundlegende Vertrauen, welches die meisten Menschen in Expertensysteme hätten, sieht Giddens insbesondere in der kindlichen Sozialisation hinsichtlich der Naturwissenschaften gegeben, welche eine „[…] Aura der Achtung vor allen Arten des Fachwissens […]“ (ebd., S. 114) vermittle, welche sich wiederum als „[…] Einstellung der Achtung vor den meisten Formen von Fachspezialistentum“ (ebd., S. 114) manifestierte. Giddens beschreibt das Verhältnis von Laie und Expertensystem als ambivalent, denn einerseits muss der Laie dem Expertensystem ob seiner eigenen Unkenntnis vertrauen, andererseits liefere Unkenntnis auch immer Gründe für Skepsis (vgl. ebd., S. 114f). Die Lösung dieses Dilemmas sieht Giddens durch die pragmatische Sicht eines, in einer modernen Gesellschaft nahezu alternativlosen, „[…] Sichabfinden[s] [sic] mit Umständen, unter denen andere Alternativen weitgehend ausgeschlossen sind“ (ebd., S. 115), was wiederum nicht bedeute, dass innerhalb des Sichabfindens nicht Deutungs- oder Handlungsspielräume bestünden (vgl. ebd., S. 115f).
Giddens Ausführungen zum Vertrauen lassen sich bis hier her also wie folgt zusammenfassen; Es bestehen, wie zuvor erwähnt, zwei Formen von Vertrauen – gesichtsabhängige Bindungen, die besonders auf zwischenmenschlichen Interaktionen beruhen und gesichtsunabhängige Bindungen, die zwischen Individuen und abstrakten Systemen bestehen, welche wiederum durch Individuen repräsentiert werden. Hierbei wird das Vertrauen in Personen als „[…] Anzeichen für Integrität […]“ (ebd., S. 112) gedeutet und das Vertrauen in Systeme als „[…] Glaube an die Leistungsfähigkeit von Kenntnissen, über die der Laie kaum Bescheid weiß […]“ (ebd., S. 112) verstanden. Des Weiteren ist die Grundlage allen Vertrauens Unkenntnis und zwar entweder auf einer interpersonellen oder einer abstrakten, von Expertensystemen geprägten, Ebene, wie Giddens schlussfolgert.
„Denn Vertrauen wird nur dort verlangt, wo es Unkenntnis gibt, sei es mit Bezug auf die Wissensansprüche technischer Experten oder mit Bezug auf die Gedanken und Absichten vertrauter Personen, auf die sich der Betreffende verlässt.“ (Giddens 1996, S. 114)





























