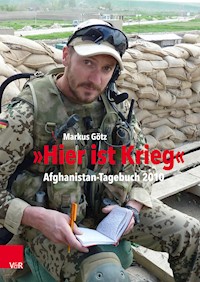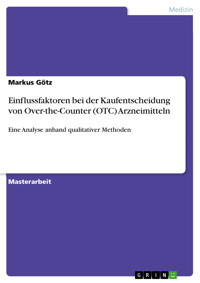
Einflussfaktoren bei der Kaufentscheidung von Over-the-Counter (OTC) Arzneimitteln E-Book
Markus Götz
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Gesundheit - Sonstiges, Note: 1,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Auf dem OTC-Arzneimittelmarkt kann der Konsument frei über die Wahl eines Medikamentes entscheiden, muss dafür aber normalerweise die Kosten selbst tragen. Dabei können viele Faktoren Einfluss auf den potenziellen Käufer ausüben. Zu diesen zählen, neben Preis und Marke, vor allem Informationsquellen, wie Ärzte, Apotheker, persönliche Erfahrungen, Meinungen und Erfahrungen von Familie, Freunden und Bekannten und Massenmedien, wie das Fernsehen, Printmedien und das Internet. Die Quellen müssen für den Endverbraucher gleichwohl sicher und glaubwürdig sein, da sie die Aufgabe haben, ihn über Anwendungsgebiete, Wirkungsweisen, Risiken und Nebenwirkungen von Selbstmedikationsarzneimitteln aufzuklären. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen am Pharmamarkt in den letzten Jahren und den Informationsmöglichkeiten der Konsumenten stellt sich nun die Frage: „Was sind die typischen Einflussfaktoren bei der Kaufentscheidung für ein OTC-Arzneimittel?“ Diese Frage stellt die zentrale Leitfrage der nachfolgenden Arbeit dar und soll insbesondere durch eine systematische Literaturrecherche und persönliche Interviews mit Konsumenten und Apothekern beantwortet werden. Zur Unterstützung und Konkretisierung der Beantwortung der Leitfrage und zur Erlangung eines verständlicheren Bildes der Kaufmerkmale von OTC-Präparaten soll noch weiteren Fragen Rechnung getragen werden: - „Welche persönlichen Merkmale des Konsumenten haben Auswirkungen auf die Entscheidung für ein Produkt?“ - „Welche Kanäle nutzen Verbraucher zur Informationsgewinnung bezüglich eines OTC-Arzneimittels? - „Welche das OTC-Arzneimittel betreffende Eigenschaften beeinflussen die Wahl für einen Artikel?“ Die Grundlage dieser Arbeit basiert auf der Betrachtung des Over-the-Counter-Arzneimittelmarktes in Deutschland und dessen Besonderheiten sowie der Darstellung der Merkmale beim Erwerb eines Selbstmedikationsproduktes. Anschließend werden die Einflussfaktoren beim Kauf von OTC-Präparaten anhand eines systematischen Literaturüberblicks und anhand von persönlichen Leitfadeninterviews herausgearbeitet, um die daraus gewonnen Erkenntnisse abschließend kritisch zu diskutieren. Interviewtranskripte nicht im Lieferumfang enthalten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Hinweis zur Verwendung des generischen Maskulinums
1.Einleitung
2. Der Over-the-Counter-Arzneimittelmarkt in Deutschland
2.1. Begriffliche Grundlagen zur Systematisierung des Arzneimittelmarktes und Abgrenzung des OTC-Segmentes
2.2. Aktuelle Daten und Fakten des deutschen OTC-Marktes
2.3. Entwicklungen am Arzneimittelmarkt und deren Auswirkungen auf den OTC-Bereich
2.3.1. Politisch-rechtliche Rahmenbedingungen
2.3.2. Strukturelle Veränderungen
2.3.3. Veränderungen in der Gesellschaft – Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortung
3. Merkmale des Kaufs eines OTC-Arzneimittels
3.1. Die Apotheke als Verkaufsort
3.2. Typologie der Verwender von OTC-Arzneimitteln
3.3. Mögliche Einflüsse auf die Kaufentscheidung
3.3.1. Persönliche Erfahrungen und Merkmale der Konsumenten
3.3.2. Informationsquellen der Konsumenten
3.3.3. Eigenschaften des OTC-Arzneimittels
3.4. Der Entscheidungsprozess einer Produktwahl
4. Einflussfaktoren bei der Kaufentscheidung von OTC-Arzneimitteln – Ein Literaturüberblick
4.1. Vorangehende Bemerkungen
4.2. Methodik des systematischen Literaturüberblicks
4.2.1. Zielsetzung
4.2.2. Datenbankenauswahl
4.2.3. Suchstrategie
4.2.4. Ein- und Ausschlusskriterien
4.2.5. Ablauf der Recherche
4.3. Ergebnisse des systematischen Literaturüberblicks
4.3.1. Vorangehende Bemerkungen
4.3.2. Identifikation der Einflussfaktoren
4.3.3. Charakterisierung der Einflussfaktoren
4.4. Fazit des Literaturüberblicks und weiteres Vorgehen
5. Die empirische Untersuchung
5.1. Die qualitative Forschung als Methodik der empirischen Untersuchung
5.2. Forschungsdesign
5.2.1. Vorangehende Bemerkungen
5.2.2. Zielsetzung und Fragestellung
5.2.3. Instrument zur Erhebung der Daten
5.2.4. Aufbereitung der Daten
5.2.5. Verfahren zur Auswertung der Daten
5.3. Durchführung der Erhebung der Daten
5.3.1. Vorangehende Bemerkungen
5.3.2. Interviews mit Konsumenten
5.3.3. Interviews mit Apothekern
5.4. Ergebnisse der empirischen Untersuchung
5.4.1. Einflussfaktoren aus Konsumentensicht
5.4.2. Charakterisierung der Ergebnisse der Konsumenteninterviews
5.4.4. Charakterisierung der Ergebnisse der Apothekerinterviews
5.4.5. Zusammenfassender Vergleich und Diskussion der Ergebnisse der Interviews mit den Konsumenten und den Apothekern
5.4.6. Vergleich der Ergebnisse der empirischen Untersuchung mit den Erkenntnissen der systematischen Literaturrecherche
5.4.7. Zentrale Ergebnisse der Arbeit
5.4.8. Limitationen und Ausblick
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Struktur des deutschen Fertigarzneimittelmarktes
Abbildung 2: Umsatz rezeptfreier Arzneimittel in der Apotheke
Abbildung 3: Der Gesundheitsbegriff aus Konsumentensicht
Abbildung 4: Wachsender Trend zur Selbstmedikation
Abbildung 5: Kaufphasenmodell
Abbildung 6: Schema Informations- und Beratungsgespräch bei Selbstmedikation
Abbildung 7: Standardsuchanfrage der Literaturrecherche
Abbildung 8: Ablauf der Literaturrecherche
Abbildung 9: Verteilung der Studien nach Ländern und Kontinenten (N=10)
Abbildung 10: Anzahl der Nennungen der Themenblöcke
Abbildung 11: Ablaufmodell eines Leitfadeninterviews
Abbildung 12: Ablaufmodell einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse
Abbildung 13: Häufigkeitsverteilung der Interviews nach Dauer (Konsumenten)
Abbildung 14: Häufigkeitsverteilung der Interviews nach Dauer (Apotheker)
Abbildung 15: Anzahl der Nennungen der Einflussfaktoren (Konsumenten)
Abbildung 16: Anzahl der Nennungen der Faktoren als wichtigste Einflussquelle (Konsumenten)
Abbildung 17: Anzahl der Nennungen der Einflussfaktoren (Apotheker)
Abbildung 18: Anzahl der Nennungen der Faktoren als wichtigste Einflussquelle (Apotheker)
Abbildung 19: Gesamtanzahl der Nennungen der Einflussfaktoren über alle Interviews hinweg
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Der Arzneimittelmarkt in Deutschland
Tabelle 2: Umsatzstärkste Indikationsbereiche der Selbstmedikation
Tabelle 3: Informationsquellen zu OTC-Arzneimitteln
Tabelle 4: Ein- und Ausschlusskriterien der Literaturrecherche
Tabelle 5: Übersicht der identifizierten Studien sortiert nach (Erst-)Autor
Tabelle 6: Interviewleitfaden der Konsumenteninterviews
Tabelle 7: Interviewleitfaden der Apothekerinterviews
Tabelle 8: Suchanfragen nach Datenbanken
Abkürzungsverzeichnis
Hinweis zur Verwendung des generischen Maskulinums
1.Einleitung
Der Gesundheitsmarkt ist einer der wachstumsstärksten und zugleich dynamischsten Märkte in Deutschland, der durch zahlreiche politisch-rechtliche, sozio-ökonomische und verhaltensorientierte Faktoren beeinflusst wird. Ein festzustellender Trend auf diesem Markt ist die Zunahme der Selbstmedikation. Diese Tendenz lässt sich einerseits mit Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen in den letzten Jahren und andererseits mit gesellschaftlichen Entwicklungen, wie dem zunehmenden Bedürfnis der Menschen nach gesundheitlicher Eigenverantwortung, erklären.
Die deutschen Gesundheitsausgaben für das Jahr 2012 beliefen sich auf 300,4 Mrd. Euro[1] und hatten einen Anteil von 10,9%[2] am Bruttoinlandsprodukt. Der Gesundheitsmarkt stellt somit einen der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren dar. Am Arzneimittelmarkt fielen im gleichen Zeitraum Ausgaben in Höhe von 39,8 Mrd. Euro an, was einem Anteil von 13,2% an den gesamten Gesundheitsausgaben entspricht; der Anteil von Over-the-Counter (OTC)-Arzneimitteln betrug 4,4 Mrd. Euro bzw. 11,1% aller Arzneimittelaufwendungen.[3] Der OTC-Arzneimittelmarkt setzt sich dabei aus rezeptfreien, aber apothekenpflichtigen Arzneimitteln und freiverkäuflichen Medikamenten zusammen.[4]
Im vergangenen Jahrzehnt gab es einige Gesetzesänderungen im deutschen Gesundheitswesen, die den Pharmamarkt und damit auch den OTC-Markt betrafen. Die für den Markt verschreibungsfreier Arzneimittel gravierendste Veränderung ergab sich durch das GKV-Modernisierungsgesetz, das zum 1. Januar 2004 in Kraft trat. Seitdem sind zum einen nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht mehr erstattungsfähig und zum anderen wurde deren Preisbindung aufgehoben. Dadurch entstand ein Preiswettbewerb für diese Präparate, da die Apotheken deren Preise nun frei kalkulieren können.[5] Des Weiteren ist es am Selbstmedikationsmarkt wichtig zu regeln, wie und welche Produktinformationen an den Kunden kommuniziert werden dürfen. Dafür sind u.a. das Heilmittelwerbegesetz und das Arzneimittelgesetz zuständig.[6]
Nicht nur regulatorische Bestimmungen verändern das Gesundheitswesen, sondern auch Entwicklungen in der Gesellschaft. Der Mensch von heute hat ein höheres Selbstverantwortungsgefühl gegenüber seiner eigenen Gesundheit und dadurch das Bedürfnis verständliche und verlässliche Informationen zur Mitgestaltung seines eigenen Wohlbefindens zu erhalten.[7] Dieser Trend zu mehr Patienten-Eigenverantwortung findet sogar Beachtung im Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (§ 140f. SGB V). Ein Patient bzw. Verbraucher von Arzneimitteln möchte sich in der heutigen Zeit nicht mehr alleine auf die Verordnung bzw. Empfehlung eines Arztes oder Apothekers verlassen, sondern er will bei seiner eigenen Gesundheit mitbestimmen und dabei insbesondere auch die Arzneimittelnutzung kritisch hinterfragen.[8]
Auf dem OTC-Arzneimittelmarkt kann der Konsument frei über die Wahl eines Medikamentes entscheiden, muss dafür aber normalerweise die Kosten selbst tragen.[9] Dabei können viele Faktoren Einfluss auf den potenziellen Käufer ausüben. Zu diesen zählen, neben Preis und Marke, vor allem Informationsquellen, wie Ärzte, Apotheker, persönliche Erfahrungen, Meinungen und Erfahrungen von Familie, Freunden und Bekannten und Massenmedien, wie das Fernsehen, Printmedien und das Internet.[10] Die Quellen müssen für den Endverbraucher gleichwohl sicher und glaubwürdig sein, da sie die Aufgabe haben, ihn über Anwendungsgebiete, Wirkungsweisen, Risiken und Nebenwirkungen von Selbstmedikationsarzneimitteln aufzuklären.[11]
Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Entwicklungen am Pharmamarkt und den Informationsmöglichkeiten der Konsumenten stellt sich nun die Frage:
„Was sind die typischen Einflussfaktoren bei der Kaufentscheidung für ein OTC-Arzneimittel?“
Diese Frage stellt die zentrale Leitfrage der nachfolgenden Arbeit dar und soll insbesondere durch eine systematische Literaturrecherche und persönliche Interviews mit Konsumenten und Apothekern beantwortet werden. Zur Unterstützung und Konkretisierung der Beantwortung der Leitfrage und zur Erlangung eines verständlicheren Bildes der Kaufmerkmale von OTC-Präparaten soll noch weiteren Fragen Rechnung getragen werden:
„Welche persönlichen Merkmale des Konsumenten haben Auswirkungen auf die Entscheidung für ein Produkt?“
„Welche Kanäle nutzen Verbraucher zur Informationsgewinnung bezüglich eines OTC-Arzneimittels?
„Welche das OTC-Arzneimittel betreffende Eigenschaften beeinflussen die Wahl für einen Artikel?“
Die Grundlage dieser Arbeit basiert auf der Betrachtung des Over-the-Counter-Arznei-mittelmarktes in Deutschland und dessen Besonderheiten sowie der Darstellung der Merkmale beim Erwerb eines Selbstmedikationsproduktes. Anschließend werden die Einflussfaktoren beim Kauf von OTC-Präparaten anhand eines systematischen Literaturüberblicks und anhand von persönlichen Leitfadeninterviews herausgearbeitet, um die daraus gewonnen Erkenntnisse abschließend kritisch zu diskutieren.
Nach den einleitenden Ausführungen beschäftigt sich das zweite Kapitel mit den Gegebenheiten auf dem Arzneimittelmarkt für OTC-Produkte in Deutschland. Dabei erfolgt eine Abgrenzung des in dieser Arbeit im Fokus stehenden Markts für Selbstmedikation in der Apotheke sowie eine Betrachtung der aktuellen Daten und Fakten des deutschen OTC-Marktes. Daneben geht dieses Kapitel auf die aktuellen Entwicklungen auf dem Arzneimittelmarkt ein und zeigt die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen mit der die Akteure am Arzneimittelmarkt zu Recht kommen müssen, die sich daraus ergebenden strukturellen Veränderungen sowie die Veränderungen in der Gesellschaft auf.
Das dritte Kapitel betrachtet, ausgehend von der Darstellung der Apotheke als Verkaufsstätte, der Charakterisierung der Verwender von Selbstmedikation und der möglichen Einflüsse auf die Kaufentscheidung, den Kaufprozess eines OTC-Arzneimittels.
Kapitel vier arbeitet den aktuellen Stand der Forschung heraus und schafft die Grundlage für die anschließende empirische Untersuchung, indem eine systematische Literaturrecherche zu Einflussfaktoren bei der Kaufentscheidung von OTC-Arzneimitteln durchgeführt wird. Im Anschluss werden die identifizierten Einflussfaktoren dargelegt und die Ergebnisse diskutiert.
Das fünfte Kapitel stellt die empirische Untersuchung der vorliegenden Arbeit dar. Zunächst werden die theoretischen Grundlagen gelegt, indem die qualitative Methodik und das Forschungsdesign unter Konkretisierung der Ziele der Erhebung, der Erhebungsmethode, der Aufbereitung der Daten und der Auswertungsmethode vorgestellt werden. Dabei wird insbesondere auf das Leitfadeninterview in der Form des Experteninterviews, die erarbeiteten Interviewleitfäden sowie die zusammenfassende Inhaltsanalyse näher eingegangen. Darauf aufbauend werden die Ergebnisse der Erhebung, getrennt nach den Interviews mit Konsumenten und den Interviews mit Apothekern dargelegt, um anschließend deren Ergebnisse zu vergleichen und sie den Erkenntnissen der Literaturrecherche gegenüberzustellen.
Kapitel sechs schließt die Arbeit mit einer Schlussbetrachtung ab.
2. Der Over-the-Counter-Arzneimittelmarkt in Deutschland
2.1. Begriffliche Grundlagen zur Systematisierung des Arzneimittelmarktes und Abgrenzung des OTC-Segmentes
Arzneimittel sind gemäß § 2 (1) des Arzneimittelgesetzes (AMG) Stoffe oder Stoffzubereitungen, die zur Anwendung im oder am menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind. Sie dienen der Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und weisen heilende, lindernde oder vorbeugende Eigenschaften auf. Arzneimittel werden dabei in Human- und Veterinärarzneimittel sowie Fertig- und Rezepturarzneimittel unterschieden. Fertigarzneimittel werden im Voraus durch industrielle Verfahren hergestellt und sind für die Abgabe an den Verbraucher am Markt bestimmt (§ 4 (1) AMG). Bei Rezepturarzneimittel hingegen handelt es sich um speziell für den Patienten individuell in der Apotheke angefertigte Präparate.[12] Im weiteren Verlauf der Ausführungen werden ausschließlich humanpharmazeutische Fertigarzneimittel betrachtet. Dabei werden die Begriffe Arzneimittel, Medikament, Pharmazeutika oder Präparat synonym verwendet.
Im Folgenden wird der in der Arbeit zu untersuchende Markt der Over-the-Counter Arzneimittel abgegrenzt und systematisiert. Um dies durchzuführen erfolgt eine Klassifizierung der Arzneimittel anhand dreier Kriterien: der Rechtsstatus von Pharmazeutika (Art der Zulassung), die Erstattungsfähigkeit der Präparate durch die gesetzliche Krankenversicherung und der gewählte bzw. gesetzlich vorgeschriebene Vertriebsweg[13].
Ausgangspunkt der Abbildung 1 sind Fertigarzneimittel, die in Originalpräparate, Generika und Analog- bzw. Me-Too-Präparate unterschieden werden.[14] Originalpräparate unterliegen einem Patentschutz, was dem forschenden Pharmaunternehmen eine zeitlich begrenzte Monopolstellung ermöglicht, d.h. bis zum seinem Ablauf können diese Medikamente ohne Konkurrenz abgesetzt werden.[15] Nach dem Ablauf des Patents werden die Originale i.d.R. als Markenprodukte vermarktet und weiter vertrieben.[16] Sie begeben sich damit in Konkurrenz mit den auf den Markt kommenden Generikapräparaten. Diese weisen die gleiche qualitative und quantitative Zusammensetzung von Wirkstoffen und Darreichungsformen wie bereits auf dem Markt befindliche Originalpräparate auf. Generika sind durch die Nutzung eines patentfreien Wirkstoffes allerdings kostengünstiger als das Original, da hier auf eine langjährige und kostenintensive Forschung verzichtet werden kann.[17] Analog- bzw. Me-Too-Präparate sind Nachahmer von bereits existierenden Substanzen mit einem allerdings geringfügig veränderten Wirkstoff. Aufgrund der Nähe zu den Originalpräparaten fallen aber auch hier die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gering aus und das Produkt kann dementsprechend günstiger angeboten werden.[18]
Abbildung 1: Struktur des deutschen Fertigarzneimittelmarktes[19]
Das erste Kriterium anhand dem sich ein Arzneimittel klassifizieren lässt, ist die Art der Zulassung, d.h. die Unterteilung in verschreibungspflichtig und nicht verschreibungspflichtig. Gemäß § 48 (2) Nr. 2a AMG unterliegt ein Präparat der Verschreibungspflicht, wenn es Stoffe enthält, die ohne ärztliche Überwachung die menschliche Gesundheit, auch bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, gefährden können. Verschreibungspflichtige Medikamente können nur gegen ein Rezept, das von einem Arzt oder einer anderen autorisierten Person ausgestellt wurde, in einer Apotheke erworben werden.[20] Sie sind somit nach § 43 (3) AMG automatisch apothekenpflichtig. Alternativ werden verschreibungspflichtige Pharmazeutika auch als RX[21]-Präparate bzw. ethische Arzneimittel bezeichnet. Nicht verschreibungspflichtige Produkte werden auch Over-the-Counter-Arzneimittel oder kurz OTC-Arzneimittel genannt.[22] Der OTC-Markt, auf dem alle Produkte freiverkäuflich sind, ist dabei ein zweigeteilter Markt, der aus dem verordneten OTC- bzw. OTX[23]-Markt und dem Selbstmedikationsmarkt besteht. Der OTX-Markt wird auch als semi-ethischer Markt bezeichnet und beinhaltet alle nicht verschreibungspflichtigen aber verschreibungsfähigen Medikamente. Am Selbstmedikationsmarkt hingegen sind die Präparate weder verschreibungspflichtig noch verschreibungsfähig.[24]
Ein weiteres Klassifizierungskriterium ist die Erstattungsfähigkeit. Erstattungsfähig bedeutet, dass die Kosten für ein Arzneimittel von der Krankenversicherung übernommen werden. Die Ausgaben für verschreibungspflichtige Pharmazeutika werden in den meisten Fällen von der GKV bzw. PKV erstattet, nur Präparate, bei denen die Erhöhung der Lebensqualität (sogenannte Life-Style-Produkte) im Vordergrund steht, wie z.B. Viagra, sind davon ausgeschlossen.[25] OTC-Arzneimittel sind mit Einführung des GKV-Moder-nisierungsgesetzes zum 1. Januar 2004 gemäß § 34 (1) SGB V grundsätzlich von der Erstattung ausgeschlossen.[26] Abweichungen ergeben sich hiervon durch eine vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) veröffentlichte Liste, in der Ausnahmen für eine begrenzte Anzahl an Arzneimitteln in bestimmten Indikationsgebieten festgelegt sind.[27]
Zudem muss hinsichtlich des Vertriebswegs differenziert werden, d.h. die Unterscheidung ob ein Medikament apothekenpflichtig ist oder ob es auch außerhalb der Apotheke verkauft werden darf. Apothekenpflicht besteht gemäß § 43 (1) AMG für Pharmazeutika, die im Sinne des § 2 (1) AMG definiert sind. Damit soll die Arzneimittelsicherheit gewahrt werden, dader Apotheker aufgrund seiner fundierten Ausbildung beim Verkauf eine Kontroll- und Beratungsfunktion wahrnehmen soll (s.a. Abschnitt 3.1.).[28] Der Kunde kann dabei das Präparat entweder über eine öffentliche Apotheke (Offizinapotheke) oder Versandapotheke beziehen.[29] Freiverkäufliche Arzneimittel sind nicht auf den Vertrieb in Apotheken beschränkt (s. Abbildung 1), da sie nach § 44 (1) AMG „ausschließlich zu anderen Zwecken als zur Beseitigung oder Linderung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwerden zu dienen bestimmt sind“. Voraussetzung für den Verkauf außerhalb von Apotheken ist gemäß § 45 (1) AMG, dass weder eine unmittelbare oder mittelbare Gefährdung bei unsachgemäßen Gebrauch besteht, noch dass eine Prüfung, Aufbewahrung und Abgabe durch eine Apotheke erforderlich ist. Die genauen Vorschriften, welche Arzneimittel nur über Apotheken vertrieben werden dürfen und welche freiverkäuflich sind, ist in der Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel (AMVerkRV) gesetzlich festgelegt.
Welchen Status ein Arzneimittel erhält, d.h. verschreibungspflichtig, apothekenpflichtig oder freiverkäuflich, entscheidet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Rechtliche Grundlagen sind hierfür die entsprechenden Richtlinien des AMG.[30]