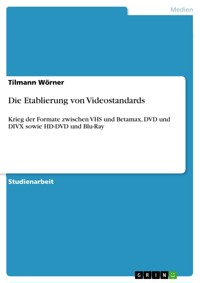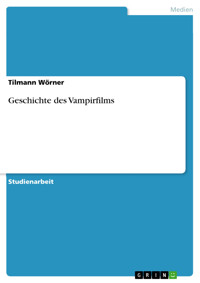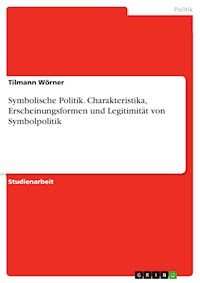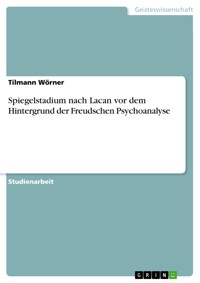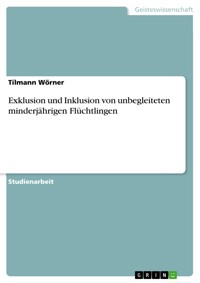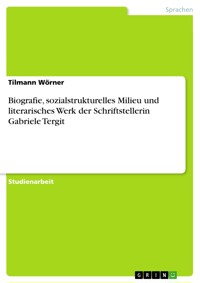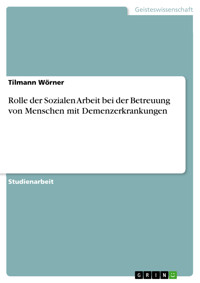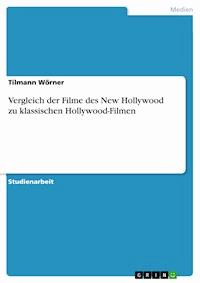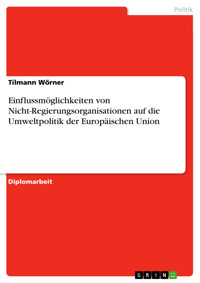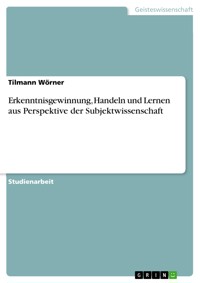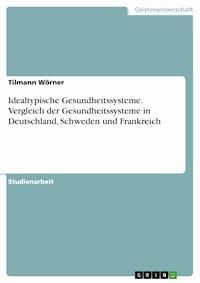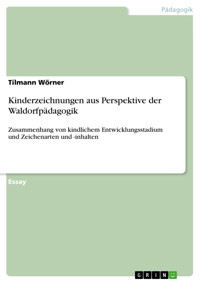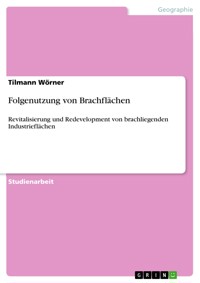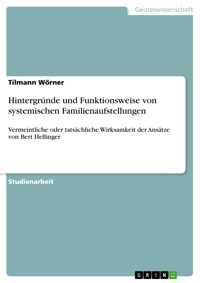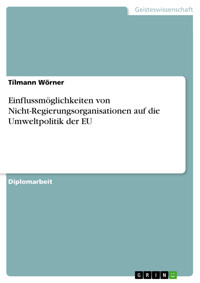
Einflussmöglichkeiten von Nicht-Regierungsorganisationen auf die Umweltpolitik der EU E-Book
Tilmann Wörner
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Soziologie - Politik, Majoritäten, Minoritäten, Note: 1,7, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Soziologisches Institut), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Nicht-Regierungsorganisationen auf die Umweltpolitik der Europäischen Union. Im Mittelpunkt stehen hierbei Umweltverbände, die Lobbying bei den EU-Institutionen betreiben. Es scheint sich sowohl bei den nationalen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, als auch bei der jeweiligen Bevölkerung die Erkenntnis durchzusetzen, dass die Umweltpolitik effizienter auf EU-Ebene betrieben werden kann. In einer Spezialuntersuchung des Eurobarometers zum Thema Umweltpolitik wurden 1995 die Menschen in den Mitgliedsländern der Union dazu befragt, ob die Umweltpolitik eine nationale Angelegenheit ist, oder ob Umweltpolitik auf Gemeinschaftsebene praktiziert werden sollte. Es zeigt sich, dass in allen Mitgliedsländern eine breite Mehrheit dafür ist, dass Umweltpolitik auf Ebene der EU betrieben werden sollte. Den höchsten Wert hat hierbei die Niederlande, wo über 85% der Bevölkerung dieser Meinung sind. Auch innerhalb des politischen Systems der EU scheint die Umweltpolitik einen immer größer werdenden Stellenwert einzunehmen. Angesichts globaler Umweltprobleme, die sich in länderübergreifenden Katastrophen widerspiegeln, scheint es erforderlich, Umweltpolitik auf supranationaler Ebene zu betreiben. Besonders das sog. „Jahrhundert-Hochwasser“ im August 2002 in Deutschland, Tschechien und Österreich vergegenwärtigt, dass bei der Lösung von Umweltproblemen länderübergreifende Maßnahmen nötig sind. Auch wenn diese Hochwasserkatastrophe möglicherweise nicht kausal mit der Erhöhung des CO2-Anteils in der Atmosphäre zusammenhängt, so ist doch „wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch für die Erwärmung des Erdballs wesentlich verantwortlich ist“ und somit zumindest eine Ursache für die Veränderung des Weltklimas darstellt. Die Europäische Union hat diesbezüglich sowohl die Möglichkeit, verbindliche umweltpolitische Entscheidungen für ihre Mitgliedstaaten festzusetzen, als auch im Rahmen einer weltweiten Klimadebatte eine Vorreiterrolle einzunehmen. Denn selbst diejenigen Mitgliedstaaten, die „die EU eher als funktionalen Zweckverband sehen, haben keine grundsätzlichen Einwände, im Rahmen eines europäischen Verbandes eine größere Rolle in der Weltpolitik zu spielen“. Erste Anzeichen hierfür zeigten sich beispielsweise daran, dass bei der Weltklimakonferenz in Kyoto im Dezember 1997 die EU mit einem gemeinsamen Positionspapier an den Verhandlungstisch ging.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2002
Ähnliche
Page 1
Page 3
3.3.1. Korporatismusbegriff S.26 3.3.2. Neokorporatismus S.26 3.3.3. Begriff S.26 3.3.4. Akteure S.27
3.3.5. Institutionelle Beteiligung von Verbänden beim Neokorporatismus S.28 3.3.6. Voraussetzungen für neokorporativ-verbandliche Strukturen S.29
3.3.7. Makro- und Mesokorporatismus S.30
3.4. Mitgliedschafts- und Einflusslogik S.31 3.5. Politik-Netzwerk-Konzept S.33
3.5.1. Die EU als Mehrebenen-Netzwerk S.34 3.5.2. Akteure S.35 3.5.3. Netzwerkfunktion S.36 3.5.4. Netzwerkstrukturen S.37 3.5.5. Machtverteilung S.37
3.6. Machtasymmetrie zwischen Umweltverbänden und anderen Verbänden S.38
3.7. Professionalisierung der Interessenpolitik S.40 3.8. Diskussion S.41
4. Offenheit der EU-Institutionen für das Lobbying von
Umweltverbänden S.424.1. Die Kommission S.42
4.1.1. Kompetenzen der Kommission S.42
4.1.2. Einflussmöglichkeiten von NGO’s auf die Kommission S.43
4.1.3. Lobbying-Verständnis der Europäischen Kommission S.46
4.1.4. Taktiken der Kommission in der Umweltpolitik S.46
4.2. Rat der Europäischen Union („Ministerrat“) S.48
4.2.1. Kompetenzen des Rats der Europäischen Union S.48
4.2.2. Bedeutung des Rats der Europäischen Union für das Lobbying S.48
Page 4
4.3. Europäisches Parlament S.50
4.3.1. Kompetenzen des Europäischen Parlamentes S.50
4.3.2. Bedeutung des EP’s für die Einflussnahme von NGO’s S.51
4.3.3. Lobbying-Verständnis des Europäischen Parlaments S.53 4.4. Europäischer Rat S.54 4.5. Ausschusswesen in der EU S.55 4.5.1. Ausschüsse des Rates S.56
4.5.2. Ausschüsse der Kommission S.56
4.6. Wirtschafts- und Sozialausschuss S.57
4.7. Europäischer Gerichtshof EuGH S.58 4.8. Gesetzgebungsverfahren S.59
4.8.1. Initiations- und Vorbereitungsphase S.59 4.8.2. Entscheidungsphase S.61 4.8.3. Implementationsphase S.62 4.9. Diskussion S.63
5. Determinanten der Zusammenarbeit von Umweltverbände S.65
5.1. Dachverbandsdilemma beim EEB S.66
5.2. Unterschiedliche Zielsetzung und Strukturen der Umweltverbände S.66 5.3. Unterschiedliche Politikstile S.67
5.4. Unterschiedlicher ideologischer Hintergrund der Umweltverbände S.68
5.5. Selbstverständnis der Umweltverbände S.70
5.6. Zusammenarbeit zwischen den Umweltverbänden S.71 5.7. Diskussion S.73
6. Organisationsfähigkeit und Interessenaggregation S.74
6.1. Theorie des kollektiven Handelns S.75 6.2. Kritik an Olsons Theorie S.77
6.3. Bereitschaft der Individuen zur Unterstützung eines Umweltverbandes S.78
6.4. Unterstützung der Umweltverbände durch EU-Bürger S.79
6.5. Anwendung der Theorie Olsons auf das Verhalten innerhalb der Umweltverbände S.81 6.6. Diskussion S.82
Page 6
Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Nicht-Regierungsorganisationen auf die Umweltpolitik der Europäischen Union. Im Mittelpunkt stehen hierbei Umweltverbände, die Lobbying bei den EU-Institutionen betreiben.
Es scheint sich sowohl bei den nationalen Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, als auch bei der jeweiligen Bevölkerung die Erkenntnis durchzusetzen, dass d ie Umweltpolitik effizienter auf EU-Ebene betrieben werden kann. In einer Spezialuntersuchung des Eurobarometers zum Thema Umweltpolitik wurden 1995 die Menschen in den Mitgliedsländern der Union dazu befragt, ob die Umweltpolitik eine nationale Angelegenheit ist, oder ob Umweltpolitik auf Gemeinschaftsebene praktiziert werden sollte.
(Quelle: Eurobarometer 43.1 ,1995)
Es zeigt sich, dass in allen Mitgliedsländern eine breite Mehrheit dafür ist, dass Umweltpolitik auf Ebene der EU betrieben werden sollte. Den höchsten Wert hat hierbei die Niederlande, wo über 85% der Bevölkerung dieser Meinung sind. Auch innerhalb des politischen Systems der EU scheint die Umweltpolitik einen immer größer werdenden Stellenwert einzunehmen.
Angesichts globaler Umweltprobleme, die sich in länderübergreifenden Katastrophen widerspiegeln, scheint es erforderlich, Umweltpolitik auf supranationaler Ebene zu betreiben. Besonders das sog. „Jahrhundert-Hochwasser“ im August 2002 in
Page 7
Deutschland, Tschechien und Österreich vergegenwärtigt, dass bei der Lösung von Umweltproblemen länderübergreifende Maßnahmen nötig sind. Auch wenn diese Hochwasserkatastrophe möglicherweise nicht kausal mit der Erhöhung des CO2-Anteils in der Atmosphäre zusammenhängt, so ist doch „wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch für die Erwärmung des Erdballs wesentlich verantwortlich ist“1und somit zumindest eine Ursache für die Veränderung des Weltklimas darstellt.
Die Europäische Union hat diesbezüglich sowohl die Möglichkeit, verbindliche umweltpolitische Entscheidungen für ihre Mitgliedstaaten festzusetzen, als auch im Rahmen einer weltweiten Klimadebatte eine Vorreiterrolle einzunehmen. Denn selbst diejenigen Mitgliedstaaten, die „die EU eher als funktionalen Zweckverband sehen, haben keine grundsätzlichen Einwände, im Rahmen eines europäischen Verbandes eine größere Rolle in der Weltpolitik zu spielen“2. Erste Anzeichen hierfür zeigten sich beispielsweise daran, dass bei der Weltklimakonferenz in Kyoto im Dezember 1997 die EU mit einem gemeinsamen Positionspapier an den Verhandlungstisch ging.
Allerdings zeichnet sich die Europäische Union nach landläufiger Ansicht durch ein erhebliches demokratisches Defizit aus. Hauptkritikpunkt hierbei sind oft die geringen Partizipationsmöglichkeiten der Bürger.
Insofern bilden die Umweltverbände, die auf EU-Ebene tätig sind, eine intermediäre Instanz zwischen den Bürgern der Union und dem politisch-administrativen System der Union. Daher soll in dieser Arbeit untersucht werden, welche Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten die europäischen Umweltverbände auf die Umweltpolitik der EU besitzen.
1Illinger/Thurau (2002): 2
2Jachtenfuchs (1996): 445
Page 8
Methodische Vorgehensweise und Erkenntnisinteresse
In dieser Arbeit soll zunächst untersucht werden, in wie weit im Bezug auf die Umweltpolitik der EU von einem vergemeinschafteten Politikfeld gesprochen werden kann, also in welchem Maße Umweltpolitik bereits auf europäischer Ebene betrieben wird.
Anschließend soll anhand von den theoretischen Modellen des Pluralismus und des (Neo-) Korporatismus ein Fundament gelegt werden, wie man Verbände in das politisch-administrative System verorten kann, also in welchem Maße diese mit den staatlichen Institutionen verzahnt sind.
Während diese zwei Verbändetheorien eher die Grobstruktur der Zusammenarbeit von Staat und Verbände verdeutlichen, soll anhand einer Netzwerkanalyse illustriert werden, welche konkrete Rolle Umweltverbände innerhalb von politischen Netzwerken spielen. Ein besonderer Aspekt soll hierbei sein, welche Art von Tauschgütern Umweltverbände in den politischen Prozess einbringen können, da dies Aufschluss über deren Verhandlungsmacht gibt. In diesem Zusammenhang werden auch in kurzer Form die Einflusspotentiale von Wirtschafts- und Industrieverbänden thematisiert, die die zweite Kategorie von Verbänden bilden, die Einfluss auf die Umweltpolitik der EU nehmen.
Ein weiteres Erkenntnisinteresse liegt darin, wie offen die Institutionen der EU für die Einflussnahme von Umweltverbänden sind. Darüber hinaus sollen die Parameter verdeutlicht werden, die die Organisationsfähigkeit und die Interessenaggregation der europäischen
Umweltverbände determinieren. Daher soll das Spannungsfeld von Mitgliedschafts-und Einflusslogik aufgezeigt werden, in dem sich Umweltverbände befinden. Als weiterer Erklärungsansatz soll zudem Mancur Olsons Theorie des kollektiven Handelns herangezogen werden.
Anschließend soll ein Fallbeispiel aus der EU-Umweltpolitik darüber Aufschluss geben, wie zumindest im Einzelfall die Zusammenarbeit von Umweltverbänden und dem politischen System gestaltet ist.
Am Ende der Arbeit werden die Umweltverbände anhand der Verbändetheorien in das politische System der EU eingeordnet. Maßgeblich hierfür sind die Informationen und Erkenntnisse, die im Verlauf der Arbeit präsentiert werden konnten.
Page 9
1. Die Europäische Union als Umweltunion
Die folgenden Ausführungen sollen der Frage nachgehen, in welchem Maße hinsichtlich der Umweltpolitik der EU von einem vergemeinschafteten Politikfeld gesprochen werden kann. Der dynamischen Entwicklung der Erweiterung von gemeinschaftlichen Umweltkompetenzen soll hierbei Rechnung getragen werden.
1.1. Entwicklung der rechtlichen Grundlagen der Umweltpolitik
1.1.1. Anfänge einer gemeinschaftlichen Umweltpolitik
Ende der 60-er und zu Beginn der siebziger Jahre wurden auf Ebene der EG erste Ansätze hinsichtlich einer gemeinsamen Umweltpolitik unternommen. E inige der damals verabschiedeten Rechtsakten, die sich mit der Angleichung von Umweltstandards beschäftigten, hatten allerdings einen ökonomischen Hintergrund, da unterschiedliche Umweltstandards in den Mitgliedsländern zu Verzerrungen innerhalb des gemeinsamen Marktes führten.
1971 gab die Kommission in einer Mitteilung bekannt, dass Umweltschutz und Umweltgestaltung als eine wesentliche Aufgabe der Gemeinschaft betrachtet wird (vgl. Schmitz 1996).
Es entstand eine Diskussion zur Frage, ob Umweltschutz auf Gemeinschaftsebene erfolgen sollte oder lediglich durch zwischenstaatliche Abstimmung unter den Mitgliedstaaten. Vor allem Frankreich war gegen eine Verlagerung des Themas Umweltschutz auf EG-Ebene.
Während des Pariser Gipfels 1972 gaben die Staats- und R egierungschefs der Kommission grünes Licht für eine gemeinsame Umweltpolitik und forderten die Kommission auf, ein umweltpolitisches Aktionsprogramm auszuarbeiten. Dieses im Jahr 1973 erschienene Aktionsprogramm enthielt drei wesentliche Orientierungsmerkmale. Es proklamierte die Eindämmung und Verhütung von Umweltverschmutzungen, die Verbesserung der Umwelt und des Lebensrahmens sowie die Durchführung von Gemeinschaftsaktionen. Auch wurde die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit umweltschutzorientierten internationalen Einrichtungen betont (vgl. Wepler 1999).
Page 10
Diesem ersten Umweltaktionsprogramm folgten im Zeitraum von 1977-1992 vier weitere „von der Europäischen Kommission erarbeitete und vom Rat verabschiedete Aktionsprogramme, die jeweils die umweltpolitischen Ziele, Prioritäten und ggf. Aktionspläne der Gemeinschaft festlegten“3.
Hey (1994) kommt allerdings zur Einschätzung, dass sowohl das erste als auch die später folgende Umweltaktionsprogramme lediglich den jeweiligen Diskussionsstand wiedergaben, aber keine bindende Arbeitsaufträge darstellten. Auch Wepler (1999) verweist ebenfalls darauf, dass dieses Aktionsprogramm keine rechtliche Verpflichtung für die Mitgliedsländer hatten, doch sei dadurch eine normative Grundlage für ein Tätigwerden der EG im Umweltbereich geschaffen worden.
Innerhalb der Gemeinschaft setzte sich dann zunehmend die Erkenntnis durch, dass konkrete und verbindliche Maßnahmen zur Lösung des Umweltproblems erforderlich sind, für die allerdings eine rechtliche Legitimation nötig war. Diese Grundlage stellte Artikel 100 (Harmonisierungsartikel) des EWG-Vertrages (Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) dar, auf den „Maßnahmen zur Rechtsangleichung innerhalb der Gemeinschaft gestützt werden konnten“4. Eckrich (1994) weist diesbezüglich auf die seit Anfang der 70-er Jahre bestehende Dichotomie im Umweltbereich hin, da die Harmonisierungsmaßnahmen meistens eine doppelte, nämlich sowohl eine umweltpolitische als auch eine binnenmarktorientierte Zielsetzung verfolgten, wobei die Gewichtung der Ziele schwankte.
Darüber hinaus gewann der Artikel 235 als eine Art Auffangkompetenz für die Umweltpolitik des EWG-Vertrages an Bedeutung. Dieser erlaubte es der Gemeinschaft, „Vorschriften für Bereiche zu erlassen, in denen der Vertrag keine Gemeinschaftsbefugnisse vorgesehen hatte“5, sofern es sich um die Verwirklichung von Zielen hinsichtlich des Gemeinsamen Marktes handelte. Die Zeit zwischen 1973 und 1987 kann man als Phase der stagnierende Integration und einer verhaltenen Entwicklung der gemeinschaftlichen Umweltpolitik beschreiben (vgl. Eckrich 1994).6
3Malek (2000): 51
4Schmitz (1996): 40
5Wepler (1999): 176
6Eckrich (1994) weist darauf hin, dass sich die Staats- und Regierungschefs bei den Tagungen des Europäischen
Rates zwischen 1972 und 1983 nicht mehr mit umweltpolitischen Fragen beschäftigte.
Page 11
1.1.2. Gemeinschaftliche Umweltkompetenzen durch die EEA
Durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA) wurde 1987 die Umweltpolitik ins Primärrecht aufgenommen, fand also f ormal Eingang in das EG-Vertragswerk. Die wesentlichste Ergänzung des EWG-Vertrages bestand in der Hinzunahme des Art. 130s, durch den „die Gemeinschaft die ausdrückliche Zuständigkeit im Bereich Umweltschutz erhielt, die ihr solange gefehlt hat“7. Die Reaktionen auf die umweltrelevanten Bestimmungen der EEA reichten „von großer Skepsis bis hin zu euphorischer Zustimmung, Kritiker befürchteten eine Umweltpolitik auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner [...], andere sahen Europa mittlerweile auf dem Weg zur Umweltgemeinschaft“8.
Denn die Mitgliedstaaten mit ausgeprägtem Umweltbewusstsein in der Bevölkerung und moderner Umwelttechnik empfanden die Umweltstandards der Gemeinschaft innovationsfeindlich und hemmend für nationale Vorreiterrollen. Für geographisch bevorzugte Länder wie Großbritannien, aber auch für die wirtschaftlich weniger entwickelten südeuropäischen Länder bedeuteten die für sie hohen Umweltstandards der EG unangenehme Eingriffe in die nationalen Angelegenheiten (vgl. Strübel 1992).
1.1.3. Artikel 130r, Absatz 1 und 2
Die zentrale Grundlage der Umweltpolitik der Gemeinschaft bildete der durch die EEA neu eingeführte Art.130r, Absatz 1, durch den die Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie die Verbesserung ihrer Qualität als Ziel der Gemeinschaft proklamiert wurde. Auch spricht dieser Artikel die umsichtige und rationelle Verwendung von natürlichen Ressourcen an, sowie die Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene.
Artikel 130r, Absatz 2 nennt die Prinzipien, die für die Gemeinschaft bei ihren umweltpolitischen Aktivitäten maßgeblich sind, nämlich das Vorsorge- und Vorbeugeprinzip, das Ursprungsprinzip und das Verursacherprinzips (vgl. Wepler 1999).
Nach dem Vorbeugeprinzip sind Umweltschutzmaßnahmen so zu gestalten, dass von vornherein das Entstehen von Umweltbeeinträchtigungen zu vermeiden sind.
7Schmitz (1996): 79
Page 12
Das Ursprungsprinzip besagt, dass nicht vermeidbare Umweltbelastungen „am frühesten Punk ihres Entstehens, also an der Quelle zu bekämpfen sind“9. Das Verursacherprinzip soll vor allem die Kostenzurechnung für
Umweltverschmutzungen regeln. Demnach soll derjenige die anfallenden Kosten tragen, der die Verschmutzung herbeigeführt hat. Es schließt damit Regelungen aus, nach denen staatliche Zahlungen an dessen Stelle treten, weil dadurch „die Allgemeinheit, also der Steuerzahler, mit den Kosten für Umweltbeeinträchtigungen belastet würde“10.