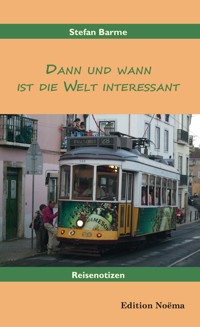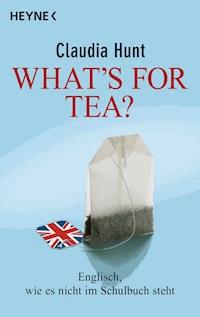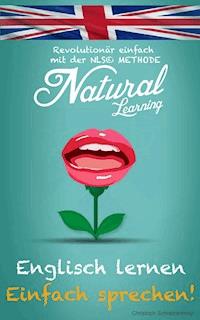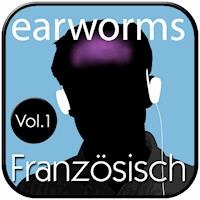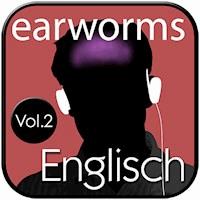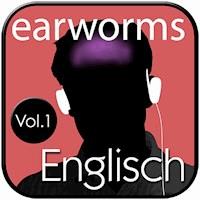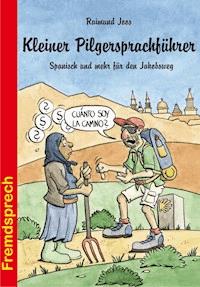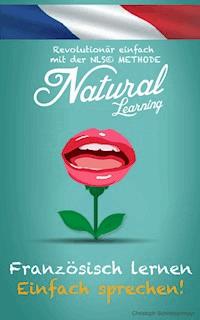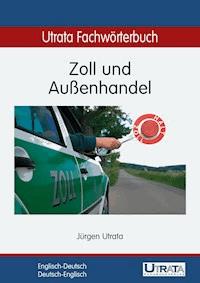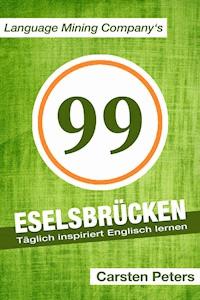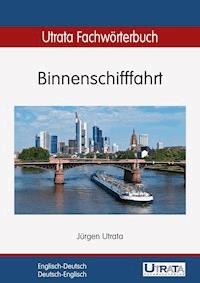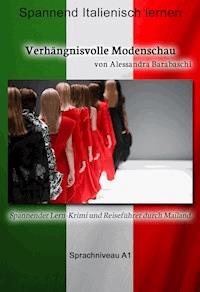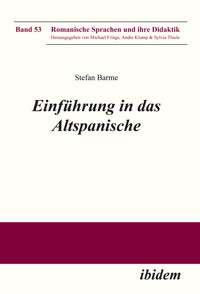
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Fremdsprachen
- Serie: Romanische Sprachen und ihre Didaktik
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Einführung in das Altspanische schließt eine im deutschsprachigen Raum seit nunmehr 35 Jahren bestehende Publikationslücke. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf der internen Sprachgeschichte, wobei die Entwicklungen in Lautung, Grammatik und Wortschatz jeweils ausgehend vom klassischen Latein über das Vulgärlatein bis zum mittelalterlichen Spanisch behandelt werden. Darüber hinaus werden die charakteristischen Züge des Altspanischen auch durch die Präsentation und Kommentierung von Texten veranschaulicht, die unterschiedliche Entwicklungsstadien und Textsorten repräsentieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Vorwort
Seit der Darstellung des Meyer-Lübke-Schülers Adolf Zauner (²1921) ist in der deutschsprachigen Romanistik keine übersichtliche Einführung in das Altspanische mehr vorgelegt worden (dasAltspanische Elementarbuchvon Metzeltin (1979) ist nicht zuletzt aufgrund seines Alters und gravierender didaktischer Schwächen sowie inhaltlicher Lücken als Einstieg für Anfänger beziehungsweise als Seminarlektüre völlig ungeeignet). Ziel des vorliegenden Bandes ist es, den Studierenden der Romanistik/Hispanistik und interessierten Romanisten/Philologen einen Überblick über das Altspanische zu verschaffen und somit das seit beinahe 100 Jahren bestehende Publikationsdesiderat zu erfüllen.
In der folgenden Beschreibung des Altspanischen wird zwar auch die externe Sprachgeschichte behandelt, doch liegt der Schwerpunkt auf den sprachstrukturellen Veränderungen, die auch anhand unterschiedlicher Texte aus den einzelnen Entwicklungsphasen des Altspanischen veranschaulicht werden – eine umfassende Präsentation der internen Sprachgeschichte des Altspanischen wird dabei nicht angestrebt.
Trier, im Sommer 2014
Inhalt
Vorwort
Abkürzungen
Symbole
1.Zur Periodisierung des Spanischen
2.Geschichte und Struktur des Altspanischen
2.1Die vorrömischen Substrate
2.2Eroberung und Romanisierung Hispaniens
2.3Das westgotische Superstrat
2.4Das arabische Adstrat
2.5Ausgliederung und Ausbreitung des Kastilischen
2.5.1Die Entstehung der christlichen Königreiche und die Reconquista
2.5.2Die sprachliche Gliederung der Iberischen Halbinsel
2.5.2.1Sprachliche Heterogenität im Norden
2.5.2.2Sprachliche Homogenität im Zentrum und im Süden
2.5.2.3Die sprachliche Sonderstellung des Kastilischen
2.6Das frühe Romanisch
2.7Vom Lateinischen zum Altspanischen
2.7.1Die lateinische Basis der romanischen Sprachen
2.7.2Exkurs: Warum kommt es zu Veränderungen in der Aussprache?
2.7.3Grundlegendes zur historischen Lautlehre
2.7.4Lautung
2.7.4.1Vokalismus
2.7.4.2Konsonantismus
2.7.5Grammatik
2.7.6Wortschatz und Semantik
2.8Texte mit Kommentar
2.8.1Nodicia de kesos(10. Jh.)
2.8.2Glosas emilianenses(10./11. Jh.)
2.8.3Mozarabischejarchas(11./12. Jh.)
3.Das Altspanische I: Ende 12./Anfang 13. Jahrhundert
3.1Geschichtlicher Hintergrund
3.2Text mit Kommentar: Cantar de Mio Cid
4.Das Altspanische II: Das alfonsinische Spanisch (13. Jh.)
4.1Geschichtlicher Hintergrund
4.2Sprachliche Merkmale
4.2.1Orthographie
4.2.2Lautung
4.2.3Grammatik
4.2.4Wortschatz
4.3Text mit Kommentar: General Estoria
5.
Abkürzungen
Abb.Abbildung
ahd.althochdeutsch
arab.arabisch
asp.altspanisch
bzw.beziehungsweise
CILCorpus Inscriptionum Latinarum
frz.französisch
germ.germanisch
got.gotisch
gr.griechisch
ib.ibidem, ebenda
it.italienisch
Kap.Kapitel
kastil.kastilisch
kat.Katalanisch
kelt.Keltisch
klt.klassisch-lateinisch
lat.Lateinisch
mlat.Mittellateinisch
nsp.Neuspanisch
pg.Portugiesisch
rum.rumänisch
sictatsächlich so
sog.Sogenannt
sp.Spanisch
splt.Spätlateinisch
s.v.sub voce ʻunter d. Ausdruckʼ
vlt.vulgärlateinisch
z.B.zum Beispiel
Symbole
˃wird zu
˂entsteht aus
→wird ersetzt durch
*nicht belegte, erschlossene Form
[ ]phonetische Umschrift
/ /Phonem
‹›Graphem; Graphie
ʻʼBedeutung
MAJUSKELNEtyma von Erbwörtern
a-Anlaut
-a-Inlaut
-aAuslaut
ē, ō
1.Zur Periodisierung des Spanischen
Bei der Betrachtung der Geschichte einer historischen Einzelsprache lassen sich unterschiedliche Phasen ausmachen, wobei die Einteilung in verschiedene Epochen, die Periodisierung, auf ganz unterschiedlichen Kriterien basieren kann. So kann die Sprachgeschichte etwa rein chronologisch nach Jahrhunderten unterteilt werden, nach einschneidenden Daten der politischen Geschichte, nach Phasen der Literaturgeschichte oder auch nach der Entwicklungdes Sprachsystems (vgl. Bollée &Neumann-Holzschuh 2003, 8). Da in der hier präsentierten Darstellung des Altspanischen der Fokus auf der internen Entwicklung der spanischen Sprache liegt, folgen wir der Periodisierung von Eberenz (1991), da sie auf eben diesem Kriterium beruht, dabei jedoch bedeutende Aspekte der externen Sprachgeschichte, wie etwa die sprachlichen und kulturellen Eingriffe Alfonsʼ des Weisen, nicht gänzlich ausblendet. Eberenz (ib., 105f.) unterscheidet die drei folgenden Epochen der spanischen Sprachgeschichte:
1. 1200–1450:Die Periode desAltspanischen(„época antigua“) ist durch eine relative Stabilität der grundlegenden Strukturen der Schriftsprache geprägt, was primär als Ergebnis der Reformbemühungen Alfons des Weisen zu betrachten ist.
2. 1450–1650:Die Epoche desMittelspanischen(„etapa media“) zeichnet sich durch eine Reihe markanter Veränderungen im lautlichen und morphosyntaktischen Bereich aus.
3. 1650–heute:DasNeuspanischeist durch ein recht hohes Maß an Stabilität charakterisiert: Im 17. Jahrhundert kommt es zu einer weitgehenden Konsolidierung des Sprachsystems, und im 18. Jahrhundert nimmt das Spanische seine moderne Form an.[1]
Es ist wichtig zu betonen, dass diese drei Perioden die wichtigsten und gleichzeitig die am besten dokumentierten, jedoch keineswegs sämtliche Phasen der spanischen Sprachgeschichte repräsentieren. Denn die Sprachgeschichte des Spanischenim engeren Sinnebeginnt bereits mit der Übergangszeit vom 6. bis zum 11. Jahrhundert, da sich während dieser Zeit aus dem Lateinischen frühe Formen des Romanischen herausgebildet haben. Die Sprachgeschichte des Spanischenim weiteren Sinneumfasst demgegenüber auch die Geschichte und die Besonderheiten des Lateinischen auf der Iberischen Halbinsel, wobei diesbezüglich auch die vorrömischen Sprachen einzubeziehen sind, da diese die Physiognomie des hispanischen Lateins bis zu einem gewissen Grad beeinflusst haben. Wir beschränken uns im Folgenden auf das Altspanische und behandeln den Zeitraum vom vorrömischen Hispanien (der ältesten „Vorgeschichte“des Spanischen) bis einschließlich des 14. Jahrhunderts.
2.Geschichte und Strukturdes Altspanischen
2.1Die vorrömischen Substrate
Als die Römer die Iberische Halbinsel ihrem riesigen Imperium einverleibten (s.u.2.2),lebten dort bereits viele unterschiedliche Volksstämme mit eigenen Kulturen und Sprachen. Die wichtigsten dieser Völker, bei denen zwischen Indogermanen undNicht-Indogermanen unterschieden werden kann,[2]waren die folgenden:
Indogermanen:Kelten, Lusitaner, Asturer, Kantabrer
Nicht-Indogermanen:Iberer, Tartessier/Turdetaner, Basken
Die Kelten sind ab dem 1. Jahrtausend v. Chr. aus Mitteleuropa auf die Iberische Halbinsel gekommen; die Herkunft der Lusitaner ist ungeklärt, ihre Sprache ist möglicherweise einem archaischen Zweig des Indogermanischen zuzuordnen; die Asturer und Kantabrer werden vielfach dem Lusitanischen zugerechnet. Nur wenig weiß man über die drei nicht-indogermanischen Völker und ihre Sprachen. Die Iberer, deren Ethnonym sich vonIberus, dem antiken Namen des Ebro herleitet (< iberischiberʻFlussʼ), besaßen ebenso wie die wahrscheinlich nicht mit ihnen verwandten Tartessier/Turdetaner eine eigene Schrift; das Baskische nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als es die einzige vorrömische Sprache ist, die bis in unsere Tage überlebt hat.
Neben diesen und weiteren kleineren Volksgruppen gab es auf der Iberischen Halbinsel vor der Eroberung durch die Römer auch noch phönizische, griechische und karthagische (punische) Handelskolonien:
phönizisch:Cádiz,Málaga
griechisch:Empúries(Emporion)
karthagisch (punisch):Cartagena,Mahón(Menorca)
Die Sprachen der von den Römern unterworfenen Volksstämme haben im Lateinischen ihre Spuren hinterlassen, da die betreffenden Sprecher sich das Lateinische natürlich vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Muttersprache aneigneten. Als besiegte, unterlegene Völker haben sie das Lateinische sozusagen von unten beeinflusst, was zur der sprachwissenschaftlichen Bezeichnung Substrat bzw. Substrateinfluss geführt hat (lat.subʻuntenʼ), wobei der Bestandteil -strat(< lat.STRATUMʻSchicht, Deckeʼ) sich auf das Lateinische als die dominierende Sprache bzw. Sprachschicht bezieht. Insgesamt ist zu sagen, dass der Substrateinfluss der vorrömischen Sprachen auf das Lateinische recht gering ausfällt und weitgehend auf einige Elemente des Wortschatzes sowie auf Ortsnamen (Toponyme) beschränkt ist(vgl. hierzu sowie zum Folgenden Bollée &Neumann-Holzschuh 2003, 14–19).
Keltisch:
-einige Realia des Alltags:sp.camisa< lat.camisia, sp.carro< lat.carros, sp.cerveza< lat.cerevisia
-einige Bezeichnungen für Pflanzen, Tiere und Dinge aus dem Bereich der bäuerlichen Kultur: sp.berro‘Kresse’, sp.abedul‘Birke’
-Elemente in einigen Ortsnamen:sego,segi(ʻSiegʼ):Segovia;-dunum(ʻbefestigter Ortʼ):Navardún(Zaragoza),Berdún(Huesca);-acum(ʻZugehörigkeit eines Gutes zu einer Personʼ):Luzaga,Buitrago;keltisch ist z.B. auch der OrtsnameCoruña.
Im Bereich der Lautungkönntendie beiden folgenden Phänomene keltischem Substrateinfluss zuzuschreiben sein:
-die westromanische Sonorisierung der intervokalischen stimmlosen Okklusivlaute (Verschlusslaute): -p-, -t-, -k- > -b-, -d-, -g-
-die Entwicklung von lat. -ct- zu -it-, die im Kastilischen bis zum Nexus-tš- führt: lat.nocte(m)> sp.noche
Baskisch:
-Wortschatzelemente: sp.izquierdoʻlinksʼ (<bask.ezker), sp.vega‘Aue, fruchtbare Ebene’, sp.pizarra‘Schiefer(tafel)’
-lexikalische Elemente in Personen- und Ortsnamen:berri‘neu’,etxe‘Haus’: bask.Etxeberri> sp.Echeberri;aran‘Tal’ (Valle d’Arán)
-Personennamen:García,Jimeno,Sancho,Íñigo
In der Lautung ist möglicherweise der sich im Spanischen vollziehende Wandel[f] > [h] (lat.filiu(m)> sp.hijo) auf einen Einfluss seitens des Baskischen zurückzuführen.
Iberisch:
Ortsnamen:Iberus>Ebro; Namen mitIli-:Iliberis>Elvira(bei Granada)
Tartessisch/Turdetanisch:
Namen mit -ippound -uba:Corduba>Córdoba;Ulisippo>Lisboa(Lissabon)
Neben den genannten Substrateinflüssen gibt es im Spanischen weitere vorrömische Elemente, deren genaue Herkunft jedoch strittig ist:
Wortschatz:conejo,cama,manteca,madroño(ʻErdbeerbaumʼ),bruja,barro(ʻLehm, Schlammʼ),losa(ʻSteinplatteʼ)
Morphologie:
-arro, -orro, -urro:machorra(‘unfruchtbares Schaf’)
-ieco, -ueco:morueco(‘Schafbock’)
-iego:mujeriego(ʻFrauenheldʼ),solariego(ʻaltadligʼ)
-asco, -asca:nevasca(ʻSchneesturmʼ),borrasca(ʻSturm; Unwetterʼ)
-az, -ez, -oz, -uz:in Personennamen (Muñoz,Sánchez,Jiménezetc.)
2.2Eroberung und Romanisierung Hispaniens
Die römische Eroberung der Iberischen Halbinsel begann imJahre 218 v. Chr. und war erst zweihundert Jahre später, im Jahre 19 v. Chr., abgeschlossen (zum Vergleich: Cäsar eroberte Gallien in nur sieben Jahren). Die Römer hatten ursprünglich gar keine Eroberung der Iberischen Halbinsel beabsichtigt, warum kam es dennoch dazu? Der Erzfeind der Römer im Mittelmeerraum, Karthago, hatte im ersten Punischen Krieg (264–241 v. Chr.) Sizilien, Sardinien und Korsika an Rom verloren, woraufhin es sich an die Eroberung der Pyrenäenhalbinsel machte, u.a. auch wegen der reichen Bodenschätze. Als Hannibal das an der Westküste der Halbinsel gelegene Sagunt angriff, das mit Rom verbündet war, mussten die Römer eingreifen (Cato der Ältere: „Cetero censeo Carthaginem esse delendam“(„Im Übrigen glaube ich, dass Karthago zerstört werden muss“)). Im zweiten Punischen Krieg (218–201 v. Chr.) besiegt Rom die Karthager erneut und teilt die Halbinsel in zwei Verwaltungsbezirke: dieHispania citeriorund dieHispania ulterior. Die Citerior, das Territorium, das von Rom aus gesehen diesseits der Straße von Gibraltar lag, umfasste die Küste der Iberischen Halbinsel von den Pyrenäen bis hinunter nach Almería, und die Ulterior, also das Gebiet jenseits der Straße von Gibraltar, war zunächst in etwa deckungsgleich mit dem heutigen Andalusien. Erst als Augustus 19 v. Chr. die Asturer und Kantabrer, die letzten noch unabhängigen Stämme im schlecht zugänglichen Bergland im Norden besiegt hatte, war die politische und militärische Unterwerfung der Iberischen Halbinsel abgeschlossen. In dem neu eroberten Gebiet implementierten die Römer das römische Recht, sorgten für Verwaltung und Infrastruktur (Bau von Straßen,Brücken, Wasserleitungen etc.),und schließlich setzte die Romanisierung der vorrömischen Völker ein, was bedeutet, dass diese sukzessive ihre herkömmliche Lebensweise aufgaben und den römischenway of lifeübernahmen (in der Sozialstruktur, im Rechtswesen, in der Architektur, Kleidung, Kunst, Religion etc.). Der für die Sprachgeschichte entscheidende Teilaspekt dieser Romanisierung ist die Latinisierung, die Aufgabe der jeweiligen Muttersprache (Iberisch, Lusitanisch usw.) und die Übernahme der Sprache der Eroberer, des Lateinischen. Die Römer haben den von ihnen unterworfenen Völkern ihre Sprache jedoch nie aufoktroyiert,und sie haben auch niemals eine aktive Sprachpolitik betrieben; die römische Kultur und somit auch die lateinische Sprache genossen vielmehr so viel Prestige, dass die besiegten Volksgruppen begierig waren, diese Sprache zu lernen. Nur punktuell gab es in Hispanien Widerstände gegen die Romanisierung und Latinisierung und so hielten sich einige vorrömische Sprachen im Zentrum und im Norden noch bis in die Kaiserzeit hinein – erst zur Zeit der Westgoten galt die gesamte Halbinsel als vollständig latinisiert (vgl. Bollée &Neumann-Holzschuh 2003, 30).
In der neueren Forschung geht man im Unterschied zu früheren Annahmen davon aus, dass das Sprechlatein in der Romania, auch wenn es sicherlich geographische, soziale, stilistische und diachrone Varianten gab, bis zum 7. Jahrhundert doch eine weitgehende Einheitlichkeit bewahrt hat. Was das hispanische Latein betrifft, herrschte lange Zeit die Auffassung vor, dass sich diese Varietät im Vergleich zum Latein der übrigen Romania durch archaische, konservative Züge auszeichne. Neuere Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die archaischen Elemente weitgehend auf den Wortschatz beschränkt sind, während sich die Lautung und die Grammatik als innovationsfreudiger erweisen. Zu den morphosyntaktischen Neuerungen des hispanischen Lateins zählt beispielsweise die sogenannte differentielle Objektmarkierung (DOM), d.h. die Markierung eines personalen direkten Objekts mittels der vorangestellten Präpositiona(<lat. AD). Eine morphologische Innovation ist der Wegfall der dritten (konsonantischen bzw. kurzvokalischen) Konjugation auf -ĕre, die vor allem von der zweiten Konjugation, dere-Konjugation (-ēre), sowie teilweise auch von der dritten, deri-Konjugation (-īre), „übernommen“wird:CADERE>caer,RECIPERE>recibir. Innovationen finden sich aber durchaus auch in der Lexik:
FRATER→GERMANUS> sp.hermano(ʻBruderʼ)
FIRMARE→SERARE> sp.cerrar(ʻschließenʼ)
SERA→TARDIS> sp. (la)tarde(ʻAbendʼ)
(vgl. Bollée &Neumann-Holzschuh 2003, 38)
Was die Romanisierung anbelangt, so ist im Hinblick auf die Herausbildung des Spanischenvon Bedeutung, dass der Romanisierungsprozess das kantabrische Bergland, die Heimat des Kastilischen, offensichtlich am wenigsten erfasst hat: Hier sind keine römischen Villen nachgewiesen, es gibt nur ganz wenige lateinische Inschriften und frühchristliche Zeugnisse, und die römischen Garnisonen befanden sich in Galicien und Asturien, jedoch nicht in Kantabrien. Hinzu kommt die zeitliche Staffelung der Romanisierung der Iberischen Halbinsel: Sie begann im Nordwesten zu einem Zeitpunkt, als sie im südlichen Teil schon fast vollständig abgeschlossen war. Diese späte und eher oberflächliche Romanisierung mag einer der Gründe dafür sein, dass das Kastilische in seiner Entwicklung im Vergleich zu den anderen ibero-romanischen Sprachen als innovativ zu charakterisieren ist und somit eine Sonderstellung einnimmt (siehe hierzu unten in 2.5.2.3).
2.3Das westgotische Superstrat
Die römische Herrschaft über die Iberische Halbinsel endete im 5. Jahrhundert, als verschiedene Volksstämme von jenseits der Pyrenäen in Hispanien eindrangen: die ostgermanischen Wandalen, die westgermanischen Sueben sowie Reste des iranischen Steppenvolkes der Alanen. Während die Alanen nach kurzer Zeit vernichtet wurden, hielten sich die Wandalen von 409–429 im Süden der Halbinsel, wurden dann jedoch von den Westgoten vertrieben und zogen nach Afrika weiter. Lediglich die Sueben, die sich im Nordwesten ein eigenes Reich schufen, konnten sich längere Zeit halten, bis auch sie gegen Ende des 6. Jahrhunderts von den Westgoten verdrängt wurden. Die Westgoten hatten zu Beginn des 5. Jahrhunderts Rom eingenommen und waren anschließend nach Südfrankreich weitergezogen, wo sie das Tolosanische Westgotenreich mit der Hauptstadt Tolosa (das heutige Toulouse) gründeten. Nachdem sie 507 von den Franken besiegt worden waren, ließen sie sich auf der Iberischen Halbinsel nieder, etablierten dort ein neues Reich und machten Toledo zu ihrer Hauptstadt. Nachdem die Iberische Halbinsel rund 700 Jahre von den Römernbeherrscht wurde (von 219 v. Chr. bis zum Beginn des fünften nachchristlichen Jahrhunderts), übernahmen Anfang des 6. Jahrhunderts die germanischen Westgoten die Herrschaft, die im Jahre 711 mit dem Einfall der Araber endete.
In der Anfangszeit waren die Westgoten und die Hispano-Romanen deutlich voneinander getrennt, weil ihr arianischer Glaube den Goten eine Vermischung (Mischehen) mit den Romanen verbot. Es kam hinzu, dass die Westgoten vor allem in ländlichen Gebieten siedelten, während die Romanen vorzugsweise in den Städten lebten. Die Situation änderte sich erst mit dem Übertritt des westgotischen Königs Rekkared zum Katholizismus im Jahre 589. Um das Jahr 654 wurde ein gemeinsames Gesetzbuch für die Westgoten und die Romanen in lateinischer Sprache verfasst, dieLex Visigothorum. Da die Westgoten seit dem 4. Jahrhundert in Dakien und später auch in Italien und in Südfrankreich in engem Kontakt mit den Römern gestanden hatten und daher mit deren Lebensweise, Kultur und Sprache vertraut waren, übernahmen sie das Lateinische der Hispano-Romanen ziemlich schnell und bereits im Laufe des 7. Jahrhunderts war die gotische Sprache von der Bildfläche verschwunden. Dies bedeutet, dass es zu keiner längeren Periode einer Zweisprachigkeit kam, was eine der Erklärungen dafür ist, warum der Einfluss des Westgotischen auf das hispanische Latein bzw. Frühromanisch nur sehr gering ausfällt.[3]In der Forschungsliteratur werden weitere Gründe genannt, wie etwa die Tatsache, dass die Westgoten, die nach dem Zerfall des Tolosanischen Reiches nach Hispanien einwanderten, im Vergleich zu den Romanen eine zahlenmäßig nur sehr kleine Bevölkerungsgruppe darstellten: Nach Schätzungen belief sich ihre Zahl nur auf ungefähr Zweihunderttausend (vgl. Hilty 2007a, 89).
Wenn die Eroberer ihre Muttersprache zugunsten der Sprache der Besiegten aufgeben und dabei Elemente aus ihrer ursprünglichen Sprache in die neu übernommene Sprache einfließen lassen, spricht man in der Sprachwissenschaft in Analogie zum Substrateinfluss von einem Superstrateinfluss, da ja in diesem Fall die Beeinflussung sozusagen von oben, von den Eroberern ausgeht (lat.superʻoben, überʼ). Der Superstrateinfluss des Westgotischen auf das hispanische Latein zeigt sich vor allem in zahlreichen Personen- und Ortsnamen, wobei letztere vor allem in Galicien und in Portugal begegnen (vgl. Lapesa 2008, 111):
Personennamen:Alfonso, Adolfo, Elvira, Fernando, Álvaro, Gonzalo, Rodrigo, Ramiro etc.
Ortsnamen: Guitiriz, Mondariz, Gomariz, Allariz, Gomesende, Gondomar etc.
Was Einflüsse auf den Wortschatz anbelangt, so wird bei mehr als 100 Wörtern ein westgotischer Ursprung diskutiert, und nur bei rund 20 gilt die westgotische Herkunft als weitgehend sicher; hierzu zählen beispielsweise:escanciar(ʻWein ausschenkenʼ),espía(ʻSpionʼ),ganso(ʻGansʼ),ganar(ʻgewinnenʼ),sacar(ʻherausnehmenʼ) (vgl. hierzu Bollée &Neumann-Holzschuh 2003, 42; Lapesa 2008, 110f.).
In der Morphologie stellt nur das Suffix -ing>engo, das in einigen wenigen Ableitungen lateinischer Wörter begegnet, westgotisches Erbe dar:abadengo(ʻzu einer Abtei gehörig; Besitzer eines geistlichen Gutesʼ),realengo(ʻKrongutʼ) (vgl. Bollée &Neumann-Holzschuh 2003, 42).
Weitaus bedeutender als der sprachliche Einfluss der Westgoten ist für die Sprachgeschichte der Iberischen Halbinsel die Tatsache, dass durch den Einfall der Westgoten und der anderen Volksstämme das ursprünglich einheitliche hispano-römische Herrschaftsgebiet in einzelne Germanenstaaten zerstückelt wurde und die engen Kontakte zu Rom sowie zu den übrigen Gebieten der Romania zum Erliegen kamen. Dies hatte zur Folge, dass das Lateinische der Pyrenäenhalbinsel nun Entwicklungstendenzen entfalten konnte ohne die ausgleichende bzw. korrigierende Einwirkung seitens der benachbarten Gebiete der Romania sowie vor allem auch von Rom (vgl. Lapesa 2008, 112).
2.4Das arabische Adstrat
Nach der Romanisierung war das wichtigste Ereignis für die Sprachgeschichte des Spanischen und der übrigen ibero-romanischen Sprachen die Eroberung der Iberischen Halbinsel durch die Araber im Jahre 711 und deren fast 800 Jahre währende Herrschaft, die bekanntlich erst im Jahre 1492 mit dem Fall von Granada ihr Ende fand. Die arabische Besetzung war aus zwei Gründen für die Sprachlandschaft der Halbinsel von besonderer Bedeutung: Zum einen hat das Arabische infolge des engen Kontaktes zu den Romanen in den verschiedenen romanischen Idiome seine Spuren hinterlassen, zum anderen – und dies ist von weitaus größerer Bedeutung – ist die Ausgestaltung der heutigen Sprachlandschaft der Iberischen Halbinsel eine direkte Folge der Rückeroberung (Reconquista) der arabisch besetzten Gebiete durch die Christen. Die Reconquista und deren Auswirkungen auf die sprachliche Physiognomie der Pyrenäenhalbinsel werden unten in 2.5 behandelt, im Folgenden wollen wir uns daher auf die Behandlung anderer Aspekte beschränken: Wie stellte sich die sprachliche Situation inAl-Andalus[4]nach dem Einfall der Araber dar, in welchen Bereichen zeigen sich arabische Einflüsse auf das Spanische und wie sind diese zu bewerten?
Die arabische Kultur war der christlichen Kultur im frühen Mittelalter deutlich überlegen, was sich vor allem in den Wissenschaften, im Handel sowie im Siedlungs- und Wohnungsbau zeigte. Wie wir schon bezüglich des Verhältnisses zwischen vorrömischen Völkern und Westgoten einerseits und den Römern andererseits gesehen haben, wirkt eine eindeutig überlegene Kultur anziehend auf Außenstehende, die schließlich die Nähe der besonders prestigeträchtigen, dominanten Kultur suchen. So sind viele Christen (Romanen) nach der arabischen Eroberung zum Islam übergetreten (diese Bevölkerungsgruppe wird in der Forschung alsMuladíesbezeichnet) (vgl. hierzu sowie zum Folgenden Bossong 2007, 66–73). Andere Romanen, dieMozaraber(< arab.musta ʼrabʻarabisiertʼ),blieben zwar ihrem christlichen Glauben treu, doch waren sie von der arabischen Kultur durchdrungen, die sie bewunderten; neben Mozarabisch, dem romanischen Idiom vonAl-Andalus, beherrschten sie daher auch das Arabische. Schließlich gab es auf der Pyrenäeninsel auch Juden, die hier schon lange vor dem Eindringen der Araber ansässig waren und Romanisch sprachen. Die gebildeten Juden kannten daneben aber auch die „heilige Sprache“, das Hebräische, was ihnen die Übernahme des Arabischen, das ebenso wie das Hebräische eine semitische Sprache ist, erleichterte. In Al-Andalus lebten Muslime, Christen und Juden lange Zeit weitgehend friedlich zusammen (die sog.convivencia), was einen regen kulturellen und auch sprachlichen Austausch ermöglichte.Al-Andalusentwickelte sich so zu einem zweisprachigen Kulturraum, fast jeder Bewohner des Landes konnte Arabisch (genauer gesagt den hispanoarabischen Dialekt) und Mozarabisch:
Mozaraber:Mozarabisch – dialektales Arabisch
Muladíes:Mozarabisch – dialektales Arabisch
Araber:dialektales Arabisch – z.T. auch Mozarabisch
Juden:Mozarabisch – dialektales Arabisch
Im Einzelnen war die sprachliche Situation jedoch sehr viel komplexer: Die gebildeten Christen beherrschten außer dem Mozarabischen (und eventuell dem dialektalen Hispano-Arabisch) auch das Lateinische, die Mozaraber waren zudem auch noch mit dem Hocharabischen als Kultursprache vertraut; auch die gelehrten Juden waren mit dem klassischen Arabisch vertraut, sie beherrschten darüber hinaus noch das Hebräische und das Griechische, wobei das Hebräische jedoch lediglich als Schriftsprache fungierte, in keinem Fall Mutter- oder Umgangssprache war; gebildete Araber waren natürlich auch des klassischen Arabisch mächtig. Wenn wir einmal von einigen berberischen Dialekten absehen, die in späteren Jahrhunderten mit berberischen Söldnern auf die Halbinsel kamen, so gab es in Al-Andalus nicht weniger als drei Schrift- bzw. Distanzsprachen (Hocharabisch, Latein und Hebräisch) sowie zwei Umgangssprachen bzw. Nähesprachen: dialektales Arabisch und Mozarabisch (Romanisch).
Das skizzierte Miteinander der Sprachen führte dazu, dass in Al-Andalus Arabismen in das Romanische der Mozaraber eingedrungen sind und über diese Bevölkerungsgruppe dann auch Eingang in andere romanische Varietäten fanden. Aber auch die umgekehrte Einflussnahme ist zu verzeichnen: Das dialektale Arabisch der Iberischen Halbinsel hat seinerseits auch einige Romanismen aufgenommen.
Was die Arabismen im Romanischen, genauer gesagt im heutigen Spanisch, anbelangt, so erstaunt ihr sehr geringer Gebrauchswert: Im spanischen Wortschatz gibt es zwar mehr als 1000 Arabismen, und rechnet man die Ortsnamen hinzu, dann sind es sogar noch sehr viel mehr Entlehnungen aus dem Arabischen, doch unter den 5000 häufigsten Wörtern des Spanischen finden sich gerade einmal 36 Arabismen (vgl. Bollée &Neumann-Holzschuh 2003, 48). Dennoch repräsentiert das Arabische nach dem Lateinischen die zweitwichtigste Quelle für die Lexik des Spanischen (vgl. zumFolgenden v.a. Bollée &Neumann-Holzschuh 2003, 48–51):
a) Wortschatz:
Kriegswesen:tambor‘Trommel’,atalaya‘Wache; Wachturm, Aussichtsturm’
Ackerbau, Gartenkultur:noria‘Schöpfrad’,alubia‘Bohne’,zanahoria‘Karotte’,aceituna‘Olive’,azúcar‘Zucker’,algodón‘Baumwolle’,berenjena‘Aubergine’
Arbeitswelt, Handwerk:tarea‘Arbeit, Aufgabe’,taza‘Tasse’,jarra‘Krug’
Handel und Verkehr:almacén‘Lagerhaus’,maravedí‘Goldstück’,quintal‘Zentner’
Siedlung, Haus, Wohnung:arrabal‘Vorstadt’,barrio‘Stadtviertel’,aldea‘Dorf’,albañil‘Maurer’,almohada‘Kissen’,alfombra‘Teppich’
Speisen, Instrumente, Spiele:arrope‘Sirup’,laúd‘Laute’,ajedrez‘Schach’,azar‘Glücksspiel’
Institutionen, Rechtspflege:alcalde‘Bürgermeister’,alguacil‘Gerichtsvollzieher’
Mathematik:álgebra,algoritmo,cifra‘Ziffer, Zahl’,cero‘Null’
Alchimie:alquimia‘Alchimie’,alambique‘Destillierkolben’,alcohol,elixir‘Heiltrank; Zaubertrank’
Medizin:nuca‘Nacken’,bazo‘Milz’
Astronomie:cenit, Sternnamen wieAldebarán,Vegausw.
Über arabische Vermittlung gelangten Wörter aus anderen Sprachen ins Spanische:
aus dem Persischen:jazmín,naranja,azúcar,azul
aus dem Griechischen:arroz,alambique
aus dem Lateinischen:alcázar(<CASTRUM)
Bei den Arabismen handelt es sich in erster Linie um Substantive, vor allem um Konkreta (s.o.), es finden sich nur wenige Abstrakta, wie z.B.alborozo‘Freude; Jubel’;alboroto‘Lärm, Radau’. Bei den übrigen Wortarten gibt es nur wenige, die arabischen Ursprungs sind:
Adjektive:mezquino‘armselig; dürftig; knauserig’;baladí‘wertlos; gering; unbedeutend’;azul,caramesí‘scharlachrot’;baldío‘öde; brach’
Verben:halagar‘schmeicheln’;acicalar‘reinigen, polieren’
Präpositionen:hasta
Interjektionen:ojalá(<arab.wa ša (A)llāh‘Gott wolle es’),olé(<arab.wa (A)llāh‘bei Gott’)
Viele lexikalische Arabismen wurden später durch Wörter lateinischen Ursprungs ersetzt, z. B.alfayatedurchsastre(‘Schneider’),alfajemedurchbarbero(‘Barbier’).
b) Ortsnamen (Toponyme) und Gewässernamen (Hydronyme):
La Mancha (‘Hochfläche’)
Alcalá (‘Burg’)
Medina (‘Stadt’)
Algeciras (‘die Insel’)
Gibraltar (‘Berg des Tariq’)
Guadalajara (‘Steinfluss’)
Guadalquivir (‘großer Fluss’)
c) hybride Bildungen aus lateinischen und arabischen Elementen:
Guadelope, Guadelupe (arab.wadi‘Fluss’, lat.lupus‘Wolf’);mit arabischem Artikel: Almonte, Alpuente usw.
In derMorphologieist der Einfluss des Arabischen äußerst gering: Die Endung -íist als Bestandteil arabischer Adjektive und Substantive ins Spanische eingedrungen (z.B.baladí,maravedí(s.o.)) und wird noch heute als Suffix bei Ableitungen von Namen (z.B.alfonsí) verwendet. Im modernen Spanisch begegnet es bei Ethnika, die sich auf Städte und Länder der semitischen bzw. islamischen Welt beziehen:israelí,iraquí,marroquíetc.
In derSyntaxlässt sich kein Arabismus nachweisen. Die von Bollée &Neumann-Holzschuh (2003, 50) und anderen Autoren arabischem Einfluss zugeschriebene Relativsatzkonstruktion des Typsla sombra que tú quieres saber su altura(anstatt:la sombra cuya altura tú quieres saber) stellt sicher keine Übernahme aus dem Arabischen dar, sondern vielmehr handelt es sich um eine weit verbreitete übereinzelsprachliche Struktur, die in vielen Sprachen, die nie einen nennenswerten Kontakt mit dem Arabischen hatten, existiert, wie beispielsweise in einigen Kreolsprachen, im Brasilianischen, Chinesischen, Neugriechischen, Irischen, in slawischen Sprachen etc. (vgl. Barme 2003, 239f.).
Beim Einfluss des Arabischen auf das Romanische handelt es sich um einen Adstrateinfluss, das Arabische fungierte als Adstrat des Romanischen, ebenso wie das Romanische in Bezug auf das Arabische als Adstrat gewirkt hat, denn wie bereits erwähnt wurde, hat das hispanische Arabisch durchaus auch einige Wörter aus dem Romanischen aufgenommen. Von einem Adstrateinfluss spricht man, wenn Handels- und Kulturbeziehungen auch sprachliche Beeinflussungen nach sich ziehen. Besteht zwischen den beiden in Kontakt stehenden Sprachen eine Diskrepanz im Hinblick auf ihr Prestige, so spiegelt sich dies in der Regel deutlich in der Zahl der Entlehnungen wider. Diese Art von Sprachkontakt verläuft im Unterschied zum Substrat- und Superstrateinfluss ohne Sprachwechsel. Daher ist es falsch, wenn in einigen romanistischen Werken vom arabischen Superstrat die Rede ist, denn im Gegensatz zu den Westgoten haben die Araber als Eroberervolk ihre Sprache nicht zugunsten der Sprache des eroberten Volkes aufgegeben.
2.5Ausgliederung und Ausbreitung des Kastilischen
2.5.1Die Entstehung der christlichen Königreiche und die Reconquista
Das (Alt-)Spanische basiert bekanntlich auf dem Kastilischen, das im frühen Mittelalter zu den romanischen Varietäten gehörte, die sich im nördlichen Teil der Iberischen Halbinsel aus dem lokalen Vulgärlatein herausgebildet hatten, wobei hier neben dem Kastilischen in erster Linie die folgenden Idiome zu nennen sind: Galicisch-Portugiesisch, Asturisch-Leonesisch, Aragonesisch und Katalanisch. Im Folgenden geht es vor allem um die Frage, warum gerade das Kastilische zum Spanischen wurde und durch welche sprachlichen Charakteristika sich diese Varietät von den anderen iberoromanischen Idiomen abhebt (die folgende Darstellung basiert vor allem auf Roegiest 2006, 224–234).
Als die Westgoten, die Bewahrer der römischen Zivilisation und Verteidiger des Christentums auf der Iberischen Halbinsel, im Jahre 711 von den Arabern unter Tarik geschlagen wurden, fanden sie in den Bergregionen im Norden, in derCordillera Cantábrica, Zuflucht. In dieser Bergregion, die als Wiege Spaniens gilt, hat das christliche Heer den Vorstoß der Araber aufgehalten. Im Jahre 718 hat der legendäre Anführer der Westgoten, Pelayo, den Arabern beiCovadonga(Cava Dominica‘die Grotte/Höhle der Jungfrau Maria’) ihre erste Niederlage beigebracht. Der westgotischen Aristokratie gelingt es, sich im 8. Jh. in dem kleinen Königreich Asturien (Asturias), rund um die Stadt Oviedo, zu reorganisieren, und sie wählt den besagten Pelayo zu ihrem ersten König. Zu Beginn des 9. Jh. gibt es somit zwei Zentren des Widerstandes gegen die Araber: das fränkische Katalonien (von den ArabernAl Afranjgenannt) und Asturien, wozu seinerzeit auch Galicien zählte (bei den Arabern heißt dieses GebietJalîkîya).
Aus dem Königreich Asturien wird ein Jahrhundert später unter Alfons III. das Königreich León, das von Galicien bis nach Kantabrien und zum Baskenland reicht. Dieses Königreich strebt die Rückeroberung der von den Arabern besetzten Gebiete an und betrachtet sich als Erbe und Erneuerer der westgotischen Monarchie, und zwar vor allem auch deshalb, weil es die christlichen Gebiete des Nordwestens der Halbinsel vereinigt hatte. Insofern sind die Herrscher (magni reges) des Königreichs León die Bewahrer der römischen Kultur, die sie von Toledo, der früheren Hauptstadt des Westgotenreiches, in den Norden getragen hatten. Im Jahre 900 erstreckt sich ihr Herrschaftsgebiet bis zum Duero und Mitte des 10. Jh. bis Salamanca (all diese verwüsteten Gebiete werden nach der Rückeroberung wiederbevölkert). Während dieser Periode (vom 8. bis zum 10. Jh.) dringen die entstehenden christlichen Königreiche nur langsam nach Süden vor und stellen keine wirkliche Bedrohung für das mächtige Kalifat von Córdoba dar.
Anfang des 10. Jh. geht die militärische Stärke der leonesischen Herrscher zurück, nachdem das arabische Heer des Kalifats von Córdoba, das verstärkt worden war, unter der Führung von SultanAl Mansûr(Almanzorim Spanischen) zweimal die Hauptstadt León geplündert und die Stadt Santiago de Compostela, ein bedeutendes Zentrum der Christenheit, angezündet hatte (die Araber ließen die Glocken der Kirche von Santiago de Compostela von christlichen Sklaven nach Córdoba transportieren).
In der Zwischenzeit war im Osten des Königreichs León (in Kantabrien), um die Stadt Burgos, eine kleine Vasallengrafschaft der leonesischen Könige entstanden (884). Wegen der militärischen Schwächung Leóns konnte diese kleine Grafschaft schließlich die Unabhängigkeit erreichen. Das Territorium dieser Grafschaft, das durch die Kämpfe zwischen Christen und Arabern weitgehend entvölkert worden war, wurde durch Siedler aus dem Norden, d.h. aus Kantabrien und dem Baskenland, sowie – in geringerem Maße – durch Mozaraber wiederbevölkert (repoblación), was aus linguistischer Sicht insofern von besonderer Bedeutung ist, als das Zusammentreffen von Siedlern unterschiedlicher regionaler Herkunft die Entstehung einerKoinébegünstigte,[5]die als Grundlage für die Herausbildung des Kastilischen zu sehen ist (vgl. hierzu Bustos Tovar 2004, 275). Das im Zuge der oben genannten Entwicklungen neu entstandene Reich, das wegen der Vielzahl der dort vorhandenen Burgen, die zum Schutz gegen Übergriffe der Araber errichtet werden mussten, den NamenKastilien(sp.castillo‘Burg’) erhielt, rivalisierte mit dem Königreich León und etablierte sich aufgrund seiner militärischen Stärke schließlich als entscheidende Kraft im Kampf gegen die Araber. Im Jahre 1037 wurde Fernando I. von Kastilien auch König von León und Galicien, während sich das Kalifat von Córdoba wenige Jahre zuvor (1031) in viele kleine Königreiche (die sog.Taifas) aufgeteilt hatte, die das militärische Vordringen Kastiliens nicht mehr verhindern konnten. Zum ersten Mal sind Kastilien und León unter demselben König vereinigt, und Kastilien übernimmt die Führungsrolle in derReconquista.
Fernando I. teilte seine drei Königreiche (Kastilien, León und Galicien) unter seinen Söhnen auf, später wurden sie unter Alfons VI. jedoch wieder vereint. Zwischen dem 11. und 12. Jh. übernehmen die christlichen Königreiche die militärische Initiative und Alfons VI. nimmt 1085 Toledo ein. Einer seiner besten Heeresführer ist Rodrigo Díaz de Bívar, besser bekannt alsCid, Protagonist des spanischen NationaleposCantar de Mio Cid. Das militärische Vordringen Kastiliens (unter Alfons VI. und demCid) sowie des Königreichs Aragón kann nur für kurze Zeit von den religiös-fanatischen Almoraviden und später von den Almohaden aufgehalten werden.
Im Jahre 1212 kommt es beiLas Navas de Tolosazur entscheidenden Schlacht derReconquista