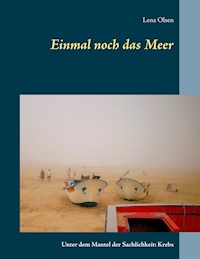
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir Menschen schmieden Pläne, versuchen uns daran zu halten und stehen plötzlich vor einer Tatsache, die mit unserem Plan gar nichts zu tun hat. Das Unerwartete kommt selten aus der Ecke, wo es vermutet wird, eine Binsenweisheit. So erging es uns. Was war geschehen, dass ich mich suchend umsah, Selbstgespräche führte, mich von der Familie abgrenzte. Dass ich verloren schien wie eine fast Ertrunkene, die auf einer einsamen Insel gestrandet war und nun gegen alle Vernunft und Erfahrung auf Rettung hoffte? Das, was alle Tage geschieht, tausendfach, in diesem Land und überall. Mein Mann Thomas sollte sterbenskrank sein: Krebs. Wir hatten kaum Zeit, diese Diagnose in unser Bewusstsein dringen zu lassen, da war er bereits operiert. Aber wie betäubt waren wir erst nach der überstandenen Operation, als die Gutachten der Experten Thomas nur noch drei bis sechs Monate Lebenszeit zu-gestehen wollten. So begann unser letzter kurzer gemeinsamer Weg. Wir suchten allerdings nach einem Ausweg, dem zu entgehen. Was wäre mein Leben ohne ihn an meiner Seite? Es gab nur eine Möglichkeit. Und mit dieser Entscheidung katapultierten wir uns ins doppelte Abseits. Wir befanden uns in einer Ausnahmesituation. Unsere Wahrnehmung war eingeschränkt. Wir verstanden die Reaktionen unserer Freunde, Verwandten und Bekannten nicht, waren enttäuscht über deren Verhalten. Und dann kam es doch ganz anders als geplant.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Aus der abgelaufenen Zeit kann ich nichts mehr machen außer Bücher.
Zukunft ist heute.
Inhaltsverzeichnis
DAS LEBEN, WIE ES WAR UND WIE ES WERDEN KÖNNTE
EIN ZWEITES LEBEN
ANALYSEN
NORMALES LEBEN
VORBEREITUNGEN ZUR FLUCHT
ZWISCHENSPURT
AUF DEM VULKAN
VORSORGE
ZUKUNFT IST HEUTE
EINBRÜCHE
EINMAL NOCH DAS MEER
ALTE UND NEUE FREUNDE
DER GESCHUNDENE KÖRPER
ICH, LENA
ABSCHIED
AUFBRUCH
SPAZIERGANG IN EINER KÜHLEN APRILNACHT
SONNENSCHEIN
FAMILIENTAFEL
EINE BOOTSFAHRT
RÜCKKEHR
NACHWORT
Das Leben, wie es war und wie es werden könnte
Was war geschehen, dass ich mich suchend umsah, Selbstgespräche führte, mich von der Familie abgrenzte. Dass ich verloren schien wie eine fast Ertrunkene, die auf einer einsamen Insel gestrandet war und nun gegen alle Vernunft und Erfahrung auf Rettung hoffte? Das, was alle Tage geschieht, tausendfach, in diesem Land und überall. Was den Unbeteiligten nur am Rande berührt, wenn überhaupt, da es das Gewöhnlichste war, mit dem jeder zu rechnen hatte, was aber verdrängt wurde, verständlicherweise, da man nicht leben kann in dem Bewusstsein des nahen Todes oder einer groben Behinderung des normalen Lebens.
Thomas und ich waren im Krankenhaus gewesen, um eine Diagnose zu hören, Thomas betreffend. Wir erfuhren, dass sein Leben nur durch eine schwer wiegende Operation zu retten war. Die unbestimmte Angst, die sich einige Wochen zuvor in uns eingenistet hatte, wurde durch klare medizinische Aussagen umgewandelt in eine konkrete Bedrohung. Die Tragweite zeigte sich irgendwo diffus am Horizont, löste sich nicht auf, wollte aber auch nicht näher kommen.
So wurde aus einem heißen Frühsommertag mit einer fast unerträglichen Schönheit ein Tag des zunächst noch leisen Schreckens. Das konnte auch nicht anders sein, da wir zu der Sorte Mensch gehörten, die in jedem Fall dank ihres Humors und vielleicht noch dank einer soliden gemeinsamen Basis jedem Schrecken standhielt.
Thomas und ich hatten uns bisher auf unsere Körper verlassen können, und es wäre uns nicht in den Sinn gekommen, es könnte dringende Signale geben, die wir missachtet hätten. Aber genau das war geschehen. Im Nachhinein und nach einigem Zögern wussten wir und gaben es zu, dass uns die Angst verboten hatte, die Versuche ernst zu nehmen, die Thomas’ Körper gestartet hatte, um auf sich aufmerksam zu machen. Dabei waren wir sogar von einer Fachärztin unterstützt worden, die die beschriebenen Symptome herunterspielte. Wieso sollten wir es besser wissen als diese Fachfrau?
Dieser flimmernde Tag gab unserem Leben eine Wende, wie sie zwanghafter und gleichzeitig absurder nicht sein konnte.
Wir begannen mit den Vorbereitungen für einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus. So kurz wie möglich sollte der Zeitraum bis zur Operation bemessen sein, auch wenn diese durchaus lebensbedrohend werden könnte. Allerdings, so hatte sich der begutachtende Operateur geäußert, sei Thomas in hervorragendem Zustand für die Operation, was Thomas’ und meine Vorliebe fürs Paradoxe sehr entgegen kam. Wenigstens war dies eine Tatsache, auf die wir bauen konnten.
Die wenigen Tage vergingen, als wären die uns zugewiesenen Stunden in einem Zeitraffer versteckt, der sie einfach nicht freigeben wollte.
An einem Spätnachmittag des Frühsommers 1989 begleitete ich Thomas in sein neues Zimmer und nahmen wir davon Besitz. Wir waren ganz nah beieinander, scherzten auf unsere Art über dieses und jenes und wollten den Abschied so weit wie möglich hinausschieben.
Als mich schließlich gegen 22 Uhr die Nachtschwester zu gehen bat, brachte mich Thomas zum Aufzug. Wir umarmten uns eine Zeitlang fest, und ich flüsterte ihm zu, ich käme am nächsten Tag direkt nach der Operation zu ihm, nachdem ich mit dem Professor gesprochen hätte. Dann betätigte ich den Knopf, um nach unten zu fahren. Die Tür ging zu, jedoch nur halb. Sie öffnete sich wieder ganz. Thomas schaute verdutzt, ich startete den zweiten Versuch. ‚Du willst wohl nicht gehen’, sagte Thomas. Ich lachte. Erst beim dritten Anlauf schloss sich die Tür, und mit klopfendem Herzen und einem dicken Kloß im Hals fuhr ich im Aufzug dem Ausgang zu.
Etwas später wird Thomas in sein Tagebuch schreiben:
Wir konnten uns nicht trennen, meine Liebste und ich. Das wäre schlimm, wenn ich sie alleine zurück lassen müsste. Bisher habe immer ich mich in dieser Rolle des Zurückgelassenen gesehen. Am Fahrstuhl schicke ich meine Liebste weg. Sie denkt, er fährt los, aber die Türen schließen sich nicht. Erst mit Verzögerung. Um 22 Uhr kommt der Nachtdienst, ein irischer Pfleger und sagt: ‚Sie sind doch Schriftsteller. Morgen springen Sie von der Bahre und sagen, Sie kämen im Auftrag von Wallraff und wollten sehen, wie die Zustände in dieser Klinik sind.’ Er gibt mir das verlangte Schlafmittel. Das erste in meinem so überaus gesunden Leben.
Und Thomas schreibt auch: Wir sind immer noch ganz betäubt von der Tatsache, dass ich Krebs habe. Ich gehe jetzt weiter: die Vorbereitung auf die Operation, was alles gemacht werden soll. Ich werde meinen Körper zur Verfügung stellen, damit Ärzte und Pfleger stechen und schneiden, aber vielleicht auch heilen. Wie sagt mein Nachbar: positiv denken, den Makel, die Stigmatisierung des Krebskranken überwinden. Die schneiden deinen Körper auf wie eine Dose, versehen ihn mit einem Reißverschluss. Vergiss endlich alle Sorgen um die Zukunft. Wenn du überleben willst, musst du dich auf die vitalen Funktionen konzentrieren, darauf, dass dein Herz stark schlägt, dass Lena für dich da ist.
Draußen angekommen, wurde ich von der immer noch vorhandenen Hitze erfasst. Es war noch hell und die Menschen, die mir auf dem Weg begegneten, kamen oder gingen in Biergärten, waren fröhlich und lebten. Und fast immer waren sie zu zweit unterwegs.
Es tat weh, Thomas im Krankenbett zu wissen; ihn, den ich nicht leidend gekannt hatte, der sportlich und gesund, gut trainiert und ausdauernd war in dem, was er sich abforderte, um die vielen, vielen Stunden Tag für Tag am Schreibtisch sitzend nicht zu einer Tortur werden zu lassen. Es tat weh, sich an den Ausdruck seiner Augen zu erinnern, als er die Diagnose empfing, die er, wie er mir gestand, bereits geahnt hatte.
Diese plötzliche Verlorenheit in einer Welt, die er nicht kannte, die er nie hatte kennen lernen wollen, in die er sich nun fügen musste, er, einer unter vielen, einer wie alle, was er nie war. Ich stellte mir vor, wie er sein neues Bett annahm in dem Bewusstsein eines Ausgeliefertseins, das er nicht gewählt hatte. Und in dem undenkbaren Gedanken, dass er und damit sein Leben in äußerster Gefahr war. Es ging tatsächlich um ihn. So wichtig war er nie gewesen, wollte es auch jetzt nicht sein. Jetzt drehte sich alles um ihn allein. In die Mitte gezogen, gezerrt, zum Objekt von Chirurgen, Krankenschwestern, ein Fall aus einer bereits bestehenden Statistik, eine Nummer mit Werteinträgen, ein Computerausdruck mit Daten, ein Patient. Wirklich ein Patient.
Ich fühlte die zärtlichsten Gedanken sich ihren Weg bahnen. So musste es sein, wenn Eltern ein Kind zurückließen in den Mauern eines Krankenhauses. Fremden Menschen aussetzten, die nichts von den Gewohnheiten des Kindes wussten, die einem Beruf nachgingen, für den sie bezahlt wurden. Was würde geschehen, wenn das Kind weinte? Wer würde es trösten können. Was würde geschehen, wenn die Angst aufstiege? Wie allein war ein Mensch in solch einer Stunde. Ich sprach in Gedanken mit meinem Mann über alle Entfernungen hinweg. So war ich schneller zu Hause, als ich erwartet hatte.
Ich ging zum Telefon, um noch einmal seine Stimme zu hören. Thomas gestand mir, wie um mich zu trösten, dass er die nächsten Stunden nutzen würde, seinen Körper auf die ungeheure Aufgabe einzustimmen, die lautete, nicht aufzugeben.
Auf diese Weise verabschiedeten wir uns für die Nacht und den Morgen des nächsten Tages.
Für mich und Thomas war es ein unverschämtes Glück, dass wir einander begegnet waren. Von Beginn an fehlte die Frage, ob aus daraus mehr entstehen könnte als nur eine Affäre. Vom Scheitelpunkt unserer Leben war deren Fortsetzung nur in eine gemeinsame Richtung möglich. Diese Gewissheit war allerdings kein Thema, wurde nie ausgesprochen. Was getan werden musste, war umgehend getan. Der hierfür erforderliche Egoismus stellte sich aus der Sicht unserer Umgebung erschreckend schnell ein.
Aber da das Menschenleben im allgemeinen aus Kompromissen bestand, die häufig genug weder zum Glück noch zum Unglück führten, den Beteiligten vielmehr ein Aufgehobensein vermittelten, das mit geringem Risiko behaftet schien, durften Thomas und ich nicht so kleinmütig sein und diese Chance ungenutzt lassen. Es gab genügend Anfeindungen und moralisierende Freunde, die sich Gehör verschaffen wollten. Schließlich befanden wir uns beide in einer lebendigen Beziehung mit anderen Partnern.
Die beiden Menschen, um die es hier geht, wir beide nämlich, hatten unser Schicksal angenommen. Wir nahmen Neid und Missgunst wahr, ließen es aber unkommentiert im Raume stehen. Es blieb letztlich unbedeutend.
Viele Male im Laufe der fünfzehn Jahre unseres gemeinsamen Ausflugs in die Welt kamen uns die Worte über die Lippen, die ausdrückten, was wir immer wieder empfanden: dass nur ein ungeheures Glück uns umfangen hielt, das nicht selbstverständlich, sogar außergewöhnlich war. Dass wir uns dieses Glücks als würdig zu erweisen hätten und dies ohne jeden Zweifel versuchen wollten.
Und die schönste Vorstellung war, so banal das auch klingen mochte, gemeinsam und bewusst alt zu werden. So fest hingen wir an diesen Bildern, wie an einem Pakt, der geschlossen war. Und auf der Rückseite der Bilder stand geschrieben, dass wir gemeinsam an einem von uns auserwählten Tage sterben wollten.
Bei allem, was in den folgenden Jahren geschah, sahen wir uns nie getrennt.
Ein zweites Leben
Ich liege im Bett in einer Wohnung, die nur vorübergehend meine ist, die ich bald verlassen muss. Ich stelle einen Plan auf, wie das äußerliche Leben weiterzugehen hat, wenn Thomas aus dem Krankenhaus entlassen sein wird. Ich bin wie er überzeugt davon, dass mit Hilfe der schweren Operation ein erster Schritt getan sein wird, der uns Bedenkzeit verschafft.
Diese hatten wir in den wenigen Tagen nicht gehabt. Beide liebten wir absurde Situationen, und zur Zeit war unsere eigene nichts anderes als genau das. Sich Thomas ernsthaft in einem Krankenbett vorzustellen war ungefähr so, als wenn sich unsere Katze in einer halb gefüllten Badewanne mit einer Plastikmaus wiederfinden würde. Was hat man denn mit mir gemacht? Was soll der Unsinn? Wahrscheinlich liegt hier eine Verwechslung vor.
Bis auf die Schluckbeschwerden hatte Thomas sich wohlgefühlt. Dass es ihm schon längere Zeit hin und wieder schwer gefallen war, beim Essen normal zu schlucken, hatte er beiseitegeschoben. Bei der Spiegelung der Speiseröhre habe man ihn verletzt, so dachte er, Ungeschick des Arztes im Umgang mit dem Instrument. Dass es zu Blutungen kam, konnte nur darauf zurück zu führen sein. Eine andere Ursache hierfür kam uns nicht in den Sinn.
Thomas hatte allerdings in der Nacht vor der Untersuchung einen Traum gehabt, den er in sein Tagebuch schreibt: Geträumt: Ich wurde operiert, der Fachmann war nicht da, so dass eine junge Assistentin operierte. Sie wühlte immer tiefer in meinen Eingeweiden, ich sah zu. Endlich gab sie auf: Ich finde die Linse nicht. Da wusste ich, sie meinte, sie finde den Herd des Krebses nicht.
Und so war es. Nur die Operation konnte hier Klarheit bringen. Die Entscheidung dazu war zügig getroffen worden.
Am folgenden Tag rief ich vom Büro aus in der Klinik an. Der Professor, der die Operation selbst durchführen wollte, hatte mich dazu ermuntert. Er war überhaupt derjenige, den Thomas ernst nahm und der ihm und auch mir von Anfang an gefallen hatte. Am Telefon sagte mir der Chirurg, dass die Operation gut verlaufen sei, Thomas liege auf der Intensivstation. Über das Stadium des Tumors sagte er nur, er habe alles entfernt, was sichtbar gewesen sei; er habe genug gesehen.
Ich, um Sachlichkeit bemüht, bat für den kommenden Tag um einen Gesprächstermin, der mir gern gewährt wurde. Von vorn herein war zwischen uns und dem Professor ausgesprochen worden, dass Aufrichtigkeit herrschen müsse, sowohl bezüglich der Diagnose als auch möglicher Therapien. Nur so würden Thomas und ich in der Lage sein, unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Und auch nur auf diese Weise würde den Beteiligten ihre Würde erhalten bleiben. Ein anderer als dieser Professor hätte womöglich seine Schwierigkeiten damit gehabt. Umso sympathischer wurde uns dieser.
Am frühen Nachmittag verließ ich mein Büro und machte mich auf den Weg. Thomas im kalten Licht der Intensivstation zu sehen, rechts und links von ihm Schwerstkranke, die wie er an Tröpfen und Schnüren hingen, war ein Anblick, der mir die Luft nahm. Ich setzte mich langsam an sein Bett und nahm die freie Hand. Er versuchte mir zuzulächeln, was ihn sehr anstrengte. Er war nicht fähig zu sprechen, versuchte zu flüstern, aber die Schwester bedeutete ihm, es zu lassen. Ich blieb bei ihm, Worte zu finden, die ihm Mut machen sollten, diese Tage gut zu überstehen. Ich würde so oft kommen, wie es mir möglich wäre. Mein Mann lächelte.
Zu dem kurzen Gespräch am folgenden Tag war mein Schwiegervater angereist. Der alte Mann hatte darum gebeten, anwesend sein zu dürfen, wenn über den Zustand und die Aussichten seines Sohnes gesprochen wurde. Keine leichte Aufgabe, weder für den Professor, noch für den alten Mann, und auch nicht für mich.
Thomas blieben vielleicht noch drei bis sechs Monate Lebenszeit; wie diese aussehen könnten, sei momentan nicht vorauszusagen. Auch solle Thomas das noch nicht erfahren, die Erholung von der Operation, die längst nicht jeder überstehe, sei wichtiger.
Da standen wir zwei auf dem Flur des Krankenhauses. Mein Schwiegervater bewahrte Haltung und ich nahm die Worte des Professors erst mal so hin wie die Mitteilung, die Waschmaschine sei nicht mehr funktionsfähig.
Wir gingen in ein nahe gelegenes Café und bestellten eine Kleinigkeit zu essen. Als wir nun so nahe beieinander saßen, wir, die nichts miteinander verband als Thomas, wussten wir, hier gab es keine Ausflüchte. Hier gab es auch keine Fluchtmöglichkeit. Hier blickten wir uns in die Augen und konnten vor der soeben erfahrenen Frist für Thomas’ Leben diese Augen nicht verschließen. Wir verständigten uns noch darauf, dass Thomas nichts erfahren solle, bis er dafür stark genug sei. Was das genau bedeutete, wussten wir beide nicht.
Dass ich mein Leben mit Thomas’ Leben so eng verknüpft hatte, dass wir gemeinsam sterben wollten, wusste bis zu diesem Zeitpunkt nur dieser alte Mann. Er drückte meinen Arm und wiederholte, was er bereits geäußert hatte, dass er damit nicht einverstanden sei, es jedoch respektiere. Das war in meinen Augen viel. Es war eine Art Geheimbund entstanden. Und der folgende Besuch bei Thomas auf der Intensivstation zeigte auch diesem, dass hier etwas vorgegangen war. Er ahnte allerdings nicht, was es war. Er freute sich, seinen Vater zu sehen. Der Professor, der zwischendurch den Raum betrat, wurde von Thomas sofort im Flüsterton in die Mangel genommen, er möge sich äußern zu den Prognosen. Dieser verwies auf die Tatsache, dass Thomas gerade erst dem Tod von der Schippe gesprungen sei und genug damit zu tun habe, die Folgen der Operation zu bewältigen. Alles würde zu seiner Zeit gesagt.
Das leuchtete ein, aber mir wurde deutlich, wie unbehaglich Thomas sich mit dieser Antwort fühlte.
Scham stieg heiß in mir auf wegen meines Wissensvorsprungs und die quälende Frage, wie lange ich diesen würde halten können oder sollen. Ich machte mir klar, dass auch ich mich diesen Gedanken nicht hingeben durfte, um Thomas nicht durch mein Verhalten zu verwirren. Lügen war mir immer schwer gefallen, um nicht zu sagen, fast unmöglich gewesen. Diese Situation könnte mich überfordern. Ich fühlte mich, als hätte ich in einen Tresor geschaut, dessen Inhalt nicht für mich bestimmt war. Ich hatte damit ein Tabu gebrochen, was mich niemals wieder unbefangen sein lassen würde in der Nähe meines geliebten Mannes.
Tag zwei endete somit nicht etwa mit dem Gedanken an das Ende meines eigenen Lebens, was man hätte erwarten können, sondern mit dem Gedanken, dass Thomas zur rechten Zeit eingeweiht werden möge. Das stand von nun an obenan in der Rangfolge all dessen, was zu bedenken sein würde und verursachte mir ungeheure Schmerzen. Ich fühlte eine Last auf mir, der ich mich nicht gewachsen wähnte.
Analysen
Die Vielfältigkeit eines jeden Charakters lebt auch in einer neuen Umgebung weiter, sogar oder erst recht im Krankenhaus. Thomas verfolgte die ihn umgebenden Ärzte mit Fragen und bekam so ernsthafte wie freche Antworten wie die eine, die er lange nicht vergessen konnte: ich weiß doch auch nicht, wie lange Sie leben werden!
Sobald es sein Zustand zuließ, stöberte er in der Bibliothek der Klinik. Da er wegen des erfolgten Magenhochzugs als Speiseröhrenersatz an Essenszeiten nicht gebunden war, sondern sich mit der so genannten Astronautenkost rund um die Uhr am Leben hielt, blieb ihm für Recherchen viel Zeit.
Seine Stimme war immer noch ein Flüstern, was sich nach Auskunft der Ärzte wieder geben würde, so dass er sie nicht einsetzen konnte, wie er es gewohnt war. Sobald er darüber nachdachte, überfiel ihn eine übermächtige Traurigkeit, da er im Wesentlichen mit seiner Stimme seinen Lebensunterhalt verdient hatte. So schlich sich ab und zu eine kaum zu bändigende Horrorvision in seine Gedanken, wie er mir sagte, die er aber ziemlich schnell wieder abzuschütteln wusste. Wie ihm das gelingen konnte, war für mich eines der großen Rätsel.
Seine Aufmerksamkeit galt vorrangig den Statistiken und deren Auswertungen aus der jüngsten Vergangenheit, galt den diversen Therapieformen, den Medikationen, den möglichen Metastasen und deren Wahrscheinlichkeit des Befalls bestimmter Organe.
Thomas ging an all diese Informationen mit der ihm eigenen wissenschaftlichen Akribie heran. Ich war beschäftigt, ab und zu die Notbremse zu ziehen. Wenn er das dann akzeptiert hatte, bekräftigte er scherzend, sein Ziel sei, aus allen Statistiken heraus zu fallen. Schon um meinetwillen, damit ich auch noch etwas mehr
Zeit zum Leben hätte, würde er alles tun, was er vermochte. Wir verbrachten Stunden damit, unsere Ziele und vor allem deren Rangfolge neu zu bestimmen. Wir trauten uns, in Zeiträumen von mehreren Jahren zu denken, wobei in meinem Kopf die Aussage des Professors immer ihre Runden drehte.
Bei der Erwähnung solcher Zeiträume überkam mich eine Beklemmung, und ich war manches Mal nahe daran, Thomas von dem Gesprächsergebnis zu berichten. Ich wusste, ich durfte das nicht tun.
Ich musste es ihm überlassen, anhand der ihm zur Verfügung stehenden Informationen selbst eine Annäherung zu schaffen. Ich studierte die Unterlagen, die er sich kopieren ließ, ebenso wie er.
Es war nicht zu übersehen, dass der Professor mit seinen Erfahrungen und seiner Kenntnis der statistischen Daten die Einordnung von Thomas’ Krankheitsstadium richtig vorgenommen hatte. Wie sich ihm der Patient gezeigt und wie er selbst sein Handwerk an Thomas hatte ausführen müssen, das war die Basis seiner Prognose. Sechs Monate Überlebenszeit sah die Klassifizierung vor, da der Tumor bereits in das umgebende Gewebe eingewachsen war. Das erkannte auch ich ganz deutlich.
Plötzlich war da in unser beider Leben eine Wand errichtet, wie wenn man ans Ende der Welt gelangt und eine Umkehr nicht mehr möglich ist. Eine Wand, zum Greifen nahe und rabenschwarz.
Thomas schreibt: Man ist so weit entfernt von allem. Diese Schritte im Karree. Unterhaltungen mit dem irischen Nachtpfleger. Er hält alle Politiker für gekauft. Seit Tagen Smogwetter. Und er schreibt auch: Nie wieder wird die Naivität kommen, einfach so dahinzuleben.
Thomas’ Genesung macht Fortschritte, wie er das erwartet hat. Den Professor sieht er täglich, aber er lässt ihn in Ruhe und fordert keine Festlegung auf bestimmte Prognosen mehr. Sie unterhalten sich über vieles. Einmal fragt Thomas ihn in meinem Beisein, ob er als Schriftsteller auf dieser teuren Privatstation Autorenrabatt bekomme, das würde sein Zahnarzt ihm auch gewähren. Der Professor fasst ihn leicht an der Schulter und sagt, er solle erst mal wieder gesund werden, bevor er sich mit solchen Fragen beschäftige. Eine Honorarrechnung hat Thomas nie erhalten.
Einmal sagt er zu mir: ‚Weißt du noch, wie ich immer gesagt habe, wenn du jemals sterbenskrank werden solltest, würde ich mitsterben? Nie bin ich davon ausgegangen, dass ich es sein könnte, der so krank ist. Und nun willst du mit mir sterben. Wenn du weiterleben würdest, hättest du mich bestimmt in drei Monaten vergessen. Überlege dir das genau.“
Ich hatte viele Male geäußert, dass ich mir nicht vorstellen könnte, ohne ihn zu leben. Und das meinte ich auch so, ohne jede Einschränkung. Es war unvorstellbar, es wäre für mich wertlos, einfach nicht lebenswert. Wir waren eins, auch wenn wir uns in Temperament und Charakter unterschieden und viele Meinungsverschiedenheiten auszutragen hatten. Wir sprachen dieselbe Sprache, teilten denselben Humor, unsere Körper waren eng verbunden, unsere politischen Ansichten ähnelten sich, viele unserer Interessen deckten sich. Und wir vertrauten einander und lebten ohne jenen zerstörenden Argwohn, der noch die beste Beziehung beenden konnte. Jeder von uns war ein eigenständiger selbstbewusster Mensch, der dazu beitrug, dass wir beide gut leben konnten durch den Ertrag unserer Arbeit. Materielles war uns nicht von Belang; für Bücher und Reisen gaben wir das Geld aus, Statussymbole kannten wir nicht.
Ich gehe Woche für Woche weiter meiner Büroarbeit nach und verabschiede mich täglich am frühen Nachmittag, um zu Thomas zu eilen. Die Arbeit hilft mir immer wieder, etwas Abstand zu gewinnen. Sonst würden meine Gedanken mich mit in den drohenden Sog ziehen, der unweigerlich vorhanden ist.
So bleibt etwas von jener Normalität vorhanden, die auch gleichzeitig Sicherheit bedeutet, die es ermöglicht, die Dinge zu tun, die getan werden müssen, und wenn sie noch so sinnlos erscheinen.
Thomas sieht indessen seinen Bettnachbarn, einen junger Lehrer, dem man den Magen entfernt hat, wie er sich auf seinen Auszug vorbereitet. Dieser leidet sehr unter der Stigmatisierung der an Krebs Erkrankten und Thomas glaubt, dass er Angst hat, in seinen Lehrer-Alltag zurück zu kehren. Seine Frau wird ihm dabei keine Hilfe sein können. Sie hat das Thema Krebs für sich abgehakt und mit Misstrauen beobachtet, wie die beiden Männer sich auf ihre Weise diesem Monstrum zu nähern versuchen, statt ihn zu verteufeln.
Einige Tage bleibt Thomas in dem Zweibett-Krankenzimmer allein. Das ist gut so. Wir haben eine schwierige Aufgabe zu lösen. Wie sollen wir uns entscheiden bei der Frage, ob Thomas sich einer Strahlentherapie stellen soll oder nicht. Diese beginne am besten gleich nach der Entlassung. Nachdem wir die routinemäßig seitens der Ärzteschaft empfohlene Chemotherapie mit einem Arzt unseres Vertrauens besprochen haben, werden wir uns darauf nicht einlassen. Der Patient gewinnt nur die Zeit zurück, die er vorher zu durchleiden hat. Wozu dann der ganze Schreckensakt mit den dann doch wiederkehrenden Hoffnungen auf Genesung, die einfach keine vernünftige Basis hat. Wir rechnen es dem Arzt hoch an, dass er zugibt, er kenne keinen Wirkstoff, der genau dieses Karzinom wirksam bekämpfen könnte.
Und wann immer über Therapien gesprochen wird, hoffe ich, Thomas möge so stark sein und erkennen, dass er, so wie er langsam wieder zu Kräften kommt, diese nicht zerstören darf durch Medikamente. Vor meinen Augen taucht nun häufiger diese schmale Zeitspanne auf, die der Professor genannt hat und von der Thomas immer noch nichts ahnt.
Deshalb stellt jeder Versuch, meinen Liebsten weiter dem normalen Leben zu entziehen, für mich einen Akt der Gewaltsamkeit dar, der durch nichts auf der Welt wieder gutzumachen sein wird. Auch in der Entscheidung für oder gegen eine Strahlentherapie fällt es mir schwer genug, Thomas nicht auf dem Weg dahin zu beeinflussen. Wir versuchen uns in sachlichen Argumentationen einen Weg zu bahnen. Ich hänge mich vorsichtig, damit es nicht zu sehr auffällt, an Thomas’ Ansicht an, auf eine Bestrahlung zu verzichten.
Wieder in der vertrauten ländlichen Umgebung unseres Hauses in der Eifel, das wir seit vielen Jahren am Wochenende nutzen, wird Thomas abwechselnd von Fieber und Schüttelfrost überfallen. Dafür gibt es keine körperliche Ursache. Wir wissen mit Sicherheit, dass Thomas ein Signal empfangen hat, diese Therapie doch zuzulassen. Und als das Fieber schließlich von allein abklingt, ist uns klar, wir werden das bewältigen. Ohne Analysen geht auch hier nichts. Thomas kennt alle möglichen Nebenwirkungen. Er benötigt dieses Wissen ebenso wie ich. Thomas als passionierter Bergsteiger ist es gewohnt, sich mit den Gefahren nicht erst dann auseinander zu setzen, wenn sie eingetreten sind, um sich womöglich von der Angst leiten lassen zu müssen. Er bereitet sich vor. Das mildert zumindest den Überraschungsangriff. Irgendwann in diesen sechs Wochen der täglichen Bestrahlungen schreibt Thomas in sein Tagebuch: Traurigste Stimmung. Es sieht doch so aus, dass kaum mehr als 6 - 8 Monate Zeit bleiben.
Er sagt mir nicht, wie er darauf kommt. Alles, was im Krankenhaus abläuft, reizt Thomas zur Umsetzung in Erzählungen. Nicht nur das. Er verrät mir den Titel für das letzte Theaterstück, das er mit mir gemeinsam zu schreiben vorhat: „Der Tag, an dem wir zwei Schäferhunde wurden: Titel für unser absurdes End-Stück.“
Mit keinem anderen Menschen kann ich mir eine solche Situation ausmalen: so über das Ende unseres Lebens zu sprechen, mit dieser Mischung aus Melancholie, mit der Freude, dass es noch Stoff hergibt für ein absurdes Stück, mit dieser Lust, es umzusetzen. Und ich liebe ihn dafür; auch wenn ich weiß, wie einsam er manches Mal ist, ja sein muss, weil ich es auch bin, und man auch nicht zu jeder Zeit sich dem Schicksal so leichtfüßig zu stellen vermag.
Es gibt Tage, an denen wir durch die Straßen gehen, viele Menschen sehen und uns dann fragen, warum gerade wir, die wir uns so lieben; oder ist das gar der Preis für all die Jahre, in denen wir es so gut hatten miteinander? Wir hadern nicht eigentlich, wir würden nur gern die Spielregeln durchschauen, aber wir wissen gleichzeitig, dass es diese Regeln nicht gibt.
Normales Leben
Zurück gekehrt in die Stadt, in unsere Wohnung auf Zeit, in der sich kaum persönliche Dinge von Thomas und mir ausmachen lassen, beratschlagen wir, wann wir mit der Bestrahlung anfangen sollten. Wir sind uns einig, es muss schnell gehen, wie die Ärzte empfohlen haben.
Thomas kommt relativ gut zu Kräften, aber die großen Narben schmerzen, die Stimme ist nicht seine alte, der gesamte Vorgang der Nahrungsaufnahme will neu erlernt sein. Schließlich hat die Speiseröhre normalerweise bestimmte Funktionen, die einem erst bewusst werden, wenn sie fehlen. Der Magen ist nicht in der Lage, diese zu ersetzen.
Thomas ist ein Mensch mit Tugenden, die ich in dem Maße nie bei ihm vermutet habe. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, wir beide seien uns so sehr ähnlich, dass ich jetzt staune, was dieser Mann alles kann, wo er die Geduld her nimmt, auf diese ausdauernde Weise das Schlucken wieder zu erlernen, in kleinsten Portionen mehrmals täglich Nahrung zu sich zu nehmen, soviel zu trinken (leider vorerst nur Wasser und Säfte), und das alles, obwohl seine Geschmacksnerven ihm nichts Angenehmes oder zu Definierendes vermitteln, was angeblich einige Zeit anhalten wird.
Thomas isst gegen die Zeit, gegen das Sterben und alle Prognosen. Diese Astronautenkost ist eine Erfindung, die wir mit Ironie betrachten möchten, aber der Ernst, mit dem Thomas Stunde für Stunde den Strohhalm in die dafür vorgesehene Öffnung steckt, straft uns Lügen. Es geht ums nackte Überleben. Die Magensäure, die sonst ihr Aktionsfeld einige Etagen tiefer hat, macht ihm das Leben schwer. Er schläft deshalb nachts auf hochgetürmten Kopfkissen; manchmal geht es auch nur sitzender Weise, was sehr unbequem ist.
Und dann ist da die Strahlentherapie. Der Mensch hat zunächst einmal zu begreifen, dass die Zerstörung gesunder Zellen in Kauf zu nehmen ist. Dass die Therapie in erster Linie eine Vernichtung und keine Heilung ist. Thomas nimmt all seinen Mut zusammen, um bei der ersten Sitzung halbwegs ruhig zu sein. Es fällt schwer, nicht auszubrechen aus diesem abgeschotteten Kellermilieu, in das die Moribunden auf ihren Bahren transportiert werden, völlig apathisch und meistens nur in Begleitung eines Pflegers. In das diejenigen geschickt werden, die noch von ihren eigenen Füßen getragen werden und in die auch jene hinuntersteigen, die wie Thomas auf Verlängerung ihrer Lebenszeit hoffen, sollten sie das alles einigermaßen überstehen.
Obwohl Termine ausgegeben werden, beträgt die Wartezeit zwischen einer und zwei Stunden. Unwürdig und elend finden Thomas und ich diese Behandlung. Die Wartenden werden nicht verschont von dem Anblick derjenigen, die vor sich hindämmern und im Verlauf der vorübergehenden Wochen oft plötzlich ganz wegbleiben. Beiläufig erzählt der eine oder andere, Herr X sei verstorben. Aber sie machen alle weiter, als warte zumindest auf sie das Heil und der andere habe eben Pech gehabt.





























