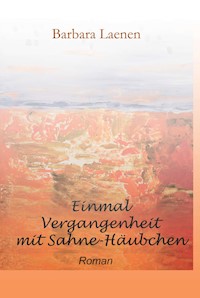
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ostpreußen 1943. Hierhin, in die Heimat ihres Vaters, verschlägt es Barbara mit ihrer Familie. Bei den schweren Bombenangriffen auf Berlin ihr Heim verloren, hoffen sie nun einen ruhigen Hafen gefunden zu haben, wo sie die Kriegswirren unbeschadet überstehen können. Doch das Schicksal lässt sich nicht beeinflussen. Sie geraten in die Ziellinie und die Mausefalle klappt zu! Der Einmarsch der "roten Armee" - Der tägliche Kampf ums Überleben beginnt! Erst nach Kriegsende kehren sie wieder in die Zivilisation zurück. In Köln bauen sich ihre Eltern eine neue Existenz auf. Barbara bekommt ein Stipendium und besucht das Gymnasium. Sie macht ihr Abitur, doch anstatt Kunst zu studieren, heiratet sie kurz darauf. Sie widmet sich voll ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Alle drei Jahre ziehen sie in eine andere Stadt und so kommt Barbara nicht dazu, irgendwo ihre Wurzeln bleibend einzupflanzen und sesshaft zu werden. Erst als die Kinder schon größer sind, ziehen sie von der Stadt auf das Land, wo sie sich ein Haus bauen, eine Bleibe für immer schaffen. Als die Kinder dann ausgeflogen sind, beginnt Barbara, ihre eigene Karriere aufzubauen. Sie studiert zwei Jahre Kunst an einer Fernuniversität, einzige Möglichkeit auf dem Lande! Ihre ersten Bilder entstehen, werden im In-und Ausland ausgestellt. Dann erkennt sie ihre eigentliche Berufung: die Schriftstellerei. Sie studiert nach dem Tod ihres Mannes nochmals zwei Jahre Literatur. Die ersten Manuskripte zu Romanen entstehen. Sie hat alles erreicht, was sie sich für ihr Leben vorgenommen hat und glaubt ihrem Lebensabend ruhig und gelassen entgegen sehen zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dieses Buch möchte ich meinem Vater widmen. Durch sein Vorbild hat er mein Denken geformt, mein Handeln beeinflusst.
Sein Lebensmotto war nach einem Zitat von Kant ausgerichtet: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Dies hat auch mich in meinem Leben stets begleitet.
Danken möchte ich meiner gesamten Familie, die mich bei diesem ersten Versuch, ein Buch zu schreiben, immer ermuntert hat.
Besonders mein Sohn und meine älteste Enkeltochter haben mich immer wieder angespornt, wenn ich zehn Mal von vorne begann und manchmal verzweifelt aufgeben wollte, bis ich endlich die richtige Eingebung hatte. Dann lief alles von selber.
Barbara Laenen
Eínmal Vergangenheit Mit
Texte ©Copyright by Barbara Laenen
Rosenstr.2
95168 Marktleuthen
Alle Rechte vorbehalten
Autorin: Barbara Laenen
Coverbild: Barbara Laenen/Robert Laenen
Lektorat: Astrid Pfitzer
ISBN Paper-Book:
978-3-7323-0146-1
ISBN Hardcover :
978-3-7323-0147-8
ISBN E-Book :
978-3-7323-0148-5
Verlag: Buchtalent – eine Verlagsmarke der tredition GmbH, Hamburg
www.buchtalent.de
www.tredition.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie, detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http:/dnb.d-nb.de abrufbar
Kapitel 1
„um – Wumm“! Da war es wieder, dieses dumpfe, unheimliche Grollen, mal stärker und klarer, dann “ wieder vom Wind verzerrt aus weiter Ferne zu hören.
Wie bei den ersten Tönen der fünften Sinfonie von Beethoven das Schicksal an die Tür pocht, um drohendes Unheil anzukündigen, so schien auch dieses ferne Donnern kommende Katastrophen einzuleiten. Bei jedem Geräusch zuckte ich innerlich zusammen. Es ging mir unter die Haut, kroch vom Magen bis zum Bauch hinab; ein Gefühl von Angst und Panik ergriff mich. Was war es nur, das mich so beunruhigte? Keine Ahnung!
Vielleicht ist es nur ein Gewitter, versuchte ich mich selber zu beruhigen, aber der Himmel war von einer klaren, azurblauen Farbe und spiegelte die klirrende Kälte wider. Kein Wölkchen war am Himmel zu sehen.
„Ach Paps, wärest du doch jetzt hier. Warum musst du immer fort sein, wenn ich dich brauche? Du könntest mir doch meine Ängste nehmen. Vielleicht gibt es ja eine ganz einfache Erklärung“?
Zum Glück war da noch meine Mutter. Ob sie mir helfen konnte? Ich machte mich auf die Suche nach ihr und fand sie mit Tante Hedwig im Wohnzimmer. Vor kurzem hatte unsere Familie Zuwachs bekommen, ich hatte jetzt neben meinem Bruder auch noch eine kleine Schwester. Katharina schlief in ihrem Arm, satt und zufrieden.
„Na, was ist los meine Große? Irgendwelche Probleme?“ Meine Mutter kannte mich nur zu genau. An meinem Gesichtsausdruck konnte man jede Gefühlsregung ablesen. Mein ganzes Leben lang habe ich es nie fertiggebracht, eine nichtssagende Miene aufzusetzen und meine Gedanken vor meiner Umwelt zu verbergen. Manchmal konnte das ganz schön peinlich sein. Meine Mutter gab das Baby ihrer Schwägerin, nahm mich in den Arm und streichelte mir beruhigend über den Rücken.
„Mams, was sind das für seltsame Geräusche? Horch, da sind sie wieder!“ Ich schmiegte mich Schutz suchend an sie. Mama sah mich nachdenklich an. War ich schon alt genug, um die ganze, bittere Wahrheit zu vertragen? Man konnte vor den Tatsachen schließlich nicht die Augen verschließen. Vielleicht war es das Beste, ich wusste, was uns in der Zukunft erwarten würde. Es war der Krieg, der sich mit grausamer Realität bemerkbar machte. Mit jedem Tag rollte der Kriegsschauplatz näher auf uns zu, unaufhaltsam! Unerbittlich wurde auf beiden Seiten gekämpft, um jedes Stückchen Boden, und wie viele Menschen mussten ihr Leben für den Irrsinn opfern. Niemand fragte, ob sie nicht lieber zu Hause bei ihrer Familie in Frieden ihre Tage verbringen wollten!
„Ich glaube, du bist groß genug, um das Ganze zu verstehen!“, meinte Mama und ihre Stimme klang traurig. Sie machte sich große Sorgen um Papa, der in Königsberg noch mehr in Gefahr war, als wir hier. Ich hatte gehofft, sie könnte meine Angst fortblasen und nun? Nichts hasste ich mehr als das Wort „Krieg“. Aus der Traum von einem friedlichen Hafen, in dem wir endlich zur Ruhe kommen würden. Wir waren hier gefangen, wie in einer Mausefalle. Der Familienkahn war wieder auf stürmischer See. In meinem Kopf wirbelte so vieles durcheinander, das musste ich erst einmal verarbeiten. Für ein Mädchen von acht Jahren keine leichte Aufgabe. Was ich brauchte, war Ruhe, um über alles nachdenken zu können. Niemand achtete mehr auf mich, und so verkroch ich mich in meinem Lieblingsversteck in der Scheune. An einer Seite war das Heu bis zur Decke gestapelt. Wenn ich mich dorthineinkuschelte, war es herrlich warm. Man spürte die Kälte nicht, die draußen herrschte, und niemand würde mich stören.
Ich ließ die letzten Jahre an mir vorüberziehen. In meinem Gedächtnis hatte ich eine Menge kleiner Schubladen, in denen all die herrlichen Erlebnisse, fertig zum Abrufen, aufbewahrt waren. Ich liebte diese Erinnerungen, meine einzigen Wurzeln, die anderen waren mir grausam entrissen worden. Sie gaben mir Kraft, diese „Tagträumereien“.
Hatten wir dafür Berlin verlassen und waren in dieses verdammte einsame Nest nach Ostpreußen geflohen? Sicher, es war die Heimat von Papa, hier lebte Opa und ein Teil seiner Familie, doch was verband mich mit alldem? Rein gar nichts.
Er war in diesem kleinen Dorf namens Gerswalde zur Welt gekommen. Kaiser Wilhelm hatte die Patenschaft übernommen, wie er es bei jedem zehnten Kind getan hatte. Das war keine Seltenheit auf dem Lande. Vielleicht wollte er damit den Kinderreichtum ankurbeln: Kanonenfutter für seine Kriege. Das Einzige, was es seinem Vater eingebracht hatte, war eine silberne Gedenkmünze, auf die er sehr stolz war, und die ihn anspornte, eine Münzsammlung anzulegen. Seine Eltern hatten einen Bauernhof und gehörten zu den wenigen Dorfbewohnern, die ein solides Haus gebaut hatten, keine Hütte mit strohgedecktem Dach, die bei jedem Gewitter in Gefahr geriet, abzubrennen. Seine Mutter führte die Landwirtschaft, während sein Vater vom Frühjahr bis zum Herbst als Anführer einer Gruppe von Flößern unterwegs war. Sie banden die gefällten Baumstämme aneinander und schifften sie durch die masurische Seenplatte bis zum Hafen.
Als Nachzügler hatte er den zweifelhaften Vorzug, als Onkel auf die Welt zu kommen. Ganz schön nervig, wenn er später mit seiner Nichte in derselben Schulklasse saß und von ihr unter dem Gespött der anderen als „Onkel“ angeredet wurde!
Seine Schwestern waren schon verheiratet, hatten im Dorf ihre eigenen Familien gegründet, oder waren dem Lockruf der Großstadt gefolgt und nach Berlin gezogen. Walter war ein zierlicher, sensibler Junge. Während seine älteren Brüder bei der Arbeit auf dem Hof mit anpackten, wurde er als Küken von seiner Mutter verhätschelt. Seine Kindheit hätte perfekt sein können, wäre nicht die Schule gewesen. Sein Lehrer, ein Sadist, glaubte mit Brutalität und Strenge der Dorfjugend die Grundlagen des Lernens im wahrsten Sinne des Wortes, „einbläuen“ zu müssen. Viele wurden zu Hause auch nicht gerade sanft angepackt, und so ließen sie diese Tätlichkeiten über sich ergehen, ohne dass es sie groß berührte. Walter aber war sehr empfindsam, schon als Kind trug er eine Künstlerseele in sich und war so ein willkommenes Opfer. Instinktiv wird Wehrlosigkeit erkannt und hier vermittelte sie seinem Lehrer ein Gefühl der Macht, die dieser grausam missbrauchte. Immer wieder fand er einen Grund, den Kleinen vor die Klasse zu stellen. Mit einer Weidenrute, die biegsam war und deren Schläge ganz schön schmerzten, hieb er auf die ausgestreckten schmalen, zarten Finger. Walter traten stets die Tränen in die Augen, jedoch zuckte er mit keiner Wimper. Ihn leiden zu sehen wollte er seinem Peiniger nicht gönnen. So verdarb ihm dieser jegliche Freude an der Schule, nicht aber am Lernen. Wie ein trockener Schwamm versuchte er, so viel Wissen wie möglich in sich aufzusaugen, und diese Sucht sollte sein ganzes Leben beherrschen. Wenn er nach der Schule zu Hause seine Hausaufgaben erledigt hatte, nahm er sich seinen Atlas und lernte die Namen der Kontinente, der Länder und deren Hauptstädte auswendig. Bücher, die er hätte lesen können, gab es im ganzen Haus nicht. Dafür hatte niemand Zeit und Interesse. Nur die Bibel durfte in keiner Familie fehlen. Meistens waren es sehr alte Exemplare, von Generation zu Generation weiter vererbt. Auf den ersten Seiten stand die Familienchronik. Gewissenhaft wurde sie von jedem neuen Besitzer weitergeführt. Jedes neue Kapitel begann mit einem verschnörkelten, bunt ausgemalten Anfangsbuchstaben, die Geschichten waren durch farbige Bilder lebendig und eindrucksvoll gestaltet. Sonntags wurde daraus vorgelesen. Das musste den Gottesdienst ersetzen, denn eine Kirche mit einem Pfarrer gab es in dem kleinen Dorf nicht. Sie hatten ja nicht einmal einen Arzt, der die Kranken versorgen konnte. Das erledigte die Gemeindeschwester, und der Gesundheitszustand der Dorfbewohner war auch nicht besser oder schlechter als der in den Städten.
Nach Beendigung der Schule, zog es Walter von zu Hause fort. Der Tradition nach erbte jeweils der jüngste Sohn den Bauernhof. Er wollte jedoch kein Bauer, sondern Künstler werden. Solange er denken konnte, hatte er davon geträumt. Nun konnte er seinen Weg selber gehen. Nur ungern ließ ihn seine Mutter ziehen. Er war und blieb nun einmal ihr Küken. Sie hatte Angst, er würde sich in der Lieblosigkeit der Großstadt unglücklich fühlen. Sie hatte schon genug Kinder an sie verloren. Als sie aber merkte, wie ernst es ihm mit seinen Zukunftsplänen war, trennte sie sich schweren Herzens von ihm. Sein älterer Bruder Konrad hatte gerade seine Lehre in einem Malerbetrieb beendet, und durch seine Fürsprache erhielt Walter einen Ausbildungsplatz. Er fühlte sich wohl dort, doch in seinem Leben fingen jetzt die Probleme an. Sein Bruder besorgte ihm ein Zimmer, aber er war so ziemlich isoliert. Alle lachten sie über den Bauernjungen vom Lande, wie Großstädter nun einmal sind. Er musste noch so viel lernen, bis er nicht mehr staunend und unbeholfen vor einer Toilette stand. Zu Hause kannte er nur die Holzhäuschen neben dem Misthaufen. Das hier war aber viel bequemer, man brauchte im Winter nicht mehr nach draußen, wenn einem das Bedürfnis überkam. Walter passte sich schnell an.
Es war die Zeit, wo das Fahrrad seinen Höhepunkt feierte. Die Radfahrvereine schossen wie die Pilze aus dem Boden und jeder, der etwas auf sich hielt, schloss sich einem an. So auch Walter. Von seinem ersten selbst verdienten Geld kleidete er sich erst einmal chic ein und als Nächstes kam dann ein Fahrrad an die Reihe. Wie man es anstellte, darauf sitzen zu bleiben und nicht sofort wieder herunterzufallen, das lernte er sehr schnell. Er fuhr zwar nicht selber auf der Bahn beim Sechstagerennen, durfte aber als Zuschauer nie fehlen. So schuf er sich ein soziales Umfeld. Natürlich kam er auch mit den verschiedensten Typen in Berührung. Da er klein und zierlich war, wurde er des Öfteren sexuell belästigt, was ihm äußerst peinlich war. Auf dem Lande wusste man nicht, dass es auch Männer gab, die Liebe nicht bei einer Frau, sondern bei Ihresgleichen suchten. Erst seine Freunde klärten ihn auf und er mied diese Typen, wie der Teufel das Weihwasser. Er hat für andersartige Veranlagungen sein ganzes Leben lang kein Verständnis aufbringen können, so tolerant er auch sonst mit den Schwächen seiner Mitmenschen umgehen konnte.
Er liebte es, sich mit seiner Umwelt zu beschäftigen, merkte aber bei Gesprächen schnell, dass ihm viel an Wissen fehlte, was ihm die Volksschule auf dem Lande keinesfalls vermittelt hatte. Er gab sich nie mit Tatsachen zufrieden, sondern suchte nach der Lösung seiner Probleme. Man hatte in der Großstadt so viele Möglichkeiten, sich selber weiterzubilden. Was bot sich da Besseres an als die Volkshochschule? Während seine Kumpel ihre freien Abende in den Kneipen verbrachten und den Lohn der ganzen Woche vertranken, besuchte er Kurse in Deutsch, Englisch und Philosophie. Dort lernte er die Literatur zu lieben. Ganz besonders Goethes „Faust“ und die alten griechischen Philosophen hatten es ihm angetan. Später hatte ich den Nutzen davon. Wir diskutierten leidenschaftlich nach antiken Regeln: These – Antithese - Synthese. Er eignete sich ein umfangreiches Allgemeinwissen an. Es gab kein Thema, bei dem er sich nicht mit einbringen konnte. Nicht nur auf das Geistige, nein auch auf sein Äußeres legte er großen Wert. Der „letzte Schrei“ war gerade gut genug für ihn. Paps wurde zu einem richtigen Dandy. Ein Armband am Handgelenk, mit einem Spazierstock lässig unter dem Arm geklemmt, einer Blume im Knopfloch, so schlenderte er am Wochenende „unter den Linden“. Sehen und Gesehen werden! Eine gewisse, angeborene Arroganz zeichnete sich bei ihm ab.
Seine Freunde machten sich oftmals über ihn lustig: „Du läufst durch die Gegend wie ein Junker, der seine Ländereien in Augenschein nimmt!“
Es machte ihm nichts aus. In Berlin musste man ein dickes Fell und eine gehörige Portion Selbstbewusstsein haben, um zu überleben. Er hatte sich beides zugelegt.
Sein Meister hatte schon bald die Fähigkeiten und Talente des Jungen entdeckt. Zwischen ihnen entstand ein Band gegenseitiger Achtung. Oftmals lud er Walter sonntags zum Essen zu seiner Familie ein. Hier begegnete er seiner großen Liebe; meiner Mutter Lotte. Sie wohnte in der Nachbarwohnung bei ihren Großeltern. Ihre Kindheit war nicht leicht gewesen. Der Vater war noch vor ihrer Geburt im Ersten Weltkrieg gefallen. Ihre Mutter starb, als sie drei Jahre alt war. Die Großmutter nahm sich ihrer an und zog sie auf, während ihre ältere Schwester in ein Waisenhaus kam. Die alte Frau gab sich redlich Mühe, ihr familiäre Wärme und Geborgenheit zu vermitteln, doch oft fühlte sich Lotte trotzdem sehr einsam. Sie hatte den Eindruck, nicht dazuzugehören, glaubte sich benachteiligt gegenüber ihren älteren Vettern. Sie fühlte sich ein wenig wie „Aschenputtel“. Vielleicht kam es daher, weil sie, neben ihrer Großmutter, als einziges weibliches Wesen bei all den Männern, schon früh im Haushalt zur Hand gehen musste. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit! Doch als Kind sieht man das wohl anders.
Mit ihren Tanten und Onkeln kam sie nicht so gut zurecht. Das war eine ziemlich seltsame Gesellschaft. Bei ihrer Lieblingstante war sie gerne, denn diese hatte etwas ganz Besonderes zu bieten: Einen großen Friseursalon. Dort konnte sie sich, so oft sie wollte, die Haare nach der neuesten Mode frisieren lassen und es kostete sie nichts. Das war schon verlockend. Nur hatte diese einen Mann, der jedes Wochenende auf der Rennbahn zubrachte und das Geld seiner Frau beim Wetten verlor. Um an neues Kapital zu kommen, hatte er für Lotte, ohne das Wissen ihrer Tante, eine Lebensversicherung abgeschlossen, mit sich als Begünstigten und bemühte sich nun bei jeder sich bietenden Gelegenheit darum, seine Nichte ins Jenseits zu befördern. Er nahm sie zum Rennen mit. Das war abenteuerlich und spannend. Sie folgte hingerissen dem Kopf-an-Kopf-Rennen der Pferde und beobachtete die Menschen, die in den entscheidenden Sekunden vor dem Sieg von ihren Plätzen aufsprangen und ihre Favoriten mit lauten Zurufen anfeuerten, als könnten sie so den Ausgang beeinflussen. Manche Dinge waren ihr bei diesen Unternehmungen aber schon rätselhaft: Warum schubste sie ihr Onkel immer gerade dann auf die Fahrbahn, wenn die Gefahr, einen Unfall zu erleiden und dabei ums Leben zu kommen, groß war? Es sollte so aussehen, als geschehe dies aus Versehen; ein unglücklicher Zufall. Sie spürte instinktiv: Das war pure Berechnung und Absicht. Da bekam sie es mit der Angst zu tun und vertraute sich ihrer Tante an. Die fiel aus allen Wolken. Nun erst kam sie hinter die Machenschaften ihres werten Gatten. Die Besuche wurden augenblicklich eingestellt.
Ein anderer dubioser Onkel fristete seinen Lebensunterhalt, und das nicht schlecht, indem er seinen Mitmenschen die Zukunft weissagte, Horoskope erstellte - alles ganz wissenschaftlich - und aus der Hand las. Am Anfang fand sie das schon lustig, später nervte es sie, da sie an den ganzen Hokuspokus nicht glauben konnte und wollte. Dann war da noch ein Neffe, der im Bankwesen tätig war. Durch Glück im Spekulieren war er zu etwas Geld gekommen, gehörte seiner Meinung nach nun den besseren Kreisen an und behandelte den Rest von oben herab. War es bei einer solchen Gesellschaft ein Wunder, dass Mama einen Graus vor dem Wort „Familie“ bekam, und auch heute noch ihrer ganzen „buckligen Verwandtschaft“, wie sie diese immer nennt, ablehnend gegenübersteht?
Sobald sie volljährig war, heirateten meine Eltern. Paps selber hätte lieber noch etwas gewartet. Die Zeiten waren zu unruhig, um eine Familie zu gründen, doch er begriff eines: Sie musste heraus aus ihrer Umgebung, je eher, desto besser. Ihre Großmutter war gestorben, sie stand praktisch auf der Straße und hatte keine Ahnung, wie ihr Leben weiter gehen sollte. Er hatte seine Ausbildung abgeschlossen. Mit seiner Meisterarbeit gewann er den Staatspreis für Kunst und damit ein Stipendium an der Kunstakademie. Alles, was er wollte, hatte er nun erreicht.
Am letzten Tag des Jahres 1935 war ich gerade noch rechtzeitig in diese von Chaos und drohendem Krieg gezeichnete Welt geschlüpft, und oft dachte ich: Wenn ich es mir selbst hätte aussuchen können: Noch so viele Jahre warten, bis es auf der Erde wieder normal und friedlich zuging, wäre besser gewesen. Aber niemand hatte mich gefragt!
Mein Vater war der glücklichste Mann der Welt. Er hatte sich immer eine Tochter mit blonden Locken und blauen Augen, gewünscht. Alle Babys haben am Anfang blaue Augen, und meistens eine Glatze, ich machte da keine Ausnahme. Er hoffte auf die Zukunft. Leider veränderte sich meine Augenfarbe sehr bald in ein Grün mit grauen Tupfen: Katzenaugen. Die Glatze blieb natürlich nicht. Die Haare wuchsen und hierin enttäuschte ich ihn nicht. Sie blieben blond und bei genauem Hinsehen konnte man sogar ein paar Locken entdecken. Ich bekam den Namen Barbara und als Anhängsel: Sylvia, damit jeder wusste, dass ich an Silvester geboren war. Das war ein tolles Datum, nie vergaß jemand meinen Geburtstag. Die ganze Welt feierte mit mir. Der Nachteil allerdings war: Nach Weihnachten hatten alle kein Geld mehr, und meine Geschenke wurden zwischen Heiligabend und meinem Geburtstag aufgeteilt. Das war unfair.
Ich entwickelte mich zu einem äußerst tatendurstigen und neugierigen Kind. Papa förderte meine Veranlagungen in vollem Maße, aber für Mama war es anstrengend. Nach knapp einem halben Jahr erwartete sie ihr zweites Kind und die Geduld mit mir war, aufgrund ihres Zustandes, nicht gerade hervorragend, man könnte auch sagen, einfach miserabel! Ich wollte beschäftigt werden, immer im Mittelpunkt stehen. Ich war kein Kind, das man mit Spielzeug in eine Ecke setzte und dann seine Ruhe hatte. Dafür hielt ich meinen Vater auf Trab. Man musste es ihm hoch anrechnen, er nahm sich alle Zeit für mich. Kaum war er zur Ruhe gekommen, schleppte ich schon alles an Zeitschriften und Büchern herbei, in denen Bilder, möglichst bunte, vorkamen, um sie mit ihm zu betrachten.
Ich liebte mein Zuhause über alles: Ein geräumiges Atelier, direkt unter dem Dach, mit riesigen Fenstern. Paps brauchte viel Licht zum Arbeiten. Wenn ich abends im Bett lag, breitete der Himmel sich über mir aus, und ich konnte die Sterne und manchmal auch den Mond betrachten, faszinierend! Vor den Fenstern hingen bis zum Boden lange weiße Vorhänge aus Nessel, die mein Vater mit Blumen bemalt hatte, in den verschiedensten Formen und Farben, wie eine große Wiese im Frühling, die zum Träumen einlud. Doch das Schönste war der Schrank. Er nahm eine ganze Wand des Zimmers ein. Mein Vater hatte ihn auf Hochglanz poliert und dann lackiert und über der Vorderfront prangte ein Schiff mit geblähten Segeln auf voller Fahrt. Es regte meine Fantasie an. Ich stellte mir vor, mit Papa an der Reling zu stehen, aufregenden Abenteuern entgegen steuernd. Und noch etwas Tolles gab es in diesem Raum: Auf dem Couchtisch stand ein Globus, drehbar und beleuchtet. Wenn wir beide davor saßen, erzählte Papa lustige Geschichten von fremden Ländern und den Menschen, die dort wohnten. Und er konnte erzählen, so anschaulich und spannend, dass ich darüber Zeit und Raum vergaß. Er nahm mich mit in ein Land der Fantasie. Die Wirklichkeit wurde einfach ausgeschaltet. Hier wurden wahrscheinlich die Weichen gestellt, auf Wunsch die Realität verlassen zu können, mich wie ein Schmetterling in die Lüfte zu erheben und ein Land zu entdecken, jenseits jeglicher Wirklichkeit.
Anfang Februar 1937 wurde Peter geboren. Ich war begeistert. Mein größter Wunsch war erfüllt, ich hatte einen Bruder und war nicht mehr alleine. Welche ungeahnten Möglichkeiten für die Zukunft. Zuerst einmal schnell groß werden, damit man mit ihm etwas anfangen konnte. Am liebsten hätte ich ihm Pflanzendünger in seinen Brei getan, denn Mama hatte einmal gesagt: Damit wachsen die Pflanzen schnell und gut. Was bei Blumen half, musste doch auch bei Babys funktionieren. In weiser Voraussicht hatte meine Mutter aber alle gefährlichen Dinge außer Reichweite aufbewahrt, nicht einmal mit einem Stuhl konnte man da herankommen. Na ja, es ging auch so. Als er ein halbes Jahr alt war, wurde mein Vater aus seiner kleinen Familie herausgerissen. Der Schrecken „Krieg“ lagen in der Luft. Alle wehrdienstfähigen Männer, die keine Beziehungen nach oben hatten und auch nicht nachweisen konnten, in der Wirtschaft dringend benötigt zu werden, wurden einberufen. Auch er wechselte nun zum Kasernenhof über. Kein guter Tausch! Während der Ausbildungszeit kam er nur selten nach Hause. Als dann Anfang 1940 der Krieg gegen Frankreich begann, war er einer der Ersten, der mitmarschieren musste. Mama war alleine total überfordert mit ihren beiden Sprösslingen, tat aber tapfer ihr Bestes, uns über die Runden und über die schlechten Zeiten zu manövrieren.
Ich fühlte mich eingeengt. Ihre Augen waren überall und ließen mir keine Chance, tolle Ideen – sie nannte das nur „Unfug“, auszuführen. Draußen durfte ich nie spielen, weil sie ihre Kinder lieber unter Kontrollehaben wollte. Wo hätten wir auch spielen sollen? Es gab nur einen dunklen Hinterhof, in den sich manchmal ein Spielmann mit seinem Leierkasten verirrte. Er spielte die neuesten Gassenhauer. Auf seinem Kasten saß stets ein kleiner dressierter Affe mit einer karierten Jacke. Wenn die Fenster aufgingen und die Groschen herunter geworfen wurden, flitzte er umher, sammelte sie auf und legte sie in einen Hut. Zum Dank machte er dann eine Verbeugung. Das war natürlich für alle Kinder DIE Sensation. Wir waren nicht zu halten und stürmten nach unten, um aus der Nähe dieses Wunder zu bestaunen. Danach wurden wir wieder eingesammelt. Mir fehlte deshalb jeglicher Kontakt zu gleichaltrigen Kindern.
Die Situation änderte sich als Peter laufen konnte. Er entwickelte sich ganz nach Wunsch. Er ließ sich von mir herumkommandieren, führte alles aus, was ich ihm sagte: Ein guter Kumpel. Ich war der Kopf, er das ausführende Organ. Ein perfektes Team.
Meine neuen Aktivitäten sollte Mama bald kennenlernen. Eines Tages war sie alleine losgezogen, um Einkäufe zu tätigen. Es dauerte immer eine Ewigkeit, bis sie ihre beiden Kinder angezogen hatte und dann die vielen Stufen mit ihnen hinunterzusteigen, in der Zeit hatte sie schon zehnmal ihre Besorgungen gemacht. Wir saßen lustlos auf unseren Betten, die sie eben noch schnellneu überzogen hatte. Es roch nach „Sauberkeit und Frische“, aber nicht lange.
Ich gähnte. Was für ein langweiliger Morgen! Meine Blicke schweiften im Zimmer umher, auf der Suche nach Inspirationen. Der Kohleofen zog mich magisch an. Mir kam eine super Idee. Das war es! In der Eile hatte Mama vergessen, den Aschebehälter zu leeren. Der Ofen wurde erst beheizt, wenn sie wieder zu Hause war. Interessiert betrachtete ich die Asche. Mit ein wenig Wasser vermischt, sah es sicher aus wie Schokolade.
„Peter, wollen wir Kuchen backen?“ Er sah mich verständnislos an. Er konnte meinen Gedanken nicht folgen.„Mensch, bist du schwer von Begriff.“ Immer diese Erklärungen! Konnte er nicht einmal selber mitdenken?
„Wir backen mit der Asche einen Kuchen – einen Schokoladenkuchen! Ich hole dir alles, was du dazu nötig hast, dann brauchst du nur noch zu rühren.“ Ich flitzte in die Küche. Die Schüsseln standen im obersten Fach des Schrankes. Kein Problem! Mithilfe eines Stuhls gelang es mir gerade, die Tür aufzumachen. Die große gelbe Schüssel war genau richtig. Das würde reichen. Nun noch einen Löffel, einen Quirl zum Rühren und einen Messbecher mit Wasser. Zurück zum Ofen und genug Asche in die Schüssel füllen. Ich brachte alles zu Peter ins Bett. „So, nun kannst du den Teig rühren.“
Und er rührte mit Begeisterung und Ungeschick. Es wurde eine wunderbare dunkelbraune Masse, wirklich wie Schokolade, nur breitete sich immer mehr von der breiigen Tunke auf dem Bettbezug aus.
Plötzlich hörten wir, wie Mama die Treppe herauf kam und die Tür öffnete.
„Hallo, meine Beiden, hier bin ich wieder!“, rief sie fröhlich.
O je! Das Donnerwetter lag spürbar in der Luft. Nun bekommen wir Ärger, dachte ich ahnungsvoll, doch was heißt „wir“? Ich hatte doch nur zugeschaut, die Schweinerei hatte schließlich Peter gemacht. Als sie das Zimmer betrat, verflog ihre gute Laune schlagartig! Mama glaubte in Ohnmacht fallen zu müssen, als sie die Bescherung sah. Verdammt! Hatte sie nicht vorhin mit so viel Mühe die Betten bezogen und nun das! Sie schimpfte, … und wie sie schimpfte!
„Kann man euch denn keine zehn Minuten alleine lassen, ohne dass ihr etwas anstellt?“ Für Peter gab es zusätzlich noch einen Klaps aufs Hinterteil, so schuldbewusst, wie der sie anblickte, war er für sie ohne Zweifel der Übeltäter. Ich hingegen schaute, als könnte ich kein Wässerchen trüben und ging ohne Strafe aus. Einen Nachteil hatte die Sache aber doch: Es dauerte eine Weile, bis mein Bruder wieder bereit war, etwas mit mir zu unternehmen.
Die nächste Gelegenheit sollte sich bald bieten. Der arme kleine Kerl tat mir leid. Immer in der Wohnung hocken, ein wenig frische Luft würde ihm gut tun. Unsere Mutter traute mir undmeinem Tatendrang nicht über den Weg. Wenn sie fortan wegging, wurde die Tür abgeschlossen und sie fragte ihre Nachbarin, die eine Etage tiefer wohnte: „Ich muss mal schnell fort. Könnten Sie ein wenig auf meine Kinder Acht geben? Ich habe sie eingeschlossen, aber man kann nie wissen … Hier haben Sie einen zweiten Schlüssel. Wenn Sie irgendwelche verdächtigen Geräusche hören, schauen Sie bitte lieber nach ihnen!“
So hatte sie sich, ihrer Meinung nach, genug abgesichert. Sie war also weg und ich überlegte, wie ich meinem Bruder zur Freiheit verhelfen konnte. Die Tür war abgeschlossen, das war Tatsache, aber für mich doch kein Hindernis! In der Wohnung gab es so viele Türen und in allen Schlössern steckten Schlüssel. Vielleicht würde ja einer auch in die Haustür passen? Nacheinander probierte ich alle aus. Fehlanzeige … Nichts! Auf der Toilette dachte ich noch einmal angestrengt nach — manch einem sind hier schon gute Ideen gekommen, so auch mir. Der Blick fiel auf den Schlüssel, der innen steckte, den hatte ich noch nicht in den Fingern gehabt, da war ich mir sicher, absolut sicher! Herausziehen, in das Schloss der Haustür stecken und Hurra, ein Erfolgserlebnis. Die Tür war offen.
Nun kam Peter an die Reihe. Ich zog ihn in den Flur hinaus und sagte: „Wenn du jetzt hier heruntersteigst, kannst du Mama entgegengehen. Was glaubst du, wie die sich freut?“ Keineswegs begeistert, schaute er ängstlich in die Tiefe. Das war ihm doch zu unheimlich. Das gesamte Register meiner Überredungskünste zog ich, vergebens. Ich sah meinen ganzen schönen Plan in Luft auflösen. Der letzte Ausweg: Ihn an seiner Ehre packen. Das ist wohl bei der Spezies Mann schon von klein auf ein wunder Punkt, und es klappt immer.
„Bist du nun ein großer Junge, oder noch ein kleines Baby? Hast du etwa Angst? Wenn du dich am Geländer festhältst und vorsichtig läufst, kann doch nichts passieren!“
„Baby“, das Wort gab den Ausschlag. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen. Er tappte los, vorsichtig Stufe um Stufe! Unsere Unterhaltung war nicht lautlos von statten gegangen und hatte unsere Nachbarin herausgelockt. Sie schaute nach oben und sah den Knirps herunterkommen. Was sollte sie tun? Wenn sie ihm entgegen lief, würde er sich wohlmöglich erschrecken und hinunterstürzen. In diesem Augenblick wurde unten die Haustür geöffnet und Mama kam herein, gerade zur rechten Zeit.
„Machen sie schnell! Peter ist auf der Treppe und kommt Ihnen entgegen“, brüllte unser Wachhund durch das Treppenhaus. So schnell war meine Mutter noch nie hinaufgesprintet, sie hätte jeden Hürdenlauf gewonnen. Sie nahm ihren Sohn in die Arme, der nach all der ausgestandenen Angst heulte, und erst einmal getröstet werden wollte. Ihre Tochter traf ein vernichtender Blick.
„Na warte mein Fräulein, komm du mir erst einmal rein! Wir sprechen noch ein Wörtchen.“ Von wegen „Ein Wörtchen“, es wurde eine gepfefferte Strafpredigt, unterstützt von ein paar ordentlichen Klapsen. Nun, das war eine schlagkräftige Warnung für die Zukunft. Mein Hintern schmerzte noch einige Zeit. Seitdem ließ sie ihre Kinder nie mehr alleine zu Hause. Nicht auszudenken, was beim nächsten Mal passieren könnte.
Ich musste mein Betätigungsfeld etwas verlagern, spielte mit meinem Bruder, und mit den nötigen guten Einfällen konnte auch das ganz lustig verlaufen.
Tante Lieschen, die Schwester meiner Mutter, hatte uns besucht und eine Tüte Kirschen mitgebracht. Im Frühling ein Luxus. Sie hatte sie auch nur durch Tricks und Beziehungen als Verkäuferin in einem großen Warenhaus ergattert. Nun, Kirschen waren meine Leidenschaft. Dafür ließ ich alles fahren, auch irgendwelche Skrupel. Die Kirschen wurden ehrlich zwischen uns verteilt. Nur zu gerne hätte ich alle für mich gehabt. Kein sozialer Zug! Mir fiel auch schon ein Plan ein:„Peter“, sagte ich schmeichelnd, wollen wir „Zoo“ spielen? Du bist der Wärter und ich der Elefant. Du darfst mich mit deinen Kirschen füttern.“
Er, nichts Böses ahnend, war begeistert. Eine nach der anderen verschwand im Mund des Elefanten, bis sein Teil aufgebraucht war.
„Nun bin ich aber an der Reihe gefüttert zu werden, und du bist der Wärter“, entschied Peter.
„Ich habe keine Lust mehr. Auf die Dauer wird das ja langweilig!“, war meine Antwort und ich verzog mich mit meinen kostbaren Früchten. Peter war empört. Er lief zu Mama und protestierte heulend. Er wollte seine Kirschen zurückhaben. Die ließ ich mir aber nicht abnehmen!
„Bist du doch selber schuld. Du hättest ja meine als Futter nehmen können.“ Es dauerte wirklich ein paar Tage, bis er wieder mit mir sprach. Zu sehr war er durch dieses brutale Verhalten gekränkt. Es hat zum Glück für die Zukunft unser Verhältnis zueinander nicht belastet, aber im Inneren hatte er es mir sein Leben lang nicht verziehen. Wenn wir uns später im Kreis der Familie über Kindheitserlebnisse unterhielten, hat er es mir jedes Mal bitterböse vor die Füße geworfen. Aber auch da konnte ich keine Reue empfinden, sondern schüttete mich vor Lachen über so viel Dummheit aus. Dann war er wieder sauer!
Bei Vaters nächstem Urlaub beklagte sich meine Mutter über mich, und sie kamen beide überein: So ging es nicht weiter! Ich musste soziales Denken lernen, und wo ging das besser, als im Kindergarten. Die Gemeinschaft würde es mir schon beibringen. Erfreut war ich darüber wirklich nicht, aber auch Papa blieb hart. Da half kein Bitten und Betteln, ich konnte ihn mit noch so vielen Küssen überschütten, er blieb standhaft. So wanderte ich schließlich am nächsten Montag an Mutters Hand los, mehr gezogen als gegangen. Der Kinderhort war in einem alten Gebäude untergebracht, das auch schon bessere Zeiten gesehen hatte. Die Hausfront war vom Zahn der Zeit angenagt, machte einen verwahrlosten Eindruck, und die inneren Räume standen dem in nichts nach: Grau, trübe, langweilig! Es waren ungefähr fünfzehn Kinder in dem großen Raum. Sie spielten miteinander. Spielzeug war genug vorhanden: Puppenhäuser, Puppenwagen mit dem dazu gehörigen Inhalt, ein Kaufmannsladen und ein Kasperle-Theater. Als sie mich, die Neue erblickten, bildete sich gleich eine feindliche Front. Fremde waren bei ihnen nicht erwünscht. Mutter gab mir noch einen Kuss und überließ das Übrige der Kindergärtnerin. Sie ging fort, hatte dabei aber ein ungutes Gefühl, sie kannte mich schließlich gut genug. Das wurde kein Erfolg! Ich fühlte mich hier völlig fehl am Platze. Die Kinder glotzten mich an, als käme ich gerade frisch importiert von einem anderen Stern, machten auch keinerlei Anstalten, auf mich zuzugehen. Sie ließen mich einfach links liegen! In solchen Situationen konnte ich einen Schutzwall von Arroganz und Überheblichkeit um mich verbreiten, was ebenfalls nicht positiv ankam. Ablehnung auf der ganzen Linie. Hier war ich einmal und nie wieder gewesen! Das stand fest. Fehlte nur noch ein triftiger Grund meinen Eltern gegenüber, und der ergab sich sehr bald.
Essenszeit: Eine Glocke rief alle zu Tisch. Ich setzte mich auf den einzigen freien Stuhl am Ende des Tisches. Mein Magen knurrte vor Hunger. Mal sehen, was es Schönes gab. Die Teller wurden ausgeteilt. Ein winziges Stück Fleisch, ein paar Kartoffeln und eine riesige Portion Rotkohl… „Rotkohl!“ O nein, den bekam ich nie im Leben runter. Dies war das Einzige, was man mir an Gemüse nicht vorsetzen durfte. Schon beim Anschauen rebellierte mein Magen. Die Leiterin machte ihre Kontrollrunde und blieb vor mir stehen: „Du hast deinen Rotkohl stehen lassen! Bei uns wird der Teller leer gegessen!“
„Ich mag das Zeug nicht, mir wird schlecht davon, ich bekomme es nicht herunter!“
„Das wollen wir doch mal sehen!“ Sie holte sich einen Stuhl herbei und trichterte mir einen Löffel nach dem anderen ein. O weh, das hätte sie lieber bleiben lassen sollen. Ich würgte und würgte und dann kam der ganze Schlamassel wieder heraus, mit einer gehörigen Portion Magensäure vermischt. Das stank bestialisch, und alles auf ihren Rock. So miserabel, wie ich mich auch fühlte, eine gewisse Schadenfreude machte alles wieder gut. Während die Leiterin sich umzog, durfte ich mich hinlegen. Es gab einen Schlafraum, wo manche Kinder ihre Mittagsruhe hielten. Erleichtert atmete ich auf, als Mama mich nachmittags wieder abholte. Die Betreuerin erzählte ihr von dem Vorfall und legte ihr nahe, sich einen anderen Hort zu suchen. Solche verzogenen Kinder konnten sie nicht gebrauchen. Meine Version gab ich zu Hause zum Besten, und damit war das Thema vom Tisch. Das Übrige würde die Erziehung bringen.
Mama gab sich alle Mühe, Abwechslung in das Leben ihrer Kinder zu bringen. Sonntags war Erlebnistag. Im Winter gingen wir ins Museum oder zu Ausstellungen, im Sommer machten wir lange Spaziergänge im Schlosspark oder im Tiergarten. Die Blumenrabatten hatten es mir besonders angetan. Sie begeisterten mich immer wieder. Auch Besuche im Zoo standen auf dem Plan. Wenn Papa da war, fuhren wir zum Wannsee, mit Badezeug und Picknickkorb. Am Strand im Sand zu spielen, das machte schon Spaß, doch das Wasser war nicht so mein Element.
„Wasser trinkt das liebe Vieh - Faldera und Falderi, auch zum Zähneputzen kann man es benutzen.“ Doch ansonsten: Zu nass! Das hatte schon ein Spaßvogel in einem Gassenhauer festgestellt.
Höhepunkte in meinem Leben waren die Theaterbesuche. Neben der Musik liebte ich diese am meisten. Meine Tante besorgte die Karten. Obwohl die Kindervorstellungen nachmittags schnell ausverkauft waren, gelang es ihr, wie auch immer, die besten Plätze zu erhalten.
Meine Mutter gab viel Geld für uns aus, sowohl für Nahrung, meistens aus dem Reformhaus ganz schön kostspielig, als auch für Kleidung. Dabei war bei ihr nicht so sehr die Mode, sondern die Qualität ausschlaggebend. Aber ob nun billig oder teuer, aus allem wuchsen wir ihrer Meinung nach, viel zu schnell heraus. Wäre mein Bruder eine weibliche Ausgabe geworden, meine Sachen hätten zur großen Befriedigung von Mama noch aufgetragen werden können.
Der erste Theaterbesuch hatte in meiner Schublade einen ganz besonderen Platz. Dieses spannungsgeladene, prickelnde Gefühl kann man nur als Kind so intensiv erleben. Es blieb etwas Besonderes, ein Rest kostbarer Kindheits-Erinnerung!
Festlich herausgeputzt machten wir uns auf den Weg. Natürlich kamen wir viel zu früh dort an. Vor lauter Angst, die Bahn zu verpassen, quälte ich Mama so lange, bis sie resignierte. Um endlich Ruhe zu haben, zog sie eine Stunde früher mit uns los. Schon die Eingangshalle war ein Erlebnis. Schwere, dunkelrote Samtvorhänge waren an den Wänden drapiert, und verdeckten die Zugänge zu den einzelnen Logen. Überall gab es brennende Kronleuchter und Wandbeleuchtungen, die alles verzauberten. Peter schien das nicht besonders zu beeindrucken. Ihm genügte es, Mamas Hand festzuhalten. Damit war für ihn die Welt in Ordnung. Ich aber war so aufgeregt. Ich wagte es kaum, zu atmen. Es herrschte eine spannungsgeladene Atmosphäre, nicht grell und schrill, sondern verhalten und festlich. Die Mütter hatten ihre Sprösslinge fest im Griff. Hin und wieder gab es schon einmal einen versteckten Knuff in den Rücken oder einen kräftigen Tritt vor das Schienbein. Man musste doch auf sich aufmerksam machen. Schauten sie einen dann wütend an, streckte man ihnen im Schutz von Mama die Zunge heraus. Kinder sind nun einmal keine Engel.
Der Gong erklang und jeder suchte seinen Platz auf. Wir saßen in der vordersten Reihe. Freie Sicht auf die Bühne. Das Licht erlosch, und das Spiel begann. Ich folgte mit Hingabe dem Geschehen. Es handelte von einem Mädchen und seinem Bruder, die in einem Blumentopf einen Sonnenblumenkern gepflanzt hatten. Der Keim entwickelte sich zu einer endlosen Kletterranke, an der sie bis zum Himmel emporstiegen. Sie halfen den Engeln die Sterne zu putzen, besuchten den Mann im Mond und befreiten die Sonne aus einem Käfig, in den ein Kobold sie eingesperrt hatte. Kein Wunder, dass sie den ganzen Tag nicht geschienen hatte, dachte ich mir. Zur Belohnung durften sie auf einem Sonnenstrahl zur Erde zurückrutschen.
Am nächsten Tag wollte ich das einmal selbst ausprobieren. Vielleicht konnte ich dann auch mit Peter in den Himmel klettern? Ich fand nur leider keine Sonnenblumenkerne. Ob der von einer Apfelsine es auch tun würde? Ich holte mir einen kleinen Topf, etwas Erde von Mamas Blumen, den Kern hineingelegt, gut angedrückt und einen Schuss Wasser dazu. Das müsste hinhauen. Jeden Tag goss ich die Erde, doch alles, was hervor kam, war ein kümmerlicher Spross, der bald darauf einging, weil er nasse Füße bekam: Zuviel Wasser! Es wurde nichts mit dem Plan, in den Himmel zu klettern.
Kapitel 2
begannen die ersten Luftangriffe auf Berlin. Zuerst nur vereinzelt, aber wir wurden wie es aussah, schon einmal für die Zukunft trainiert. Jedes s hatte seinen Luftschutzkeller mit Holzbänken und Liegen für Alte und Kranke. Das Radio unterrichtete die Bevölkerung über die Arten der Sirenentöne. Sie hatten verschiedene Intervalle und Klangfarben. Die Ersten bedeuteten: Alles hinab in den Keller. Die Zweiten: Die Luft ist rein, ihr könnt wieder zum Vorschein kommen. Bei dem Probe Alarm wurde erst einmal tüchtig geübt.
Ein Jahr später kam Papa aus Frankreich nach Hause zurück, aber nur, um seine Sachen zu packen. Es ging wieder los, der Russland-Feldzug hatte ihn im Griff. Jeder wusste: Nun wurde es ernst. Dies war kein Spaziergang mehr. Das Schicksal würde entscheiden, ob wir ihn jemals wieder sehen würden. Als Abschiedsvorstellung marschierten sie durch das Brandenburger Tor, und die Zurückgebliebenen jubelten ihnen laut zu: Propaganda für den Rest der Welt. Wir heulten ihnen nach!
Die Bombenattacken wurden immer häufiger und schwerer. Den folgenden Sommer beschloss Mama auf dem Lande zu verbringen. Onkel Fritz hatte ein Gut an der Grenze zu Polen mit einem großen See, Fischerei und Fischzucht. Er lebte zwar in einer unruhigen Gegend, denn es trieb sich dort, wie in den meisten Grenzgebieten zwielichtiges Gesindel herum, doch davor wusste er sich zu schützen. Er kaufte mehrere scharf abgerichtete Wachhunde. Tagsüber waren sie im Zwinger, doch abends wurden sie freigelassen. Niemand von der Familie durfte dann noch das Haus verlassen. Ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben keine Angst vor Hunden gehabt, doch diese flößten uns Kindern einen solchen Respekt ein, dass wir nie auch nur daran dachten, uns dem Zwinger zu nähern. Wehe dem Leichtsinnigen, der sich in die Nähe des Gutes wagte! Wir sollten den ganzen Sommer dort verbringen, und es war ein Bilderbuch-Sommer!
Onkel Fritz und Tante Martha, die Schwester meines Vaters hatten fünf Kinder. Die zwei Jungen waren aus dem Lausbubenalter schon heraus und halfen ihrem Vater beim Fischen. Er hatte sich auf ein Luxus Sortiment spezialisiert, und die gesamte High Society von Berlin zählte zu seiner Kundschaft, sofern sie Fisch auf ihrem Speiseplan mochten, wie Aale, Hummer, Krebse und all die Süßwasser-Edelsorten. Als Gegenleistung bekam er: Vergünstigungen, die er benötigte, und die ihm und der Familie von Vorteil waren und das Leben erleichterten. Die beiden Mädchen waren etwas älter als wir, man kam jedoch gut miteinander aus. Das Los der Kleinsten ist immer dasselbe – links liegen gelassen zu werden! Man kann nichts mit ihnen anfangen und lässt sie besser zu Hause zurück.
Für Peter war dieser Sommer ein Segen. Er war in die Höhe geschossen, und seine inneren Organe hatten keine Lust, diesen Wachstum-Stress mitzumachen. Bei jedem Windzug bekam er eine Lungenentzündung. Dadurch hatte er sich zum Muttersöhnchen entwickelt. Wir hatten noch nicht das Zeitalter der Antibiotika erreicht. Gegen diese Krankheit gab es kein wirksames Mittel und außerdem: Wir lebten im Krieg und die Medikamente waren rar. Peter sollte einmal über zwei Meter lang werden, Mamas Liebling ist er immer geblieben. Wir wurden später eine Zwei-Parteien Landschaft im Familien-Verband. Mutter und Sohn auf der einen Seite, Vater mit seinen drei Töchtern auf der anderen: Wir hatten immer die absolute Mehrheit.
Eva, meine ältere Cousine litt unter einer Hautkrankheit und fuhr einmal in der Woche in die Kreisstadt zum Arzt. Mein Onkel besaß ein Auto, Marke „Mercedes“. Das war in der Kriegszeit schon eine Sensation auf dem Lande. Dank seiner guten Beziehungen wurde es nicht einkassiert. Wie wären die Städter auch sonst zu ihren kostbaren Fischen gekommen? Die mussten schließlich angeliefert werden.
Mit zwei Personen war es natürlich nicht ausgelastet. Meistens fuhr Mama mit. Ich gönnte es ihr von Herzen. Wer aber durfte sie begleiten? Mein Bruder! Was half es mir, dass ich heulend protestierte? „Immer darf Peter mit, und was ist mit mir? Ich will auch mitkommen. Ich bin noch nie im Auto gefahren!“ Keine Chance – ich erfuhr nicht einmal einen Grund, warum es nicht ging. Das fand ich so ungerecht. Ich liebte das Auto. Schon der Geruch von Lederpolster und Benzin war ein Erlebnis. Ich durfte es nur von außen bewundern. Was hätte ich darum gegeben, einmal mitfahren zu dürfen. Ich träumte nachts schon davon. Na bravo! Das waren so Situationen, da wünschte ich, Paps wäre da. Der hätte mich sicher mitgenommen.
Im Haus sah man uns nur zu den Mahlzeiten. Wir trieben uns den ganzen Tag draußen herum. Langeweile war uns unbekannt. Meine Cousinen führten uns voll in das Landleben ein. Eva und Erika zeigten uns ihre Verstecke und Abenteuerplätze. Die befanden sich natürlich im Wald. Auf einer kleinen Lichtung hatten die Jungen aus Ästen und Zweigen eine Hütte gebaut. Hier konnte man sich herrlich verstecken. Abgeschirmt von der Welt hockten wir dort und erzählten uns Geschichten, natürlich gruselige, dass einem eine Gänsehaut über den Rücken lief. So richtig zum Fürchten. Wir sollten uns zwar nie weit vom Haus entfernen, weil die Gefahr durch herumstreunende Vagabunden ziemlich groß war, aber zum Glück, war bisher nie etwas passiert, und darum nahmen wir die Verbote nicht so ernst. Es gab nichts Schöneres, als in den Wäldern herum zu streifen, auf Bäume zu klettern und sich die Welt von oben anzuschauen. Das hatte ich erst einmal lernen müssen. Wo gab es in Berlin schon die Gelegenheit, auf Bäume zu steigen? Ich beherrschte die Kunst sehr bald. Man konnte merken: Ich stammte vom Affen ab. Sollte einer meiner Urahnen sich voller Vergnügen von Ast zu Ast geschwungen haben?
Ein beliebtes Spiel war auch, über die Zäune zu den Kühen auf die Weide zu klettern, aber immer auf der Hut! Bereit, bei der geringsten Gefahr außer Reichweite der Rindviecher zu gelangen. Vielleicht waren sie bei uns immer gut gelaunt? Kein Stier machte je Anstalten, uns auf seine Hörner zu nehmen.
Manchmal boten wir uns auch an, die Gänse zu hüten. Sie wurden morgens auf eine weiter entfernt gelegene Wiese getrieben, fraßen sich den ganzen Tag durch das Gras und abends ging es wieder in den Stall zurück. Unsere Aufgabe war es, aufzupassen, dass keine sich absonderte und ihre eigenen Wege ging. Wir lagen faul in der Sonne, und hingen unseren Träumen nach. Ich lauschte dem Schnattern der Gänse, beobachtete die Hummeln, die fleißig von einer Blüte zur anderen flogen, um genügend Honig zu sammeln und ließ einen Marienkäfer auf meinem Arm herumkrabbeln. Welche Ruhe und wie viel Frieden strahlte diese Natur aus. So weit entfernt von der Hektik der Großstadt. Ich genoss diesen Sommer auf dem Land in vollen Zügen. Ich fühlte die Wärme der Sonne auf meiner Haut, atmete sie tief in mich hinein. Die Luft konnte man direkt schmecken, rein und vollgesogen von dem Duft der Blüten. Die Sommer in der Stadt dagegen … In unserer Atelier-Wohnung staute sich die Wärme, die großen Glasflächen gaben die Hitze der Sonne komplett an uns weiter. Kein kühler Luftzug herrschte. Da wäre eine Klimaanlage schon wunderbar gewesen - hatten wir aber nicht. Doch auf die Dauer hätte ich mit meinen Cousinen nicht tauschen wollen. Da wäre mir die Einsamkeit schon auf die Nerven gegangen, denn auch der schönste Sommer hat mal ein Ende und dann die langen, kalten Winter…
Hier lernte ich auch Krebse zu essen. War gar nicht so einfach, das Fleisch aus den Schalen heraus zu pulen. Hatte man es aber erst einmal geschafft, schmeckte es köstlich, die Mühe war nicht umsonst gewesen. Mamas Lieblingsfische waren Aale: Frisch geräuchert, das Fett tropfte nur so von den Fingern herab! Einmal habe ich sie probiert, hatte aber noch Stunden danach Bauchschmerzen.
Am Ende des Sommers hatten wir ganz schön zugenommen und waren braun gebrannt. So kehrten wir nach Hause zurück, im Gepäck ein Fresspaket. Es erinnerte uns noch eine Zeit lang an die Ferien.
In der ersten Nacht, wieder daheim, plagte mich ein schrecklicher Albtraum: Ich spazierte alleine auf einer Wiese und pflückte mir einen Strauß Blumen. Um mich herum Rinder, die friedlich grasten. Doch plötzlich, ich weiß nicht, was in sie gefahren war, drehten sich alle zu mir um und stürzten auf mich zu. Das sah nicht lustig aus. Ich geriet in Panik … rannte … und rannte … Die Zäune entfernten sich mit jedem Schritt weiter von mir. Keine Chance, den Ungetümen zu entkommen. Da! Ein lauter Knall holte mich aus diesem Horror in die Wirklichkeit zurück. Außer Atem und in Schweiß gebadet, saß ich im Bett. Zitternd hörte ich noch den Nachhall. Als Papa fort gegangen war, waren wir für die Nacht zu Mama übergesiedelt. Hier fühlten wir uns sicherer. Auch sie war aufgeschreckt.
„Hast du den Knall gehört, Barbara?“, fragte sie beunruhigt.
„Es hörte sich an, als wäre in der Nähe eine Bombe explodiert.“
Peter schlief ruhig in seinem Bett. Ich aber kroch zu Mama unter die Decke. Wir konnten beide nicht mehr schlafen. „Erzählst du mir eine Geschichte?“, bettelte ich, „vielleicht kann ich dann wieder einschlafen.“ Doch ich war mit meinen Gedanken noch immer bei dem gerade Erlebten.
Mama war schrecklich neugierig und wollte am nächsten Morgen natürlich herausfinden, was in der Nacht geschehen war. Jeden, den sie im Treppenhaus traf, stellte sie die gleiche Frage: „Was war eigentlich heute Nacht los? Haben Sie auch den lauten Knall gehört?“ Doch keinem war etwas aufgefallen. Wir beide waren wohl die Einzigen gewesen. Es blieb ein Rätsel. Hatten wir schon Wahnvorstellungen?
Ein paar Tage später bekam Mama Post. Der Kommandant der Truppe schrieb ihr: Papa war, schwer verwundet noch am selben Tag nach Deutschland ausgeflogen worden. Als er wieder zu Hause war, erzählte er uns: „Ich habe in dem Augenblick, als die Granate neben mir explodierte, ganz stark an euch beide gedacht.“ An meinen Bruder anscheinend nicht. Da hatten wir die Erklärung. Diese Telepathie, der Gleichklang unserer gedanklichen Hirnschwingungen ist das ganze Leben über geblieben.
Mein Vater war schon ein außergewöhnlicher Mensch, er besaß eine Art innere Antenne. Fahrzeuge, die noch weit entfernt waren, konnte er durch die Erschütterungen, die sie verursachten, wahrnehmen, lange bevor sie zu hören waren. Er konzentrierte sich sehr stark, kroch fast in sich hinein und fing diese Bewegungswellen auf. Sie ergriffen seinen gesamten Körper und brachten ihn zum Schwingen. Das machte sich auch seine Truppe an der Front zunutze. Bei einem bevorstehenden Panzerangriff kam „Sonny Boy“, wie er bei allen genannt wurde, wegen seines heiteren, fröhlichen Wesens, in Aktion. Als Medium konnte er sie schon frühzeitig warnen: Sie waren bestens vorbereitet. Später hat er es uns einmal demonstriert. In diesen Zustand konnte er sich beliebig oft hinein versetzen.





























