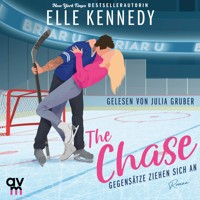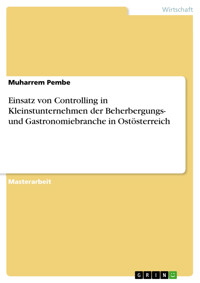
Einsatz von Controlling in Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche in Ostösterreich E-Book
Muharrem Pembe
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Note: 2, Fachhochschule Burgenland, Sprache: Deutsch, Abstract: Bei der Betrachtung der österreichischen Unternehmenslandschaft wird ersichtlich, dass zirka 99 % der Unternehmen in die Kategorie der Klein- und Mittelbetriebe, die auch die Kleinstbetriebe umfasst, eingeordnet werden können. Auf dieser Tatsache beruhend lässt sich somit feststellen, dass diese Betriebe zu der in Österreich am meist verbreiteten Unternehmensgrößenklasse zählen und daraus resultierend einen starken Einfluss auf die österreichische Wirtschaft haben. Dieser beachtliche Anteil an der Unternehmenskultur Österreichs ermöglicht eine weitere Differenzierung in sogenannte Kleinstbetriebe. Diese Kleinstbetriebe stellen die große Mehrheit aller österreichischen Betriebe im Jahr 2011 mit knapp 92 % (zirka 370.000 Unternehmen) dar. Laut der EU-Regelung beschäftigen Kleinstunternehmen nicht mehr als neun MitarbeiterInnen und die Jahresbilanz bzw. der jährliche Umsatz überschreiten nicht die zwei Mio. Euro-Grenze. Sehr stark vertreten sind diese Kleinstunternehmnungen in der Beherbergungs- und Gastronomiebranche, wo Kleinstunternehmen zirka 88 % aller Betriebe ausmachen. Diese Kleinstbetriebe sind zu Beginn ihrer Tätigkeit oft mit Hindernissen konfrontiert, die die Startup-Phase zusätzlich erschweren. Kleinstunternehmen haben es in der Anfangsphase schwer ein nachhaltiges Management und eine reibungslos funktionierende Organisation aufzubauen. Da diese Entscheidungen stark mit Kapital- und Humanressourcen verbunden sind und diese für Kleinstbetriebe eher eine Rarität darstellen, ist es hier sehr problematisch, eine optimale Lösung zu finden. Diese Aussage manifestiert sich auch in der Anzahl der im Jahre 2009 eingetretenen Unternehmensschließungen. Mit einem Anteil der Unternehmensschließungen im besagten Jahr von rund 99 % weisen diese österreichischen Kleinstbetriebe die höchste Rate unter den zum Schließen gezwungenen Unternehmen auf. Das Fehlen der zuvor genannten Ressourcen erschwert es, eine Prognose zu erstellen, wie sich das Geschäft in der kurz- bis mittelfristigen Zukunft entwickeln wird. Dieser bittere Beigeschmack der Ungewissheit begleitet das Management auf seinen tagtäglichen Entscheidungen. Des Weiteren stellt die Tatsache, dass nicht jede Kleinstunternehmerin bzw. jeder Kleinstunternehmer über genügend Controllingwissen verfügt, eine Hürde dar, weshalb häufig neben den simplen Kontrollen wie Soll-Ist-Vergleiche, keine weiteren Controllinginstrumente eingesetzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Abstract
The purpose of this thesis is parallel to the review of the controlling literature to analyse and answer the scientific research questions posed by this literature. It will aim to answer how controlling is executed in micro-enterprises in the accommodation and gastronomy sector in eastern Austria. If it should come out that there are no implemented controlling tools within these enterprises, the reason for that should be explained. Also information about the characteristics of an optimal controlling tool should be gathered. As a result of this information, a special controlling concept for the micro-enterprises of the accommodation and gastronomy sector should be developed.
Based on this subject this thesis is concentrated to answer the scientific research questions. For this reason a review of current literature on this topic is undertaken. Also the realization of interviews of experts was focused. To be considered as an expert, the person has to be the leader of a micro-enterprise within the accommodation or gastronomy industry in eastern Austria. Or he or she has to work for a company like the Austrian hotel and tourism bank, where he or she has a good overview over the sector. Within this frame eight guided interviews were made with experts to gain the requested information.
In conclusion, it was found that even if the experts do consider controlling measures as very important, there is no real use of controlling tools in practice except simple comparisons etc. in micro-enterprises in the accommodation and gastronomy sector in eastern Austria. The specifications that came out during the “optimal” controlling tool-survey are, that it should be compact and easy to handle and should summarise all the relevant information on one page. Additionally the execution without a high level of expertise should be guaranteed.
Abkürzungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Abkürzungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zentrale Fragestellungen
1.3 Methodik
1.4 Aufbau der Arbeit
2 Besonderheiten von Kleinstunternehmen
2.1 Definition der Größenklassen für Unternehmen
2.2 Wirtschaftliche Bedeutung der Klein- und Mittelbetriebe bzw. Kleinstbetriebe in der EU
2.3 Kleinstunternehmen in Österreich
2.3.1 Wirtschaftliche Bedeutung
2.3.2 Neugründungs- und Schließungsraten
2.3.3 Trends
3 Daten und Statistiken der Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche in Österreich
3.1 Definitionen
3.2 OECD-Vergleich Österreichs als Reisedestination
3.3 Strukturdaten der Beherbergungs- und Gastronomiebranche
3.3.1 Neugründungen und Beschäftigte
3.3.2 Schließungen und Beschäftigte
3.3.3 Umsatzerlöse
3.3.4 Bruttoinlandsprodukt
4 Controlling in Kleinstunternehmen
4.1 Definition und Begriffsabgrenzung
4.2 Controllingrelevante Charakteristika der Kleinstunternehmen
4.2.1 Personenbezogene Charakteristika
4.2.2 Organisationsbezogene Charakteristika
4.2.3 Kaufmännische Charakteristika
4.3 Aufgaben des Controllings in Kleinstunternehmen
4.3.1 Aufgaben des Controllings
4.3.2 Charakteristika und Ebenen des Controllings
4.4 Operative Controllinginstrumente für Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche
4.4.1 ABC-Analyse
4.4.2 XYZ-Analyse
4.4.3 Break-Even-Analyse
4.4.4 Budgetierung
4.4.5 Kennzahlen
4.4.6 Kennzahlensysteme
4.4.7 Deckungsbeitragsrechnung
4.4.8 Soll-Ist-Vergleich
4.4.9 Liquiditätsplan
5 Empirische Studie
5.1 Definition
5.2 Qualitative vs. Quantitative Forschung
5.3 Forschungsziel
5.4 Forschungsfragen
5.5 Forschungsdesign
5.5.1 Methodisches Vorgehen
5.5.2 Auswahl der Methoden
5.5.3 Auswahl der ExpertInnen
5.5.4 Erhebung der Daten
5.5.5 Auswertung der Daten
5.6 Ergebnisse und Interpretation
5.7 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus den Interviews
6 Controllingkonzeption für KleinstunternehmerInnen der Beherbergung- und Gastronomie
6.1 Merkmale und Aufbau einer Controllingkonzeption
6.2 Erstellung einer Controllingkonzeption für Kleinstunternehmen der Beherbergung und Gastronomie
6.2.1 Ziele
6.2.2 Instrumente
6.2.3 Aufgaben
6.2.4 Träger
6.2.5 Das „optimale“ Controllingtool
7 Zusammenfassung und Ausblick
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anhang 1
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Bei der Betrachtung der österreichischen Unternehmenslandschaft wird ersichtlich, dass zirka 99 %[1] der Unternehmen in die Kategorie der Klein- und Mittelbetriebe, die auch die Kleinstbetriebe umfasst, eingeordnet werden können. Auf dieser Tatsache beruhend lässt sich somit feststellen, dass diese Betriebe zu der in Österreich am meist verbreiteten Unternehmensgrößenklasse zählen und daraus resultierend einen starken Einfluss auf die österreichische Wirtschaft haben. Dieser beachtliche Anteil an der Unternehmenskultur Österreichs ermöglicht eine weitere Differenzierung in sogenannte Kleinstbetriebe. Diese Kleinstbetriebe stellen die große Mehrheit aller österreichischen Betriebe im Jahr 2011 mit knapp 92 % (zirka 370.000 Unternehmen) dar. Laut der EU-Regelung beschäftigen Kleinstunternehmen nicht mehr als neun MitarbeiterInnen und die Jahresbilanz bzw. der jährliche Umsatz überschreiten nicht die zwei Mio. Euro-Grenze.[2]
Sehr stark vertreten sind diese Kleinstunternehmnungen in der Beherbergungs- und Gastronomiebranche, wo Kleinstunternehmen zirka 88 % aller Betriebe ausmachen.[3]
Diese Kleinstbetriebe sind zu Beginn ihrer Tätigkeit oft mit Hindernissen konfrontiert, die die Startup-Phase zusätzlich erschweren. Kleinstunternehmen haben es in der Anfangsphase schwer ein nachhaltiges Management und eine reibungslos funktionierende Organisation aufzubauen. Da diese Entscheidungen stark mit Kapital- und Humanressourcen verbunden sind und diese für Kleinstbetriebe eher eine Rarität darstellen, ist es hier sehr problematisch, eine optimale Lösung zu finden.
Diese Aussage manifestiert sich auch in der Anzahl der im Jahre 2009 eingetretenen Unternehmensschließungen. Mit einem Anteil der Unternehmensschließungen im besagten Jahr von rund 99 % weisen diese österreichischen Kleinstbetriebe die höchste Rate unter den zum Schließen gezwungenen Unternehmen auf.[4]
Das Fehlen der zuvor genannten Ressourcen erschwert es, eine Prognose zu erstellen, wie sich das Geschäft in der kurz- bis mittelfristigen Zukunft entwickeln wird. Dieser bittere Beigeschmack der Ungewissheit begleitet das Management auf seinen tagtäglichen Entscheidungen. Des Weiteren stellt die Tatsache, dass nicht jede Kleinstunternehmerin bzw. jeder Kleinstunternehmer über genügend Controllingwissen verfügt, eine Hürde dar, weshalb häufig neben den simplen Kontrollen wie Soll-Ist-Vergleiche, keine weiteren Controllinginstrumente eingesetzt werden. Dieses fehlende Wissen führt zum freiwilligen Verzicht einiger ManagerInnen auf umfangreichere Controllinginstrumente, was wiederum zum, obgleich manchmal auch unbewusst eintretenden Verzicht von Strategien und Konzepten führt, die eigentlich unerlässlich sind, um eine nachhaltige und wirtschaftliche Unternehmung aufbauen und erfolgreich führen zu können.
1.2 Zentrale Fragestellungen
Die zentralen Fragestellungen dieser Arbeit sind:
Welche Controllinginstrumente gibt es laut Literatur und welche dieser Instrumente eignen sich für den Einsatz in Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche?
Welche Controllinginstrumente werden in der Wirtschaft tatsächlich von Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche eingesetzt und wie beurteilen KleinstunternehmerInnen die Notwendigkeit und Machbarkeit des Einsatzes von ausgewählten Controllinginstrumenten?
Wie könnte ein „optimales“ Controllinginstrument für die österreichischen Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche aufgebaut sein, sodass es in der Praxis anwendbar wäre?
1.3 Methodik
Zur Beantwortung der Fragestellungen wird die vorhandene Literatur zum Thema Controlling in Kleinstunternehmen ausgewertet. Die wichtigsten Literaturquellen sind neben der Basisliteratur für Controlling und Rechnungswesen, aktuelle Statistiken und Daten der WKO, Statistik Austria, KSV, Bundeministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend etc.. Darüber hinaus wird mittels Fachzeitschriften für Kleinunternehmen in Österreich und Controllingzeitschriften der aktuelle Themenbereich der Masterarbeit bearbeitet.
Im empirischen Teil der Arbeit werden, im Rahmen eines qualitativen Designs mit Hilfe von leitfadengestützten Experteninterviews, die Controllingverantwortlichen in Kleinstunternehmen befragt. Neben den zuständigen Personen für das Controlling in diesen Unternehmen werden dabei BranchenexpertInnen wie beispielsweise MitarbeiterInnen der österreichischen Hotel- und Tourismusbank interviewt, die einen Überblick über die Beherbergungs- und Gastronomiebranche haben. Die zu befragenden ExpertInnen werden mittels convenience samplings festgelegt. Durch diese Befragung werden wesentliche Informationen zu Kapitel 5 untersucht.
1.4 Aufbau der Arbeit
Im Kapitel 2, 3 und 4 erfolgt die theoretische Grundsteinlegung der Arbeit. Die Definition der Kleinstunternehmen und die wirtschaftliche Bedeutung innerhalb der EU und Österreich wird im Kapitel 2 erläutert. Das dritte Kapitel der Arbeit widmet sich der wirtschaftlichen Bedeutung der Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche in Österreich. Im darauffolgenden Kapitel 4 wird das Controlling theoretisch näher beschrieben und vor allem der Fokus auf ausgewählte operative Instrumente gelegt, die sich zur Anwendung in Kleinstunternehmen eignen. Somit wird auch die erste Forschungsfrage beantwortet.
Mit Hilfe der Experteninterviews wird im fünften Kapitel dieser Masterarbeit das theoretisch erarbeitete Wissen zusätzlich empirisch untersucht. Dabei werden sowohl VertreterInnen der Beherbergungs- als auch der Gastronomiebranche bezüglich Controllingeinsatz in Ihren Unternehmen befragt. Auch ExpertInnen aus verschiedenen wichtigen Organisationen der Branche, wie beispielsweise der österreichischen Hotel- und Tourismusbank sind InterviewpartnerInnen. Damit wird die zweite Forschungsfrage der Masterarbeit beantwortet.
In weiterer Folge werden im Kapitel 6 eine Controllingkonzeption speziell für Kleinstunternehmen der Beherbergungs- und Gastronomiebranche vorgestellt. Dabei werden vor allem die maßgeblichen Parameter, Ziele, Instrumente, Aufgaben und Träger der Controllingkonzeption näher dargestellt. Abschließend beschreibt das „optimale“ Controllingtool die gewünschten Eigenschaften der KleinstunternehmerInnen der Beherbergung und Gastronomie. Somit wird die dritte Forschungsfrage dieser Masterarbeit beantwortet.
Als letztes Kapitel folgt eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, die während der Erstellung dieser Arbeit gemacht wurden.
2Besonderheiten von Kleinstunternehmen
Im folgenden Kapitel wird anhand der EU-Verordnung die Definition der einzelnen Unternehmensgrößenklassen mittels einer übersichtlichen Grafik illustriert. Anschließend wird beschrieben, wie wichtig die Klein- und Mittelbetriebe, speziell Kleinstbetriebe, auf der europäischen Wirtschaftsebene sind. Des Weiteren wird auf die Bedeutung der Kleinstunternehmen speziell für die österreichische Wirtschaft näher eingegangen. Abschließend wird gezeigt, wie sich die Kleinstunternehmer-landschaft in Österreich innerhalb der letzten Jahre entwickelt hat.
2.1 Definition der Größenklassen für Unternehmen
Obwohl die wirtschaftliche Bedeutung der Klein- und Mittelbetriebe und somit auch der Kleinstbetriebe enorm ist, gibt es interessanterweise auf nationaler Ebene keine klare Definition für die Größenklassifizierungen von Unternehmen. Aufgrund des Fehlens einer klaren Definition für Kleinst-, Klein-, Mittel- und Großunternehmen wird die Empfehlung der EU-Kommission herangezogen.[5] Diese wurde erstmals im Jahr 1996 als eine gemeinsame Definition für Klein- und Mittelunternehmen erstellt. Jedoch gab die Kommission am 6. Mai 2003 eine neue Empfehlung aus, worin die ökonomische Entwicklung miteinbezogen wurde. Mit 1. Jänner 2005 trat die aktuelle Empfehlung in Kraft und ist somit für alle Politikfelder, Programme und Maßnahmen der Kommission gültig. Neben der Tatsache, dass eine Verordnung auf freiwilliger Basis der Mitgliedsstaaten gültig ist, ist es jedoch unausweichlich diese einzuhalten, um bestimmte Vorteile wie z.B. der Europäischen Investitionsbank (EIB) oder des Europäischen Investitionsfonds (EIF) zu nützen.[6]
Die EU-Verordnung sieht vier Unterscheidungsmerkmale vor, die zur Klassifizierung von Unternehmen ausschlaggebend sind. Diese sind:[7]
Anzahl der MitarbeiterInnen
Umsatz
Bilanzsumme
Unabhängigkeit
In Abb. 1 ist dargestellt, welche Grenzen für die einzelnen Größenklassen die EU-Verordnung bezüglich der MitarbeiterInnen, Umsatz, Bilanzsumme und Unabhängigkeit vorsieht.
Abbildung 1: Definition der Größenklassen anhand der EU-Verordnung
Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an portal.wko.at
Bei der Betrachtung der obigen Grafik (Abb. 1) ist ersichtlich, dass KleinstunternehmerInnen laut der EU-Verordnung nicht mehr als neun MitarbeiterInnen beschäftigen dürfen. Ein weiteres Kriterium ist, dass der Umsatz höchstens 2 Mio. Euro im jeweiligen Geschäftsjahr betragen darf. Die Obergrenze für die Bilanzsumme ist für KleinstunternehmerInnen laut der EU-Verordnung mit maximal 2 Mio. Euro limitiert.