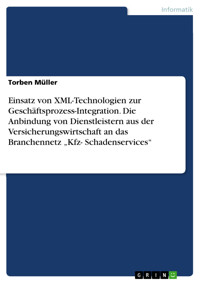
Einsatz von XML-Technologien zur Geschäftsprozess-Integration. Die Anbindung von Dienstleistern aus der Versicherungswirtschaft an das Branchennetz „Kfz- Schadenservices“ E-Book
Torben Müller
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Fachbuch aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, , Sprache: Deutsch, Abstract: Nach der unternehmensinternen Prozessorientierung gewinnt die elektronische Integration von Geschäftsprozessen über Unternehmensgrenzen hinweg an Bedeutung. XML-Technologien versprechen im Zusammenhang mit der B2B-Integration flexible Lösungen. In kleinen und mittelständigen Unternehmen bieten die Standardtechnologien eine kostengünstige Alternative zu kommerziellen Integrationslösungen. Das Buch stellt ein Konzept für den Einsatz von XML-Technologien, insbesondere XSLT, zur Geschäftsprozess-Integration vor. An einem Beispiel zur Anbindung von Dienstleistern an Versicherer wird gezeigt, wie eine dynamische Transformation von XML basierten Geschäftsdokumenten den unternehmensübergreifenden Datenaustausch unterstützen kann. Neben betriebswirtschaftlichen Grundlagen geht der Autor auf Treiber, Ebenen und die Realisierung von B2B-Integrationsprojekten ein. Auf dieser Grundlage wird an einem Fallbeispiel gezeigt, welche Vorteile eine flexible, konfigurierbare Transformation von Geschäftsdokumenten bietet. Neben dem Konzept wird auch eine mögliche Implementierung vorgestellt, was das Buch auch für Praktiker interessant macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Der Autor
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziel der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Allgemeine Grundlagen
2.1 Betriebswirtschaftlich-organisatorische Grundlagen
2.1.1 Geschäftsprozess
2.1.2 E-Business
2.1.3 Enterprise Application Integration
2.1.4 Business to Business Application Integration
2.2 Informationstechnische Grundlagen
2.2.1 Integrationsansätze
2.2.2 XML-Technologien
3 E-Business Integration
3.1 Integrationstreiber
3.1.1 Heterogenität der Systeme
3.1.2 Dynamisches Unternehmensumfeld
3.1.3 ERP-Integration
3.1.4 B2B-Integration
3.1.5 E-Commerce
3.1.6 Fusionen und Akquisitionen
3.2 Ebenen der Integration
3.2.1 Präsentations-Integration
3.2.2 Prozess-Integration
3.2.3 Anwendungs-Integration
3.2.4 Daten-Integration
3.3 Realisierung von Integrationsprojekten
3.3.1 Theoretische Vorgehensweise und Praxis
3.3.2 Erfolgsfaktoren
3.3.3 Wirtschaftlichkeitsbeurteilung
3.4 Integration mit XML
3.4.1 Probleme des inner- und zwischenbetrieblichen Datenaustauschs
3.4.2 XML versus traditionelles EDI
3.4.3 XML-Standards im Bereich des E-Business
3.4.4 Electronic Business XML und die Universal Business Language
4 Die Anbindung eines Dienstleisters an das „Kfz-Schadennetz“
4.1 Vorstellung des GDV
4.1.1 Das „Kfz-Schadennetz“ des GDV
4.1.2 Der GDV-Standard
4.2 Der Beispielprozess „Fakturierung und Versand von Produkten“
4.2.1 Der Geschäftsprozess „Fakturierung und Versand“
4.2.2 Informationstechnische Unterstützung
4.2.3 Schwächen des Vorgehens mit statischer Transformationslogik
5 Konzept zur dynamischen Transformation
5.1 Anforderungsdefinitionen
5.2 Workflow-Ebene
5.3 Transformations-Ebene
5.3.1 Dynamisches XSLT
5.3.2 XSLT-Objekte
5.3.3 Zusammensetzen der Objekte - „Assembler“
5.3.4 Konfiguration
5.3.5 Zusammenfassung der Transformationsprozesse
5.3.6 Dokumentation – „Docwriter“
5.3.7 Allgemeine Anwendbarkeit
5.4 Aspekte der Implementierung
5.5 Betrachtung der Wirtschaftlichkeit
6 Implementierung der dynamischen Transformation
6.1 Quell- und Zieldokumente
6.2 Die Konfiguration der Transformation
6.3 Aufbau der XSLT-Objekte
6.4 Die Transformation
6.5 Die Funktionsweise des Assemblers
6.6 Automatische Erzeugung der Dokumentation
7 Zusammenfassung und Ausblick
Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2.1: Abteilungsübergreifende Geschäftsprozesse
Abbildung 2.2: Der Weg zum E-Business (Vgl. [ScKö01])
Abbildung 2.3: Geschäftsmodelle im E-Business (in Anlehnung an [HeSa99, 23])
Abbildung 2.4: Enterprise Application Integration (in Anlehnung an [Kell02, 7])
Abbildung 2.5: B2B-E-Commerce (in Anlehnung an [Kell02, 6])
Abbildung 2.6: Punkt-zu-Punkt-Verbindung
Abbildung 2.7: EAI-Hub und Bus-Struktur
Abbildung 2.8: Bausteine einer EAI-Architektur (in Anlehnung an [Booz01, 22])
Abbildung 2.9: Wohlgeformtes XML-Dokument
Abbildung 2.10: XSL-Transformation (in Anlehnung an [Bong04, 28])
Abbildung 2.11: Signieren eines XML-Dokuments
Abbildung 2.12: Testen eines signierten XML-Dokuments
Abbildung 3.1: Ebenenmodell für die E-Business Integration (nach [Borg05])
Abbildung 3.2: Struktureller Rahmen für Erfolgsfaktoren bei Integrationsprojekten
(in Anlehnung an [KlWS05])
Abbildung 3.3: Integrationskosten (in Anlehnung an [Kaib02, 130])
Abbildung 4.1: Beispielprozess Schadensregulierung (in Anlehnung an [Geri01])
Abbildung 4.2: Der Nachrichtentyp „Schadenmeldung“ [GDVb]
Abbildung 4.3: Ausschnitt Geschäftsprozess „Fakturierung und Versand“
Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der IT-Systeme
Abbildung 4.5: XSL-Transformation der Daten aus dem Produktionssystem
Abbildung 5.1: Workflow im Soll-Konzept
Abbildung 5.2: Dynamisches XSLT
Abbildung 5.3: Aufbau eines Objekts
Abbildung 5.4: Erzeugen des Ziel-Stylesheets
Abbildung 5.5: Kopiervorgang zur Erzeugung eines Ziel-Stylesheets
Abbildung 5.6: Aufbau eines Konfigurationsdokuments
Abbildung 5.7: Transformationsprozesse in der Soll-Situation
Abbildung 5.8: Erzeugen der Dokumentation
Abbildung 5.9: Vorgehensmodell der Implementierung
Abbildung 5.10: Kostenvergleich Soll-Ist
Abbildung 6.1: Das Quelldokument
Abbildung 6.2: Nachrichtentyp 005, Kalkulation
Abbildung 6.3: Zieldokument für VUA
Abbildung 6.4: Zieldokument für VUB
Abbildung 6.5: Standardkonfiguration für Nachrichtentyp 005
Abbildung 6.6: Format der Schadennummer im Quelldokument
Abbildung 6.7: Konfigurationsdokument für VUA
Abbildung 6.8: Konfigurationsdokument für VUB
Abbildung 6.9: Objekt „Zahlenformatdefinitionen“
Abbildung 6.10: Objekt „RootTemplate“
Abbildung 6.11: Konfiguration, Dokumentation und Verwendung von Parametern
Abbildung 6.12: Objekt „Zugriffspfaddefinitionen“
Abbildung 6.13: Objekt „DatumUhrzeitErmitteln“
Abbildung 6.14: Objekt „Variablendefinitionen“
Abbildung 6.15: Objekt „4001“
Abbildung 6.16: Objekt „Header“
Abbildung 6.17: Objekt „4300“ – Kalkulation / Rechnung
Abbildung 6.18: Objekt „4900“ - Anhang
Abbildung 6.19: Benötigte Dateien für die Transformation
Abbildung 6.20: Ziel-Stylesheet „export_VUA_005.xsl“
Abbildung 6.21: Der Nachrichtentyp 005 für VUA
Abbildung 6.22: Der Nachrichtentyp 005 für VUB
Abbildung 6.23: Präferenzen – Konfiguration und Umsetzung
Abbildung 6.24: Dokumentation für das RootTemplate für VUA
Abbildung 6.25: Dokumentation für die Satzart 4900 für VUA
Abbildung 6.26: Dokumentation für die Satzart 4900 für VUB
Hinweis zur Quellenangabe
Im Text wird hinter dem Titel der Abbildung ggf. auf die Quelle hingewiesen. Abbildungen ohne diese Angabe wurden zur Illustration vom Autor selbst erstellt.
Abkürzungsverzeichnis
Der Autor
Torben Müller hat in den Jahren 2002 bis 2007 an der Universität Kassel Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik studiert. Seine beiden praxisnahen Diplomarbeiten schrieb er jeweils in Kooperation angesehenen Unternehmen aus der Automobilbranche. Mittlerweile arbeitet er bei einem IT-Dienstleister der Automobilindustrie im Bereich der Systemanalyse und Prozessautomatisierung. Neben seiner akademischen Laufbahn besitzt er Erfahrung in den Bereichen IT- und Softwarearchitektur, Software-Engineering, verteilte Systeme sowie Internet- und Datenbanktechnologien.
Reaktionen zu diesem Buch nimmt er gerne per E-Mail ([email protected]) entgegen. Auch ist es möglich, auf diesem Weg die Quelltexte aus diesem Buch für eigene Experimente zu beziehen und Fragen direkt an den Autor zu stellen.
Vorwort
Das vorliegende Buch gibt eine anonymisierte und erweiterte Version meiner Diplomarbeit wieder, die zur Erlangung des akademischen Grades Diplom Ökonom angefertigt und von den Gutachtern des Fachgebiets Wirtschaftsinformatik der Universität Kassel im Januar 2006 mit der Note 1,0 bewertet wurde.
Die Themengebiete rund um die Integration von Geschäftsprozessen über Unternehmensgrenzen hinweg sind heute so aktuell wie sie es im Jahr des Entstehens der Diplomarbeit waren. Auch die XML-Technologien finden heute im Zusammenhang mit der B2B-Integration Anwendung. Gerade in kleinen und mittelständigen Unternehmen bieten die Standardtechnologien eine kostengünstige Alternative zu kommerziellen Integrationslösungen.
Die Arbeit verliert durch ihre Anonymisierung nicht an Wert. Das auf einer dynamischen Datentransformation basierende Konzept zur Integration von Geschäftsprozessen, bei denen XML-basierte Daten unterschiedlichen Formats ausgetauscht werden, ist übertragbar und branchenübergreifend anwendbar. Für dieses Buch wurde die Originalarbeit um ein Kapitel ergänzt, welches eine technische Umsetzung des Konzepts zur Transformation XML-basierter Daten mittels XSLT vorstellt. Das Buch ist damit auch für Praktiker interessant.
1 Einleitung
Geschäftsprozesse werden heute durch Anwendungssysteme unterstützt. Einzelne Aktivitäten innerhalb von Geschäftsprozessen werden vielfach von unterschiedlichen Anwendungen abgebildet. Optimale funktionsbereichübergreifende Prozessabläufe und ein hohes Maß an Automatisierung lassen sich zumeist durch die Integration der unterstützenden Anwendungssysteme erreichen. Die Integration beschleunigt und rationalisiert die Informationsflüsse innerhalb eines oder zwischen mehreren Unternehmen. Ein erster Ansatz war der gemeinsame Zugriff auf zentrale Daten durch mehrere Anwendungen. Heute steht zunehmend die Integration und Automatisierung von umfassenden Geschäftsprozessen - auch über Unternehmensgrenzen hinweg - im Vordergrund.
Die Konzepte der Enterprise Application Integration (EAI) bzw. Business to Business Application Integration (BBAI) liefern einen Beitrag zur Lösung der Integrationsprobleme. Für den innerbetrieblichen oder zwischenbetrieblichen Datenaustausch zwischen Anwendungssystemen hat sich die Extensible Markup Language (XML) als Standard einen Namen gemacht.
Diese Arbeit zeigt den Einsatz von XML-Technologien, insbesondere XSLT, zur Geschäftsprozess-Integration am Beispiel der Anbindung von Dienstleistern an Versicherer über das Branchennetz „Kfz-Schadenservices“ des GDV.
1.1 Problemstellung
Durch historisch gewachsene Strukturen bildeten sich in den Unternehmen viele voneinander unabhängige, zumeist inkompatible, Anwendungssysteme. Die heterogene Anwendungslandschaft ist unflexibel, wenn es darum geht, sich laufend verändernde Geschäftsprozesse mit wechselnden Geschäftspartnern zu unterstützen. Heterogene Anwendungssysteme sind nicht interoperabel, d. h. sie können nicht von Haus aus miteinander kommunizieren, Daten austauschen und interagieren.
Innerhalb der Geschäftsprozesse zwischen Dienstleistern wie Prüfgesellschaften und Versicherungsunternehmen werden Daten über den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Form von Geschäftsdokumenten ausgetauscht. Diese Daten werden von den Empfängern oft in einem anderen Format erwartet, als sie vom Absender vorliegen oder erzeugt werden. Dies erfordert eine Transformation. Zudem stellen verschiedene am Markt agierende Unternehmen differenzierte Ansprüche an die genauen Inhalte der Geschäftsdokumente.
1.2 Ziel der Arbeit
Diese Arbeit soll die Grundlagen der Themengebiete EAI und BBAI erarbeiten. Aktuelle Integrationsansätze und Integrationstechnologien sowie Topologien und eine Architektur von Integrationssystemen sollen vorgestellt werden. Es sollen mögliche Motive für die Integration von Anwendungssystemen und Prozessen aufgezeigt und ein Überblick über das Konzept der Enterprise Application Integration gegeben werden. Im Kontext der E-Business-Integration wird auf Aspekte der Realisierung von Projekten, Erfolgsfaktoren und die Wirtschaftlichkeit eingegangen. Die Technologien auf Basis der Extensible Markup Language (XML-Technologien) sollen mit traditionellem Electronic Data Interchange (EDI) verglichen werden, und es soll aufgezeigt werden, wie aktuelle XML-Technologien zum Datenaustausch in einem B2B-Integrationsszenario beitragen können.
Im Rahmen des Praxisteils der Arbeit wird ein wieder verwendbares Konzept für die flexible Transformation von in XML-Notation vorliegenden Daten entwickelt, welches das Potenzial hat, die oben angesprochenen unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse für die Verbindung unterschiedlicher Unternehmen in Hinblick auf die dafür nötige Datentransformation optimal zu unterstützen. Dies ist Voraussetzung, dass Unternehmen ihren Kunden eine elektronische Anbindung anbieten und flexibel auf Kundenwünsche reagieren können. Es soll gezeigt werden, dass eine flexible und konfigurierbare Transformation von XML-Daten zwischen unterschiedlichen Formaten und Formatvarianten mit Hilfe von XML-Technologien kostengünstig realisierbar ist.
1.3 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil. Der Theorieteil umfasst die Kapitel 2 und 3. Im zweiten Kapitel werden zunächst die betriebswirtschaftlichen sowie die informationstechnischen Grundlagen des Themenbereichs vorgestellt. Darauf aufbauend werden im dritten Kapitel „E-Business-Integration“ vertiefend Aspekte der Integration von Anwendungssystemen und Geschäftsprozessen beleuchtet. Neben der Darstellung von möglichen Gründen für die Integration und deren verschiedenen Ebenen ist auch die Realisierung von Integrationsprojekten Gegenstand dieses Kapitels. In Hinblick auf den Praxisteil wird die Eignung von XML-Technologien für die Unterstützung der Integration von Anwendungssystemen und Prozessen - auch in Bezug auf unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse - bewertet.
Der Praxisteil besteht aus den Kapiteln 4 bis 6. Im vierten Kapitel wird zunächst das „Kfz-Schadennetz“ des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft und ein beispielhafter Geschäftsprozesse mit seinen technischen Schnittstellen zwischen einem Anbieter für Unfallgutachten und Versicherungsunternehmen vorgestellt. Es wird gezeigt, wie Geschäftsdokumente im XML-Format mit Hilfe von statischem XSLT in ein vom GDV akzeptiertes Format transformiert werden und welche Schwächen dieses Vorgehen mitbringt.
2 Allgemeine Grundlagen
In diesem Kapitel werden allgemeine Grundlagen beschrieben, die für das Thema der Arbeit, die elektronische Geschäftsprozess-Integration, von Bedeutung sind. Dabei werden betriebswirtschaftlich-organisatorische und informationstechnische Aspekte behandelt.
Der Abschnitt „Betriebswirtschaftlich-organisatorische Grundlagen“ erläutert die Begriffe Geschäftsprozess, E-Business, Enterprise Application Integration und Business to Business Application Integration.
Dagegen werden im informationstechnischen Teil Technologien, Topologien und eine Architektur von Integrationsansätzen beschrieben. Der Praxisteil der Arbeit beschäftigt sich mit der Geschäftsprozess-Integration auf Basis der XML-Technologie. Folglich nehmen die grundlegenden Elemente dieser Technologie einen besonderen Platz ein.
2.1 Betriebswirtschaftlich-organisatorische Grundlagen
In der Literatur besteht derzeit keine Einigung über die genaue Definition von E-Business oder Enterprise Application Integration (EAI). Die meisten Autoren verbinden mit EAI nur die unternehmensinterne Integration und grenzen den Begriff von der zwischenbetrieblichen Integration ab, andere verstehen unter demselben Begriff die Integration verschiedener Systeme auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Durch die Unterscheidung zwischen einer internen und einer zwischenbetrieblichen Anwendungsintegration kann der Problembereich strukturiert werden [MaSc02, 171]. In den folgenden Abschnitten werden aus diesem Grund neben dem Geschäftsprozessbegriff die Begriffe E-Business, Enterprise Application Integration und B2B Application Integration (BBAI) erläutert und abgegrenzt.
2.1.1 Geschäftsprozess
Der klassische organisatorische Aufbau der Unternehmen ist durch die Aufteilung des gesamten Unternehmens in voneinander getrennte Funktionsbereiche und durch eine hierarchische Gliederung der Organisationseinheiten geprägt. Diese funktionale Organisation folgt dem Taylorismus. Die methodischen Grundsätze sind horizontale und vertikale Spezialisierung, Akkordlohnsysteme und die Normierung von Arbeitsobjekt, Arbeitszeit und Arbeitstätigkeit [Tayl13]. Die funktionsorientierte Organisationsform der Unternehmen dominierte bis Anfang der 90er Jahre, als die Prozessorientierung mit Schlagworten wie Business Process Reengineering (Hammer/Champy, 1995) in den Fokus der betriebswirtschaftlichen Betrachtung rückte. Über die einzelnen Funktionsbereiche wurde eine Prozesssicht gelegt. Geschäftsprozesse werden heute auf die Kunden ausgerichtet und reichen über die Grenzen der einzelnen Abteilungen hinweg.
Abbildung 2.1: Abteilungsübergreifende Geschäftsprozesse
Im Folgenden werden mehrere Definitionen für den Geschäftsprozess-Begriffs vorgestellt, die verschiedenen Aspekten einen unterschiedlichen Schwerpunkt beimessen, sich inhaltlich jedoch nicht gegenseitig ausschließen.
Hammer und Champy definieren einen Geschäftsprozess als „Bündelung von Aktivitäten, die einen oder mehrere Inputs benötigen und für den Kunden ein Ergebnis von hohem Wert erzeugen [HaCh95, 52].“ Davenport und Short definieren den Begriff als spezielle Reihenfolge von Aktivitäten, an deren Ende eine Leistung/ein Produkt für bestimmte Kunden oder Märkte entstanden ist [DaSh90]. Nach Scheer ist ein Geschäftsprozess „eine zusammengehörende Abfolge von Unternehmensverrichtungen zum Zweck einer Leistungserstellung. Ausgang und Ergebnis des Geschäftsprozesses ist eine Leistung, die von einem internen oder externen Kunden angefordert und abgenommen wird [Sche02, 3].“ Eine aktuelle Definition bieten Schmelzer und Sesselmann: „Geschäftsprozesse sind funktionsübergreifende Verkettungen wertschöpfender Aktivitäten, die von Kunden erwartete Leistungen erzeugen und deren Ergebnisse strategische Bedeutung für das Unternehmen haben [ScSe04, 46].“
Zusammenfassend kann man sagen, dass Geschäftsprozesse durch verknüpfte Aktivitäten über mehrere Funktionseinheiten im Unternehmen hinweg einen oder mehrere Inputs in eine Output-Leistung verwandeln, die einen Wert für einen Kunden darstellt. Dabei kann es sich um einen internen Kunden im Unternehmen oder um einen externen Kunden handeln.





























