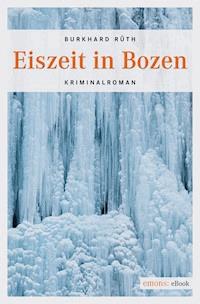
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gerade noch hat Commissario Vincenzo Bellinis von der Bozener Polizei mit seiner Freundin Gianna die herrliche Natur der Alpen genossen, da wird er zu einer entstellten Leiche gerufen. Am Fuß des Toten entdeckt er Giannas Halskette, Gianna selbst ist spurlos verschwunden. Ihr Entführer macht Bellini einen perfiden Vorschlag: Durch ein "Spiel" kann der Commissario seine Freundin zurückgewinnen. Belline ahnt nicht, dass die letzte Aufgabe tödlich ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Burkhard Rüth, Jahrgang 1965, ist als Unternehmensberater und betriebswirtschaftlicher Fachautor tätig. Er lebt bei Bonn, seine Wahlheimat ist jedoch Südtirol, das er sehr gut kennt. Burkhard Rüths Romane bieten für den interessierten Leser ganz nebenbei eine höchst spannende Art von Reiseführer. Im Emons Verlag erschien bisher »Das Monster von Bozen«.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
© 2012 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: istockphoto.com/anzeletti Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-147-3 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Aus seinen Kammern kommt der
Sturm und von Norden her die Kälte.
Vom Odem Gottes kommt Eis,
und die weiten Wasser liegen erstarrt.
Die Wolken beschwert er mit Wasser,
und aus der Wolke bricht sein Blitz.
Er kehrt die Wolken, wohin er will,
dass sie alles tun, was er ihnen gebietet auf
dem Erdkreis: zur Züchtigung für ein Land
oder zum Segen lässt er sie kommen.
Ich widme mein zweites Buch Christian,
einem meiner engsten Freunde.
Letztendlich haben mich sein Zureden
und seine freundschaftlichen Ratschläge
an einem von diversen Bierchen begleiteten Abend
davon überzeugt, meine Ideen für einen Regionalkrimi,
Prolog
Vor mehr als dreißig Millionen Jahren driftete die afrikanische Kontinentalplatte nach Norden, auf vollem Konfrontationskurs mit der großen eurasischen Platte, über die sie sich mit gewaltigen Kräften schob. Dabei verschwand zum größten Teil das Tethysmeer, jener Urozean, der zwischen dem heutigen Mitteleuropa, Nordafrika und Indien lag, und hinterließ mächtige Kalkablagerungen. Durch den Druck der Plattenkollision begannen sich die Alpen aufzufalten. Phasen der Ruhe und der aktiven Gebirgsbildung wechselten einander ab. Die beiden letzten Faltungen vor zwanzig und sechs Millionen Jahren hoben die Alpen zu der uns bekannten Form an. Sogar die majestätischen, eisbedeckten Flanken des 3.798 Meter hohen Großglockners sowie das Stilfser Joch in Südtirol, der höchste befahrbare Gebirgspass dieses riesigen europäischen Gebirges, bestehen aus ozeanischen Böden.
Auch wenn der tektonische Antrieb schon lange erlahmt ist, unterliegen die Alpen trotzdem einem permanenten Veränderungsprozess, bedingt durch Erosion, Wasser, Stürme, Niederschläge und die sich immerzu verändernden Gletscher mit ihren enormen Kräften. Grundvoraussetzung für die Entstehung dieser »Ferner« oder »Kees«, wie sie je nach Region auch genannt werden, ist Schnee.
Jede Schneeflocke ist ein unverwechselbares Individuum, keine gleicht der anderen. Lediglich eines haben sie gemeinsam: Ihre Eiskristalle sind sechseckig. Erst, wenn sich Hunderte davon aneinandergeheftet haben, ist eine Schneeflocke entstanden, die für ihren Weg von der Wolke zum Boden bis zu fünf Stunden braucht.
Schnee überlebt in tiefen Lagen meistens nur wenige Stunden oder Tage. Im Gebirge hingegen kommen im Laufe eines Winters im dauernden Wechsel von Niederschlägen, Tauwetter und Verwehungen Dutzende Meter von Schnee zusammen. In extremen Jahren erreicht die Schneeschicht absolute Höhen von mehr als zehn Metern. Und dieser Schnee ist die Nahrung der mächtigen Gletscher.
Damit ein neuer Gletscher entstehen kann, muss so viel Neuschnee fallen, dass die oberen Schneeschichten die unteren durch ihr Gewicht zusammenpressen, dann beginnt die faszinierende Metamorphose von Schnee zu Gletschereis. Über Tausende von Jahren haben die Gletscher in den Alpen eine Mächtigkeit von bis zu vierhundert Metern entwickelt. Wände aus vierhundert Metern reinem Eis, das in unwirklichen, kalten Grün- und Blautönen schimmern kann.
Jeder Gletscher ist unentwegt talwärts in Bewegung, unaufhaltsam rutscht er nach unten. Je steiler der Hang ist, auf dem sich der Gletscher bewegt, desto höher ist seine Geschwindigkeit. In den Alpen kann ein Gletscher in einem Jahr hundertfünfzig Meter zurücklegen, im Himalaya das Zehnfache, in Grönland sogar bis zu dreißig Kilometer.
Viele Gletscher sind von gefährlichen Spalten durchsetzt. Doch es gibt Wege, Pfade, die sich durch das Eis schlängeln, bis tief hinein in den Gletscher.
Inmitten des ewigen Eises verlieren Zeit und Raum an Bedeutung. Kein Geräusch, nicht einmal Licht dringt hinab in die Abgründe des Eises. Dort ist nichts. Nichts als Eis.
1
Bozen, Sonntag, 26. September
Was für ein erhebender Anblick! Diese wohltuende Wärme! Ein herrlicher Kontrast zu dieser endlosen, zermürbenden Tristesse um ihn herum. Das ganze Jahr Regen, es hörte gar nicht mehr auf. Diese widerliche Kälte, die unaufhaltsam bis in den letzten Winkel des Körpers kroch und ihn lähmte. Das hatte mit Klimaerwärmung nichts zu tun, im Gegenteil, man könnte meinen, eine neue Eiszeit zöge herauf.
Lange hatte er davon geträumt, sich aber nie getraut. Interessanterweise wurde es viel leichter, wenn man es einmal getan hatte. Die erste Überwindung, das war die größte Hürde. Wenn man sich noch ausmalte, was alles passieren könnte, sich vorstellte, man würde gefasst. Das war vorbei. Er hatte längst erkannt, wie simpel es war.
Er konnte gar nicht sagen, was ihn eigentlich dazu trieb. Es war keineswegs der Wunsch, zu zerstören oder zu verletzen. Auch nicht der Kick, gejagt zu werden. Wahrscheinlich war es nichts als Faszination. Eine Faszination, die er seit seiner Kindheit kannte. Wenn sie mit der Jugendgruppe ein Lagerfeuer machten, wenn der Nachbar in seinem Garten Abfall verbrannte oder wenn zu Ostern der riesige Holzhaufen auf dem Dorfanger in Flammen aufging, dann war er jedes Mal wie hypnotisiert. Das Feuer zog ihn auf geheimnisvolle Weise an, manchmal hatte er sogar den Eindruck, es würde mit ihm sprechen, allein mit ihm!
Nur ein Narr konnte glauben, Flammen wären etwas Totes. Nichts war lebendiger! Feuer hatte einen unbändigen Hunger. Wurde er nicht gestillt, dann verendete es qualvoll. Nie hatte er das mitansehen können. Und er begriff auch die Einfältigkeit und Gleichgültigkeit seiner Mitmenschen nicht, die nicht begreifen wollten, dass es sie ohne die Entdeckung des Feuers gar nicht gäbe.
Endlich hatte er den Pfad eingeschlagen, der für ihn vorherbestimmt war. Er schaute voller Ehrfurcht in die meterhohen Flammen. Am liebsten wäre er hineingesprungen, aber er wusste, dass Feuer in seiner unersättlichen Gier nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden konnte.
In der Ferne – Sirenen! Diese Ignoranten. Schon wieder marschierten sie mit ihrer Artillerie auf, um dem Feuer den Garaus zu machen. Er hatte keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das Einzige, was er tun konnte, war, den Flammen immer wieder neue Nahrung zu geben, das Feuer zu füttern, um sein Vertrauen zu gewinnen.
Er lief in Richtung Wald. Wehmütig blickte er noch einmal zurück. Er hatte den Eindruck, als reckten sich die Flammen nach ihm. Sie riefen voller Angst: Bleib bei uns! – Lass uns nicht im Stich! Er fühlte sich wie ein feiger Verräter.
***
Ortler, Forni-Gletscher
Der Wind hatte sich zu einem richtigen Sturm ausgewachsen. Das leichte Schneetreiben, das just in dem Moment, als sie den Gipfel des Monte Cevedale verließen, eingesetzt hatte, war inzwischen ein undurchdringliches Schneegestöber. Sie hatten höchstens dreißig Meter Sicht. Als Vincenzo heute Morgen beim Aufbruch von der Branca-Hütte auf das Thermometer geschaut hatte, zeigte es minus elf Grad, und das Wetter war sonnig und fast windstill. Jetzt aber, während ihm eisige Schneekristalle wie winzige Splitter ins Gesicht peitschten, schätzte er die Temperatur auf unter minus zwanzig Grad. Gott sei Dank hatte er seinen Windstopper angezogen. Der hielt ihm selbst diesen Kältesturm halbwegs vom Leib.
Vincenzo war mit Hans Valentin, seinem Bergführerfreund aus Sand in Taufers, am Samstagmittag in Bozen losgefahren. An dem großen Parkplatz am Ende der Straße ins Forni-Tal hatten sie den Wagen abgestellt und den bequemen Weg zur Hütte eingeschlagen. Der Wetterbericht hatte ab Samstagmittag ein Zwischenhoch versprochen, ehe es im Laufe des Sonntags umschlagen sollte. Damit war der Sonntag der einzige Tag für ihren vorläufig letzten gemeinsamen Gipfel, denn in drei Wochen würde Hans zu seiner Expedition nach Neuseeland aufbrechen. Zuvor hatten immer wieder Schlechtwettereinbrüche ihren langgehegten Plan, den Cevedale über den riesigen Forni-Gletscher zu besteigen, zunichtegemacht. Hans hatte die Ortlergruppe ausgewählt, um seinen Freund endlich einmal über einen der ganz großen Gletscher zu führen. Die technischen Anforderungen waren eher gering, die Hauptgefahr ging von unter dem Schnee verborgenen Spalten aus. Aber Hans kannte jeden Winkel dieses Gletschers.
Bis zum Gipfel hatte sie strahlender Sonnenschein begleitet. Weil Schnee und Eis die Sonne reflektierten, konnten sie sogar im T-Shirt gehen. Nachdem sie über den schmalen Grat den höchsten Punkt erreicht hatten, bot sich ihnen ein atemberaubender Rundblick: vom Palon de la Mare und der Punta San Matteo, dem südlichen Gipfel des Ortler, bis zur Brenta, zur Bernina und zu weiteren prominenten Bergriesen. Sie nahmen sich die Zeit für eine ausgiebige Gipfeljause, zumal sie dort oben ganz allein waren. Normalerweise lockte der Cevedale im Frühherbst noch zahlreiche Bergsteiger an, aber der angekündigte Wettersturz hatte die meisten Gipfelstürmer abgeschreckt.
Dann ging es plötzlich ganz schnell. Von einer Sekunde auf die nächste frischte der Wind auf, von der Königspitze her zogen dunkle Wolken auf. Noch während sie ihre Rucksäcke packten, hüllten tief hängende Wolkenfetzen den Gipfel ein, und kaum eine Stunde später tobte ein bedrohlicher Schneesturm. Vincenzo wusste, dass er sich allein hoffnungslos verlaufen hätte.
»Bist du dir sicher, dass wir in dem Inferno den Weg zur Hütte nicht verpassen?« Er musste gegen die brüllenden Windböen anschreien, damit Hans Valentin ihn verstehen konnte.
»Mach dir keine Sorgen, Vincenzo, das ist noch harmlos. Erst heute Nacht wird es richtig heftig, aber dann liegst du längst in deinem behaglichen Bett. Davon abgesehen kenne ich mich hier aus. Sonst hätte ich so eine Tour bei dieser Wettervorhersage nicht mit dir gemacht. Achte bitte darauf, dass du das Seil gut unter Spannung hältst. Ich kenne nicht jede Gletscherspalte.«
»Selbst wenn wir es bis zum Parkplatz schaffen, wie sollen wir wegkommen? Er liegt auf über zweitausend Meter, da ist garantiert schon alles eingeschneit. Wir haben bald zwanzig Grad unter null.«
Hans Valentin lachte. Das war typisch Vincenzo. Er neigte zur Dramatik, was allerdings auch dem Umstand geschuldet war, dass ihn die unbändigen Kräfte der Natur von jeher faszinierten. »Vincenzo, es ist kaum kälter als minus fünf Grad, es kommt dir nur wegen des Sturms so eisig vor. Am Parkplatz haben wir höchstens Schneeregen, vor Mitternacht schneit es da nicht. Du kennst die Berge halt nur bei schönem Wetter.«
Hans behielt recht. Immer wieder riss die Wolkendecke für kurze Zeit auf, und der Schneefall ließ nach, bevor ein neuer Schauer Vincenzo vergessen ließ, dass nicht einmal Oktober war. Sie erreichten den Parkplatz mühelos nach drei Stunden. Dass Vincenzo noch keine Winterreifen auf seinem Alfa hatte aufziehen lassen, war unproblematisch, denn bei nasskalten drei Grad regnete es lediglich.
2
Bozen, Montag, 27. September
Fröstelnd blickte Vincenzo durch sein Bürofenster der Questura in Bozen auf die regennasse Largo Giovanni Palatucci. Als er heute Morgen um sieben Uhr in seiner Sarntheiner Wohnung aufgestanden war, hatte er seinen Augen kaum getraut. Wie von Hans auf der Rückfahrt vorausgesagt, waren alle Berge ringsum in ein weißes Kleid gehüllt, soweit sich das hinter den tief hängenden Wolkenmassen überhaupt erkennen ließ. Sarnthein lag zwar nur tausend Meter hoch, doch auch hier mischten sich dicke, nasse Schneeflocken unter den Dauerregen, und es war stockfinster. Trotz seiner bis zum Boden reichenden Panoramafenster musste er beim Frühstück das Licht einschalten.
Hans hatte ihm erklärt, dass es solche frühen Kälteeinbrüche in Zukunft häufiger geben würde, und es kämen wieder viel strengere Winter. Das hänge mit dem Golfstrom, mit ungewöhnlichen Blockadewetterlagen und mit rasch voranschreitenden Veränderungen in der Barents-Kara-See, einem Teil des arktischen Ozeans, zusammen. Der eigentliche Grund für all das sei paradoxerweise der vom Menschen verursachte Treibhauseffekt, der nun insgesamt die Durchschnittstemperatur auf der Erde erhöhe.
Vincenzo war umweltbewusst, er kannte die Gefahren des Klimawandels. Aber von dem, was sein Freund ihm erzählte, verstand er kaum ein Wort, obwohl Hans anschaulich erklären konnte. Die traurige Aussicht auf permanente Kälte schlug ihm jedenfalls aufs Gemüt. Was wurde dann aus seinen Bergwanderungen? Bräuchte er für jeden kleinen Gipfel einen Bergführer? Musste er in Sarnthein demnächst das ganze Jahr heizen? Er war so in seine Überlegungen vertieft, dass er das Klopfen an seiner Tür nicht wahrnahm.
Ohne eine Antwort abzuwarten, betrat Ispettore Guiseppe Marzoli Vincenzos Büro. Er setzte sich sogleich an den Besprechungstisch und musste voller Enttäuschung feststellen, dass die Etagere mit seinen heißgeliebten Cantuccini, die er erst am Freitag vollständig abgeräumt hatte, nicht frisch aufgefüllt war. »Haben Sie es schon gehört, Commissario?«
Marzolis Stimme riss Vincenzo aus seinen Gedanken. Er löste den Blick von den Pfützen und drehte sich langsam zu seinem Kollegen um. »Was soll ich gehört haben?«
»Der Feuerteufel hat zugeschlagen, gestern, in der Via Miramonti.«
Vincenzo verdrehte die Augen. »Nicht schon wieder. Was hat er sich denn diesmal ausgesucht?«
»Ein großes Gartenhaus. Mit viel Kaminholz drum herum. Die Hausbewohner haben Rauch gerochen und die Flammen in ihrem Garten gesehen. Sie haben sofort die Feuerwehr gerufen.«
Angefangen hatte es im Mai. Nichts weiter als eine brennende Tonne für Papierabfälle. Sie hatten es für einen Dummejungenstreich gehalten, ihnen wäre nicht in den Sinn gekommen, dass dies der Auftakt zu einer ganzen Serie von Brandstiftungen werden sollte. Das gestrige Feuer war der zehnte Anschlag. Nie wurde jemand verletzt, der finanzielle Schaden hielt sich zunächst in Grenzen. Mal brannte ein Holzstapel, mal eine Papiertonne, allzu intensiv wurde nicht ermittelt. Aber allmählich wurde er oder sie mutiger. Zuletzt hatte ein ganzer Lkw gebrannt, der Holztüren geladen hatte. Ein Gartenhaus passte zu diesem Entwicklungstrend.
»Wie immer gibt es reichlich Spuren, nehme ich an?«
Der Ispettore blickte verstohlen auf die Etagere. »Ja, Commissario, alles, was Sie wollen. Rückstände, Fingerabdrücke, Brandbeschleuniger. Ein Schlaraffenland für die Spurensicherung. Was uns nicht weiterbringt. Er findet sich nicht in unserer Kundenkartei.«
»Verrückt. Offenbar ein Spinner, der ein bisschen Gott spielen will. Hinterlässt für uns nutzlose Spuren, schlägt beliebig zu, hat keine bestimmte Brandmethode, keine speziellen Ziele, kein bevorzugtes Viertel. Keinerlei Muster, das ihn für uns berechenbar machen würde. Wie sollen wir den bloß je zu fassen kriegen?«
»Ich befürchte, Commissario, wir müssen darauf hoffen, dass ihn bei einem seiner Anschläge jemand sieht, dass ein Augenzeuge eine zuverlässige Täterbeschreibung geben kann.«
Vinzenco entging der traurige Blick seines Kollegen nicht, der immer noch keineswegs auf ihn, sondern auf die leere Etagere gerichtet war. Grinsend ging er zu seinem Schreibtisch, öffnete die unterste Schublade, die ausschließlich einem beachtlichen Vorrat an Cantuccini vorbehalten war, und füllte die Etagere bis zum Rand. »Inzwischen kenne ich Sie, Ispettore. Sobald Sie mein Büro betreten, gilt Ihr erster Gedanke nicht unserem Fall, sondern meinen ohne Frage überaus delikaten Cantuccini. Oder liege ich falsch?«
Marzoli grinste verlegen, was ihn nicht davon abhielt, sofort zuzugreifen. »Ich könnte mich da reinlegen, Commissario. Wissen Sie, seit ein paar Monaten hält mich meine Barbara auf Diät. Keinen Nachschlag mehr, erst recht nichts Süßes. Sie meint, ich wäre auseinandergegangen wie ein Hefekuchen. Finden Sie das auch?«
Eine gefährliche Situation.
»Ich möchte nicht zwischen die Fronten geraten, deshalb sage ich lieber gar nichts dazu. Mein Vorschlag: Schlagen Sie hemmungslos zu, also wie gewohnt. Erzählen Sie es zu Hause nicht. Ich verspreche Ihnen, Sie nicht zu verraten, wenn Sie mir dafür gelegentlich ein paar übrig lassen. Ich gehe derweil mal zu Reiterer. Vielleicht gibt es neue Spuren, die uns weiterbringen.«
Der Leiter der Spurensicherung saß an seinem Schreibtisch und hielt eine Espressotasse in die Höhe, die er verliebt ansah.
»Ciao, Signor Reiterer. Machen Sie Ihrer Tasse gerade einen Heiratsantrag?«
An der Tasse vorbei blickte Reiterer zu Vincenzo. »Reden Sie nicht so dummes Zeug, Commissario. Setzen Sie sich lieber und sehen Sie sich das an!«
Vincenzo nahm auf der anderen Seite des Schreibtisches Platz. Als er aufblickte, fuchtelte Reiterer schon mit der Tasse direkt vor seinen Augen herum.
»Sie behaupten doch, Sie verstünden etwas von feiner Lebensart, Bellini. Dann werden Sie mit Ihrem fachmännischen Blick gewiss erkennen, was das ist.«
Vincenzo hielt eine weiße Espressotasse in den Händen, die auf einer ovalen Untertasse stand. Der auffallend große, fast protzig wirkende Henkel der Tasse schloss passgenau mit dem Oval der Untertasse ab. »Nun, ich sehe eher ein avantgardistisches Kunstwerk als eine Tasse, Signor Reiterer. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich die Tasse auf die andere Seite drehe?« Vincenzo schob sie unter den entsetzten Blicken des Leiters der Spurensicherung im Zeitlupentempo so lange herum, bis ihr lang gezogener Henkel asymmetrisch mit der abgerundeten Seite der Untertasse abschloss. »Merkwürdig.«
»Bellini, Sie sind ein Banause, ist Ihnen das klar? Sie halten eine Originaltasse von Rosenthal in Ihren Patschhändchen. Aus der Coffee-Cult-Scoop-Serie. Drehen Sie die Tasse in die vorgesehene Position, Sie Kulturbarbar! Schätzen Sie!«
Vincenzo befolgte Reiterers unmissverständlichen Befehl und stellte die Harmonie der Formen zwischen Tasse und Untertasse wieder her. Keinesfalls wollte er den Leiter der Spurensicherung in seinem Kunstverständnis erschüttern. »Was soll ich schätzen?«
Reiterer verdrehte die Augen. »Was diese Pretiosen gekostet haben! Ich habe sie mir gleich im Sechserset gekauft.«
Vincenzo trank liebend gerne Espresso, mit den dazugehörigen Tassen kannte er sich allerdings überhaupt nicht aus. Er wagte einen Schuss ins Blaue. »Fünf Euro pro Tasse?«
Reiterer schien aufrichtig entsetzt. »Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Fünf lächerliche Euro? Für so ein Artefakt? Eine solche Meisterleistung klassisch-moderner Designkunst? Ich hoffe, dass ich mich verhört habe. Siebenundzwanzig Euro! Siebenundzwanzig!« Reiterer betonte jede Silbe dieser exorbitanten Summe einzeln. »Pro Set, wohlgemerkt. Konzilianterweise will ich Ihnen diesen Fauxpas nachsehen. Holen Sie sich einen Espresso aus meiner Maschine und testen Sie das einzigartige Trinkgefühl. Die Bohnen sind übrigens von Izzo, hundert Prozent Arabica Gold, versteht sich. Nichts anderes hat dieses Kunstwerk verdient. Folglich müssen Sie das zelebrieren. Danach haben Sie in Ihrem unterentwickelten Kunstverständnis einen Quantensprung vollzogen. Passen Sie bloß auf meine formvollendete Tasse auf, wehe, die fällt runter! Dann sind Ihre nächsten Gehälter verplant.«
Schmunzelnd füllte der Commissario seine Tasse. Reiterers schräger Humor, seine Schrulligkeit waren sein Markenzeichen. Sein Erscheinungsbild passte perfekt dazu. Er war Anfang fünfzig, groß, eher hager, hatte kurze graue Haare. Mit seinen blauen, ein wenig vorstehenden Augen sah er aus, als würde er sich ständig selbst persiflieren. Seine Fähigkeit zur Selbstironie war der Grund, warum sich kaum ein Kollege in der Questura von Reiterers Scherzen beleidigt fühlte. Als Vincenzo sich setzte und dabei die Tasse mit etlichen bewundernden Blicken würdigte, konnte er endlich sein eigentliches Anliegen zur Sprache bringen, den letzten Anschlag des Feuerteufels.
Mit dem Hinweis, dass er all das schon Marzoli erzählt habe, nahm Reiterer unter lautem Schlürfen und mit geschlossenen Augen einen kleinen Schluck Espresso. Vorsichtig stellte er die Tasse in der vorgegebenen Position ab. »Das Übliche, Commissario. Stümperhaftes Vorgehen, Fingerabdrücke, zweifelsohne ein Dilettant. Kommen wir zur Brandursache. Entsprechend meiner außergewöhnlichen Fähigkeiten, ohne die diese Questura schon längst dichtgemacht worden wäre, habe ich mich eines Analyseverfahrens bedient, das in Italien niemand außer mir beherrscht. Ich habe eine Gaschromatografie mit einer Massenspektroskopie kombiniert. Das Ergebnis meiner genialen Expertise ist gleichermaßen seltsam, verblüffend, einzigartig, faszinierend und was Ihnen sonst noch einfällt: C zwei H sechs O.«
Vincenzo starrte Reiterer an. »C was?«
»Wäre Zeit für die eine oder andere Fortbildung, Bellini, nicht wahr? C zwei H sechs O, oder laienhaft ausgedrückt: Alkohol, Spiritus, Weingeist, Ethanol.«
»Das ist alles?«
»Jawohl. Problemlos zu besorgen, kinderleicht in der Anwendung, billig wie beim Grillen.«
Reiterers breites Grinsen machte Vincenzo deutlich, dass er das heutige Wortgefecht verloren hatte. Wenigstens einen kleinen Seitenhieb musste er dem Leiter der Spurensicherung aber zum Abschied noch versetzen. »Vielen Dank, Signore, das bringt mich ungemein weiter, großartig.« Vincenzo grinste über das ganze Gesicht, deutete ein Klatschen an. »Eine abschließende Frage habe ich aber noch. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, mein lieber Reiterer. Kann es sein, dass Sie, nun, dass Sie etwas … etwas fülliger geworden sind?«
Ein Volltreffer, wie Reiterers wütendes Funkeln zeigte. »Dieses dämliche Ding! Haben Sie eine Ahnung, was ein anständiger Crosstrainer kostet? Fünftausend Euro habe ich dafür hingeblättert. Fünftausend! Ein Profigerät von Life Fitness. Kaum zwei Jahre genutzt, schon ist es hin. Seit vier Wochen warte ich auf diesen arroganten Kundendienst.«
Vincenzo empfahl Reiterer übergangsweise die eine oder andere Bergtour, aber der Experte für Espressotassen winkte ab. »Vergessen Sie’s. Unter zwanzig Grad friere ich, ab einundzwanzig Grad schwitze ich. Außerdem kann ich Mücken, Fliegen und was sonst noch draußen rumfliegt oder -kriecht auf den Tod nicht ausstehen.«
***
Forensische Psychiatrie
Mit hängenden Schultern schlich Eusebio Zabatino durch die verlassene Abteilung mit ihren nüchternen, kalten Gängen. Nicht einmal ein paar Bilder lockerten die abstoßende, feindliche Atmosphäre auf. Jeder Schritt hallte gespenstisch durch das triste Einheitsgrau. Putz bröckelte von den Wänden. Sie nutzten diesen Bereich nur noch für »Sonderfälle«, wie sein Chef es nannte. Die meisten Fachbereiche waren längst in die Räume der neuen Psychiatrie umgezogen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Gruselkabinett, das den perfekten Rahmen für Horrorfilme im Stil von »Freitag, der 13.« geboten hätte, unwiderruflich geschlossen wurde.
Die Umgebung entsprach Eusebio Zabatinos seelischem Zustand. Er war ein desillusionierter Mensch. Als er vor langer Zeit Medizin studiert hatte, war er noch voller Ziele gewesen, hatte Ideale. Er wollte kranken Menschen helfen, gesund zu werden, am liebsten als niedergelassener Arzt. Geld war für ihn zweitrangig. Im Laufe des Studiums musste er erkennen, dass er für diesen Beruf nicht geschaffen war. Er war zu weich, zu sensibel. Das körperliche Leid anderer Menschen belastete ihn, verfolgte ihn manchmal bis in seine Träume.
Einer seiner Professoren hatte ihm ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen bescheinigt und ihm geraten, sich in Richtung Psychologie oder Psychiatrie zu orientieren. Auch das erschien ihm als gute Möglichkeit, seine Ideale zu verfolgen. Oftmals waren seelische Erkrankungen viel schmerzhafter als die äußerlich sichtbaren oder im Blutbild nachweisbaren. Er beendete sein Studium mit guten Noten, war davon überzeugt, dass ihm nun die Welt offenstünde. Zweifelsohne musste er nur mit dem Finger schnippen, schon hatte er eine interessante Position an einer renommierten Klinik.
Er irrte sich. Zwei Jahre lang schrieb er vergeblich Bewerbungen, und mit jeder Absage sank sein Selbstwertgefühl. Wurde er tatsächlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, ließ ihn sein mangelndes Selbstbewusstsein scheitern. Als er die Hoffnung bereits aufgegeben hatte, kam unverhofft ein ehemaliger Kommilitone auf ihn zu und erzählte ihm, dass in der Forensischen Psychiatrie jemand befristet zur Aushilfe gesucht werde. Alles andere als ein Traumjob, aber immerhin ein Anfang. Er bekam die Stelle, ein Jahr später eine Festanstellung, machte schließlich den Facharzt für Psychiatrie. Wenn er geglaubt hatte, das sei endlich sein Sprungbrett für Höheres, hatte er sich erneut geirrt.
Sein ganzes Leben war er in derselben Abteilung geblieben und niemals aufgestiegen. Noch immer war er Assistenzarzt. Seine Patienten waren allesamt Kriminelle, genau die Klientel, mit der er eigentlich nichts zu tun haben wollte. Helfen wollte er solchen Leuten schon gar nicht. Egal, ob krank oder nicht, seiner Meinung nach gehörten Verbrecher in den Knast. Er fand es einfach nicht richtig, Menschen zu helfen, die anderen Leid zufügten. Das war ungerecht.
Der ganze Frust, all die Jahre des Scheiterns, hatten aus einem optimistischen, fröhlichen jungen Mann eine verhärmte Existenz gemacht. Längst hatte er aufgehört, auf sich zu achten. Das ergraute Haar fiel ihm in ungepflegten Locken ins Gesicht, das von nicht minder grauen Bartstoppeln übersät war. Er war mager, wog nur gut sechzig Kilo bei einer Größe von einem Meter fünfundachtzig. Schon lange hatte er keinen Appetit mehr, Essen war ein notwendiges Übel. Weil er sich zurückgezogen hatte, war er einsam geworden, eine zunehmende Menschenscheu war die Folge, alles andere als zuträglich für seinen Beruf. Er hatte nie geheiratet, keine seiner Freundinnen hatte es länger als ein halbes Jahr mit ihm ausgehalten. Sie ergriffen die Flucht vor seiner negativen Aura, seiner Missmutigkeit, die jeden Menschen vertrieb, der ihn längere Zeit um sich hatte. Seine letzte Beziehung lag nun fast vier Jahre zurück. Er ließ sich auf nichts mehr ein, weil er den Gedanken nicht ertragen konnte, dass er sowieso versagen würde. Freunde hatte er auch nicht. Nicht einmal Bekannte. Und seine Kollegen machten einen großen Bogen um ihn. Seit dem Tod seiner Eltern hatte er außer seinen Patienten keinerlei soziale Kontakte mehr.
Patienten? Nein, es war lediglich ein Patient.
Seine Miene hellte sich ein wenig auf. Er freute sich auf sein fast tägliches kleines Highlight, das ihn stets für kurze Zeit aus seiner Tristesse befreite. Er zog seine Codekarte für den Hochsicherheitstrakt durch den Scanner neben der Tür. Seit ungefähr einem Jahr hatte er diese »Sonderaufgabe«. Ein besonders schwerer Fall, ein Mörder ohne erkennbare Anzeichen von Reue, der längst die Grenzen zum Wahnsinn überschritten hatte. So zumindest hatte sein Chef, der dem Mann eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert hatte, ihn beschrieben. Weil Signor Eusebio Zabatino über ein so außergewöhnliches Einfühlungsvermögen verfüge, wäre es für ihn zweifellos eine besondere Herausforderung, sich, entbunden von allen anderen Aufgaben, ganz und gar diesem Patienten zu widmen. Keine versteckte Degradierung, im Gegenteil: »Ihre große Chance, Zabatino! Holen Sie den Kerl aus seiner schizophrenen Welt zurück. Vielleicht ist sogar eine Beförderung drin.«
Sein Chef war ein zynisches Arschloch. Er hasste ihn.
Und er war ein Dilettant. »Der Kerl«, wie der Chef ihn nannte, war nicht schizophren. Das war Zabatino schon nach wenigen Sitzungen klar geworden. Dieser Mann wusste genau, was er tat und wovon er sprach. Er war auch nicht wahnsinnig. Er gehörte nicht in die Psychiatrie, schon gar nicht in einen Hochsicherheitstrakt. Nichts deutete darauf hin, dass sein Chef ausnahmsweise richtig liegen könnte. Sein Patient hörte weder Stimmen noch stellte er sich als das große Genie dar, das nicht einmal Gott über sich hatte. Zerknirscht hatte er Zabatino erzählt, wie es zu den Morden gekommen war. Er bereute sie aus tiefster Seele.
Einem Eusebio Zabatino konnte er nichts vormachen. Er erkannte mit all seiner Erfahrung und Empathie, dass er einen Menschen vor sich hatte, der tief bereute, der seine Verbrechen nur zu gerne ungeschehen machen würde. Ein solcher Mann war nicht krank, er musste nicht behandelt werden. Neuroleptika gab er ihm deshalb schon lange nicht mehr.
Anfangs hatte ihm bei der Vorstellung, allein auf sich gestellt einen Mörder therapieren zu müssen, geradezu gegraut. Er hatte Angst gehabt, hatte seinen Patienten, den er noch gar nicht kannte, bereits gehasst. Schon allein für seine Taten. Aber allmählich erkannte er, dass hinter diesem Mörder ein Mensch steckte, der keineswegs eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellte. Er bedauerte seine Verfehlungen, hatte jedoch keine Lust, das Idioten wie Zabatinos Chef auf die Nase zu binden. Zu ihm, Eusebio Zabatino, hatte er schon nach kurzer Zeit Vertrauen gefasst.
Zabatino war angetan von der Vernunft seines Patienten. Er wich keiner Frage aus, war in allen Punkten offen, ehrlich, kooperativ. Zabatino freute sich zunehmend auf seine Visiten. Sie philosophierten oft miteinander, sein Patient zeigte reges Interesse und Anteilnahme an der Person seines Psychiaters, an seinem Werdegang. Jedes einzelne Detail wollte er wissen: Familie, Freunde, Wohnumfeld, Hobbys, was er am liebsten aß und trank … Niemals meckerte der Mann, er beschwerte sich nicht und aggressiv wurde er schon gar nicht. Wenn Zabatino es recht bedachte, war sein Patient der Einzige, dem er sich anvertrauen konnte. Manchmal fragte er sich, wer bei Lichte besehen eigentlich wen therapierte. Das war wahrhaftig verrückt.
Zabatino gab den vierstelligen Code für die schwere Stahltür zur Zelle seines Patienten ein. Er blickte in ein strahlendes Gesicht.
»Mensch, Eusebio, ich dachte schon, du kommst heute gar nicht mehr! Du bist mein einziger Kontakt zur Außenwelt. Dazu ein besonders liebenswerter. Ein echter Freund. Ohne dich wäre ich restlos aufgeschmissen. Danke übrigens für die leckere Erdbeertorte, die war echt klasse. Hätte nicht gedacht, dass ein alleinlebender Single so gut backen kann. Setz dich. Willst du mich zuerst ein bisschen therapieren, oder können wir gleich über interessantere Dinge reden?«
Zabatino fühlte sich leicht und unbeschwert. All sein Frust, seine Enttäuschung fielen von ihm ab, wenn auch nur für diese kurzen Augenblicke. Er setzte sich. »Bei dir gibt es nichts mehr zu therapieren. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass du so schnell wie möglich rauskommst. Obwohl ich mir damit selbst keinen Gefallen tue. Du warst mein einziger Lichtblick in dieser vergessenen, heruntergekommenen Abteilung. Ohne dich wird mein Leben noch trostloser.«
3
Ultental, St. Pankraz, Dienstag, 28. September
»Sie wollen das Haus tatsächlich für einen ganzen Monat buchen?«
»In der Tat, Signora, ich brauche für mein Projekt absolute Ruhe. Ein Hof im Ultental ist dafür perfekt geeignet.«
»Aha, was ist das denn für ein Projekt, wenn ich fragen darf, Herr, Herr …?« Was für ein komischer Kauz.
Mehr als vierzig Jahre lang hatte Maria Hofer mit ihrem Mann den Hof bewirtschaftet. Eine kleine Landwirtschaft, an die hundert Kühe auf den umliegenden Almen. Irgendwann waren die Kinder aus dem Haus. Keines, nicht einmal ihr Ältester, zeigte Interesse, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. So war das mit dieser Generation. Anstatt die Familientradition fortzuführen, zog es sie in die Städte. Sie wollten studieren, tolle Jobs, Geld, Karriere, Autos.
Vor sechs Jahren war ihr Mann nach einem Schlaganfall gestorben, und plötzlich war sie alleine mit ihrem Hof. Keines ihrer Kinder lebte in Südtirol. Sie konnte den Hof unmöglich allein bewirtschaften, von der Viehzucht ganz zu schweigen. Daher verkaufte sie alle Tiere, baute den Hof zu Ferienwohnungen, den alten Stall zu einem größeren Ferienhaus um. Sie schloss sich örtlichen Werbegemeinschaften an, ließ sich beim Tourismusbüro registrieren. Bald kamen genug Gäste, um sich über Wasser zu halten.
Dieser Gast allerdings war eine neue Erfahrung. Er stand vor ihr, hochgewachsen, breite Schultern, ein Gesicht wie gemeißelt, tiefe, männliche Stimme, und erzählte ihr, dass er gedenke, das Haus für einen Monat zu buchen. Mitten im Herbst, auf fast tausendvierhundert Meter Höhe. Er war ein Typ, der in Hochglanzbroschüren, in ein Pariser Modehaus oder gar nach Hollywood gepasst hätte. Aber nicht auf einen abgelegenen Hof im Ultental.
»Stadler, Frau Hofer, Alois Stadler. Aus München. Ich bin Schriftsteller. Ich schreibe Bücher und Bildbände über die Alpen. Dieses Jahr ist Südtirol an der Reihe. Es wird mehr als einen Band geben. Schließlich hat Ihre Heimat viel zu bieten. Die traumhafte Natur, eine vielfältige Kultur, ein traditionsreiches Brauchtum. Dazu die leidvolle Geschichte dieses Landes. Ich habe also viel zu tun, muss hier gründlich recherchieren. Insofern würde ich nicht ausschließen, dass ich Ihr Haus sogar länger benötige. Selbstverständlich werde ich eine adäquate Vorauszahlung leisten.«
Das war interessant. Jemand, der Reisebücher schrieb. Das passte auch zu ihm. Und es eröffnete interessante Perspektiven. Nicht allein finanziell, weil das Haus viel teurer war als die kleineren Wohnungen und nach frühen Wintereinbrüchen im Herbst nur selten vermietet werden konnte. Sein Projekt wäre auch eine erstklassige Werbung für ihren Ferienbetrieb. Sie musste ihn dazu bringen, dass er in seinen Büchern ihren Hof erwähnte. Idealerweise mit Fotos und schwärmerischen Hinweisen auf die herrliche Lage, die herzliche Gastfreundschaft … Genau darauf kam es an.
»Das klingt spannend, Herr Stadler. Kommen Sie doch rein, Sie holen sich ja den Tod, wenn Sie noch länger in Ihrem dünnen Hemd im Schneetreiben rumstehen. Ich mache Ihnen einen schönen heißen Tee, und dann besprechen wir alles. Sie können das Haus gerne haben. Wenn Sie es für so lange Zeit und in der Nebensaison buchen, komme ich Ihnen im Preis natürlich entgegen. Um diese Zeit ist es schon recht ruhig, aber Sie können sich nicht vorstellen, was im Sommer los ist. Mein Hof ist inzwischen ein echter Geheimtipp, wissen Sie.«
4
Bozen, Donnerstag, 30.September
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























