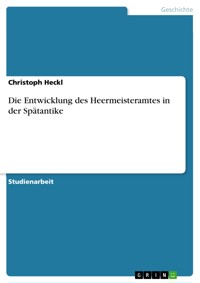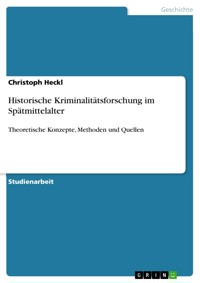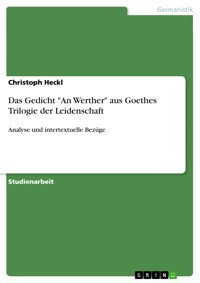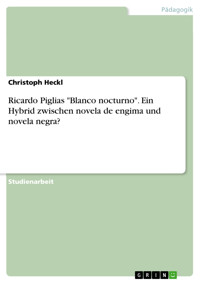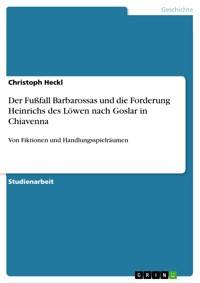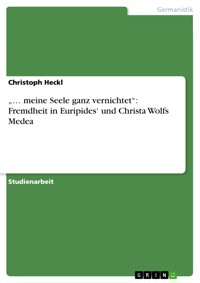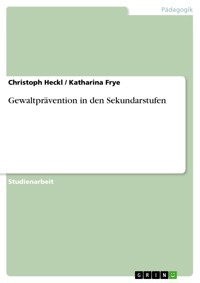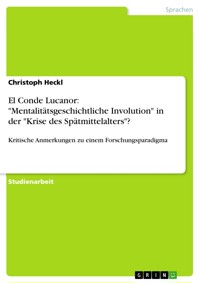
El Conde Lucanor: "Mentalitätsgeschichtliche Involution" in der "Krise des Spätmittelalters"? E-Book
Christoph Heckl
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Romanistik - Hispanistik, Note: 1,0, Universität zu Köln (Romanisches Seminar), Veranstaltung: Literarische Gattungen des spanischen Mittelalters, Sprache: Deutsch, Abstract: In der vorliegenden Arbeit wird es nicht darum gehen, eines oder mehrere Exempel aus dem „Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio” zu analysieren. Die Forschung zu den einzelnen Exempla ist Legion. Stattdessen soll jenes „Werk der Weltliteratur“ des kastilischen Hochadeligen don Juan Manuel, das nach José Manuel Blecua dessen „obra mas importante“ darstellt, unter einer anderen Fragestellung gelesen werden. Denn die Literaturwissenschaft ist, was die Beurteilung dieses opus des Neffen Alfons X. anlangt, verblüffend zwiegespalten. Weite Teile der Forschung sehen in der Sammlung typisch ‚mittelalterliche‘, ja nachgerade rückwärtsgewandte Elemente verwirklicht. Der Conde Lucanor wird in dieser Perspektive vor der Folie der „kastilischen Krise“ in den letzten Regierungsjahren Alfons des Weisen gelesen: Der Kollaps der königlichen Herrschaft habe im Verlauf weniger Jahre den „Horizont des ‚dunklen Spätmittelalters‘“ heraufziehen lassen. Verglichen mit dem Corpus Alfonsinum erscheint Gumbrecht der Conde Lucanor als „ein Symptom mentalitätsgeschichtlicher Involution“. Ich habe mich ob der vergleichsweise harschen Wortwahl dazu angeregt gesehen, die Argumentation Gumbrechts näher in den Blick zu nehmen. Ausgehend von dessen Bewertung wird daher in dieser Arbeit zunächst der entstehungsgeschichtliche Hintergrund, wie ihn Gumbrecht entwirft, untersucht werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit das Paradigma eines krisenhaften und ‚dunklen‘ 14. Jahrhunderts gerechtfertigt ist; denn von einer solchen Auffassung scheint Gumbrechts Bewertung des Conde Lucanor sowie weiterer, im Umfeld des kastilischen Königshofes in manuelinischer Zeit entstandener Literatur maßgeblich abhängig zu sein. Anschließend wird ein weiteres omnipräsentes Forschungsparadigma problematisiert, wonach der Conde Lucanor ein dezidiert didaktischer Text sei und keinerlei Ambiguität aufweise. Unter Rückgriff auf neuere Forschungsliteratur wird argumentiert werden, dass der Text nicht nur nicht ausschließlich didaktisch ist, sondern das – möglicherweise an der Intention des Autors vorbei laufende – Potential auf alternative Lektüren bietet. Darüber hinaus sollen einige Aspekte in den Vordergrund gerückt werden, die durchaus modern und nicht ‚typisch mittelalterlich’ oder gar rückwärtsgewandt anmuten: so etwa die Rolle, die der Text dem Leser zuweist, das Selbstverständnis Juan Manuels als Autor und die iim Text greifbare Neubewertung menschlichen Erfahrungswissens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
Einleitung
1. Im Schatten des Spätmittelalters? Kastilien im 14. Jahrhundert
1.1 Die „Krise“ des Spätmittelalters
1.2 Soziale Spannungen im Kastilien des 14. Jahrhunderts
1.3 Die Folgen der „Krise“: kultureller Niedergang oder literarische Produktivität?
2. El Conde Lucanor
2.1 …“transparently didactic and completely untroubled by ambiguity”?
2.2 Der Leser als Hermeneut
2.3 Der Autor als Individuum
2.4 Neubewertung individuellen Erfahrungswissens
Resümee
Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen
Literatur
Einleitung
In der vorliegenden Hausarbeit wird es nicht darum gehen, eines oder mehrere Exempel aus dem „Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio” zu analysieren. Die Forschung zu den einzelnen Exempla der Exempelsammlung[1], die besser bekannt ist unter dem Kurztitel „El Conde Lucanor“[2], ist Legion. Stattdessen soll jenes „Werk der Weltliteratur“[3] (Dank Josef Eichendorffs Übersetzung auch der deutschen Literatur)[4] des kastilischen Hochadeligen don Juan Manuel, das nach José Manuel Blecua dessen „obra mas importante“[5] darstellt, unter einer anderen Fragestellung gelesen werden. Denn die Literaturwissenschaft ist, was die Beurteilung dieses opus des Neffen Alfons X. anlangt, verblüffend zwiegespalten. Weite Teile der Forschung sehen in der Sammlung typisch ‚mittelalterliche‘, ja nachgerade rückwärtsgewandte Elemente verwirklicht.[6] Eine repräsentative Rolle innerhalb dieses Forschungsstranges nimmt dabei die bekannte und umfassende Literaturgeschichte von Hans Ulrich Gumbrecht ein.[7] Dieser interpretiert den Conde Lucanor vor der Folie der „kastilischen Krise“ in den letzten Regierungsjahren Alfons des Weisen: Der Kollaps der königlichen Herrschaft habe im Verlauf weniger Jahre den „Horizont des ‚dunklen Spätmittelalters‘“ heraufziehen lassen[8]. Verglichen mit dem Corpus Alfonsinum erscheint ihm der Conde Lucanor sodann als „ein Symptom mentalitätsgeschichtlicher Involution“[9]. Der Verfasser der vorliegenden Arbeit hat sich ob der vergleichsweise harschen Wortwahl dazu angeregt gesehen, die Argumentation Gumbrechts näher in den Blick zu nehmen.
Ausgehend von dessen Bewertung wird daher in dieser Arbeit zunächst der entstehungsgeschichtliche Hintergrund, wie ihn Gumbrecht entwirft, untersucht werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit das Paradigma eines krisenhaften und ‚dunklen‘ 14. Jahrhunderts – in Europa und dann speziell in Kastilien – gerechtfertigt ist; denn von einer solchen Auffassung scheint Gumbrechts Bewertung des Conde Lucanor sowie weiterer, im Umfeld des kastilischen Königshofes in manuelinischer Zeit entstandener Literatur maßgeblich abhängig zu sein.
In einem zweiten Schritt wird ein weiteres omnipräsentes Forschungsparadigma problematisiert, wonach der Conde Lucanor ein völlig transparent didaktischer Text sei und – vor allem im Gegensatz zum Libro de buen amor – keinerlei Potential auf Ambiguität besitze. Unter Rückgriff auf neuere Forschungsliteratur wird argumentiert werden, dass der Text nicht nur nicht ausschließlich didaktisch ist, sondern das – möglicherweise an der Intention des Autors vorbei laufende – Potential auf alternative Lektüren bietet. Darüber hinaus sollen einige Aspekte in den Vordergrund gerückt werden, die durchaus modern und nicht ‚typisch mittelalterlich’ oder gar rückwärtsgewandt anmuten: so etwa die Rolle, die der Text dem Leser zuweist, das Selbstverständnis Juan Manuels als Autor und die im Text greifbare Neubewertung menschlichen Erfahrungswissens.
1. Im Schatten des Spätmittelalters? Kastilien im 14. Jahrhundert
Im Folgenden soll zunächst Gumbrechts Argumentation des plötzlich einbrechenden „dunklen Spätmittelalters“ in Kastilien nachvollzogen werden, wozu eine kurze Einordnung in den historischen Kontext nötig ist: Das Königreich Kastilien ist beginnend vom Ende des 13. Jahrhunderts an und noch das ganze 14. Jahrhundert hindurch beherrscht von Erbfolgestreitigkeiten. Der erste Sohn Alfons X. des Weisen, Fernando de la Cerda, war 1275 auf einem Feldzug gegen die Mauren gefallen. Dessen Sohn war von Alfons nach den gültigen Erbfolgeregeln zum Nachfolger ernannt worden. Kastilische Adelsgruppen aber kürten den späteren Sancho IV. zum Thronfolger. Die letzten Lebensjahre bis zu seinem Tod im Jahre 1284 war Alfons X. gezwungen, gegen seinen eigenen Sohn und mit diesem verbündete rebellische Vasallen Krieg zu führen.[10]
Die Intervention des Adels und die damit beginnenden kriegerischen Auseinandersetzungen markieren für Gumbrecht das „abrupt[e]“ Ende einer Zeit kultureller Blüte. Im Verlauf weniger Jahre sei der „Horizont des ‚dunklen Spätmittelalters‘ heraufgezogen“.[11] An die Stelle einer vernunftbezogenen Erkenntnis der Schöpfung Gottes sei die „Angst vor einer nun nicht mehr allein von Heiden, sonder auch von Teufeln bewohnten Welt“ getreten.[12] Ausweg habe man in „dem zum ‚magischen Gegenzauber‘ degenerierte[n] Sakramentenempfang“ gesucht, was Gumbrecht in der Hervorhebung ritueller Formalitäten in den Castigos e documentosdel Rey Don Sancho zu belegen sucht[13].
Als weitere Quelle für den „Umschlag des intellektuellen Horizonts Kastiliens ins ‚dunkle Mittelalters‘ führt Gumbrecht den Lucidario aus der Schreibstube Sanchos IV. an, der die Unfähigkeit erweise, „die materielle und die geistige Welt, die diesseitigen Erfahrungen und die göttliche Offenbarung im Denken auseinander zu halten“.[14] Im Folgenden soll zu dieser Argumentation Stellung bezogen werden.
1.1 Die „Krise“ des Spätmittelalters
Gleich zu Beginn ist bei Gumbrecht die Rede von den Auswirkungen der „Krise des Spätmittelalters auf der iberischen Halbinsel“, womit die eben erwähnten politischen Querelen zwischen Königvater, Sohn-Usurpator und den (mit)rebellierenden Vasallen gemeint sind, die sogleich den sich literarisch entsprechend manifestierenden „Horizont des ‚dunklen Spätmittelalters‘“ evoziert haben sollen.[15] Die Krise auf der iberischen Halbinsel wird also zunächst identifiziert als Manifestation einer europäischen spätmittelalterlichen Krise.
Das Paradigma einer „Krise des Spätmittelalters“ ist im 20. Jahrhundert zu einem vielzitierten Begriff in der historischen Forschung und benachbarten Disziplinen geworden. Nun muss allerdings eine solche Formulierung spätestens seit Peter Schusters einschlägigem Aufsatz zu diesem Phänomen aufhorchen lassen.[16] Dieser betont, dass es zu dieser Krise, anders als zahlreiche Publikationen vermuten lassen, in denen der Begriff rege und mitunter bedenklich unreflektierte Anwendung findet, „eine communis opinio in der Mediävistik nicht gibt und wohl auch nie gegeben hat“[17]. In diesem Sinne gestand auch Erich Meuthen, ein ausgewiesener Kenner der Epoche, freimütig ein, dass er nicht recht wisse, was die Krise des Spätmittelalters eigentlich sei.[18] Schuster endet seinen Beitrag mit dem Fazit, dass die „Krise des Spätmittelalters (…) eine Imagination des 20. Jahrhunderts“ sei, „das in einen ‚fernen Spiegel‘ zu schauen versucht hat und sich dort allenfalls schemenhaft selbst zu erkennen vermochte“[19].
Problematisch ist vor allem, dass es dem Begriff der ‚Krise‘ an Präzision ermangelt. Anders als es landläufiger und kolloquialer Gebrauch nahezulegen scheinen, beinhaltet der Krisenbegriff eine weitere, oftmals unterschlagene Dimension, was die Ausführungen Ferdinand Seibts zeigen. Ihm zufolge sei die „Lage missverstanden wenn man, wie im Alltag oft, ‚Krise‘ als ‚Niedergang‘ deutet. Krise ist Wendezeit, Entscheidungsphase, vielleicht Neuaufbruch und Umkehr, Instabilität, aber nicht notwendig ‚Verfall‘“[20]. Qualitativ kann Krise also etwas sehr vitales und produktives sein, wenn sie den Aufschwung einleitet. Und in Opposition etwa zu Johan Huizinga[21] wird das Spätmittelalter von einigen Historikern durchaus nicht als generell absterbende Epoche gewertet, sondern als Übergangsepoche zwischen Mittelalter und Neuzeit.[22]
1.2 Soziale Spannungen im Kastilien des 14. Jahrhunderts
Die Krise in Kastilien, auf die Gumbrecht Bezug nimmt, äußert sich darin, dass der Adel in direkter militärischer Auseinandersetzung mit dem König versucht, Kontrolle über Teile seiner Macht zu gewinnen. Dies ist im Wesentlichen ein Kampf um ökonomische Interessen, der andauert bis die ‚reyes católicos‘ an die Macht gelangen.[23] Leidtragende solcher Auseinandersetzungen war, wie fast immer im Mittelalter, die landsässige Bevölkerung. Julio Valdeón Baruque zeichnet davon ein beredtes Bild:
“Los nobles tenían a su alcance el recurso a la violencia, procediendo a requisas arbitrarias o al puro bandolerismo (...) La violencia ejercida (...) sobre los grupos desamparados de campesions que continúa durante la primera mitad del siglo XIV, y a ella no fue ajeno, ni mucho menos, Don Juan Manuel.”[24]
Doch muss man sich fragen, ob dies in methodischer Hinsicht die alleinigen Indikatoren sein können, anhand derer ein bestimmter Zeitablauf mit einem so abstrakten bzw. problematischen Begriff wie ‚Krise‘ zu rubrizieren wäre, oder ob dies nicht zu einem impliziten Reduktionismus führt. Denn ähnlich wie in Italien und im Reich lässt sich auch in Kastilien ein dynamischer Wandel beobachten, der mit den genannten ‚Krisenerscheinungen‘ eng verknüpft ist. In nicht wenigen Bereichen hält der Aufschwung unvermindert an oder setzt neu ein[25]: So lässt sich etwa unter dem Aspekt des Spannungsverhältnisses von persönlicher Freiheit und ständischer Unterdrückung etliches an historischer Weiterentwicklung in dieser Zeit ausmachen. Julio Rodríguez-Puértolas weist darauf hin, dass ein Resultat der Machtkämpfe des Adels – und auch des seit 1348/49 grassierenden schwarzen Todes – darin besteht, dass die traditionellen Agrarstrukturen ins Wanken kommen und damit zugleich die Grundlagen des mittelalterlichen Feudalsystems.[26] Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften, der deren Arbeitskraft aufwertet, ermöglicht es sozial benachteiligten Schichten, ihre Stellung zu verbessern. Beispiele sind z.B. das Ordenamiento von Valladolid (1325), in dem Bauern geschützt wurden, die die Ländereien ihrer Herren verlassen hatten, oder – ganz ähnlich – das Ordenamiento von Alcalá aus dem Jahr 1348. Die Bauern konnten, die veränderte Situation für sich ausnutzend, bisher unerhörte Forderungen darbringen.[27] Die Schwächung der Zentralgewalt des Königtums zugunsten des Adels und die Umwälzung des Feudalsystems begünstigte zudem das Entstehen neuer Machtgruppen, wie etwa des Bürgertums in den Städten. Diese sind im späten Mittelalter die Keimzellen protomoderner Staatlichkeit.[28]
Hier klingt die Krise im Sinne von Ferdinand Seibt als „Wendezeit“ und „Neuaufbruch“ an. Es handelt sich daher nicht nur, mit Jonathan Burgoyne ausgedrückt, um „a period of extraordinary political and social unrest in which Castilla experienced the erosion of its social institutions”, sondern eben auch um “increased urbanization, the emergence of a middle class, and a growing dependency on a monied economy”[29]. Ohne Zweifel hatten diese Faktoren einen “profound impact on the aristocracy’s role in society, especially during the second decade of the fourteenth century”[30]. Dies habe, so weite Teile der Forschung, Juan Manuel dazu bewegt, in seinen Geschichten die Tradition und Autorität einer Standesideologie evozieren, um die soziale Stabilität literarisch zu fixieren und die Identität des Adels in einer Zeit sozialer und politischer Destabilisierung zu wahren.[31] Doch sollte, selbst wenn man eine solche Standesideologie konzediert, in der wissenschaftlichen Betrachtung eine Engführung auf allein solche Aspekte vermieden werden. Doch soll darauf im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit zurückzukommen sein. In Kapitel 1.3 soll zunächst die Argumentation Gumbrechts aufgegriffen werden, der aus der politischen Krise in Kastilien eine darauf folgende kulturelle ausmacht.
1.3 Die Folgen der „Krise“: kultureller Niedergang oder literarische Produktivität?
Als Spiegel der realpolitisch turbulenten Verhältnisse sei nun, Gumbrecht zufolge, an die Stelle der in alfonsinischer Zeit vorherrschenden vernunftbezogenen Erkenntnis der Schöpfung Gottes die „Angst vor einer nun nicht mehr allein von Heiden, sonder auch von Teufeln bewohnten Welt“ getreten, die eine ganz neue Faszination von „Teufeln und den Schreckensvisionen des Jüngsten Gerichts, von Engeln und der den Menschen Schutz gewährenden Jungfrau Maria“ – abzulesen an den Castigos e documentos sowie dem Lucidario Sanchos IV. – begründet habe.[32]
Insbesondere der Lucidario, welcher als pars pro toto für den „Umschlag des intellektuellen Horizonts Kastiliens ins ‚dunkle Mittelalters‘“ fungiert, erweise die Unfähigkeit, „die materielle und die geistige Welt, die diesseitigen Erfahrungen und die göttliche Offenbarung im Denken auseinander zu halten“.[33] Belegen sollen dies quaestiones, die von Gumbrecht aus dem Lucidario zitiert werden, wie etwa „XIX. Como pudo santa Maria fincar virgen despues del parto…“.[34] Dieser hier konstatierte, relativ sprunghaft anmutende Wechsel in der Anschauung, die in der Forschung – oftmals wenig reflektiert – unter den schillernden Begriff der Mentalität gefasst wird[35], wird also in der Argumentation des Autors maßgeblich aufgezogen an zwei Quellen. Wenn hier zwar die prinzipielle Crux des mentalitätsgeschichtlich orientierten Historikers zum Tragen kommt, der Mentalität als ein weitgehend kollektives Phänomen beinahe ausschließlich aus individuellen Zeugnissen erschließen kann,[36] so muss es jedoch umso wichtiger sein, die auszumachenden Phänomene genau zu betrachten.
Aus religiöser Perspektive ist die von Gumbrecht ausgemachte quaestio zunächst einmal keine unwichtige. Legt man ein mittelalterliches enges, eben wörtliches biblisches Textverständnis zugrunde, dann ist es nur folgerichtig, sich daraus ergebende problematische, weil metaphysische Phänomene – wie etwa das einer jungfräulichen Geburt – erklären zu wollen/müssen. Was man (auch) hier beobachten kann, ist die theologische Grundlegung der mittelalterlichen Scholastik für eine Versöhnung des Glaubens mit dem Verstand und dem menschlichen Wissen. Und man sollte nicht vergessen, dass bis heute ja christliche Theologen in Fragen – etwa des Abendmahls – kleinmütig miteinander hadern, in denen es letztlich auch nur um eine Auseinandersetzung um eine textnahe oder eher weitere Auslegung des biblischen Textes geht.
Wer im Übrigen Texte wie diesen schlicht als „kindliche Buchstäblichkeit“[37] abtut, der müsste weiter gehen und weite Teile der Scholastik so betiteln. Denn für unbestritten große mittelalterliche scholastische Denker wie etwa Thomas von Aquin, der sich mit Erkenntnistheorie, Problemen der Ethik oder Gottesbeweisen auseinandergesetzt hat, ist die geographische Lage des Paradieses oder die schmerzlose Geburt der Jungfrau Maria ein ebenso erklärungsbedürftiges Anliegen, das von ihm entsprechend behandelt wird.[38] Seine Summa theologica wird deswegen weniger als typisch „dunkel“, sondern vielmehr als typisch scholastisch anzusehen sein.
Besieht man das Argument genauer, wonach eine Unfähigkeit zu Tage trete, in gelehrten Schriften nicht mehr zwischen Geistlichem und Weltlichem zu trennen, was Ausweis einer nunmehr nur noch dunklen, verkümmerten Intellektualität in Kastilien sein soll, so muss doch eingeräumt werden, dass im theozentrischen Weltbild des gesamten europäischen Mittelalters, und nicht nur in Kastilien, Wissenschaft fast immer aufs Engste verknüpft ist mit der Theologie. So ist etwa Geschichtsschreibung bis zum Ausgang des Mittelalters immer in eine christliche Heilsgeschichte verwoben und eben auch gar nicht anders zu denken. Einem mittelalterlichen Autor, der ja fast immer dem Klerus entstammt, eine fehlende Trennung von Diesseits und Jenseits vorzuhalten, läuft daher ins Leere.
In der Forschung gibt es im Übrigen auch anders lautende Bewertungen des Lucidario. In einem neueren Beitrag von Ana M. Montero Moreno wird der bei Gumbrecht als ein Beispiel des intellektuellen Umschlags ins „dunkle Mittelalter“ figurierende Text etwa als ein „documento clave, una ‚piedra miliaria‘ en la historia del pensamiento“ bezeichnet.[39] Angestrebt werde darin „la difícil sintonización entre la sagrada escritura (...) y las ciencias (Aristóteles)”. Speziell die Auseinandersetzung mit den neuentdeckten naturphilosophischen Schriften des Aristoteles steht im Lucidario viel eher im Vordergrund als noch im alfonsinischen Werk.[40]
Ein weiterer theoretischer Ansatz Gumbrechts ließe sich in diesem Kontext diskutieren. Wenn dieser schreibt, dass „wir uns hüten [müssen], jegliches Erscheinen neuer Themenbereiche in der Überlieferung als Symptom für die Orientierungslosigkeit, die ‚Selektionsschwäche‘ einer in die Krise geratenen Gesellschaft zu sehen“[41], dann ist dem zwar zunächst zustimmen. Doch wird mit dieser Formulierung über die Betonung „jegliches“ gleichzeitig insinuiert, dass eben nicht jegliches, aber scheinbar doch prinzipiell das Erscheinen neuer Themenbereiche ein Indiz für die Orientierungslosigkeit und Selektionsschwäche einer Gesellschaft darstelle. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit literarische Neuansätze in der Überlieferung unabhängig von materiellen Literaturproduktionsmöglichkeiten überhaupt als ein Symptom für die Orientierungslosigkeit einer Gemeinschaft angesehen werden können oder sollten. Für Gumbrecht scheint zu gelten, dass anspruchsvolle und fortschrittliche Literatur nur in einer gefestigten Gesellschaft, in diesem Fall der kastilischen in der alfonsinischen Ära geschrieben werden kann. Der durch die „spielerischen Spekulationen im Umgang mit kosmologischem Wissen“ literarische Zenit des Corpus Alfonsinum wird direkt zurückgeführt auf die stabile Verfassung der kastilischen Gesellschaft unter Alfons X. und die enge Zusammenarbeit von Kirche und Krone. Soziale Turbulenzen sind dann die Erklärung für die „literarische Involution“ mit dem als „epigonal“ abgetanen Werk Juan Manuels.[42] Dass aber eine solche kausale Rückführung unter Umständen fehlgehen kann, ja dass ‚hochwertige‘ Literatur auch in einer ‚Krisenzeit‘ entstehen kann bzw. dass mit Krisenerfahrung völlig unterschiedlich umgegangen wird,[43] zeigt ein einfaches Beispiel: das bekannteste und mit großem Konsens als in vielerlei Hinsicht ‚modern‘ anmutende Hauptwerk von Boccaccio, der Decameron, ist fast zur gleichen (Krisen-)Zeit entstanden wie der Conde Lucanor. Offensichtlich scheint aber Boccaccio in seiner literarischen Schöpfung, die gemeinhin als „epochaler Einschnitt im Bereich der Kurzerzählungen auf der Wende zwischen Mittelalter und früher Neuzeit“[44] angesehen wird, einen gänzlich anderen Weg zu gehen als Don Juan Manuel mit seinem Conde Lucanor.[45]
Die Ausgangsfrage, ob die Folge der kastilischen ‚Krise’ tatsächlich ein kultureller Niedergang war, soll hier mit einem Zitat von Jonathan Burgoyne beantwortet werden. Dieser weist in seiner Monographie zum Conde Lucanor die These einer literarischen Verkümmerung entschieden zurück: “(…) the time of Sancho IV’s reign, and well into the first half of the fourteenth century, was not the cultural wasteland that many historians believe. On the contrary it witnessed the production of many important works of Spanish medieval literature.”[46]
2. El Conde Lucanor
Im zweiten Teil der Arbeit soll nun der Conde Lucanor selbst näher in den Blickpunkt gerückt werden. Das Werk besteht aus fünf Büchern: Buch I beinhaltet 50 Exempel[47], die Bücher II, III und IV Sentenzen und das fünfte Buch ein tratado doctrinal.[48] Immer noch einschlägig ist die Monographie von Daniel Devoto, die Quellenstudien zu den einzelnen Exempla bietet, welche u.a. Querverweise auf viele andere mittelalterliche Exempel-Sammlungen zulassen.[49] Neuere Forschungsliteratur und weitere kritische Editionen finden sich verzeichnet z. B. in der Edition von Guillermo Serés[50] oder der aktuellen Monographie von Jonathan Burgoyne[51].
Die Stoffe derer sich der kastilische Adlige in seinen enxiemplos bedient, stellten wohl populäres Erzählgut dar.[52] Mittelalterliche Erzählsammlungen, die zur Zeit Juan Manuels, kurz vor ihm oder unmittelbar danach in lateinischer und/oder spanischer Sprache zirkulierten, weisen viele der von ihm bearbeiteten Stoffe als Gemeingut aus. Die Zeitgenossen dürften die „relatos, sentencias, normas morales y símiles, que don Juan usa como materia propia“ daher oft gehört oder gelesen haben.[53]
Die Anordnung der Geschichten folgt keiner erkennbaren systematischen Ordnung. Die Exempel mit ihren praktischen, d. h. ökonomischen, politischen sowie psychologischen Lebensproblemen tauchen zufällig auf. Betroffen ist stets Graf Lucanor, der zur Lösung seines Problems den Ratschlag seines consegero Patronio einholt. Dessen Antwort besteht nie aus einem unmittelbaren Problemlösungsvorschlag, sondern aus gleichnishaften Beispielen und Fabeln, also „indirekten Sprechakten“. Dem Ratgeber bleibt so die die autoritäre Lehrerrolle und dem Beratenen „seelischer ‚Widerstand‘“ erspart.[54]
Wen Juan Manuel als Rezipienten seines Werkes anvisiert hat, ließe sich diskutieren. Der Autor selbst adressiert in seinem Prolog ausdrücklich jene „que non fuessen muy letrados nin muy sabidores“.[55] Für Albert Gier und John Esten Keller sei mit dem Buch ausschließlich ein adliger Freundes- und Verwandtenkreis, der am kastilischen Hof mit der Erziehung junger Fürsten betraut gewesen sei, angesprochen gewesen.[56] Mit der geistigen Erziehung der Prinzen war jedoch in der Regel die intellektuelle Elite in Person gelehrter Kleriker betraut. Dass Juan Manuel sich jedoch gegen die lateinische Sprache und für die Volkssprache entscheidet, spricht meines Erachtens nicht für einen Fokus auf diese Personengruppe.
Die in dieser Arbeit vorgenommene Konzentration auf den ersten Teil des Conde Lucanors spiegelt gewissermaßen auch die Wirkungsgeschichte des Werkes, in der das Libro de los enxiemplos mit fünf überlieferten Handschriften und einem Druck aus dem Jahr 1575 den prominentesten Raum eingenommen hat.[57] Im Folgenden soll ein für die Bewertung des Werkes gewichtiger Aspekt in den Fokus gerückt werden: das Potential des Textes „Ambiguität“ aufzuweisen. Sodann sollen die sich aus dem Text ergebenden Rollenzuweisungen an den Leser und das Selbstverständnis des Autors untersucht werden. In einem weiteren Punkt soll die in Juan Manuels Werk aufscheinende Neubewertung menschlichen und individuellen Erfahrungswissens herausgestellt werden.
2.1 …“transparently didactic and completely untroubled by ambiguity”?
Bei der Betrachtung der fachwissenschaftlichen Publikationen zum Conde Lucanor sticht ein quasi omnipräsentes Paradigma heraus, auf das sich die Forschung lange Zeit kapriziert hat. María Rosa Menocal fasst dieses in einem Aufsatz zur “openness” im Conde Lucanor treffend zusammen: das Werk werde gesehen als „transparantly didactic, completely untroubled by ambiguity or contradiction, and essentially referential to Juan Manuel’s political life experiences and culture“[58]. Die Exempelsammlung des kastilischen Adligen wurde in diesem Sinne häufig als in einer „oposición simplista“ stehend zu einem anderen literarischen Erzeugnis der Zeit, dem Libro de buen Amor von Juan Ruiz, gesehen.[59] Das Libro de buen amor zeichne sich dadurch aus, „ambiguo, múltiple e inestable“ zu sein, während der Conde Lucanor dazu geradezu einen Gegenpol darstelle.[60] Da die Literaturgeschichtsschreibung die spielerische Polysemie eines Textes als wichtiges ‚Qualitätsmerkmal‘ ansieht, fiel die Bewertung des Conde Lucanor, von der Forschung insbesondere in dieser gleichsam binären Konstellation betrachtet, abgesehen von einigen Ausnahmen eher negativ aus. Gumbrechts Beurteilung des Textes als „ein Symptom mentalitätsgeschichtlicher Involution“[61] kann hier als ein Paradebeispiel gelten.
Dieser generelle Konsens der Forschung ist jedoch vor einiger Zeit aufgebrochen worden unter anderem durch Beiträge der amerikanischen Literaturwissenschaftler Laurence de Looze sowie Jonathan Burgoyne.[62] De Looze argumentiert unter Rückgriff auf möglicherweise im Prolog verwirklichte augustinische Zeichentheorie, dass sich auf einer tieferen Ebene – und unabhängig von rhetorisch motivierten Elementen – zeigt, dass auch die Ratschläge, die in Form von Exempeln und Fabeln transportiert werden, den Leser letztlich allein lassen in einem Zeichensystem, in dem nichts ist, wie es scheint und dessen Wahrheit – Superhermeneut Patronio ausgenommen – für niemanden erkennbar ist.[63] Die Formulierung Burgoynes fasst den prekären Sinngehalt des Werkes zusammen: “What the reader encounters in Part I of the Conde Lucanor is a discursive array of symbolic actions that often collide with each other, creating tension, ambiguity, and antinomy”[64]. Der Sinn stehe nicht für sich, sondern wird erst im Interpretationsakt durch den Leser konstruiert.[65]
Die Idee, dass der Leser entscheiden muss, wie der Text umzusetzen ist, konfundiert den didaktischen Anspruch der Sammlung, indem sie die exklusive Autorität Patronios und Don Juans, jedes einzelne ejemplo zu interpretieren, unterminiert.[66] So lassen sich die Texte durchaus nicht nur in der Lesart verstehen, wie etwa das proverbio am Ende der Geschichte nahelegt. Der Leser wird, wie Jonathan Burgoyne argumentiert, mit einem „discursive array of symbolic actions“ konfrontiert, die häufig widersprüchlich sind, was „tension, ambiguity, and antinomy“ erzeuge und den Leser dazu zwingt, seinen eigenen „critical act of reading“ vorzunehmen.[67] Ian Macpherson hat etwa in exemplo quinto das Potential für eine alternative Lektüre des Texts ausgemacht, die eine andere Botschaft kommuniziert als jene, die in dem proverbio am Ende der Geschichte transportiert wird. Das ejemplo, dem die äsopische Fabel[68] von dem schmeichlerischen Fuchs und der eitlen Krähe mit dem Käse („De lo que contesçió a un raposo con un cuervo que teníe un pedaço de queso en el pico“) zugrundeliegt, lässt sich nämlich auch als Apologie betrügerischen Verhaltens lesen. Denn Patronio zeigt mittelbar eine andere Moral auf, und zwar, dass List und Schmeichelei über Eitelkeit und Einfältigkeit – mit Fuchs und Krähe als deren Repräsentanten – triumphieren. Dies ist nicht die Lehre, die der consegero seinem Herren beizubringen sucht – er rät ihm vorsichtig zu sein und sich vor Betrug zu hüten –, aber davon unbenommen bleibt die Beobachtung, dass hier eine alternatives Prinzip zum Vorschein kommt: „It is tempting to conclude“, spekuliert Macpherson, „that Juan Manuel is here illustrating a case in which flattery and cunning pay off – in this tale the gullible man is no match for the crafty man”[69].
Unter den Geschichten, die Patronio seinem Herrn erzählt, finden sich häufig Fabeln, deren Verwendung eine didaktische Finte des Autors darstellen könnte. Denn eine Fabel erlaubt es, den Blick dank ihrer ‚äußeren Unwahrscheinlichkeit‘ auf wiederkennbare Geschehensabläufe zu richten. Für diese hat Lessing den Begriff der „inneren Wahrscheinlichkeit“ geprägt, die gerade durch die programmatische äußere Unwahrscheinlichkeit ins Licht gerückt wird.[70] Die in der Fabel geleistete Befreiung der Geschehensabfolge aus historischen Wahrscheinlichkeiten, die immer auch Zufälligkeiten sind, macht sie damit für den Leser als regelhaft erkennbar.
2.2 Der Leser als Hermeneut
Schon die Komposition des Conde Lucanors als eine aus Gnomen und Chrien gebildete Lebenslehre, die „auf raffinierte, eben schon selbst lebenskluge Weise sowohl den Sammel- als auch den Lehrbuchcharakter unkenntlich macht“[71], überträgt dem Leser eine bestimmte Rolle bei der Lektüre des Textes. Denn der erzählerische oder gedankliche Rahmen des Werkes, das „mehrstufige dialogisch-diegematische Verschachtelungsverfahren“[72] schränkt die Benützbarkeit inhaltlich zunächst ein. Dies spricht gegen eine Reduktion des Werkes auf einen allein didaktischen Anspruch, der dem Leser keinerlei Deutungsmöglichkeiten zubilligt. Denn zunächst müssen von diesem „die disponiblen facta et dicta (…) aus ihm [dem Rahmen, C.H.] herausgebrochen und kontextuell neu eingepaßt werden“[73]. Gewonnen wird dabei der „methodische Gewinn einer impliziten Anleitung zum situationsgerechten ‚Transfer‘“, wie Peter von Moos schreibt.[74]
Der Leser befindet sich somit ständig in der Situation, den Text auf die eigenen, individuellen Umstände anwenden zu müssen, und ist, mit John Dagenais gesprochen, „caught up in a process of judgement and choice”.[75] Dass Juan Manuel seinen Lesern diese Art des Lesens abverlangt, wird deutlich, wenn er schreibt, dass ein jeder in den exemplos Umstände finden wird, die den seinen ähneln, jedoch nicht gleichen: „Et sería maravilla se de cualquier cosa que acaezca a cualquier omne, non fallare en este libro su semejan ça que acaesçió a otro“[76]. Ganz im Sinne dieser dem Leser zukommenden Rolle des Hermeneuten[77] findet sich im anteprologo des Autors sogar die Aufforderung, der Leser möge ein von Juan Manuel autorisiertes Werk bei Fehlern einsehen und somit quasi quellenkritische Studien betreiben:
„Et porque don Iohan se reçeló desto, ruega a los que leyeren qualquier libro que fuere trasladado del que él compuso, o de los libros que él fizo, que si fallaren alguna palabra mal puesta, que non pongan la culpa a él, fasta que bean el libro mismo que don Iohan fizo, que es emendado, en muchos logares, de su letra [Hervorhebung von C. H.].”
2.3 Der Autor als Individuum
Roger Chartier hat in einem Vorwort zu Jacqueline Cerquiglini-Toulet’s Buch zur literarischen Produktion in Frankreich im 14. Jahrhundert ausgeführt, dass hier mehrere revolutionäre literarische Innovationen erfolgt seien.[78] Dies ließe sich möglicherweise übertragen auf das spanische 14. Jahrhundert. Juan Manuels El Conde Lucanor könnte eines der frühesten Beispiele darstellen, in dem die modernen Ideen von Autor, Literatur und Buch grundgelegt worden sind.
Vor allem in den Vor- und Nachworten findet sich bei ihm eine greifbare Autorinstanz mit detaillierter Funktionsbestimmung des Erzählens. Im dem kurzen Prolog Juan Manuels findet sich eine Sicht des modernen Buches als „a means for presenting the work and the author in their full individuality“[79]. Wenn nämlich Juan Manuel im Prolog markant zwischen der geistigen Autoren-Verantwortung und der Arbeit der Manuskript-Kopisten differenziert[80], wird deutlich, dass hier eine Auffassung vertreten wird, nach der der Text des Autors als dessen geistiges Eigentum betrachtet wird. Dies ist für mittelalterliche Verhältnisse sehr ungewöhnlich, wie María Rosa Lida Malkiel betont: “(...) dentro de la Edad Media, poco favorable al cultivo y a la expresión de los personal – de ahí la enorme proporción de obras anónimas (...)”.[81] Der Autor tritt in der Regel hinter seinem Werk zurück, weswegen es auch völlig normal ist, dass Texte ohne jeden Verweis auf den Urheber einfach in den eigenen aufgenommen werden. Vorherrschend war ein Bild – das gleichzeitig zum Topos wurde –, nämlich das des Ährenlesers „gathering up strands of grain left by the great harvesters oft he past“[82]. Bei Juan Manuel finden wir den Anfangspunkt einer neuen Entwicklung, die Roger Chartier als ein Verdienst des 14. Jahrhunderts sieht: „a new alliance, set up among the book, the work, and the author“[83]. Selbstbewusst gibt sich Juan Manuel im Prolog namentlich und unter Nennung seiner politischen Funktion als Autor zu erkennen:
„Por ende, yo, don Johan, fijo del infante don Manuel, adelantado mayor de la frontera et del regno de Murçia, fiz este libro compuesto de las más palabras que yo pude, et entre las palabras entremetí algunos exiemplos de que se podrían aprovechar los que los oyeren.”[84]
Daran anschließend erscheint in Anlehnung an das Horazische miscere utile dulci das traditionelle Bild des Arztes, der dem Kranken die Medizin versüßt. Dazu äquivalent schmückt der Autor seine nützlichen Lehren durch schöne Worte und angenehm zu lesende Geschichten. Dass andere Leser mit anderen “entendimientos“, die den didaktischen Inhalts des Textes nicht erfassen, denselben auch als unterhaltsame Kurzgeschichte lesen können, könnte den Anfang einer modernen literarischen Tradition bedeuten.
Modern mutet auch an, dass sich Juan Manuel in keinem der beiden Prologe und auch nicht in den Erzählungen auf Quellen oder Autoritäten beruft, sondern vielmehr die volle Verantwortung für die Auswahl der Geschichten auf sich nimmt: „Et puso en él los enxiemplos más aprovechosos que él sopo de las cosas que acaesçieron“[85].
Auch die detaillierte Auflistung der bereits von Juan Manuel verfassten Bücher und der Hinweis auf den Aufbewahrungsort der Originale zeigt, so drückt es Ian Macpherson aus, eine „’unmedieval’ preoccupation about the integrity of his work”[86].
2.4 Neubewertung individuellen Erfahrungswissens
Bei der Lektüre des Conde Lucanor frappieren zudem weitere Aspekte. Zunächst wäre der Stil Juan Manuels zu nennen, der sich – im Vergleich mit anderen mittelalterlichen Texten – durch eine bemerkenswerte Schlichtheit auszeichnet, die bereits Marcelino Menéndez y Pelayo als zu der Aussage veranlasste, Juan Manuel sei „el primer escritor de neustra Edad Media que tuvo estilo en prosa, como fue el Arcipreste de Hita el primero que lo tuvo en verso”.[87]
Obwohl sich Juan Manuel durchaus eine profunde Bildung angeeignet haben muss – das zeigen vielerlei Anleihen bei klassischen Autoren –, kommt er erstaunlich unprätentiös daher, löst Zitate stets auf und verwebt diese in seinen Text, anstatt sie, wie in dieser Zeit oft üblich, in erratischer Manier in der lateinischen Originalsprache einzusetzen. Diese Praxis und auch seine Entscheidung für die Abfassung des Werkes in der Volkssprache statt des gelehrten Lateins, lässt vermuten, dass nicht nur sein Bemühen um Verständlichkeit höher rangiert als das bloße Protzen mit Wissen, sondern auch, dass ihm die vergnügliche Unterhaltung des Lesers, das delectare, über einen bloßen Unterweisungscharakter hinaus ein wichtiges Anliegen ist.
Ebenso fällt auf, dass sich die meisten Exempla Juan Manuels von den historischen bzw. im Mittelalter historisch genannten und sehr erfolgreichen Exempelsammlungen – man denke etwa an die Gesta romanorum – sehr unterscheiden. Dort begegnen uns häufig begrifflich isolierbare Exempla im engeren Sinn, die man auch als argumentative oder rhetorische Exempla bezeichnen könnte.[88] Sie bauen auf „die Überzeugungskraft des einmal in der Geschichte faktisch Gewesenen, auf Figuren wie Alexander und Cato und ihre Taten und Reden“.[89] Juan Manuel lässt nur selten solche großen Persönlichkeiten/Autoritäten als Protagonisten auftreten.[90] In Teilen ist sein Figurenarsenal zwar ein bekanntes, teils biographisch motiviertes oder topisch codiertes[91]. Generell ist Juan Manuel jedoch weniger stolz darauf, das Überkommene zu überliefern, sondern vielmehr, Tradiertes klug auszuwählen.[92] Und in der Mehrzahl bleiben die Akteure anonym bzw. fiktiv. „Fiktionale Beispiele sind für uns insofern interessanter“, schreibt Peter von Moos, „als sie lebensweltlich mögliche Situationen als eine Art Bühnenraum für die darin modellhaft agierenden und Sprechenden Personen gezielt aufbauen können, ohne durch äußere Zwänge – ein idealistisches Einteilungsschema oder sperrige Realität – eingeengt zu werden“. Das für ihn „vielleicht einleuchtendste Beispiel dieser Art“ stellt für ihn der Conde Lucanor dar.
Doch davon unbenommen, ob der Leser die Geschichten als real oder fiktiv ansieht: deutlich wird, dass der Erfahrung, unabhängig vom Orientieren an Autoritäten oder zumindest darüber hinaus, ein völlig neuer Stellenwert zukommt. Eine wichtige Funktion kommt dabei dem Rahmen zu, über den gezeigt wird, dass jede allgemeine Wahrheit immer wieder neu in den individuellen Umständen der Existenz eines jeden Menschen erprobt werden muss.[93] Am Ende jedes Exemplums findet sich die Formel „(…) et fízolo assi, et fallósse dello muy bien“ (in diesem oder leicht abgewandeltem Wortlaut). Die refrainartige Wiederholung darf nicht über die Bedeutung der Worte hinwegtäuschen, dass das Exempel nicht nur in das Buch aufgenommen wurde, weil ihm die Autorität der Vergangenheit eignet, sondern weil das Exemplum neu erprobt wurde und es seinen Nutzen erwiesen hat.[94] Auch im Libro infinido, einem weiteren Werk des kastilischen Adligen, lässt sich eine Emphase für ein sachkundiges Verstehen auf Basis individuell angeeigneter Erfahrung als angemessene Basis für menschliches Handeln erkennen, wenn in einer vergleichsweise offenen Struktur in der Form eines neuzeitlichen Tagebuchs immer neue Erfahrungen notiert werden. Diese neue Betonung von Pragmatismus, individuellem Willen und persönlicher Verantwortung lässt sich kaum als typisch mittelalterlich bezeichnen. Zurecht kann daher Juan Manuel in einem Zug mit Juan Ruiz und López de Ayala als eine der „primeras personalidades literarias“[95] bezeichnet werden, die statt enzyklopädisch gesammelten Wissens dem nunmehr konkret anvisierten Leser persönlich Gesichtetes und Gestaltetes vermitteln.
Resümee
Ausgehend von der Interpretation Gumbrechts, der in Juan Manuels Conde Lucanor einen ‚involutionären’ literarischen Rückschritt verwirklicht sieht, wurde in dieser Arbeit der literaturhistorische Kontext wie ihn Gumbrecht entwirft problematisiert. Argumentiert wurde, dass das Paradigma einer Krise des Spätmittelalters, die auch über Kastilien ihren – mit einem Bild Gumbrechts ausgedrückt – dunklen Schatten geworfen habe, differenzierter zu betrachten ist. Die Beispiele, die dieser für den postulierten kulturellen Verfall in post-alfonsinischer Zeit gibt, sind jedenfalls nicht geeignet, einen solchen hinreichend zu belegen. Ein Großteil der weiteren Forschung hebt vor allem auf die vermeintlich absolute didaktische Intention des Werkes ab, das – im Vergleich mit dem Libro de buen amor – bar jeder Ambiguität sei. Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde diese Sicht problematisiert und darüber hinaus zu zeigen versucht, dass das Werk Juan Manuels durchaus eine alternative Lektüre nahelegen kann, die von frappierend modern anmutenden Elementen durchzogen ist. Dies betrifft die Rolle, die dem Leser zugewiesen wird, das Selbstverständnis des Autors und insbesondere die deutlich werdende Verlagerung vom Orientieren an Autoritäten hin zur Neubewertung eines individuellen Erfahrungswissens.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Quellen
Don Juan Manuel: El Conde Lucanor o Libro de los enxiemplos del conde Lucanor et de Patronio. Edición, introducción y notas de José Manuel Blecua, Valencia 1969.
Thomas Aquinas: Summa theologica, hg. v. Thomas F. O’Meara/Michael J. Duffy, London/New York 1968.
Literatur
Alborg, Juan Luis: Historia de la literatura española. Edad Media y Renacimiento, Madrid 2. Aufl. 1972.
Blecua, José Manuel: Don Juan Manuel. Obras completas, Madrid: Gredos, 1981-1983.
Bremond, Claude/ Jacques Le Goff und Jean-Claude Schmitt: L’Exemplum (Typologie des sources du Moyen Age occidental), Turnhout 1982.
Burgoyne, Jonathan: Reading the Exemplum Right. Fixing the Meaning of El Conde Lucanor (North Carolina Studies in the Romance Languages and Literatures 289), Chapel Hill 2007.
Chartier, Roger: Foreword: The Author, the Book, and Literature, in: Jacqueline Cerquiglini-Tollet (Hg.): The Color of Melancholy, Baltimore 1997, S. xiii-xvi .
Chicote, Gloria B.: La construcción ficcional en las colecciones de cuentos medievales: Libro del Conde Lucanor, Decamerón y Cuentos de Canterbury, in: Nuevas miradas sobre la Tierra Media. El Cuento en el Occidente Europeo (siglos XIV a XVII), hrsg. v. Ders., Buenos Aires 2006, S. 15-38.
Chicote, Gloria B.: La construcción ficcional en las colecciones de cuentos medievales: Libro del Conde Lucanor, Decamerón y Cuentos de Canterbury, in: Nuevas miradas sobre la Tierra Media. El Cuento en el Occidente Europeo (siglos XIV a XVII), hrsg. v. Ders., Buenos Aires 2006.
Seibt, Ferdinand: Zu einem neuen Begriff von der Krise des Spätmittelalters, in: Mittelalter und Gegenwart. Ausgewählte Aufsätze. Festgabe für Ferdinand Seibt zu seinem 60. Geburtstag, hrsg. von Winfried Eberhard und Heinz-Dieter Heimann, Sigmaringen 1987, S. 218-234.
Dagenais, John: The ethics of Reading in Manuscript Culture: Glossing the Libro de Buen Amor, Princeton 1994.
Devoto, Daniel: Introducción al estudio de don Juan Manuel y en particular de El Conde Lucanor, Madrid 1972.
Don Juan Manuel: El Conde Lucanor. Edición, prólogo y notas de Guillermo Serés. Con un estudio preliminar de Germán Orduna (Biblioteca clásica 6), Barcelona 1994.
Dunn, Peter N.: The Structures of Didacticism: Private Myths and Public Fictions, in: Ian Macpherson (Hg.): Juan Manuel Studies, London 1977, S. 53-68.
Eichendorff, Josef: Der Graf Lucanor. Fünfzig altspanische Novellen. Dt. von Josef Eichendorff. Hrsg. und mit einem Nachw. vers. von Manfred Hinz, Passau 2007.
England, John P.: Los que son muy cuerdos entienden la cosa por algunas sennales learning the lessons of El Conde Lucanor, in: Bulletin of Hispanic Studies 76 (1999), S. 345-364.