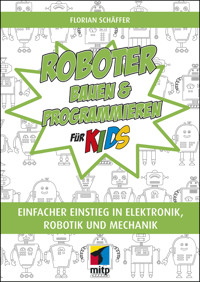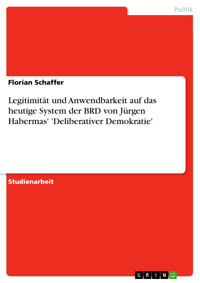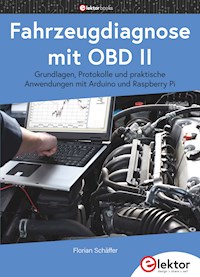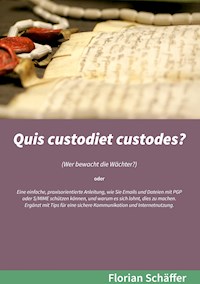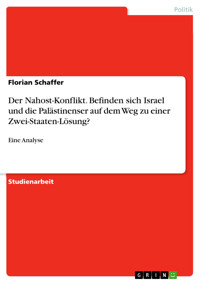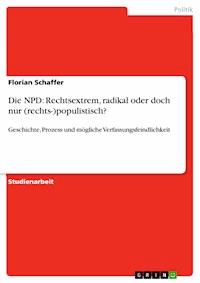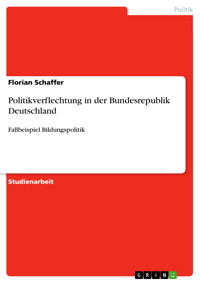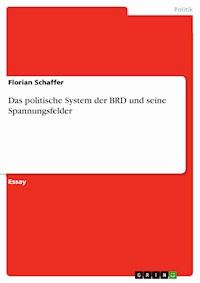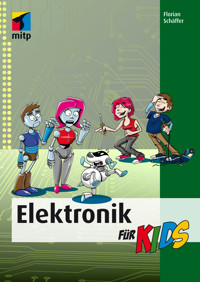
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MITP
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: mitp für Kids
- Sprache: Deutsch
Eigene Elektronikexperimente durchführen und verstehen Alles zu Strom, Schaltplänen, Ladungen und Spannungen Mit vielen kniffeligen Fragen und Aufgaben am Ende der Kapitel Batterien, Schalter, Lampen, Motoren und Leuchtdioden begegnen uns jeden Tag. Florian Schäffer vermittelt dir in diesem Buch nicht nur technisches Hintergrundwissen und Physik zum Anfassen, sondern experimentiert, baut und misst mit dir an Schaltungen. Zitronenbatterie, Morseschalter, Dimmer, Lichtschranke, Lügendetektor, Geschicklichkeitsspiel, Blumengießautomat und noch viel mehr warten auf dich. Alle Versuche sind genau beschrieben und reich bebildert, sodass du sie ganz einfach nachbauen kannst. Auf lockere Art erfährst du, was Strom und Spannung überhaupt sind, und kannst dann profimäßig Schaltpläne entziffern und eigene Experimente entwickeln. Wichtige Elektronik-Merksätze, einfache Formeln und die wichtigsten Schaltzeichen gehen dir dabei ebenso in Fleisch und Blut über wie das Wissen zu Relais, Widerständen, Transistoren und Dioden. Falls es einmal richtig kniffelig wird, steht dir Hund Buffi mit Rat und Tat zur Seite.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elektronik für Kids
Florian Schäffer
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-95845-018-9
1. Auflage 2015
www.mitp.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 7953 / 7189 - 079
Telefax: +49 7953 / 7189 - 082
© 2015 mitp-Verlags GmbH & Co. KG
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Wir danken allen Mitwirkenden bei Wikipedia und Wikimedia, die Bildmaterial der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. So weit erforderlich, ist die Creative Commons Lizenz bei den Abbildungen angegeben. Der jeweilige Lizenztext kann unter http://creativecommons.org/licenses/ nachgelesen werden. Danke auch an Fritzing, mit dessen Software die Steckboardansichten erstellt wurden.
Lektorat: Katja Völpel
Sprachkorrektorat: Petra Heubach-Erdmann
Covergestaltung: Christian Kalkert
electronic publication: III-satz, Husby, www.drei-satz.de
Dieses Ebook verwendet das ePub-Format und ist optimiert für die Nutzung mit dem iBooks-reader auf dem iPad von Apple. Bei der Verwendung anderer Reader kann es zu Darstellungsproblemen kommen.
Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheherrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.
Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Kapitel 1: Bevor es richtig losgeht
In diesem Kapitel lernst du:
welche Dinge du für deine eigenen Elektronikexperimente benötigst
welche wichtigen Sicherheitshinweise es gibt, damit keine Gefahr besteht
was deine Eltern oder Erzieher über dieses Buch wissen sollten
was ein Experimentiersteckboard ist und wie du es benutzen kannst
welche Tipps es gibt, wenn ein Fehler auftaucht und ein Versuch nicht auf Anhieb funktioniert
Damit dir dieses Buch recht viel Freude bereitet und du als Entdecker auf dem Weg in die neue Welt der Elektronik nicht ins Straucheln kommst, sind (leider) ein paar ernste Worte notwendig. Um den »erhobenen Zeigefinger« kommen wir auch nicht herum, um dich vor Schaden zu bewahren. Trotzdem lass dich bitte nicht davon abhalten, die Texte aufmerksam zu lesen und zu beherzigen. Versprochen: Es wird noch richtig spannend!
Wenn etwas ganz besonders wichtig ist und deiner Aufmerksamkeit bedarf, dann steht das in einem solchen Kasten. Wenn du diese Texte aufmerksam liest, dann dürfte es keine Probleme geben.
Ich bin immer da, wenn es kniffelig wird oder ich noch einen echten Profitrick für dich habe. Manchmal will ich auch nur zeigen, wie schlau ich bin. Dann kannst du meinen Kommentar gerne lesen und staunen oder du hebst es dir für später auf, wenn du neugierig geworden bist.
Die Lösungen zu den Fragen und Aufgaben aller Kapitel gibt es unter www.mitp.de/016.
Ein Wort an die Eltern
Liebe Eltern, Erzieher oder sonst wie verantwortliche Leser: Dieses Kapitel ist speziell für Sie gedacht (natürlich darf auch Ihr Kind das hier lesen).
Obwohl sich das vorliegende Buch primär an Kinder und Jugendliche richtet, so dürfen Sie dabei nicht vergessen, dass die Materie recht anspruchsvoll ist. Der Umgang mit Elektronik kann gefährlich sein. Natürlich wird in diesem Buch nichts Gefährliches gezeigt und alle Experimente sind im Prinzip harmlos. Trotzdem sind einige Sicherheitshinweise erforderlich, die Sie beachten und mit Ihrem Kind besprechen sollten. Vielleicht fragen Sie sich auch, wie Sie und Ihr Kind am besten mit dem Buch umgehen sollen? Auch dazu kommen ein paar Vorschläge.
Lesen Sie die Sicherheitstipps bitte aufmerksam durch und besprechen Sie die Hinweise mit Ihrem Kind, bevor es selbstständig mit dem Buch arbeitet.
Sicherheitshinweise
Die verwendeten Bauteile sind nicht für Kleinkinder geeignet! Es besteht die Gefahr, dass die Teile verschluckt oder eingeatmet werden. Das empfohlene Mindestalter beträgt acht Jahre.
Strom aus der Steckdose ist lebensgefährlich! Es werden keine Experimente mit »Lichtstrom« gemacht. Achten Sie auch darauf, dass keine Drahtstücke in eine Steckdose gesteckt werden können.
Keine Netzteile verwenden! Auch wenn kleine Netzteile, wie Sie sie vielleicht von Ihrem Handyladegerät her kennen, praktisch sind und eine an sich ungefährliche Spannung bereitstellen, sind diese für eigene Experimente ungeeignet.
Die auch spöttisch als »Wandwarzen« bezeichneten Geräte sind oft sehr billig produziert und genügen nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards (auch wenn die entsprechenden Symbole wie das »CE« und VDE-Zeichen, TÜV-Siegel usw. aufgedruckt wurden). Bei einem (unsichtbaren) Defekt kann Netzspannung an der Ausgangsseite anliegen oder es kommt zur Überhitzung etc.
Nutzen Sie eine Batterie und keinen Akku. Auch wenn das nicht ökologisch sein mag, so kann ein Akku durch einen (versehentlichen) Kurzschluss stark beschädigt werden und explodieren etc. Es genügt eine billige Batterie, die im Doppelpack schon für weniger als einen Euro zu bekommen ist. Benutzen Sie auch keine Lithium-Batterien (zum Beispiel »Knopfzellen«), da diese ebenfalls explodieren können.
Unbedingt darauf achten, dass die beiden Pole der Batterie nicht versehentlich mit einem metallischen Gegenstand (Schlüssel, Schraubenzieher, Draht etc.) kurzgeschlossen werden. Es besteht die Gefahr der Überhitzung und Zerstörung.
Verformte, beschädigte oder ausgelaufene (weiße Säurerückstände an den Polen oder Kanten) Batterien sofort entsorgen.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Jede Verkaufsstelle von Batterien nimmt Altbatterien kostenlos zurück.
Die Experimente sind für gesunde, normal entwickelte Kinder konzipiert und ungefährlich. Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen und/oder mangels motorischer Fähigkeiten, müssen durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden.
Einige Experimente produzieren Lichtblitze, akustische Töne oder physische Irritationen. Sollte die Personen, die das Experiment durchführt, hierauf übermäßig sensibel reagieren, beaufsichtigen Sie die Person bei der Durchführung.
Es mag kleinkariert sein und der ökologische Nutzen in Bezug auf die hier verwendeten Kleinstmengen darf durchaus kritisch hinterfragt werden, aber der Gesetzgeber will es so: Alle elektronischen und elektrischen Komponenten (sie werden etwas irritierend als »Geräte« bezeichnet) dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Die Verordnung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung – ElektroStoffV) legt fest, dass selbst Elektrokabel hierunter fallen und natürlich auch die einzelnen Bauteile, die für die Schaltungen hier im Buch benutzt werden. In der EU wird der Umgang mit Elektronikschrott durch die WEEE-Richtlinie geregelt, die in Deutschland im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) umgesetzt worden ist. Im Rahmen der Elektronikentsorgung müssen gebrauchte Geräte in Deutschland von den Geräteherstellern (nicht aber den Verkäufern) zur Entsorgung und Beseitigung zurückgenommen werden. Üblicherweise werden die Teile aber bei den regionalen Recyclinghöfen (Müllsammelstellen) kostenlos angenommen. Das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar. Ein Balken unter der Tonne weist darauf hin, dass das Produkt (in Deutschland) nach dem 23.3.2006 in Verkehr gebracht wurde.
Wie Sie und Ihr Kind mit dem Buch arbeiten können
Können Sie Ihr Kind mit dem Buch allein lassen? Ja und nein. Von der Idee her ist das Buch natürlich so gedacht, dass ein Jugendlicher sich allein mit dem Thema befassen kann und alle Versuche auf eigene Faust ausprobiert. Allerdings setzt das ein recht hohes autodidaktisches Vermögen voraus. Haben Sie die Sicherheitshinweise gemeinsam besprochen und stellen Sie die Materialien bereit, kann es losgehen.
Früher oder später werden aber vermutlich Fragen und Probleme auftreten. Trotz aller Mühe kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Fehler in den Text eingeschlichen hat. Auch die Beschreibungen sind manchmal für den einen Leser leichter oder anders zu verstehen als für andere. Dann funktioniert die Schaltung vielleicht nicht wie gewünscht oder gar nicht. Oder es gibt Verständnisprobleme ganz allgemeiner Natur. Dann freut sich jeder Mensch, wenn er auf verständliche Hilfe hoffen kann. Wenn Sie Vorkenntnisse im Bereich Elektronik haben, ist dies sicher vorteilhaft – es ist aber keine Bedingung. Vielleicht haben Sie selber Spaß an der Materie und arbeiten den Stoff schon mal vor, um zu sehen, wie es funktionieren soll. Manchmal hilft auch schon ein entkrampfter Blick eines Außenstehenden, um zu erkennen, dass ein Bauteil falsch eingesetzt wurde oder ganz banal die Batterie alle ist. Wenn Sie als erwachsener Begleiter bei der Fehlersuche entspannt und vor allem systematisch vorgehen, sollten sich alle Fehler finden lassen.
Lassen Sie sich von Ihrem Kind mit eigenen Worten erklären, was die Schaltung machen soll und was für ein Fehler oder Problem besteht. So sehen Sie, ob die Versuchsbeschreibung verstanden wurde, und Sie helfen dem Kind, zu lernen, wie man Fehler erkennt, eingrenzt, analysiert und letztendlich beseitigt.
Lesen Sie selbst die Beschreibung durch.
Lassen Sie sich zeigen, welche Schritte schon zur Eingrenzung und Behebung des Fehlers unternommen wurden.
Prüfen Sie systematisch jede Verbindung und jedes Bauteil. Es kann hilfreich sein, die Bauteile auf den Abbildungen im Buch mit Bleistift abzustreichen.
Bauteile können beschädigt werden. Tauschen Sie die Bauteile nacheinander einzeln gegen andere/neue aus. Prüfen Sie die Batterie.
Im Internet finden Sie weitere Hilfen. Es gibt zahlreiche Webseiten, die sich mit Elektronik befassen und auf denen viele Informationen unterschiedlich aufbereitet wurden. Vielleicht finden Sie dort eine Beschreibung, die Sie besser verstehen oder mit der Sie offene Fragen beantworten können. Elektroniker sind in der Regel sehr hilfsbereit und freuen sich, wenn sie Anfängern helfen können. Die nachfolgende Sammlung stellt nur eine (keinesfalls vollständige) Übersicht einiger populären Webseiten dar:
http://www.blafusel.de/phpbb/index.php Webseite und Forum des Autors. Im Forum können Sie mit anderen Lesern in Kontakt treten.
http://www.mikrocontroller.net/ Eigentlich ein Forum für Mikrocontroller. Es gibt aber auch andere Unterforen und vor allem eine sehr große Teilnehmergemeinschaft.
http://www.elektronik-kompendium.de/ Fachartikel und Forum rund ums Thema.
https://groups.google.com/forum/#!forum/de.sci.electronics Newsgroups waren früher (in Zeiten vor dem WWW) die beliebteste Form, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten. Auch wenn dies nachgelassen hat, so findet man in diesen Gruppen noch viele hilfsbereite Fremde.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/ Die häufigsten Fragen »FAQ« aus der vorher genannten Newsgruppe. Hier gibt’s viele Antworten zu immer wieder auftauchenden Fragen.
http://www.strippenstrolch.de/menue-1.html Beim Strippenstrolch gibt’s viele Infos und Schaltungen für eigene Experimente.
Ohne Mathe geht es nicht
Um Elektronik richtig zu verstehen, sind ein paar einfache Berechnungen unumgänglich. Ohne diese wüsste man nicht, welche Bauteildimensionen notwendig sind oder wieso die Schaltung sich so verhält. Mathematik wirkt aber auf viele Menschen abschreckend. So weit wollen wir es hier gar nicht kommen lassen. Die Formeln sind einfach und werden immer ausführlich vorgestellt. Ihr Kind sollte lediglich die vier Grundrechenarten (Plus, Minus, Mal, Geteilt) kennen, Terme und Variablen kennen und die Grundrechenarten auf einem Taschenrechner beherrschen. Im Internet finden Sie hierzu zahlreiche Hilfen, wenn Sie selber noch einmal nachschauen wollen (z. B.: http://de.wikibooks.org/wiki/Mathematik:_Schulmathematik). Terme sind meistens Lerninhalt etwa ab Klassenstufe 5 bis 7.
Ein einfacher Schultaschenrechner wie der verbreitete Texas TI-30XA genügt vollauf. Sie können auch den Rechner benutzen, der beim Betriebssystem Microsoft Windows auf dem PC installiert wurde. Bei Start|Programme|Zubehör finden Sie das Programm Rechner.
Der Windows-Rechner. Wählen Sie Ansicht|Wissenschaftlich, um die gezeigte, sinnvolle Ansicht zu erhalten.
Was du für deine Versuche brauchst
Für die Durchführung der Experimente und den Aufbau der Schaltungen werden ein paar Bauteile und eine Grundausstattung an Werkzeugen benötigt. Im Buch werden ganz bewusst keine speziellen Bauteile verwendet, sondern so weit wie möglich Standardteile, wie sie auch jeder Hobbyanwender später für eigene Versuche im Heimlabor benutzt.
Die elektronischen Bauteile sind so gewählt, dass sie einfach zu beschaffen sind und es sich meistens um Centartikel handelt. So ist es leicht zu verschmerzen, wenn etwas verloren geht oder beschädigt wird. Es gibt eine Liste mit Bauteilen, die unbedingt vorhanden sein sollten, und eine optionale Ergänzungsliste.
Zusätzlich gibt es auch zwei Listen mit Werkzeugen: Wieder enthält die eine Liste solche, die unbedingt notwendig sind, und die Ergänzungsliste zeigt Material, das zusätzlich sinnvoll ist. Vielleicht gibt es das eine oder andere Tool ja auch schon sowieso zu Hause in der Werkzeugkiste. Grundsätzlich ist es so, dass gutes Werkzeug eine Menge Geld kosten kann. Einen Seitenschneider gibt es bereits für drei Euro, vom Markenhersteller kostet er dann gleich 15 Euro und mehr. Werkzeug (auch teures) aus dem Baumarkt ist nur selten geeignet für Elektroniker.
Es ist besser, bei einem Händler zu kaufen, von dem man auch die Elektronikteile bezieht. Für den Einstieg empfehle ich, sich mit billigem Werkzeug auszustatten. Es ist ansonsten doch ärgerlich, wenn der teure Seitenschneider gleich beim Abknipsen eines zu dicken Nagels ruiniert wird. Sollte sich die Elektronikbastelei zum Hobby entwickeln, dann bietet sich beim nächsten Geburtstag etc. die gute Gelegenheit, hochwertiges Equipment anzuschaffen, an dem man dann lange Freude hat.
Die Preisangaben in allen Listen sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen. Je nach Abnahmemenge und Preisentwicklung können sich die tatsächlichen Marktpreise auch ändern. Ebenso dienen die Abbildungen und Bestellnummern für die Versender Reichelt (http://www.reichelt.de/) und Conrad (http://www.conrad.de/) nur der Orientierung und stellen keine spezielle Kaufempfehlung dar. Weitere gute Bezugsquellen sind zum Beispiel Segor (http://www.segor.de/) und Pollin (http://www.pollin.de/). Bewahre die Bauteile in den gelieferten und beschrifteten Tütchen auf, sodass später immer festgestellt werden kann, um welche Teile es sich handelt. Vor allem, wenn keine Bezeichnung auf dem Bauteil selber steht, ist das hilfreich.
Bauteile (Mindestanforderung)
Anzahl
Name
€/Stück
Bestellnummer
Beispielabbildung
1
Experimentier-Steckboard
3,-
R: STECKBOARD 1K2V
C: 526819
1
Drahtbrücken-Sortiment
4,-
R: STECKBOARD DBS
C: 524530
2
Batterie 9 V Block
1,-
2
Batterieclip
0,50
R: CLIP HQ9V-T
C: 650514
1
Rolle Litze, ca. 5 m, 0,14 mm²
Weitere Farben sind praktisch.
2,-
R: LITZE GE
C: 605208
1
Rolle Draht, isoliert, ca. 5 m, Ø 0,8 mm
3,-
R: KLINGELDRAHT
C: 1180517
1
Set Messleitungen mit Kroko(dil)klemmen (ca. 10 Stück)
3,-
R: MK 612S
C: 108488
2
LED Low Current, rot, 2 mA, 3 mm
0,10
R: LED 3MM 2MA RT
C: 156225
3
LED grün, 25 mA, 5 mm
0,10
R: LED 5MM ST GN
C: 180183
3
Glühlampe, 12 V, bedrahtet
0,80
R: L 3212
C: 727180
1
Kurzhubtaster
1,80
R: T9141GN
C: 707732
je 5
Kohleschichtwiderstände, 5 %, ¼ Watt
10 , 22 , 47 ,
100 , 220 , 470 ,
1.000 , 2.200 ,
10 k, 47 k,
100 k, 1 M
Alternativ zu den Einzelwerten kann auch ein Widerstandssortiment gekauft werden, wie es in der Ergänzungsliste steht.
0,10
Exemplarisch:
R: ¼W 10
C: 403016
5
0,1A Feinsicherung, 5x20 mm, mittelträge
0,20
R: MTR. 0,1A
C: 533220
1
Trimmer/Potenziometer 1 k
1,-
R: 76-10 1,0K
C: 424927
1
Trimmer/Potenziometer 100 k
1,-
R: 76-10 100K
C: 424986
1
Fotowiderstand, 4...500 k
1,-
R: LDR 07
C: 140370
1
Relais 6 V DC, 2xUM
2,60
R: FIN 40.52.9 6V
C: 503975
1
Lautsprecher, 8 , 0,2 W
1,10
R: BL 50
C: 710396
2
1N4148 Diode
0,04
R: 1N 4148
C: 162280
2
1N4004 Diode
0,05
R: 1N 4004
C: 162248
1
SFH 484 IR LED
0,50
R: SFH 484
C: 525176
5
BC547 NPN Transistor
0,06
R: BC 547C
C: 155955
1
BC557 PNP Transistor
0,06
R: BC 557C
C: 154970
1
Fototransistor BPX81–3
1,30
R: BPX 81
C: 153175
Bauteile (Ergänzungsliste)
Anzahl
Name
€/Stück
Bestellnummer
2
LED rot, 25 mA, 5 mm
0,15
R: LED 5MM ST RT
C: 180141
2
LED gelb, 25 mA, 5 mm
0,15
R: LED 5MM ST GE
C: 180224
1
LED blau, 30 mA, 5 mm
1,30
R: LED 5MM ST BL
C: 180212
1
E12 Widerstandsreihe/Sortiment
13,-
R: K/RES-E12
C: 418706
1
Elektro-Minimotor, 4–14 V
5,-
R: -
C: 229021
Werkzeugliste (Mindestanforderung)
Anzahl
Name
€
Bestellnummer
Beispielabbildung
1
Elektronik-Seitenschneider
3,-
R: SCHERE570
C: 406634
1
Spitzzange, klein
3,-
R: MAN10704
C: 817725
1
Digitalmultimeter
10,-
R: PEAKTECH1070
C: 122999
1
Feinmechaniker-Schraubendreherset (mind. 2 x Schlitz, 2 x Kreuz)
2,-
R: TS6N
C: 813146
Werkzeugliste (Ergänzungsliste)
Anzahl
Name
€
Bestellnummer
Beispielabbildung
1
manuelle Abisolierzange
4,-
R: KN1102160
C: 284356
1
Widerstandsuhr
2,80
R: VITROHMETER
C: 400009
Lötzinn gibt es mit und ohne Blei und mit und ohne Flussmittel. Bleihaltiges Lötzinn ist für industrielle Anwendungen inzwischen verboten worden. Für private Anwender besteht das Verbot nicht. Bleifreies Lötzinn ist zwar etwas weniger gesundheitsschädlich, lässt sich aber deutlich schwerer verarbeiten und ist gerade für Anfänger deshalb weniger geeignet. Das Blei ist vor allem als Kontaktgift schädlich. Deshalb sollte auf ausreichende Handhygiene geachtet werden und das Lötzinn nicht in den Mund genommen werden. Beim Löten entstehen Dämpfe vor allem durch das notwendige Flussmittel (beispielsweise Kolophonium). Die Dämpfe und das Blei gelten in den Mengen, wie sie im Hobbybereich auftreten, nicht als gefährlich. Trotzdem sollte ein direktes Einatmen vermieden werden. Mit einem Lötdampfabsauger (ca. € 30,-) kann der Rauch aus der Atemluft abgesaugt werden.
Vom Buch zum eigenen Versuch
Jetzt soll’s endlich langsam losgehen. Fangen wir damit an, dass du dein Werkzeug und deinen Laborplatz kennenlernst und erfährst, wie du die Beispiele aus dem Buch in der Praxis selber durchführst. Wichtig ist nämlich, dass du möglichst alle Experimente auch selber ausprobierst und nachbaust. Am besten lernt es sich nämlich, wenn man Dinge wirklich »begreift«. Also die Bauteile anfassen und sehen, was wirklich passiert.
In der Elektronik spricht man von einer (elektrischen) Schaltung. Auch wenn gar kein Schalter im Aufbau benutzt wird.
Alle Beispiele werden hier im Buch in drei verschiedenen Formen vorgestellt:
Der Schaltplan ist eine technische Zeichnung. Zu Beginn wirst du mit ihm nicht viel anfangen können, aber mit der Zeit wird alles erklärt werden und dann wirst du verstehen, was die Symbole bedeuten. Zu einer Schaltung gehört immer ein Schaltplan, damit jeder Techniker – und zu denen wirst auch bald du gehören – sehen kann, wie die Schaltung funktionieren soll.
Im Schaltplan werden für alle Bauteile standardisierte Symbole benutzt.
Eine grafische Darstellung des Experimentierboards. Die Bilder wurden mit der kostenlosen Software Fritzing (http://fritzing.org) erstellt. Sie zeigen dir, welche Bauteile, Drahtbrücken usw. an welcher Stelle in das Steckbrett zu setzen sind. Die Farben der Bauteile und der Drahtbrücken sind nicht zwingend genau so, wie sie bei dir aussehen. Wichtig ist, immer zu schauen, wo die grauen Anschlussbeine eines Bauteils im Board enden, also eingesteckt sind.
Beispiel für eine mit Fritzing erstellte Ansicht
Ein oder mehrere Fotos zeigen dir den realen Aufbau. Auch hier sehen die Bauteile usw. vermutlich ein wenig anders aus als bei dir.
Foto von einem Musteraufbau
Kein Brotschneidebrett: das Experimentierboard
Ein Steckbrett mit Federkontakten wird im Deutschen als Experimentierboard oder Steckplatine bezeichnet. Im Englischen sagt man dazu einfach Breadboard (Brotbrett). Für unsere Versuche benutzen wir ein kleines einfaches Modell dieses Steckboards. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und Größen. Um eine Schaltung zuerst einmal auszuprobieren, ist das eine praktische Sache, denn so kann man die Bauteile und Verbindungen jederzeit umstecken und probieren, ob alles funktioniert. Hat dann alles geklappt, kann die Schaltung auf einer Platine aufgelötet werden. Die Federkontakte nehmen die Bauteile auf und stellen die Verbindung her. Allerdings leiern sie mit der Zeit aus, wenn man immer wieder die gleichen Kontaktöffnungen benutzt oder mal ein Bauteil mit etwas dickeren Beinchen (mehr als ca. 0,8 mm Durchmesser) einsteckt. Das führt dann dazu, dass die Bauteile nicht mehr richtig sitzen und die Schaltung nicht funktioniert – oder nur, wenn man an den Teilen wackelt. Deshalb benutze dein Breadboard nicht länger, wenn du solche Probleme erkennst, sondern besorge dir ein neues – zum Glück kosten die kleinen Modelle nur sehr wenig.
Fünfpoliger Federkontakt einer Buchsenreihe
Es gibt eine Vielzahl an preiswerten Entwicklungsboards. Die meisten verwenden Federkontakte mit fünf Löchern in einer Reihe je Element. Alle Bauteile, die du in eins dieser fünf Löcher steckst, sind miteinander verbunden, als würdest du die Beinchen direkt zusammenhalten. Später werden wir uns Verbindungen und deren Funktion noch genauer anschauen. Die Löcher und die Federleisten sind in einem standardisierten Rasterabstand zueinander angeordnet. Dieser beträgt 2,54 mm. Die meisten elektronischen Bauteile nutzen dieses Maß (oder ein Vielfaches wie z. B. 5,08 mm) für den Abstand der Anschlussbeinchen, sodass sie meistens passen und einfach eingesteckt werden können. Drähte mit einem Durchmesser von 0,8 mm (Querschnitt: 0,5 mm²) passen am besten in die Federkontakte.
Weil auch Experimentierplatinen zum Einlöten von Bauteilen das gleiche Rastermaß verwenden, können die Experimente vom Steckboard später einfach auf einer Platine dauerhaft aufgebaut werden.
2,54 – sagt dir diese Zahl etwas? Vielleicht hast du schon mal gehört, dass nicht alle Menschen auf der Welt, so wie wir in Europa, mit Zentimetern rechnen. Beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) benutzt man Zoll beziehungsweise Inch. Unser deutsches Wort »Zollstock« erinnert daran, weshalb pingelige Leute meinen, man müsste deshalb zu dem Teil in Deutschland auch »Gliedermaßstab« sagen. Bitte, wer will, kann das ja machen. Für mich ist das ein Zollstock und Schrauben drehe ich nicht, sondern ich ziehe sie (»Schraubenzieher« ist eigentlich auch falsch und es müsste »Schraubendreher« heißen). Unser Zahlensystem nennt man metrisches System und das der Amerikaner wird als imperiales oder angloamerikanisches System bezeichnet. Um zwischen den beiden Systemen umzurechnen, muss man mit 2,54 multiplizieren beziehungsweise durch diese Zahl dividieren: 2,54 Zentimeter entsprechen 1 Zoll.
Ein Lineal mit Einteilungen in Zoll (oben) und Zentimetern (unten)
Etwas kniffelig ist zu erkennen, welche der Pins denn nun zu einem Federkontakt gehören. Die meisten Boards besitzen eine horizontal verlaufende Vertiefung in der Mitte. Darüber und darunter sind die Kontakte senkrecht nebeneinander angeordnet. Alle Kontakte einer Farbe (Grün, Blau, Orange) sind miteinander verbunden. Kontakte unterschiedlicher Farbe sind nicht miteinander verbunden.
Kleines Steckboard mit zwei Reihen senkrechter Federkontakte. Die obere und die untere Reihe haben also jeweils 20 Federkontakte mit jeweils fünf Stecklöchern.
Etwas größere Boards haben oben und unten eine waagerecht verlaufende Leiste aus Kontakten. Diese sind zwar auch in Fünfer-Abschnitten ausgeführt, besitzen aber eine Verbindung zueinander (rote und blaue Reihe). Manchmal gibt es auch zwei parallel verlaufende Reihen. Die Löcher sind dann nur mit den Nachbarn nebeneinander verbunden. Zwischen den beiden Reihen gibt es keine Verbindung. Diese horizontalen Verbindungen eignen sich hervorragend, um über diese Leisten die zwei wichtigen Anschlüsse Plus und Minus von der Batterie zu verteilen. Was es genau damit auf sich hat, kommt bald. Für die Beispiele in diesem Buch wird ein solches Board benutzt.
Steckboard mit parallel verlaufenden Reihen oben und unten (Blau und Rot). Die vier Löcher in den Ecken des vorderen Breadboards sind einfach nur Löcher, um Schrauben durchzudrehen, um das Board zu befestigen.
In der nächstgrößeren Liga an Steckboards ändert sich nicht mehr viel. Es gibt einfach mehr Kontakte. Allerdings gibt es einige Varianten mit einer echten Gemeinheit: Die horizontale Verteilerleiste ist nicht durchgehend, sondern in der Mitte unterbrochen. Zwischen der linken und der rechten Reihe besteht keine Verbindung. Im Grunde handelt es sich um zwei kleine Boards, die einfach nebeneinander geklebt wurden. Das ist leider oft nur schwer zu erkennen. Die farbigen Linien am Rand des einen Boards zeigen deutlich, dass die ganze Reihe von links bis rechts verbunden ist. Die Farben sind praktisch, weil sie den gebräuchlichen Farben für Plus und Minus entsprechen – nur Geduld, das kommt bald! Bei längeren Boards sind die Verteilerleisten am Rand also mit Vorsicht zu genießen und es ist gut, bei einem neuen Board erst einmal zu prüfen, wie und ob die Leisten verbunden sind.
Hast du ein Breadboard mit durchgängigen Reihen oben und unten, die aber nicht farbig markiert sind, dann mache das am besten gleich selber mit einem wasserfesten Filzstift. Die Farben sind nämlich sehr praktisch, um Verwechslungen zu vermeiden. Später wird in den Aufbauten immer ein Steckboard benutzt, das oben und unten je zwei dieser Reihen hat.
Bei dem vorderen großen Experimentierbrett sind die horizontal verlaufenden Verteilerkontakte oben und unten ab der Hälfte unterbrochen. Es gibt also vier voneinander unabhängige Reihen (Blau, Rot, Grün, Gelb). Beim hinteren Board mit der farbigen aufgedruckten Linie sind alle Pins einer Reihe verbunden.
Bauteile in die Zange nehmen
Willst du ein Bauteil oder einen Draht in das Experimentierboard einstecken, so solltest du darauf achten, dass die Anschlussbeinchen oder Drähte dabei nicht verbogen werden. Viele Bauteile passen dank des schon erwähnten 2,54-mm-Rasters direkt in die Löcher. Einige Bauteile gibt es aber auch in der sogenannten axialen Bauweise: Bei dieser liegen das eigentliche Bauteil und die zwei Anschlüsse in einer Achse. Aber auch ein einfacher Draht ist erst einmal nur ein gerades Stück Metall.
Ein Kondensator mit radialen Anschlüssen und ein Kondensator sowie ein Widerstand mit axialen Anschlüssen
Willst du diese einsetzen, müssen die Beinchen zu einer Brücke gebogen werden. Das Bauteil einfach in der einen Hand halten und dann die Drähte biegen, ist allerdings nicht die beste Idee. Dabei treten nämlich Biegekräfte auf, die das Bauteil beschädigen können, was man aber nicht unbedingt sieht. Eleganter ist es, wenn du eine kleine Flachzange nimmst und damit den Draht greifst. Setze die Zange dicht am Bauteil an und halte es fest. Jetzt kannst du den Anschlussdraht, der gerade in der Zange klemmt, von Hand biegen, bis ein rechtwinkliger Knick entstanden ist. Mit dem anderen Drahtende machst du das Gleiche. Auf diese Weise wird das Bauteil nicht beschädigt und der Knick sieht zudem besser aus.
Greife zuerst das Bauteil am Anschlussdraht, den du verbiegen willst.
Halte das Bauteil fest und biege den Anschlussdraht nach unten. Mit der anderen Seite des Bauteils machst du dann noch einmal das Gleiche.
Je nachdem, wie nah du die Zangen am Bauteil ansetzt, entstehen Brücken, die eine unterschiedliche »Spannweite« haben und entsprechend viele Löcher auf dem Steckbrett zwischen den Beinchen überbrücken. Mit der Zeit wirst du so viel Routine entwickeln, dass du die Abstände ganz gut mit Augenmaß abschätzen können wirst. Für Profis und Faule gibt es auch Biegelehren. In diese kleinen Plastikkeile legt man das Bauteil ein und fixiert es mit einem Finger, während man die Beine abknickt. Das Bauteil wird vor Knickschäden geschützt und du kannst die Länge der Brücke beeinflussen, indem du das Bauteil mehr zum schmalen Ende hin einlegst oder an der breiteren Seite.
Zu einer der häufigsten Tätigkeiten des Elektronikers gehört es, einen Draht abzuisolieren. Die Isolierung ist das gummiartige (oft weiße, schwarze oder auch farbige) Material um den eigentlichen Metallkern. Damit du den Draht in einem Experiment verwenden kannst, müssen die Enden ca. 5 mm blank sein: Die Isolierung muss weg. Dazu gibt es verschiedene Methoden:
Ein (elektrisches) Kabel besteht aus einem metallischen Kern (meistens rötliches Kupfer) und einer Ummantelung aus einer Isolierung. Früher war das Stoff oder Papier, heute ist es Kunststoff. Der Kern kann entweder aus einem einzelnen Draht bestehen oder aus dünnen Drähten (sogenannte Litzen), die zu einer Ader verdreht wurden. Es gibt Kabel, die nur eine Ader haben (wird auch als »Volldraht« bezeichnet) oder mehradrige Kabel, bei denen jede der Adern für sich von einer Isolierung umgeben ist und alle Adern zusammen noch einmal von einer Isolierung (dem Kabelmantel). Je nach Anwendung können die Adern auch noch von einem Kupfergeflecht oder einer Alufolie umhüllt sein oder es befindet sich ein Stück Schnur dazwischen. Für manche Kabelarten haben sich Namen wie Klingeldraht, Telefonkabel, Steuerleitung oder Lautsprecherkabel eingebürgert. Das heißt natürlich nicht, dass man damit nur ein Telefon etc. betreiben darf. Klingeldraht sagt man meistens zu einem dünnen, einadrigen, massiv aufgebauten Kabel. Als Telefonkabel wird oft ein Kabel aus vieradriger recht dünner Litze bezeichnet. Bei einem zweiadrigen Kabel, dessen beide Adern nicht von einem zusätzlichen Mantel umgeben sind, sondern bei dem die Adern aneinanderhaften, spricht man oft von Lautsprecherkabel. Die Adern bestehen aus Litzen und sind von dünn bis dick erhältlich. Wenn du am Anfang zwischen den beiden Adern in Längsrichtung einen Schnitt setzt, kannst du die beiden Adern auseinanderziehen und bekommst so zwei einzelne Drähte.
Wenn du ein Kabel kaufen willst, dann sagt dir die Bezeichnung, aus wie vielen Adern das Kabel aufgebaut ist und wie dick eine einzelne Ader (ohne Isolierung) ist. Die Angabe »4 x 0,25« bedeutet zum Beispiel, dass es vier Adern gibt und jede davon besitzt einen Querschnitt von 25 mm². Beachte, dass der Querschnitt nicht das Gleiche ist wie der Durchmesser. Der Querschnitt ist eine Fläche und der Durchmesser ist ein Längenmaß.
Mit einem scharfen Messer wird vorsichtig ringförmig in die Isolierung geschnitten. Nur so tief, dass das Plastik angeschnitten wird, nicht aber das Kupfer. Dann kann der Mantel abgezogen werden. Vor allem bei dicken Kabeln ist dieses Vorgehen oft erforderlich.
Diese Methode mit dem Messer empfehle ich nicht für Kinder! Leicht schneidest du dir dabei in den Finger. Hartgesottene »Profis« schaffen es sogar, die Isolierung mit den Zähnen abzureißen. Auch das solltest du auf keinen Fall machen! Du könntest das Plastik verschlucken und es ist auch nicht gut für deine Zähne oder deine Zahnspange.
Mit einem kleinen Elektronikseitenschneider drückst du an der gewünschten Stelle ein wenig zu. Gerade so sehr, dass du die Isolierung festhältst, nicht aber das Kabelende abschneidest. Dann ziehe ruckartig Richtung Kabelende und reiße so die Isolierung weg. Dieses Vorgehen ist mit etwas Übung ganz praktikabel, da man als Elektronikbastler immer einen Seitenschneider in der Nähe haben wird. Am Anfang wirst du sicher immer das Kabel durchschneiden oder beschädigen (Teile der Litze mit abreißen) oder die Isolierung bleibt dran.
Am einfachsten geht es mit einer speziellen Abisolierzange. Es gibt automatische Zangen und manuelle. Bei den Automatikzangen muss man nur den Draht zwischen die Backen klemmen und am Abzug der Zange ziehen. Billigmodelle haben aber oft Aussetzer. Eine manuelle Zange lässt sich recht einfach bedienen: Mit der Einstellschraube legst du fest, wie stark die Zange zusammendrücken soll. Im Grunde ist die Abisolierzange nämlich nichts anderes als ein Seitenschneider, der den eingestellten Abstand zwischen den Schneidebacken von sich aus einhält. Bei der Methode mit dem Seitenschneider musst du das im Gefühl haben. Löse die Rädelschraube (äußere Schraube) und drehe an der Einstellschraube (mittlere, längere Schraube). Drücke die Zange zusammen und schaue von vorne auf die Schneiden. Stelle jetzt mit der Einstellschraube den Abstand ein, der vom Kabel übrig bleiben soll. Der Abstand muss so groß sein, dass zwar die Isolierung zerschnitten wird, nicht aber der innere Kupferdraht. Jetzt kannst du diesen Abstand mit der Feststellschraube fixieren.
Vor allem bei Kabeln, die aus mehreren kleinen Drähten bestehen, wird meistens der Draht mit der Zeit abknicken und aufdröseln. Wenn du löten kannst, ist es schon mal sehr gut, wenn du die Enden einfach ein wenig verzinnst. Vielleicht können das auch deine Eltern für dich übernehmen. Ansonsten verdrille einfach die offenen Drahtenden: Halte das Kabel mit der einen Hand fest und zwirbele die offenen Litzen zwischen Daumen und Zeigefinger ein wenig. Für das Experimentiersteckboard eignet sich Litze nicht besonders gut. Besser du verwendest einen soliden Draht.
Wenn du bei einem Bauteil die Beinchen umgebogen hast, kannst du die langen Enden mit dem Seitenschneider abknipsen. Belasse aber immer ca. 1 cm lange Beinchen dran, damit du das Bauteil noch gut mit der Zange greifen und in einen Federkontakt einsetzen kannst. Achte darauf, dass die abgeschnittenen Enden nicht wild durch die Gegend fliegen. Meistens landen sie irgendwo, wo sie eher stören: zwischen den Tasten der PC-Tastatur, im Lüftungsschlitz eines Gerätes oder in deinem Auge. Wenn du beim Schneiden einen Finger leicht auf das abzuknipsende Ende legst, dann fliegt der Draht nicht so weit herum.
Beim Abknipsen das Drahtende mit dem Zeigefinger gegen Herumfliegen sichern.
Weil die Federkontakte auf dem Steckboard ein wenig schwergängig sein müssen, kann es manchmal etwas schwierig sein, ein Bauteil einzusetzen. Wenn du den Draht oder das einzusteckende Beinchen mit der Flachzange etwa 1 cm vom Ende entfernt greifst, kannst du es meistens ganz einfach in das Board einstecken.
Wenn’s mal nicht so richtig klappt
Jeder Forscher kennt das Phänomen: Der schönste Versuch will einfach nicht so funktionieren, wie gewünscht. Da hast du dir ganz viel Mühe gegeben und das vorgestellte Experiment nachgebaut, aber nichts passiert. Das ist natürlich schade und kann schnell frustrierend sein. Aber sieh es von der positiven Seite: Auch aus Fehlschlägen kannst du eine Menge lernen. Du darfst dich nur nicht ärgern und den Mut verlieren. Manchmal steckt der Teufel im Detail oder es ist einfach »der Wurm drin«. Dann helfen nur ein ruhiger Kopf und etwas Ausdauer bei der Suche nach dem Problem. Leider bist du dabei ziemlich auf dich allein gestellt, denn es ist nicht möglich, alle Fehler vorauszuerkennen und dir für alles eine Lösung anzubieten. Wenn du deine Eltern oder einen Lehrer fragen kannst, dann nutze dies und nimm die Hilfe