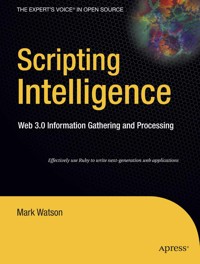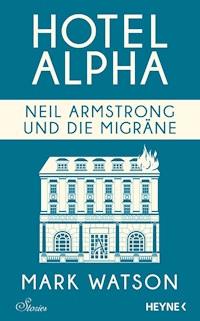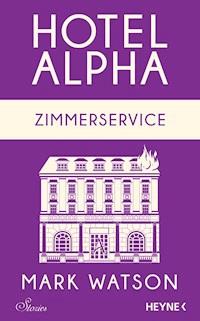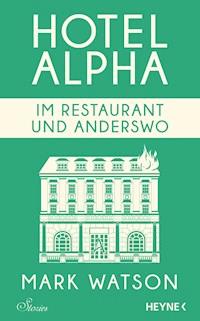9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Augenblick. Eine unterlassene Tat. Unendliche Konsequenzen: Elf Menschen, die sich niemals begegnen werden. Elf Schicksale, die unabänderlich miteinander verknüpft sind. Und ein Mann, dessen Leben aus den Fugen geraten ist.
Xavier Ireland, Mitte Dreißig, ist ein guter Mensch, Turnier-Scrabble-Spieler und Moderator eines nächtlichen Radiotalks. Auch Xavier selbst ist ein in der Nacht Gefangener, eine in der Millionenstadt gestrandete Seele. Irgend etwas bedroht und bedrängt Xavier, ein Ereignis aus der Vergangenheit, welches unantastbar, unberührt bleiben soll. Xavier ist in Australien aufgewachsen, hatte Freunde, eine große Liebe - vor der er geflohen ist, um einen neuen Namen, ein neues Leben in Angriff zu nehmen. Nichts gibt Xavier von sich preis - bis er sich unerwartet in Pippa verliebt, seine exzentrische, pragmatische und vor Leben sprudelnde Putzfrau. Sie ist es, die Xavier dazu bringt, sich seiner Vergangenheit zu stellen.
Dieser Roman ist auch unter dem Titel "Ich könnte am Samstag" im Heyne Verlag als Taschenbuch erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber das BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungKapitel IKapitel IIKapitel IIIKapitel IVKapitel VKapitel VIKapitel VIIKapitel VIIIKapitel IXKapitel XKapitel XIÜber das Buch
Dieser Roman ist auch unter dem Titel »Ich könnte am Samstag« im Heyne Verlag als Taschenbuch erschienen. Ein Augenblick. Eine unterlassene Tat. Unendliche Konsequenzen: Elf Menschen, die sich niemals begegnen werden. Elf Schicksale, die unabänderlich miteinander verknüpft sind. Und ein Mann, dessen Leben aus den Fugen geraten ist. Xavier Ireland, Mitte Dreißig, ist ein guter Mensch, Turnier-Scrabble-Spieler und Moderator eines nächtlichen Radiotalks. Auch Xavier selbst ist ein in der Nacht Gefangener, eine in der Millionenstadt gestrandete Seele. Irgend etwas bedroht und bedrängt Xavier, ein Ereignis aus der Vergangenheit, welches unantastbar, unberührt bleiben soll. Xavier ist in Australien aufgewachsen, hatte Freunde, eine große Liebe - vor der er geflohen ist, um einen neuen Namen, ein neues Leben in Angriff zu nehmen. Nichts gibt Xavier von sich preis - bis er sich unerwartet in Pippa verliebt, seine exzentrische, pragmatische und vor Leben sprudelnde Putzfrau. Sie ist es, die Xavier dazu bringt, sich seiner Vergangenheit zu stellen.
Über den Autor
Mark Watson, geboren 1980 in Bristol, ist Romanautor, Kolumnist, Radio- und Fernsehmoderator und international erfolgreicher Stand-up-Comedian. Er ist außerdem studierter Literaturwissenschaftler und Umweltaktivist. Mark Watson lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in London. »Elf Leben« ist sein erstes ins Deutsche übersetzte Buch.
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2011/2015 by Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Karsten Kredel
Umschlaggestaltung: studio grau, Berlin; Illustration: Inga Israel
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-2650-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Kit
I Eine klirrend kalte Februarnacht. London versinkt im Schnee. Die Flocken tanzen in den Neonlichtkegeln der Straßenlampen und legen sich als Schals um die geparkten Autos.
Hinter einem Betongebäude im Westen der Stadt huscht ein dürrer Fuchs auf der Suche nach einem warmen Plätzchen über einen Parkplatz und hinterlässt eine kokette Fährte, deren schwache Reste in wenigen Stunden Frühaufsteher bestaunen werden. Fünf Stockwerke höher beobachtet Xavier Ireland durch das zunehmend weiße Fenster eines Radiostudios, wie sich der Fuchs in einen Winkel neben einem Recyclingcontainer verkriecht.
»Also, ich an eurer Stelle würde es mir im Warmen gemütlich machen und weiter bei uns anrufen«, rät Xavier seinem unsichtbaren, über London verstreuten Publikum. »Gleich hören wir von einem Mann, der dreimal geheiratet hat … und dreimal geschieden ist.«
»Autsch!«, wirft sein Co-Moderator und Producer Murray in seiner typisch banalen Art ein und drückt einen Knopf, um den nächsten Song zu starten.
»Sehr beschaulich da draußen«, sagt Xavier.
»Ich w-w-w-wette, das gibt ein Chaos morgen früh«, stottert Murray.
2003, als Xavier bei diesem Radiosender als Runner arbeitete, Tee kochte und Kabel in die Wand steckte, sah er zum ersten Mal Schnee. Erst ein paar Wochen zuvor hatte er Australien verlassen, einen neuen Namen angenommen – der alte war Chris Cotswold gewesen – und sich in das Vorhaben gestürzt, ein neues Leben in diesem fernen Land zu beginnen, in dem er als Baby gelebt hatte, aber seitdem nicht mehr. Damals wie heute beeindruckte es ihn, wie zart jede einzelne Schneeflocke war und wie viele es davon brauchte, um eine Straße zu bedecken. Zugleich erinnerten ihn der ungewohnte Anblick und die bittere Kälte daran, dass der größte Teil der Welt zwischen ihm und seiner Heimat lag, zwischen ihm und seinen Freunden.
Mit der Zeit war Xavier vom Mädchen für alles zu Murrays Assistent aufgestiegen, bis sich die Rollen schließlich umkehrten, sodass jetzt Xavier der Berater für die große, schlaflose Hörerschaft der Sendung ist.
»Ich frage mich nur, was mit mir nicht stimmt«, sagt der aktuelle Anrufer, ein zweiundfünfzigjähriger Lehrer, der allein am Rand einer Wohnsiedlung in Hertfordshire lebt.
Es ist zwanzig vor zwei Uhr morgens. Die schlechte Handyverbindung hackt einige seiner Sätze in der Mitte ab. Murray fährt sich mit dem Finger von links nach rechts über den Hals, er will den nächsten Anrufer hereinnehmen, denn dieser hier spricht schon gute drei Minuten, aber Xavier schüttelt den Kopf.
»Ich meine, ich bin ein anständiger Mensch«, klagt der deprimierte Lehrer weiter, der Clive Donald heißt und nach diesem Anruf noch soviel unruhigen Schlaf aus der Nacht herausholen wird, wie er eben kann, bevor er aufstehen, einen grauen Anzug anziehen und sich in sein Auto setzen wird, auf der Rückbank dreißig Mathematikhefte in einer wettergegerbten Aktentasche. »Ich … ich spende zum Beispiel regelmäßig. Ich habe auch ein paar Interessen. Es ist nicht so, dass irgendwas – dass mit mir irgendwas nicht stimmen würde, könnte man sagen. Warum kann ich keine glückliche Ehe führen? Warum mache ich immer irgendwas falsch?«
»Es ist zu einfach, immer zu glauben, es wäre alles Ihre Schuld«, sagt Xavier zu ihm und zu allen anderen Hörern überall in der Stadt. »Glauben Sie mir, ich habe Monate – ach was, Jahre – damit verschwendet, immer wieder über meine Fehler zu grübeln. Irgendwann habe ich mir gesagt: Schluss jetzt, du musst sie vergessen.«
Clive, soweit getröstet, dass er sich zum Schlafengehen entschließen kann, bedankt sich bei Xavier und legt auf.
Murray drückt einen Knopf.
»Und jetzt freuen wir uns auf die Nachrichten und das Wetter«, sagt er. »Wir sind gleich wieder da.«
Murray geht hinaus in den Flur und hält eine Brandschutztür auf, um an der frischen Luft eine Zigarette zu rauchen. Der Schnee fällt mit einer unbritischen Heftigkeit, eher wie Hagel oder Graupel, statt mit der fedrigen Leichtigkeit dessen, was normalerweise so als Schnee gilt. Xavier trinkt einen Schluck Kaffee aus einem gelben Becher mit der Aufschrift BIGCHEESE und dem Bild einer Scheibe Käse darauf. Er hat ihn vor ein paar Jahren von Murray zu Weihnachten bekommen, und in seiner eher plumpen Funktionalität und seiner unhandlichen Größe hat er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, der ihn geschenkt hat.
Ein paar Meilen weiter schlägt ein schlotternder Big Ben – den man in klareren Nächten von Xaviers Studio aus gerade so sehen kann – zwei Uhr.
»Und hier die Schlagzeilen«, verliest meilenweit entfernt eine Frau, deren fast gänzlich tonlose Stimme in diesem Moment auf allen Radiosendern des Networks im ganzen Land zu hören ist. »Rekordschnee. Wenn das Land in einigen Stunden erwacht, wird es mit den stärksten Schneefällen seit zehn Jahren konfrontiert werden.«
Komische Ausdrucksweise, denkt sich Xavier – Wenn das Land erwacht –, als wäre Großbritannien ein großes, schlafendes Internat, das am Morgen von der Glocke geweckt wird. Wie der Erfolg von Xaviers Vierstundenschicht beweist, gibt es allein in London eine riesige Phantomgemeinschaft von Leuten, die aus allen möglichen Gründen nachts wach sind: Schichtarbeit, ungewöhnliche Hobbys, Schuldgefühle, Ängste oder Krankheiten – oder auch einfach Begeisterung für seine Sendung. Xavier blickt noch einmal auf die schneebedeckte Fensterscheibe und stellt sich das stille, verschneite London vor, das sich da draußen meilenweit erstreckt. Er versucht sich Clive Donald vorzustellen, den Mathelehrer, wie er nach dem Telefonat langsam den Hörer auflegt, den Wasserkocher anstellt, gedankenverloren zwei Tassen aus einem Schrank nimmt und eine wieder zurückstellt. Er denkt an die vielen regelmäßigen Anrufer: die Fernfahrer, die am Radio herumfummeln, wenn der Empfang auf der M1 stadtauswärts schlechter wird, und die älteren Damen, die sonst niemanden zum Reden haben. Dann denkt er vage an die halbe Million Londoner auf Nachtschicht, direkt jenseits des Parkplatzes mit dem herumschleichenden Fuchs, den stillen Ecken und, heute Nacht, dem Schnee, der sich immer dicker in Wellen darauf legt.
Einer von Clive Donalds Schülern, Julius Brown, siebzehn Jahre alt und hundertdreißig Kilogramm schwer, sitzt in seinem Zimmer und weint leise. Obwohl er regelmäßig ins Fitnessstudio geht, bekommt er sein Gewicht einfach nicht in den Griff. Mit vierzehn begann er, Medikamente gegen Epilepsie einzunehmen, deren Nebenwirkung unter anderem sprunghafte Gewichtszunahme war, und obwohl kein Arzt eine Erklärung dafür hat, geht er jedes Mal, wenn er etwas isst, fast sichtbar weiter in die Breite. An jedem Schultag hagelt es Beleidigungen: Seine Mitschüler machen Furzgeräusche, wenn er sich setzt, und auf dem Schulhof stecken die Mädchen die Köpfe zusammen und lachen auf ihre unergründliche Art, wenn er vorbeigeht. Er hat drei Hauptfächer, unter anderem Informationstechnologie, und möchte Softwareentwickler werden, aber er rechnet damit, bei einer Hotline zu enden und dünneren Menschen zu helfen, deren Computer nicht hochfahren. Er spürt den Schneefall, ohne nach draußen zu sehen: Es war bitterkalt, als er von dem Restaurant, in dem er ein paar Mal die Woche abends arbeitet, mit dem Bus nach Hause fuhr. Er würde alles darum geben, dass die Schule morgen ausfällt.
Andere hoffen auf das Gegenteil, zum Beispiel Jacqueline Carstairs, die Mutter eines Jungen im Jahrgang über Julius. Sie ist freie Journalistin und hat eine schnelle, aggressive Art zu tippen, wie jemand, der Rockpiano spielt. Ihr Mann hat versprochen, ihren Sohn Frankie morgen zur Schule zu bringen, damit sie lange wach bleiben und einen Artikel über chilenischen Wein zu Ende schreiben kann, und wenn die Schule nicht ausfällt, kann sie auch morgen noch ungestört arbeiten. Die Jahre als Mutter haben ihre Ohren geschärft, und sie hört, wie die Schneeflocken watteweich und beinahe geräuschlos in die Recyclingkiste draußen vor der Tür fallen. Sie tippt in eine Suchmaschine den Namen eines chilenischen Schauspielers ein, der jetzt in Großbritannien lebt und bei einer Werbekampagne für den Wein mitwirkt, über den sie schreibt.
Die Psychotherapeutin des Schauspielers, Dr. Maggie Reiss, sitzt in ihrem Haus in Notting Hill auf der Toilette. Sie stammt aus New York und praktiziert seit 1990 in London, wo sie mittlerweile eine lange Liste bekannter Klienten aus der Welt der Unterhaltungs-, Geschäfts- und Modewelt vorweisen kann. Vor zwei Jahren wurde bei ihr ein Reizdarm diagnostiziert, den sie auf das unzumutbare Auftreten vieler ihrer Klienten zurückführt: ihre Ansprüche, ihre Selbstgefälligkeit und manchmal sogar Aggressivität. Sie sitzt unter der Reproduktion eines Klimt-Gemäldes aus dem MOMA und blickt durch das Badezimmerfenster auf die immer weißer werdenden Dächer und Schornsteine. Sie fragt sich, ob Schornsteine heutzutage überhaupt noch eine Funktion haben oder mehr oder weniger zur Zierde da sind, ob London sie als eine seiner berühmten Überspanntheiten beibehalten hat. Maggies rotes Seidennachthemd liegt zusammengerafft in ihrem Schoß. Seufzend denkt sie an einen ihrer empfindlicheren Klienten, einen Politiker, der – selbst jetzt, in diesem Moment – zu den Menschen in London gehört, die Ehebruch begehen. In der heutigen Sitzung war er besonders schwierig, machte ihr absurde Drohungen, sie zu verklagen, sollte sie ihre Schweigepflicht missachten. Soll er doch zur Hölle fahren, denkt sich Maggie, in deren Bauch es rührt und rumort. Ich habe es nicht nötig, mich so zu fühlen. Meinetwegen kann er tot umfallen.
Nur ein paar Häuser weiter fällt George Weir, ein Maurer im Ruhestand, tatsächlich tot um. Er und Maggie haben einander ein paarmal auf der Straße zugenickt, aber nie ein Wort gewechselt. Während Xavier drei Meilen weiter westlich einen Schluck Kaffee trinkt, erleidet George einen Herzanfall und ringt verzweifelt nach Luft, doch es ist, als wäre eine Folie über seinen Mund gespannt. Zentimeter für Zentimeter windet er sich zum Telefon, um seine Tochter anzurufen, aber es ist zu spät, und sie könnte ohnehin nichts mehr tun. Genau in dieser Woche ist es siebzig Jahre her, dass er in Sunderland geboren wurde. Eigentlich wollte er morgen zum Treffen seines Bowls-Clubs gehen, das jedoch ausfallen wird wegen des Wetters, und in der kommenden Woche abermals, als Geste des Respekts ihm gegenüber.
Einer von George Weirs letzten Gedanken auf dieser Welt ist eine Erinnerung daran, wie er einmal ein lateinisches Verb konjugieren musste – audere, wagen – und wie ihm Mr. Partridge, als er mittendrin nicht weiterwusste, auf die Fingerknöchel schlug. Mehr als ein halbes Jahrhundert danach fällt ihm ein, wie es weitergehen muss. Während er vergeblich nach Luft ringt, erinnert er sich außerdem, wie er vor vielleicht fünfundzwanzig Jahren von Mr. Partridges Tod erfuhr und eine gewisse Befriedigung darüber verspürte, dass die Generation von Pedanten und Sadisten, die ihm die Schulzeit zur Hölle gemacht hatten, endlich ausstarb. Aber jetzt, und das ist unvorstellbar, stirbt George selbst, und die Zeit wird ihn ebenso unbarmherzig auslöschen wie Mr. Partridge und all die anderen.
Lieber Gott, denkt er – obwohl er nie gläubig oder sonderlich emotional gewesen ist –, lieber Gott, lass es das nicht gewesen sein. Aber das ist es gewesen. George wird bald einen Herzstillstand erleiden, und wenn Xavier und Murray dann nach Hause fahren, wird er mit überstrecktem Kopf und aufgerissenem Mund darauf warten, dass ihn einer von Maggies Nachbarn findet. In ein paar Tagen wird ein Leichenwagen mit seinen sterblichen Überresten feierlich durch den letzten Schnee zum Abbey Park Cemetery fahren, und Xavier wird ihn von seinem Wohnzimmerfenster aus flüchtig sehen. Vorläufig jedoch blickt er zum Fenster des Studios hinaus auf diese Leinwand voll winziger, unbeobachteter Ereignisse.
»I-i-in fünfundvierzig Sekunden geht’s weiter«, sagt Murray, lehnt sich wieder in seinen Drehstuhl und schwenkt sanft hin und her. Xavier denkt noch einen Augenblick an seinen ersten Schnee an jenem Abend vor fünf Jahren, bevor er mit den Gedanken eilig in die Gegenwart zurückkehrt: in das kühle Studio und zu den Anrufern, die darauf warten, dass er ihnen zuhört.
Als sie um kurz nach vier nach Hause fahren, sind die Straßen dick verschneit. Xavier, wohlproportionierte Einsneunzig groß, sitzt auf dem Beifahrersitz, die Lederjacke eng um den Körper geschlungen, und trommelt mit den Füßen auf das Bodenblech, um sich aufzuwärmen. Murray, stämmig und mit buschigem Haar, steuert den Wagen ruckweise vorwärts, als würde er ein bockiges Pferd antreiben.
»Klasse Sendung heute«, sagt Murray und nickt mit seinem Lockenschopf. »Aber der Typ mit den drei Frauen war ein Langweiler. Den hätten wir eher abwürgen sollen.«
»Ich finde, wir mussten ihn dranbehalten. Er klang ziemlich einsam.«
»Bist ein guter Junge, Xavier.«
»Soweit würde ich nicht gehen.«
Es folgt eine irgendwie drückende Stille. Murray räuspert sich. Das dienstbeflissene Klick-Klick der Scheibenwischer verstärkt noch den Eindruck, dass er gleich etwas Wichtiges sagen wird.
»W-w-was hältst du davon, wenn wir heute zu einem Speed-Dating-Abend gehen? In dieser Kneipe da, in Ca-camden.«
»Was?«
»Du weißt schon, Speed Dating. Du gehst von einem Tisch zum anderen und lernst jede Menge Frauen kennen. Und dann …«
»Ja, schon klar, ich weiß, was das ist. Ich frage mich nur gerade, ob es wirklich dein Ernst ist, dass wir so was machen sollen.«
Murray reibt sich mit der freien Hand die Nase.
»Na ja, ich meine, w-w-wir sind ja beide schon eine W-weile solo.« Wenn er in Verlegenheit ist, schlägt sein Stottern meist so richtig durch, als wäre seine Stimme eine alte Festplatte, die jedes Wort einzeln herunterladen muss. Beim ›W‹ hakt es meist zuerst.
»Ich bin eigentlich ganz gern solo.«
»Ich nicht.«
Der Wagen fährt schwerfällig um eine rutschige Kurve an einem Briefkasten, dessen Leerungszeiten von seinem neuen Schneemantel überdeckt sind.
»Ich glaube nicht, dass ich ideale Voraussetzungen für einen Single-Abend habe. Ich kann ja schlecht sagen: Hallo, ich bin Xavier aus dem Radio. Stell dir mal vor, bei den Frauen ist eine Hörerin dabei, wie peinlich das wäre.«
»Dann benutz halt deinen alten Namen. Chris. W-w-was war denn überhaupt so schlecht daran?«
»Na ja, aber sie werden mich trotzdem fragen, was ich so mache, egal wie ich mich vorstelle.«
»Dann erfinde halt was.«
»Ich soll fünfundzwanzig wildfremde Frauen kennenlernen und eine nach der anderen belügen?«
»Sie w-w-werden alle lügen«, sagt Murray, »das macht man eben, um sich po-positiv darzustellen.«
Murray setzt sorgfältig den Blinker, obwohl keine anderen Autos unterwegs sind, und rollt unsicher die steile Bayham Road bis zur Nr. 11 hinunter.
»Meinst du wirklich, auf die Art findest du jemanden?«, fragt Xavier. »Durch Hunderte von kurzen Gesprächen in einer lauten Bar?«
»Hast du eine bessere Idee?«
Xavier seufzt. Fast alles wäre eine bessere Idee. Murray sollte eigentlich selber wissen, dass er als Stotterer bei Drei-Minuten-Dates denkbar schlechte Karten hat. Natürlich will Xavier ihm das nicht so direkt sagen.
»Na gut, einverstanden. Dann können wir das wenigstens abhaken.«
Xavier tappt zur Haustür, wobei seine Füße unerwartet tief in den Schnee einsinken, wie Kerzen in eine Buttercremetorte, und er dreht sich noch einmal um und winkt Murray zu.
Auf einer Branchenparty letztes Jahr um Weihnachten wollte ihm eine einflussreiche Producerin – klein und drall, mit teleskopischen Absätzen – eine eigene Sendung schmackhaft machen, ohne Murray: etwas, das Xavier immer wieder passiert, seit er begonnen hat, sich einen Namen zu machen.
»Wissen Sie, bei allem Respekt, er bremst Sie aus«, rief sie, reckte sich zu ihm hoch und blies ihm cocktail-sauren Atem ins Gesicht. Sie war die Art von Frau, die jeden anschrie, als wäre sie es in ihrer Zwergenhaftigkeit gewohnt, ihre Worte über eine große Distanz zu übermitteln. »Er bremst Sie aus, dieser … Wie heißt er?«
»Murray.«
»Genau, Baby.« Sie packte Xavier am Handgelenk, als würden sie gleich tanzen oder sich küssen. Xavier, der Firmenpartys eher meidet, ist oft überrascht über die plumpen Vertraulichkeiten der Mächtigen in seiner Branche. »Ich habe erst neulich in einem Meeting über Sie gesprochen.« Sie ließ ein paar wichtige Namen fallen. »Sie sollten das Fernsehen in Betracht ziehen, ganz im Ernst, Sie würden sich fabelhaft machen vor der Kamera, und auch im Radio gibt es tausend Möglichkeiten, wenn Ihnen das lieber ist. Aber Sie müssen allein weitermachen.«
Xavier sah beklommen zu Murray hinüber, der am Rande eines Grüppchens herumgelungert und erfolglos versucht hatte, hier und da in das lebhafte Gespräch einzuhaken.
»Ich denke mal darüber nach.«
»Ja, unbedingt.« Sie drückte ihm eine Visitenkarte in die Hand.
Er steckte sie in die Hosentasche, wo sie auch jetzt noch ist, in seinem Kleiderschrank. Natürlich hat er Murray nichts von dem Gespräch erzählt; wie immer bei solchen Gelegenheiten sagte er, er habe nur Smalltalk gemacht.
Xavier sieht zu, wie Murray den Wagen mit seiner unbeholfenen Hartnäckigkeit knirschend und ruckelnd die steile Straße hochmanövriert.
Während Xavier im Wartesaal zwischen Gedanken und Träumen im Bett liegt, wandern seine Gedanken zurück zu dem Gespräch im Auto, und er erinnert sich an den Tag, als er seinen Namen änderte, zwei Wochen nach seiner Ankunft in London. Der eigentliche Vorgang war erstaunlich unspektakulär – ein paar Formulare ausfüllen, sie in ein graues Büro in Essex bringen und ein paar Tage auf die Bestätigung per Post warten. Aber die unendliche Auswahl an neuen Namen war ziemlich beängstigend.
Zuerst überlegte er sich seine neuen Initialen, XI. Sie lagen aus mehreren Gründen nahe. Erstens war Xi ein kaum bekanntes, aber gültiges Wort, mit dem er in der Woche seines Namenswechsels ein Scrabble-Turnier gewann. Und natürlich bezeichneten die Buchstaben als römische Ziffern Elf, die Zahl, die ihn aus unerfindlichen Gründen schon immer begleitet hatte. Es überraschte ihn daher nicht, dass er schließlich eine Wohnung in der Bayham Road Nr. 11 fand. Xavier war einer der wenigen geeigneten Vornamen, die ihm einfielen, und auch Ireland, sein neuer Nachname, hatte keine besondere Bedeutung. Als Ganzes gesehen funktionierte Xavier Ireland aber ganz gut – exotisch, einzigartig, aber irgendwie glaubhaft.
Einen neuen Namen anzunehmen, war ihm bedeutsam erschienen, weil der alte, Chris Cotswold, eine entscheidende Rolle beim Aufbau der wichtigsten Beziehungen in seinem bisherigen Leben gespielt hatte. Seine drei besten Freunde, Bec, Matilda und Russell, hatte er kennengelernt, als ihre Nachnamen in der vierten Klasse der Reihe nach in der alphabetischen Liste im Klassenbuch standen und die vier in eine Gruppe eingeteilt wurden, um eine Fabel von Äsop nachzuspielen. Chris, wie er damals hieß, nahm die Sache in die Hand und legte fest, dass Bec, schon mit neun gut angezogen mit Strumpfhose und roten Schuhen, den Fuchs spielen sollte; Matilda mit ihren Zöpfen war das Schaf und der pausbäckige Russell das Boot, das sie über den Fluss brachte. Als sie zu proben begannen, bekam Matilda Nasenbluten. Nie wird Xavier das unheilvolle Tropf-tropf auf den Bodenkacheln vergessen, und auch nicht ihr kleines, gelassenes Sommersprossengesicht mit den schmutzig dunklen Blutspuren. Sie saß da mit der Gleichgültigkeit einer Neunjährigen, und die Tropfen rannen ihr über die Oberlippe wie Regen über eine Scheibe.
Chris kramte in seiner Tasche nach einem schmuddeligen Papiertaschentuch, das er ihr geben könnte.
»Ich geh zu Mrs. Hobson und sag’s ihr.«
»Geh nicht. Es hat schon aufgehört.«
»Nein, ich meine nicht zum Petzen. Damit sie dir hilft, meine ich.«
»Bitte sag’s ihr nicht.«
Sie nahm seinen Ellbogen. Er blieb, wo er war. Die beiden hatten gerade den ersten Schritt auf dem Weg zu ihrem ersten Kuss gemacht, fünfzehn Jahre später auf einer Grillparty.
Kurz entschlossen und ohne viele Worte, wie Kinder manchmal sind, einigten sich die vier, das Nasenbluten zu vertuschen, indem sie sich für ihre Vorführung besonders ins Zeug legten. An jenem Nachmittag gingen Chris, Matilda, Russell und Bec zu viert nebeneinander zur Bushaltestelle, und niemand traute sich, mit ihnen zu reden. Chris war so glücklich, dass er kaum einschlafen konnte; er war in einer Bande.
Die Viererbande, wie sie von gemeinsamen Freunden später genannt werden sollte, wurde zu einer festen Einrichtung. Bec war elegant und ordentlich, Matilda lotterig und voller Sommersprossen, immer mit Laufmaschen in der Strumpfhose und zu großen oder zu kleinen T-Shirts, und der langsame, schwerfällige Russell brauchte dauernd Chris’ Hilfe bei den Hausaufgaben. Russell und Bec wurden mit vierzehn ein Paar: Von da an lag auf Russells bulligem Gesicht der Ausdruck eines Mannes, der eine Frau gefunden hat, die seine vernünftigen Erwartungen weit übertrifft. Chris und Matilda brauchten etwas länger. Sie behaupteten, ihre Freundschaft sei zu wertvoll, um sie für eine Affäre aufs Spiel zu setzen. Trotzdem schien es nur eine Frage der Zeit, denn es war das einzig vorstellbare Ergebnis. Die vier machten zusammen Urlaub, leisteten zusammen freiwillige Arbeit und wurden wie selbstverständlich zu Partys und sogar zu Hochzeiten als Gruppe eingeladen, als wären sie eine Person. Selten verging mehr als ein Tag, an dem sie einander nicht sahen, und das zwanzig Jahre lang.
Nachdem er kurz in Nostalgie geschwelgt hat, sinkt Xavier in den Schlaf, aber wie so oft führen ihn seine Träume zurück nach Melbourne. Er ist mit der Viererbande und Michael, dem kleinen Sohn von Bec und Russell, im Botanischen Garten. Michael macht ein paar unsichere Schritte, jagt einen Vogel mit einem langen Schnabel, und plötzlich kommen seine Beinchen einander in die Quere und er kippt um. Alle lachen, aber Michael schreit vor Schmerz. Während der ganzen Zeit ist Xavier jedoch nicht vollständig in den Traum eingetaucht: Selbst während er vor seinen Augen abläuft, weiß irgendein Teil seines Gehirns, dass es nicht in Wirklichkeit passiert, nie passieren könnte, und er macht einen bewussten Versuch, daraus aufzutauchen.
Schließlich reißt ein wildes Hämmern an der Tür Xavier aus dem Traum und den vergangenen Zeiten, die er verwackelt wiederaufleben lässt. Sofort sitzt er aufrecht im Bett. Das Hämmern hört auf, dann fängt es wieder an. Durch die zugezogenen Vorhänge leuchtet ein gedämpftes Weiß, und Xavier fällt der Schnee von letzter Nacht wieder ein. In dem T-Shirt und den Boxershorts, in denen er geschlafen hat, wankt Xavier zur Tür und öffnet sie vorsichtig.
Zuerst sieht es aus, als wäre niemand da. Aber als Xavier hinuntersieht, steht auf Kniehöhe ein dreijähriger Junge, ziemlich überrascht über den Erfolg seines Türhämmerns, und überlegt, was er als nächstes tun soll. Xavier und Jamie – der im Erdgeschoss wohnt und eines Tages einen Antikörper gegen zwei Arten von Krebs entwickeln wird – sehen einander an.
Bevor einer von beiden etwas sagen kann, ist Jamies Mutter die Treppe hochgekommen und steht auf dem Absatz.
»Komm her, Jamie! JAMIE!«, schreit sie und sagt dann zu Xavier: »Oh je, das tut mir so leid!«
»Ist schon in Ordnung«, sagt Xavier.
»Du kannst doch nicht einfach den Mann da stören«, schimpft sie mit ihrem Sohn, der sich energisch gegen ihre Versuche wehrt, ihn an die Hand zu nehmen. »Los komm.«
Jamie brüllt irgendwas über Schnee.
»Ja, wenn Mamis Päckchen da ist, gehen wir raus in den Schnee.«
Jamie schüttelt den Kopf und haut mit seiner kleinen Faust gegen einen Heizkörper; das Päckchen ist keine annähernd gute Ausrede. Er stöhnt und hüpft herum wie ein Hund an einer zu kurzen Leine.
Seine Mutter, die Mel heißt, sieht Xavier an und verzieht das Gesicht.
»Das tut mir wirklich leid.«
»Schon in Ordnung«, sagt Xavier.
Sie sehen sich ein paar Sekunden lang verlegen an. Mel schämt sich: Das war wieder einmal der beste Beweis, dass sie ihren Sohn nicht im Griff hat. Auch Xavier ist die Situation unangenehm, denn obwohl Mel weiß, dass er nachts arbeitet, ist es irgendwie peinlich, gerade erst aufgewacht zu sein, wenn der andere offensichtlich schon seit Stunden auf den Beinen ist. Mel kommt sich vor wie eine schlechte Mutter, weil es keinen Vater gibt, der mit Jamie hinaus in den Schnee gehen könnte, denn ihre Ehe endete im letzten Jahr mit gegenseitigen Anfeindungen, und sie wird das Gefühl immer noch nicht los, dass jeder, der davon weiß, schlecht über sie denkt. Nach einigen Sekunden stummer Beschämung lächeln sich die beiden verlegen an, und Mel verschwindet die Treppe hinunter, im Schlepptau den widerwilligen Jamie.
Jamies Ungezogenheiten begannen, lange bevor Mels Mann seine Sachen packte, eigentlich kurz nach jenem Abend – Xavier erinnert sich noch sehr gut –, als am Straßenrand ein schwarzes Taxi hielt und das bald darauf geschiedene Paar mit seinem neuen Prunkstück in einem Babykorb triumphierend ausstieg. Xavier, der einen freien Abend hatte – es muss also ein Freitag oder ein Samstag gewesen sein –, staunte darüber, wie winzig ein Mensch sein konnte, und wie dieses träge Etwas mit seinen fast unsichtbar kleinen Fingernägeln ein ganzes, kompliziertes Leben fix und fertig vor sich haben konnte. Das heißt, falls Leben tatsächlich fix und fertig im Voraus geplant sind, wie Xavier es sich gern vorstellt.
Fast von diesem ersten Abend an machte der neue Bewohner der Bayham Road Nr. 11 Eindruck. Wenn Xavier um halb fünf Uhr morgens nach der Sendung nach Hause kam, waren die Lichter im Erdgeschoss an, und die Schatten der frisch gebackenen Eltern huschten über die Vorhänge. Morgens hörte er den Mann, Keith, schwerfällig zur Arbeit schlurfen, und am frühen Abend drangen die müden Streitereien der beiden zu ihm hoch. Aber Jamie hatte über bloßes Lärmen hinaus eine besondere Begabung zum Unheilstiften. Er aß die erste Seite des neu eingetroffenen Telefonbuchs, das im Hausflur lag. Seine dicken Fingerchen kniffen in eine Messscheibe des Stromzählers und setzten ihn auf Null zurück, sehr zum Erstaunen des Ablesers, der allen Hausbewohnern eine Strafgebühr aufdrückte. Jamie lauerte auf der Treppe und rammte Besuchern aus dem Hinterhalt seine Spielzeugbohrmaschine oder sein Feuerwehrauto in die Knie. Besonders beunruhigend ist seine neue Angewohnheit, zur Tür hinauszuschießen, sobald sie offen ist, und zu tun, als würde er auf die viel befahrene Straße rennen, die vor dem Haus mit seinen drei übereinanderliegenden Wohnungen entlangführt.
Seine Mutter folgt ihm auf Schritt und Tritt, immer drei Sekunden zu spät, strampelt sich ab, um seine neueste Entdeckung aus seinem Mund fernzuhalten oder ihn auf dem Weg zu irgendeiner Gefahr zu bremsen, und verzieht zu jedem, der gerade Zeuge ist, entschuldigend das Gesicht.
Schlafen kann ich jetzt auch vergessen, denkt Xavier, obwohl er erst vor Kurzem zu Bett gegangen ist. Draußen krakeelen Kinder, etwas älter als Jamie. Die meisten Schulen in der Gegend sind geschlossen. In der Wohnung über ihm ist es still: Tamara, die städtische Angestellte, die dort wohnt, würde jetzt normalerweise schon arbeiten, nachdem sie geräuschvoll an Xaviers Tür vorbeigestöckelt wäre. Aber wie mehr als die Hälfte von Londons arbeitender Bevölkerung wird sie heute zu Hause bleiben. Heute ist kein Tag wie jeder andere.
Im Spülbecken in der Küche tummeln sich schmutzige Tassen und Teller, und in den Schränken stehen allerlei Lebensmittel, die ihre besten Zeiten hinter sich haben. Xavier wohnt seit fünf Jahren in dieser Mietwohnung, und währenddessen ist sie zwar nicht direkt heruntergekommen, aber doch wenigstens in eine Art Erstarrung verfallen. Wenn ich eine Freundin hätte, würde ich mir vielleicht mehr Mühe geben, überlegt Xavier, und ihm fällt die Verabredung zum Speed-Dating am Abend wieder ein. Er stellt den Wasserkocher an und verflucht Murrays Überredungskünste oder was auch immer es gewesen sein mochte. Pures Mitleid vielleicht. Wie alle Single-Veranstaltungen hat der Abend schon im Voraus etwas Verbissenes. Vielleicht wird er abgesagt wegen des Wetters, aber Xavier bezweifelt das: Wer unerschrocken genug ist, um sich bei einem Dating-Abend anzumelden, wird sich wohl kaum von Frost abschrecken lassen, nicht einmal von so strengem wie diesem.
Am frühen Nachmittag geht Xavier aus dem Haus, um einzukaufen. Der Himmel hängt als farblose Masse über London, regungslos, als ob ihm sein Ausbruch letzte Nacht ein wenig peinlich wäre. Die Gehwege sind glatt, mit vereisten Stellen zwischen Schneematsch voller Schuhabdrücke. Die Luft fühlt sich kalt an, wie Besteck in einer vergessenen Schublade. Xavier versteckt die Hände in den Ärmeln seines Mantels. Der Besitzer des Eckladens, ein fröhlicher, bauchiger Inder mittleren Alters, der in drei Jahren sterben wird, packt Xaviers Sachen in eine blaue Plastiktüte, bevor Xavier sagen kann, dass er selbst eine mitgebracht hat. Xavier will nicht kleinlich wirken und hält den Mund.
Auf dem Rückweg den Hügel hinab fällt ihm auf der anderen Straßenseite etwas auf. Von einem Klumpen schwarzer Jacken geht ein heiserer Sprechchor aus, die sorgfältig modulierten Stimmen Halbwüchsiger, die um eine Art Bündel auf dem Boden herumstehen. Als Xavier näher kommt, sieht er, dass das Bündel ein weiterer Junge ist, der sich krümmt und windet, während ihm fünf andere Jugendliche abwechselnd Schnee auf den Kopf werfen. Der niedergestreckte Junge, etwas kleiner als die anderen, stößt einen schrillen Schrei aus und will aufstehen, aber seine Peiniger stoßen ihn immer wieder zu Boden. Seine Schreie gehen in durchdringendes, elendes Schluchzen über. Einer der größten Jungen geht ein Stück beiseite, bückt sich und hebt eine Zwei-Handschuh-Ladung Schnee auf, die er zu einem Klumpen zusammendrückt und auf den Kopf seines Opfers fallen lässt. Alle gackern. Der Junge in der Mitte liegt jetzt wie ein niedergerissenes Zelt vor den Füßen seiner Angreifer, halb begraben unter Schneebrocken.
Xavier sieht sich verstohlen um: Außer ihm ist niemand da, der eingreifen könnte. Er nähert sich der Gruppe. Sie kratzen eifrig noch mehr Schnee zusammen und beachten ihn nicht.
Er räuspert sich.
»Hört auf damit«, sagt er, und seine normalerweise volle Stimme klingt in der kalten Luft dünn und zögerlich.
Ein paar Jungen sehen auf. Xavier durchfährt ein Schauder. Sie sind älter und kräftiger, als sie von der anderen Straßenseite aus gewirkt hatten, und er hätte kaum eine Chance, wenn sie alle gleichzeitig auf ihn losgingen.
»Verpiss dich«, sagt einer der Jungen.
»Lasst ihn in Ruhe«, sagt Xavier.
Jetzt sehen sie ihn alle an.
»Was willst du denn machen?« Der Anführer, von dem diese Provokation kommt, hat fiese Augen, einen schlaffen, verächtlichen Mund und Bartflaum auf der Oberlippe.
Xavier zögert.
Ein anderer sieht aus, als wollte er auf ihn losgehen, er macht mit ausgestreckter Faust vier, fünf schnelle Schritte auf ihn zu. Xavier zuckt zusammen, und die Jungen lachen. Er hat schon genug von dieser Situation und will nur noch weg. Er ist über dreißig, diese Jungen sind nicht einmal halb so alt, und trotzdem, denkt er ärgerlich, trotzdem habe ich Angst vor ihnen.
»Lasst ihn einfach in Ruhe«, sagt er noch einmal, dreht sich dann aber um und geht, und seine Wangen glühen von dem rauen Triumphgelächter, das über seine Schulter zu ihm dringt.
Er sucht, so schnell er kann, das Weite, ohne sich noch einmal umzudrehen und zu sehen, wie der Junge weiter gequält wird. In der sicheren Bayham Road Nr. 11 angekommen, wirft er die Tür zu, schüttelt den Schnee von seinen Hosenaufschlägen und geht die Treppe hinauf, vorbei an der Erdgeschosswohnung, wo Jamie von einer Fernsehsendung besänftigt wird – »Here we go, here we go, here we go again!«, singt eine gekünstelte, hektische Frauenstimme.
Den ganzen Nachmittag denkt er mit Unbehagen an den Vorfall zurück und wird das Gefühl nicht los, dass er noch mehr hätte tun können. Natürlich hätte er auch viel weniger tun können – einfach wegsehen. Das wäre vielleicht besser gewesen als dieser halbherzige Versuch. Er fragt sich, in welchem Zustand der Junge wohl nach Hause gegangen ist, lässt diese Spekulation aber sofort wieder sein. Er erweckt den Gasherd zu fauchendem Leben und stellt einen Topf Suppe zum Aufwärmen darauf.
Vielleicht, um an dem Rest schlechten Gewissens zu kratzen, den der Vorfall hinterlassen hat, widmet Xavier einen Teil des Nachmittags den Mails seiner Hörer. Nach der Sendung gibt er stets eine E-Mail-Adresse an, für die vielen Leute, die nicht durchgekommen sind, und seine Zuhörerpflichten gehen mittlerweile weit über die Grenzen der eigentlichen Sendung hinaus. Xavier versucht stets, sich auf eine Mail pro Person zu beschränken, um nicht in lange Korrespondenzen mit praktisch Unbekannten verwickelt zu werden, denn dazu reicht die Zeit einfach nicht; danach schickt er eine Standardmail, in der er auf andere Anlaufstellen verweist. Auch hier könnte er mehr tun, aber andererseits könnte er die Mails auch komplett ignorieren, wenn er wollte.
Montags kommt es meist besonders dick: die freien Zeitmengen am Wochenende führen mitunter zu quälend detaillierten Bekenntnissen, zu besonders eindringlichen Hilferufen aus der Einsamkeit. An diesem Nachmittag haben die meisten Schreiber eher Praktisches auf dem Herzen.
Xavier, was würdest du tun, wenn deine Frau ganz versessen darauf wäre, einen Bikini anzuziehen, du ihr aber – vorsichtig – beibringen willst, dass sie nicht die Figur dafür hat?
Sie müssen mir helfen. Ich habe über 50000 Pfund Schulden. Meine Frau weiß nichts davon, meine Kinder auch nicht, niemand weiß etwas davon.
Er fordert den Mann mit dem Bikiniproblem dazu heraus, sich zu überlegen, ob es nicht vielleicht um seine eigene Eitelkeit geht, und ermutigt den mit dem Schuldenproblem dazu, seiner Frau reinen Wein einzuschenken.
Menschen mit Problemen haben sich schon immer instinktiv an Xavier gewandt, oder er hat irgendeine zufällige Anziehungskraft auf sie ausgeübt. Er ist der Typ Mensch, der sich immer die Sorgen des Taxifahrers anhören muss oder mitfühlend nickt, wenn ihm ein Fremder im Aufzug plötzlich wortreich das Herz ausschüttet. Vielleicht hilft es, dass Frauen ihn gut aussehend finden (Vertraulichkeiten haben oft etwas Verführerisches, selbst sehr peinliche), aber vielleicht liegt es auch bloß daran, dass er die seltene Gabe hat zu schweigen. Xavier war es jedenfalls schon gewohnt, Leuten zuzuhören, bevor es Teil seines Jobs wurde – eigentlich entwickelte sich diese Gewohnheit schon, als er noch als Chris bekannt war.
Einmal, mit Mitte zwanzig, hatte sich Chris auf der Straße über eine Stunde lang mit einem Unbekannten unterhalten. Es war an einem Abend Anfang Oktober, und Melbourne stimmte sich auf den bevorstehenden langen Sommer ein. Ein erster Anflug von Hitze erfüllte die Luft, und mitten im sanft verblassenden Blau des Himmels hing träge ein noch blasserer Mond. Chris’ Arm lag auf Matildas Rücken: Sie waren noch kein offizielles Paar, sondern befanden sich in jener spannend-quälenden Phase von zärtlichen Berührungen, Insiderwitzen und Kosenamen. Durch ihr verwaschenes Nirvana-T-Shirt fühlte er den Verschluss ihres BHs. An der Ecke Brunswick- und Johnston-Street trennten sie sich, die drei anderen gingen in eine Richtung und Chris in die andere, um eine Straßenbahn zu nehmen.
An der Haltestelle stand ein obdachloser Alter mit einer Baseball-Kappe und einer Dose Lager in der Hand. Chris sagte höflich Hallo, und die beiden standen eine Weile still da und sahen zu, wie auf der anderen Straßenseite die Bahnen vorbeiratterten. Hinter ihnen klebte ein Mädchen Plakate für eine Rockband an eine Backsteinmauer. Chris dachte an Matilda, der er am Tag davor bei einem Trampolinwettbewerb zugesehen hatte. Jedes Mal, wenn sie gen Himmel flog, stellte er sich vor, hochzuspringen und sie in der Luft aufzufangen. Der Alte begann, vor sich hin zu singen, und sah freundlich zu Chris hinüber. Er wirkte wie ein Trinker, aber ein harmloser: einer, der im Leben so viel gebechert hat, dass er nie wieder richtig betrunken sein wird, aber auch nie wieder ganz nüchtern.
Er zwinkerte Chris zu.
»Na, wie war der Tag?«
»Ganz gut. War gerade im Kino.«
»Im Kino!« Der Alte gluckste. »Weißt du, wie lange ich schon nicht mehr im Kino war?« Er wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Das muss zwanzig Jahre her sein.«
Chris wusste nicht recht, was er antworten sollte, und fragte: »Und … und wie war Ihr Tag?«
»Weißt du«, sagte der Fremde, »ich werde nächsten Monat achtzig. Ein Wahnsinnsalter, nicht wahr?«
»Ja, ziemlich gut«, stimmte Chris zu.
»Wenn man so alt wird wie ich, will man über vieles lieber nicht nachdenken. Deshalb hab ich so eine Gruft im Kopf, weißt du, da kommt das alles rein.«
Er fingerte mit einer Zigarette herum und fischte mit zittriger Hand ein abgewetztes Feuerzeug aus seiner Jackentasche. Chris nahm die Zigarette und zündete sie für ihn an.
»Ich sage mir einfach, das ist jetzt in der Gruft«, fuhr der Alte fort. »Und passe auf, dass ich da nicht reingehe. Die ist abgeschlossen, verriegelt und verrammelt. Sogar für mich selber. Ich hab keine Ahnung, wo der Schlüssel ist.« Er lächelte Chris an, wobei erstaunlich gute Zähne zum Vorschein kamen.
Eine Straßenbahn nach der anderen surrte vorbei. Im Laufe der nächsten Stunde erzählte der Mann Chris, dass seine Frau in jungen Jahren starb und sein Bruder, ein Angehöriger der australischen Truppen, 1944 fiel. Seine Söhne waren beide eine Enttäuschung: Einer hätte Fußballer werden können, war aber zu faul, und der andere war nach Frankreich gegangen und hatte sich, wie der Mann es nannte, »mit Künstlern und Rauschgiftsüchtigen eingelassen«. Das Geschäft des Mannes, ein kleiner Lebensmittelladen, wurde im Laufe einiger Jahrzehnte von den neu aufkommenden Zeitungsshop-Ketten, den 7-Eleven-Geschäften und dem ganzen Rest in den Ruin getrieben. Mit Anfang vierzig merkte der Mann, dass er sich zu jungen Männern hingezogen fühlte und niemals in der Lage sein würde, dieses Verlangen zu stillen. Mitte der Siebziger unterschlug er Geld, um sein Geschäft anzukurbeln, und als die Sache mehr als zehn Jahre später ans Licht kam, ging einer seiner besten Freunde dafür ins Gefängnis. Und so weiter und so fort.
»Jep, ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen kann«, fasste der Alte zusammen und zeigte ein weiteres Mal seine Zähne. »Und ich weiß zwar, dass das alles passiert ist – ich hab’s dir ja gerade erzählt –, aber ich denk nicht dran. Ich geh einfach nicht in die Gruft. Verstehst du?«
»Und Sie wollen die … die Gruft wirklich nicht mal aufmachen?«, fragte Chris. »Einfach, um das mal aus dem Kopf zu kriegen?«
Der Alte zündete sich noch eine Zigarette an, hustete und grinste.
»Wenn ich weiß, dass ich sterbe«, sagte er, »in der letzten Stunde vielleicht, dann mach ich sie mal auf und denk gründlich über alles nach, und dann denk ich mir, gut, das war’s jetzt, worüber hast du dir eigentlich so einen Kopf gemacht?«
Als die nächste Straßenbahn kam, wurden die Augen des Alten auf einmal wässrig und flehend, und er packte Chris am Ärmel und bat ihn um einen Dollar. Chris drückt ihm einen Zehner in die Hand und stieg in die Bahn.
Als die Viererfreundschaft älter und komplexer wurde, wurde er mehr und mehr zum inoffiziellen Anführer der Viererbande, der Lebenstüchtigste von allen. Oft brauchte Russell seine Hilfe: Er behielt einfach keinen Job, nicht einmal einen, bei dem er im Karottenkostüm Flyer für eine Saftbar verteilen musste, er war chronisch pleite, und Bec wurde einfach nicht schwanger. Chris’ zwanzigjährige Freundschaft mit Russell war in vieler Hinsicht eine gute Vorbereitung auf die Arbeit mit Murray: derselbe Typ Mann, ein pummeliger Pechvogel, dem man mit gutem Willen und einer gewissen bösen Vorahnung begegnet, wie einem Wettbewerbsteilnehmer, den man anfeuert, obwohl man voll und ganz damit rechnet, dass er verliert.
Einmal im Bett hatte Matilda gesagt, ihr habe in den fünfzehn Jahren platonischer Freundschaft kaum etwas mehr Lust gemacht, Xavier die Kleider vom Leib zu reißen, als seine – sie fand kein besseres Wort – schiere Hilfsbereitschaft.
»Wie, es macht dich an, dass ich nett zu anderen Leuten bin?«
»Dass du ganz insgesamt ein netter Mensch bist. Ist das so komisch?«
»Und alles andere, womit ich versucht habe, dich zu beeindrucken – das hätte ich mir sparen können? Das ganze Geld für Klamotten, und dass ich mir Pretty Woman angetan habe? Ich hätte also bloß alten Omas über die Straße helfen müssen, bis du mit mir schläfst?«
»Bitte lass mir meine Illusionen.« Matilda lachte.
Xavier sieht aus dem Fenster in den freudlosen frühen Abend. Die Autos, immer noch mit Schnee überzogen, sehen aus wie Tiere auf einer reifbedeckten Weide. Ein Paar mittleren Alters, beide in roten Regenmänteln, die aussehen, als wären sie für das Wetter zu dünn, klammern sich Halt suchend aneinander und eiern Stückchen für Stückchen über den glatten Gehweg. Xavier fragt sich, ob eine von den Frauen beim Speed-Dating seine angeblich so attraktive Freundlichkeit bemerken wird, ob er sie eigentlich überhaupt noch besitzt. Er wünschte, er hätte Murray nicht zugesagt für heute Abend, und überlegt, ob es nicht vielleicht doch sein könnte, dass das Speed-Dating ausfällt.
Aber wie er sich schon die ganze Zeit dachte, hat die widrige Witterung der Veranstaltung nichts anhaben können. Sechs oder sieben Leute haben es nicht geschafft, dafür sind eine Handvoll andere gekommen, dank der spärlichen Zahl von anderen Attraktionen, die London an diesem verschneiten Abend zu bieten hat: Kinos und Restaurants haben wegen Personalmangel geschlossen. Die Veranstaltung findet in einem Nachtclub mit noblen Samtsofas und Schummerbeleuchtung statt. Da, wo normalerweise die Tanzfläche ist, sind im Karree Tische aufgestellt.
Murray ist seinen buschigen Locken mit einer Extraladung Haargel zu Leibe gerückt. Er trägt ein knallrotes Hemd, und unter den Achseln breiten sich bereits dunkelrote Flecke aus. Als er Xavier sieht, wirkt er erleichtert. Die einsamen Herzen stehen verlegen in der Bar herum, bis der Moderator, ein gutaussehender Schwarzer im Anzug, in ein kabelloses Mikro spricht.
»Okay, Leute. Jeder von euch hat eine Nummer bekommen.« Murray hat die 4 und Xavier die 8, nicht die 11, die er gern gehabt hätte. »Gleich werde ich euch bitten, an den Tisch mit eurer Nummer zu gehen. Dann setzt sich euer erstes Date zu euch. Jedes Mal, wenn ihr die Sirene hört« – es ertönt etwas, das wie eine aus dem Auto gerissene Hupe klingt – »gehen die Herren der Schöpfung einen Tisch weiter. Am Ende des Abends schreibt ihr die Nummern von allen auf, die ihr gern wiedersehen würdet, und wir verkuppeln euch dann. Seid ihr bereit?«
Falls der Moderator für seine abgenudelte Leier einen Beifallssturm erwartet hat, wird er enttäuscht: Die Teilnehmer schlurfen murmelnd zu ihren Tischen.
»Viel Glück«, sagt Xavier zu Murray und klopft ihm auf den speckigen Rücken.
In den nächsten anderthalb Stunden drehen sie auf Befehl der Hupe eine Runde durch den Raum; manchmal ist sie eine Unterbrechung des Drei-Minuten-Dates, öfter jedoch eine willkommene Erlösung. Auf jedes Hupen folgt ein kollektives Stühleschrappen, die Masse setzt sich unsicher in Bewegung und lässt sich am nächsten Tisch nieder. Das Ganze wirkt wie eine Abfolge vorgeschriebener Transaktionen, eher wie eine choreographierte Übung als ein Austausch von Gefühlen. Aber vielleicht finden die Leute ja gerade das reizvoll, überlegt Xavier.
4: Okay, also, was hast du so für … Hobbys und Interessen und so?
Xavier: Ich spiele Scrabble.
4: Scrabble?
Xavier: Ja, Turnier-Scrabble. Als Wettbewerb.
4: Es gibt Scrabble-Turniere?
Xavier: Ja, das ist –
4: Geht es bei Scrabble nicht einfach nur darum, wer die längsten Wörter kennt?
Xavier: Nicht unbedingt. Es gibt ziemlich viele Taktiken. Man kann zum Beispiel –
4: So genau will ich es nun auch wieder nicht wissen.
Xavier: Ach so.
9: Und, was machst du beruflich?
Xavier: Ich, äh, ich bin Filmkritiker.
9: Cool. Auf was für Filme stehst du denn so?
Xavier: Äh …
9: Hast du die Harry-Potter-Filme gesehen?
Xavier: Nein.
9: Musst du dir unbedingt ansehen. Aber sag mal, du klingst irgendwie, als wärst du Australier, wie ich.
Xavier: Ja, ich komme aus Melbourne. Aber ich lebe jetzt hier.
9: Wieso bist du weggegangen? Gefällt’s dir hier besser?
Xavier: Das ist eine lange Geschichte. Es ist was passiert, und dann konnte ich nicht mehr dort bleiben.
9: Krass. Aber sag mal, findest du nicht auch irgendwie, dass es schwer ist, mit den Leuten hier ins Gespräch zu kommen?
12: Ich bin Putzfrau. Zwei Tage die Woche mache ich in einer Hotelkette sauber, und ich mache einmalige Einsätze bei allen möglichen Geschäftskunden. Und außerdem putze ich wöchentlich bei Privatleuten. Für zwölf Pfund die Stunde. Das ist viel für eine Putzfrau. Ich bin aber auch richtig gut. Entschuldige, ich rede und rede. Ich bin ein richtiges Plappermaul. Besonders wenn ich jemanden neu kennenlerne.
Xavier: Ich brauche eine Putzfrau. Bei mir sieht’s aus wie Kraut und Rüben.
12: Ich könnte am Samstag.
Xavier: Okay. Dann simse ich dir meine Adresse.
12: Prima.
Xavier: Okay, wir sollten wohl mal weitermachen mit dem, äh …
12: Ich glaub, die Hupe geht gleich.
22: Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Woher kenne ich denn deine Stimme?
Xavier: Ich glaube, du irrst dich.
22: Bist du im Fernsehen oder so?
Xavier: Nein.
22: Hm. Um ehrlich zu sein, ich hab schon einen Freund. Ich bin bloß mit einer Freundin mitgekommen.
Xavier: Und ich mit einem Freund.
22: Echt? Welcher ist es?
Xavier: Der da hinten. Mit dem roten Hemd. Und den Locken.
22: Ach der. Ja, der war ganz nett. Aber das Stottern …
Xavier: Ich weiß.
Als die letzten ›Dates‹ vorbei sind und die Veranstaltung als ganz normaler Singleabend ausklingt, liegt spürbare Erleichterung in der Luft, und rund um die Bar kommen weniger steife Versionen der Gespräche an den Tischen in Gang. Ein DJ legt Club-Remix-Versionen von Sechziger-Jahre-Hits auf, die hin und wieder von den Ansagen des Moderators unterbrochen werden – »Ab auf den Floor, Leute!« Xavier geht zu Murray, der den obersten Hemdknopf geöffnet hat. Sein Haar hat sich in zwei breite Lager geteilt; hier und da wird es noch von dem Gel in Stellung gehalten, woanders springen widerspenstige Strähnen hoch.
»Und jetzt freuen wir uns auf die Abzocke an der Bar.«
»Wie lief’s bei dir?«, fragt ihn Xavier.
»G-g-gar nicht schlecht. Ein paar haben d-definitiv angebissen. Abwarten und Tee trinken. Und bei dir?«
»Ich habe eine Putzfrau engagiert. Der Abend war also nicht ganz für die Katz.«
Es ist bereits zehn Uhr, um Mitternacht werden sie auf Sendung sein. Xavier geht raus und besorgt ein Taxi, während sich Murray an der proppevollen Bar anstellt, um noch schnell zwei Drinks zu bestellen. Es wird nicht das erste Mal sein, dass sie ihre Sendung unter leichtem Alkoholeinfluss machen. Draußen vor der Bar hört Xavier immer noch das basslastige Stampfen der Musik. Er denkt an die vier Stunden im Studio, die vor ihm liegen, und lässt die Ereignisse des Tages oberflächlich Revue passieren. Die Auseinandersetzung der Jungen im Schnee beunruhigt ihn immer noch, aber er sagt sich, dass er sich nicht alles so zu Herzen nehmen darf, und versucht, nicht mehr daran zu denken. Er kann schließlich nicht auf jeden Menschen in London aufpassen. Außerdem liegt die Sache ja schon in der Vergangenheit.
II Manchmal hat Xavier noch keine Lust, ins Bett zu gehen, wenn Murray ihn morgens um halb fünf zu Hause absetzt. Dann sitzt er im Wohnzimmer vor den unbekannten Kriegsfilmen, die frühmorgens im Fernsehen kommen, oder schaltet auf irgendeinen Nachrichtensender und starrt auf das Laufband am unteren Rand mit seinen endlosen Telegrammbotschaften: WEITERERWIRTSCHAFTSABSCHWUNGBEFÜRCHTET, PRÄSIDENTAUFÜBERRASCHUNGSBESUCHIMIRAK, NOBELPREISTRÄGERGEEHRT. Er sieht zu, wie irgendwelche Amerikaner mit leuchtenden Augen jedes noch so kleine Nachrichtenhäppchen durchkauen und zu Korrespondenten in jedem Kriegsgebiet der Welt schalten. Wenn sich Xavier den Gaza-Streifen oder Afghanistan vorstellt, wimmelt es dort nur so von Reportern und Kamerateams, die sich um jede Auseinandersetzung herumdrängen.
Manchmal setzt er sich ins Arbeitszimmer und schaltet den Computer ein. Die Radiosendung bringt ihm genug ein, um die moderate Miete zu zahlen, die noch nie angehoben wurde, seit er hier wohnt: Die Vermieterin ist mit einem Millionär verheiratet und macht sich kaum je die Mühe, das Geld überhaupt zu kassieren. Aber allein schon, um eine Beschäftigung zu haben, schreibt Xavier Filmkritiken für verschiedene Londoner Stadtmagazine und regelmäßige Kolumnen für überregionale Zeitschriften, deren Leser nach Lebenshilfe suchen.