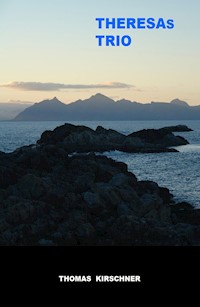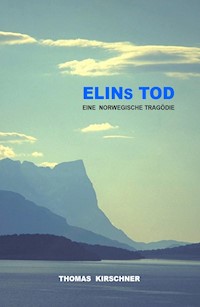
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Theresa-Themis-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Sonja, eine junge Frau aus Deutschland, reist zum Studium nach Norwegen. Ihre Großmutter Elin gilt seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen. Sonja stellt Nachforschungen an und erfährt, dass Elin bei der Seeschlacht um Narvik einen deutschen Seemann vor dem Ertrinken gerettet hat. Sie versetzt sich in die Vergangenheit mit dem ganzen Schrecken, der Grausamkeit und Tragik des Krieges. Auf den Lofoten lernt Sonja eine junge Norwegerin kennen. Freya besucht ihre Großmutter Kristiana, die Elin gekannt hat. Das Schicksal ihrer Großeltern beschäftigt Sonja sehr: Johannes ist 1944 bei dem Untergang des Schlachtschiffes Tirpitz vor Tromsø umgekommen, aber Elins Tod erscheint mysteriös. Plötzlich geschehen merkwürdige Dinge und Sonja wird ernsthaft bedroht, als wolle jemand verhindern, dass die Wahrheit über Elins Verschwinden ans Licht kommt. Sie verlässt die Lofoten und beginnt in Tromsø ihr Studium. Aber dort sieht sie sich neuen Anfeindungen ausgesetzt … Dann erreicht sie die Nachricht, dass ihr Vater in Trondheim gestorben ist. Die Todesursache ist unklar. Freunde begleiten sie dorthin - darunter Theresa, die in besonderer Weise Anteil an Sonjas Schicksal nimmt. Sie beginnen auf eigene Faust zu recherchieren und kommen einem mächtigen Feind auf die Spur. Trauer, Verzweiflung und Angst wandeln sich in Wut - es ist ein gutes Gefühl, jetzt aus der Rolle der Gejagten in die der Jägerin zu wechseln. Eine Verfolgungsjagd beginnt, die erneut in den Norden führt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ELINS TOD
EINE NORWEGISCHE TRAGÖDIE
THOMAS KIRSCHNER
© 2021 Thomas Kirschner
Autor: Thomas Kirschner
Umschlaggestaltung: Thomas Kirschner
Lektorat, Korrektorat: Deutsches Lektorenbüro Würzburg
Dr. Ursula Ruppert & Rudolf Langer
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-347-31522-8
ISBN Hardcover: 978-3-347-31523-5
ISBN e-Book: 978-3-347-31524-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
INHALTSVERZEICHNIS
TEIL EINS
Kapitel 1.1
Ferien auf den Lofoten
Kapitel 1.2
Das Tagebuch
Kapitel 1.3
Ahnenforschung
TEIL ZWEI
Kapitel 2.1
Die dunkle Stadt im Norden
Kapitel 2.2
Wintersemester
Kapitel 2.3
Freya
Kapitel 2.4
Frühlingsanfang
TEIL DREI
Kapitel 3.1
Auf den Spuren der Tirpitz
Kapitel 3.2
Semesterferien
Kapitel 3.3
Auf Tournee
TEIL VIER
Kapitel 4.1
Vaters Tod
Kapitel 4.2
Ånstad
EPILOG
Zwölf Jahre später
ANHANG
Über dieses Buch
Biografien der Protagonisten
Glossar
Bildnachweis
Dank
Schlachtschiff "Tirpitz"
Landkarten
PERSONEN
Sonja Feldhoff
Studentin, Tänzerin aus Frankfurt jung, unerfahren, offen, zeigt unerwartete Stärke
Alexandra Bruhns
Staatsanwältin, ihre Mutter will ihre Tochter behüten
Manuel Feldhoff
Rechtsanwalt, ihr Vater hat ein Norwegen-Trauma
Elin Håkonsen
Händlerin, Manuels Mutter aus Ånstad unkonventionell, frivol, tatkräftig
Johannes Feldhoff
Seemann, Manuels Vater aus Hamburg die Lebensretterin Elin ist seine große Liebe
Freya Gudmundsson
Musikerin aus Å i Lofoten Tochter einer Kriegsheldin aus Ånstad
Greta Andersson
Hotelbesitzerin in Sørvågen hat Angst um das ererbte Vermögen
Leif Andersson
Spediteur in Sørvågen hat Panik um das ererbte Vermögen, fühlt sich als Widerstandskämpfer wie 1940
Dr. Johann Haugen
Arzt in Moskenes sein Vater war schon Arzt im Zweiten Weltkrieg
Thorstein Andersson
Großgrundbesitzer in Sørvågen 1940 gab Elin eine Chance
Asbjørn Heimdal
Jugendlicher in Ånstad 1940 beteiligt sich an der Gewalt gegen die Kollaborateurin Elin
Einar Gustavsson
Polizist in Ånstad 1940 kann nichts für Elin tun
Erich Tarnow
Ortskommandant von Svolvær 1940 führt die Hochzeit kraft seines Amtes durch
Per Østby
Fischer aus Ånstad 1940 hat freundschaftlichen Kontakt zu Johannes
Geir und Thorhild Nordal
Nachbarn in Ånstad 1940 behandeln Johannes und Elin fair
Kristiana Nordal
ihre Tochter geht 1940 in den Widerstand
Dr. Karl Haugen
Arzt in Moskenes 1940 behandelt Freund und Feind getreu seinem Eid
Anna Lien
Hauswirtin in Bodø 1941 beherbergt die kleine Familie
Sigrid Lien
ihre Tochter in Bodø gute Zeitzeugin
Solveig Bodin
Studentin aus Trondheim hat Angst vor den Herausforderungen des Lebens, klammert sich an die Kommilitonin Sonja
Franca Bodin
Staatsanwältin, ihre Mutter gut befreundet mit Sonjas Mutter
Saïra Koïvisto
Studentin aus Kautokeino tut sich schwer, die ererbte Deutschfeindlichkeit zu überwinden
Sven-Olav Gudmundsson
Musiker aus Å i Lofoten, Freyas Bruder hat Liebeskummer, Sonja mag ihn
Lena Nordal
Kristianas Kusine in Tromsø 1943 sorgt für ein letztes glückliches Weihnachtsfest der kleinen Familie
Clemens
Kamerad von Johannes auf der Tirpitz treuer Freund
Wolf Junge
1. Offizier der Tirpitz Held für einen Tag
Hugo Heydal
Navigationsoffizier der Tirpitz Vorgesetzter von Johannes
Christian Keller
Musik-Produzent aus Frankfurt integriert die Tänzerin Sonja in die Band
Theresa Themis
Musikerin aus Hamilton, Neuseeland Mastermind der Gruppe Black Rose, mag Sonja sehr
Cynthia Peterson
Musikerin aus San Francisco einfühlsame Freundin, Kämpferin
Einar Heimdal
Sohn von Asbjørn in Sørvågen wichtiger Zeitzeuge
Svensson
Bediensteter der Anderssons in Sørvågen 1944 wichtiger Zeitzeuge
Fritjof Andersson
Sohn von Thorstein in Sørvågen 1944 wird aus Panik um das Familienerbe zum Mörder
Larsen
Fischer aus Reine 1945 abhängig von Fritjof
Rena Larsen
Tochter von Larsen in Reine begegnet Sonja unvoreingenommen
Arvid Larsen
Fischer aus Reine, Sohn von Rena unterstützt bei der Suche nach der Wahrheit
Søren
Mechaniker in Reine, Arvids Freund Schulkamerad von Freya
TEIL EINS
Kapitel 1.1London. Auf vielfältige Weise anregend
In Gedanken versunken fuhr ich mit dem Wagen hinaus an eine einsame Stelle der Küste; in dieser spektakulären Umgebung hoffte ich, einen klaren Kopf zu bekommen. Es gab vieles, über das ich nachdenken musste, seit ich an diesem Morgen den Brief meiner Mutter – mit vollem Namen und Titel Dr. Alexandra Bruhns, Staatsanwältin – gelesen hatte.
Ich stellte mein Auto auf dem kaum befahrenen Feldweg ab; dieser Landstrich an der Außenseite der Lofoten ist unbesiedelt und kaum jemand verirrte sich hierher.
Es war herrlich warm, und so zog ich mich aus, legte mich in die Sonne und dachte nach: Ich war also zu einem Viertel Norwegerin!
Das war ein seltsames Gefühl. Bis heute Morgen hatte ich mich für eine ganz normale Deutsche gehalten, aber nun hatte mich Alex' Brief eines Besseren belehrt.
So ganz konnte ich es noch gar nicht glauben: Meine langen Haare sind fast schwarz, und mein Teint ist relativ dunkel. Mein portugiesischer Tanzlehrer in Frankfurt hatte meine Vorfahren auf der Iberischen Halbinsel vermutet, aber bisher hatte ich nur gewusst, dass meine Eltern aus Hamburg stammten. Alexandras Vorfahren waren Hamburger Kaufleute gewesen. Mein Vater Manuel, erfolgreicher Rechtsanwalt in Bad Homburg, war bei seinen Großeltern väterlicherseits in Hamburg aufgewachsen, Alex hatte seinen Großvater noch kennengelernt, aber sein Vater war aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurückgekehrt. Über seine mütterliche Linie war mir nichts bekannt.
Jetzt schrieb Alex, dass Manuels Mutter Norwegerin gewesen war! Alex hatte Manuels Geburtsurkunde gefunden, aus der das eindeutig zu entnehmen war.
Ich dachte an früher, an die Zeit vor der Scheidung von Alex und Manuel: Vater hatte nie über seine Eltern gesprochen und war immer, wenn das Gespräch auf sie kam, ungewöhnlich zurückhaltend und verschlossen gewesen. Später hatten Mutter und ich dieses Thema gemieden.
Meine Gedanken wanderten weiter, und jetzt erschienen mir weitere sonderbare Verhaltensweisen Manuels in einem anderen Licht. Nach der Trennung meiner Eltern war ich in unserem Haus in Bad Homburg bei meinem Vater geblieben und hatte hautnah miterlebt, wie negativ er auf Alex' Versetzung nach Norwegen reagiert hatte.
Vielleicht weil ich meine Mutter vermisste, hatte ich begonnen, mich für Norwegen zu interessieren, und beschlossen, nach dem Abitur dort zu studieren. Manuel hatte sich vehement dagegen ausgesprochen und versucht, mir das auszureden. Ich dachte ungern an diese Szene zurück. Wir waren bis dahin sehr gut miteinander ausgekommen, und so belastete mich diese heftige Auseinandersetzung sehr. Vater konnte keine vernünftigen Gründe für seinen Widerstand nennen; dabei war er so stur und schroff, wie ich ihn nie zuvor erlebt hatte. Er konnte mich aber nicht aufhalten, da ich inzwischen volljährig geworden war. Nur ein paar Tage später habe ich mein Gepäck ins Auto geladen und war losgefahren. Wenigstens war der Abschied einigermaßen versöhnlich gewesen. Vor dem Hintergrund meines neuen Wissens erschien mir diese Haltung umso befremdlicher. Wenn er doch zum Teil norwegischer Abstammung war, warum sträubte er sich so sehr dagegen, dass ich oder Alex in dieses Land reisten?
Ein leichter Wind strich sanft über meine Haut; der Sommer war ungewöhnlich heiß für norwegische Verhältnisse. Ich hatte gelesen, das Temperaturmittel der Lofoten liege mehr als 20° Celsius über dem Durchschnitt dieser Breitenlage, was der Inselgruppe eine der größten positiven Temperaturanomalien der Erde verschaffe. Geowissenschaften sind mein Spezialgebiet, und besonders interessiere ich mich für Erdkunde und Ökologie. Wie schön, wenn ich das eines Tages zu meinem Berufsinhalt machen könnte.
Ich schaute die Umgebung auf einmal mit ganz anderen Augen an: Also war dieses Land – ich blickte mich mit einem gewissen Staunen in der beeindruckend schönen Szenerie um – nun auch mein Heimatland. Der Gedanke gefiel mir. Meine Augen wanderten von dem aufgewühlten Nordatlantik mit seiner leuchtend weißen Brandung zur Steilküste, auf deren schmalem Uferstreifen gerade Platz für die kleine Schotterstraße war, und zu meinem Wagen, einem Sportcoupé, das ich Charly getauft hatte. Sein dunkelblauer Metallic-Lack glänzte in der Sonne und bildete mit seinem modernen Design einen großen Kontrast zu dieser urweltlichen Landschaft.
Welch ein weiter Weg lag hinter uns: von Frankfurt über Trondheim, der neuen Heimat meiner Mutter, bis hierher, mehrere tausend Kilometer weit in den höchsten Norden Europas.
Das Telefon klingelte.
Unwillig stöhnend öffnete ich die Augen und streckte mich, brachte es aber nicht fertig aufzustehen und ließ noch einen Moment lang die paradiesische Szenerie auf mich wirken. Tief unter mir rollten die Wellen des tiefblauen Atlantiks an die Felsen und brachen sich geräuschvoll in blendend weißen Kaskaden. Ich war mir auf einmal meiner physischen Existenz, meines nackten Körpers in dieser Landschaft besonders bewusst, spürte intensiv den sonnengewärmten Felsen unter mir und das Gras an meinen Beinen.
Wieder klingelte es. Ich hätte mein Handy doch abschalten sollen! Ich ging barfuß zum Auto zurück und genoss die Erde unter meinen Fußsohlen. Durchs offene Fenster wühlte ich in meinen Sachen, bis ich das Handy fand. Es war Alex, die übers Wochenende zu ihrem Vater nach Hamburg gefahren war. Erstaunlich, dass sie sich schon wieder meldete, wo sie mir doch gerade erst geschrieben hatte. Es war sonst nicht ihre Art, ständig Kontakt mit mir aufzunehmen. Kamen doch wieder alte mütterliche Instinkte mit dem überkommenen Kontrollzwang zum Vorschein? Ihre Stimme klang trotz der großen Entfernung bemerkenswert deutlich. Ich lehnte mich an, dabei berührte meine Haut die Karosserie des Wagens. Ich schrie kurz auf, so heiß war das Blech in der Sommersonne geworden.
»Was ist denn los, Töchterlein?« Ich hasse es, wenn mich Alex so nennt, aber ich ließ sie fortfahren: »Egal; hast du meinen Brief bekommen?«
»Ja, heute Morgen.«
Alex fuhr aufgeregt fort: »Ich war ziemlich überrascht, als mir mein Vater die alte Truhe mit den Sachen von Manuels Vater zeigte. Nach der Auflösung des Haushalts seiner Großeltern väterlicherseits, das war 1970, hatte Manuel ein paar Sachen bei meinen Eltern untergestellt; ich weiß nicht, ob du dich an die kleine Wohnung in Altona erinnerst. Als wir nach Frankfurt umgezogen sind, haben wir das meiste mitgenommen oder weggegeben; bis auf diese Truhe, die dann aber in Vergessenheit geriet. Vor Kurzem hat sie mein Vater wiederentdeckt und Manuel angerufen, aber der hatte kein Interesse daran. Im Gegenteil: Er bat sogar darum, den ganzen alten Krempel wegzuschmeißen, aber das brachte Vater nicht fertig. Du kennst ihn ja, Sonja.«
»Und darin hast du dann seine Geburtsurkunde entdeckt?«
»Ja, ich fand das merkwürdig. Alle hatten seinerzeit gedacht, die Unterlagen und Urkunden über Manuels Eltern und über seine Geburt seien verschwunden, möglicherweise bei den Bombenangriffen gegen Kriegsende verbrannt.«
Der Wind frischte auf, ich erschauerte und setzte mich ins Auto. »Hast du Manuel von deinem Fund erzählt?«
»Nein, noch nicht«, antwortete Alex zögernd. »Er hatte so eindringlich darum gebeten, die Kiste zu vernichten. Und du weißt sicher noch, wie ungern er über seine Eltern spricht.«
Ein kurzes Schweigen setzte ein; es drückte unsere Ratlosigkeit angesichts von Manuels unerklärlichem Verhalten aus. Ich riss mich von meinen Gedanken los und fragte Alex mit gespielter Munterkeit: »Was war denn sonst noch in der Kiste?«
»Nur ein paar alte Bücher. Ich habe sie mir noch gar nicht alle angesehen. Außerdem einige Orden. Aber, weshalb ich dich anrufe: Ich habe dir die Geburtsurkunde gerade ins Hotel gefaxt!« »Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich fahre sofort ins Hotel und schau sie mir an.«
Auf einmal hatte ich es furchtbar eilig; Neugier und Euphorie trieben mich an. Ich schlüpfte in Jeans und T-Shirt, glitt auf den Fahrersitz und fuhr los. Ich hetzte den Ford Probe über den Schotterweg zwischen Vestresand und der Hauptstraße. Ein paar Mal schlingerte der Wagen gefährlich auf dem losen Untergrund, aber ich konnte ihn gerade noch abfangen.
»Charly, du alte Kiste! Nun komm schon«, sagte ich streng. Albernerweise redete ich manchmal mit ihm. Der Wagen hatte zwar etliche Jahre auf dem Buckel und zeigte äußerlich ein paar kleine Macken, aber die Technik war in bestem Zustand, und ich liebte das schöne und kompakte Sportcoupé heiß und innig. Ich hatte ihn direkt nach meiner Führerscheinprüfung in Frankfurt gebraucht gekauft.
Auf der Staatsstraße 19 kam ich besser voran und genoss die schnelle Fahrt – besonders, als ich die Auffahrt zur spektakulären Brücke über den Sundklakk-Straumen hinaufschoss. Ich kam inzwischen sehr gut mit dem Wagen zurecht, und das Handling war großartig. Er lenkte willig ein, lag satt auf der Straße und umrundete schnelle Kurven absolut neutral. Kleinere Korrekturen nahm er gutmütig hin, und so entwickelte sich ein perfektes Zusammenspiel von Mensch und Maschine; einer Maschine, die für mich fast schon eine Persönlichkeit war.
Beim Fahren nahm ich die Umgebung intensiv wahr: Die Sonne stand hoch über den tiefblauen Fluten der schnell strömenden Wasserstraße, die Berge bildeten eine bizarre Kulisse. Dazu passten die Klänge von Steve Morse & The Dregs aus dem CD-Player meines Autos. Die Zusammenstellung hatte meine Mutter selbst auf CD gebrannt. Eine virtuose Musik – modern, extravagant und rein instrumental –, die Alex total begeisterte. Ich verstehe nicht besonders viel von Musik, aber auch mich sprachen diese ausgefeilten, progressiven Stücke ganz unmittelbar und intensiv an.
Ich umrundete in schneller Fahrt die kleine Insel Gimsøya und überquerte die zweite große Brücke zur Insel Austvågøy. Kurz vor dem Tunnel, der ins Innere der Insel führt, bemerkte ich am Straßenrand einen Polizisten, der mich unmissverständlich herauswinkte. Klopfenden Herzens bremste ich. Der Polizist wirkte zunächst verblüfft, als er im Wagen eine junge Frau erblickte, dann ermahnte er mich, ich sei zu schnell gefahren. Ich fragte nur: »How much?« und stellte kühl einen Scheck aus. Die Höhe des Bußgeldes war schmerzlich, aber das wollte ich mir nicht anmerken lassen.
Der Polizist nahm den Scheck an sich, und der Vorgang schien schon abgeschlossen, da bemerkte ich, wie sein Blick an mir herunterwanderte. Jetzt erst fiel mir auf, dass ich das Shirt nicht ganz heruntergestreift hatte, und instinktiv zog ich meinen eigentlich nicht vorhandenen Bauch ein. Jetzt lächelte der Polizist – im Grunde ein netter junger Mann. Ich lächelte zurück und schob den Stoff herunter. Wir verabschiedeten uns freundlich, und etwas langsamer setzte ich meine Fahrt nach Svolvær fort.
Mir ging durch den Kopf, wie ich hierhergekommen war: Als meine Mutter vor einem Jahr nach Norwegen gezogen war, hatte ich nicht geahnt, dass ich ihr bald folgen würde. Sie war von ihrer Behörde im Rahmen eines Austauschprogramms nach Trondheim versetzt worden. Die Hintergründe hatte ich nie so ganz durchschaut. Jedenfalls war ihr letzter Fall so brisant gewesen, dass man sie aus Gründen ihrer persönlichen Sicherheit für einige Zeit aus Frankfurt entfernen wollte. Ich vermutete eine Mafia-Geschichte dahinter.
Angeregt durch Alex las ich alles, was ich über Norwegen in die Finger bekommen konnte. Das Land im äußersten Norden Europas begann, eine besondere Faszination auf mich auszuüben. Und es passte zu meinen Ideen, was mein Studium betraf.
Im März war ich zu meiner Mutter nach Trondheim gefahren, um Norwegisch zu lernen.
Mein Studium würde ich allerdings in Tromsø aufnehmen. Diese Stadt ganz im Norden bot für meinen Studiengang Geowissenschaften mit Ozeanografie und Meeresbiologie sehr interessante Schwerpunkte.
Den Sommer vor Studienbeginn wollte ich nutzen, um mir Nordnorwegen ein wenig anzusehen. Ich musste erst Anfang September in Tromsø sein, hatte also noch einige Monate Zeit und war allein losgezogen. Alex sah das nicht so gern, aber sie war an meine Alleingänge gewöhnt. Nur das Handy hatte sie mir aufgeschwatzt. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich es inzwischen zu schätzen gelernt habe. Auch hat es Alex nie als Instrument mütterlicher Kontrolle missbraucht.
Also war ich mit meinem Auto, auf das ich mächtig stolz war, nach Norden aufgebrochen. Der Ford Probe war ein elegant gestyltes Sportcoupé. Ein Ford dieser Klasse hatte kein gutes Image, und so verkaufte sich dieser Typ nicht gut. Der Gebrauchtwagenpreis war schnell in erschwingliche Regionen gefallen. Angeberei war für mich – fast – kein Motiv für den Kauf gewesen. Ich bin ein richtiger Auto-Freak. Schon als Kind konnte ich mit typischen Mädchen-Hobbys nicht viel anfangen und habe den Jungen mit meinen Autokenntnissen was vorgemacht.
Beim Gedanken an meinen Weg hierher musste ich grinsen. Die Fähre hatte mich von Skutvik nach Svolvær auf den Lofoten gebracht. Das war vor dem Wetterumschwung gewesen, und die Sturmfahrt über den breiten Vestfjord zwischen dem Festland und den Lofoten war gelinde gesagt interessant gewesen. Ich hatte nicht gedacht, dass ein so großes Schiff so heftige Bewegungen vollführen konnte. Wenigstens hatte ich auf diese Weise feststellen können, dass ich nicht anfällig für Seekrankheit bin.
Meine Gedanken konzentrierten sich wieder auf die unmittelbare Gegenwart, als ich um die Ecke der Hauptstraße am alten Hafen bog und das im Stil alter Lagerhäuser gebaute Hotel in Sicht kam. Ich fuhr über die Brücke auf die kleine Insel Lamholmen und parkte vor dem Haupteingang. An der Rezeption fragte ich sofort nach dem Fax, ging auf mein Zimmer und schaute mir die Urkunde an. Da stand es nun schwarz auf weiß:
Viele Male las ich mir das Dokument durch und dachte über meinen Vater nach: geboren im Krieg, im besetzten Norwegen, als Sohn eines deutschen Soldaten und einer norwegischen Frau. Johannes Feldhoff, mein Großvater, war damals erst 21 gewesen – mir selbst fehlten nur wenige Jahre zu diesem Alter!
Die Bezeichnung Obermaat sagte mir nicht viel. Was hatte er in Bodø gemacht?
In Trondheim bei meiner Mutter hatte ich viel über Norwegen, die Geschichte des Landes und den Krieg gelesen. Dabei hatte ich mich gefragt, wie ich als Deutsche mit dem Wissen um das, was meine Vorfahren hier angerichtet haben, leben kann. Wie viel Schuld hatte mein Großvater auf sich geladen?
Eine Weile rätselte ich über die Abkürzung EK I, ehe mir klar wurde, dass es sich um das Eiserne Kreuz Erster Klasse, eine Tapferkeits-Auszeichnung der deutschen Wehrmacht, handeln musste. Dazu die Narvik-Spange – war er ein Kriegsheld gewesen?
Elin Håkonsen, meine Großmutter, stammte offenbar aus einem Ort namens Ånstad in der Gemeinde Moskenes. Der Ortsname Moskenes kam mir bekannt vor! Ich suchte meine Karte von den Lofoten heraus und fuhr mit dem Finger auf der Karte die Inselkette nach Süden ab: Austvågøy (wo ich mich gerade befand), Gimsøy, Vestvågøy (wohin ich meinen Morgenausflug gemacht hatte), Flakstadøy und Moskenesøy. Auf den beiden südlichsten Inseln war ich noch nicht gewesen.
In der Kommune Moskenes fand ich nur fünf Ortschaften: Reine, Moskenes, Sørvågen, Tind und Å. Reine und den Ort mit dem kuriosen Namen Å kannte ich von Bildern, aber nirgendwo fand ich Ånstad!
Elin (der Name gefiel mir) war mit 24 etwas älter als Johannes gewesen. Wie war sie dazu gekommen, einen Soldaten der Besatzungsmacht zu heiraten? War sie in den Augen ihrer Landsleute dadurch nicht zu einer Kollaborateurin geworden?
Viele Fragen schossen mir durch den Kopf, von denen mir die wichtigste war: Was war aus den beiden geworden?
Kurz entschlossen griff ich zum Telefon und wählte die Nummer meines Vaters in Bad Homburg bei Frankfurt. Trotz Alex' Bedenken wollte ich ihn nun doch unbedingt sprechen. Die Verbindung nach Deutschland war erstaunlich gut, und ich erreichte auf Anhieb sein Büro. Die Anwaltsgehilfin konnte mir aber nur sagen, dass er sich auf Geschäftsreise befand. Weder sein Reiseziel noch die Dauer seiner Abwesenheit durfte sie mir mitteilen.
Unruhig lief ich im Hotelzimmer auf und ab. Es war später Nachmittag, als ich zu einem Entschluss kam: Ich warf ein paar Sachen in die Reisetasche, stieg ins Auto, orientierte mich kurz auf der Karte und nahm die Route, die ich am Morgen schon einmal gefahren war. Nach dem Tunnel passte ich auf und fuhr diesmal ganz langsam an der Polizeikontrolle vorbei – dann überquerte ich wieder die Brücken und war auf Vestvågøy. Nach der Abzweigung nach Vestresand betrat ich Neuland. Im relativ dicht besiedelten Landesinneren kam ich an einem Wikingermuseum vorbei, fuhr aber weiter, bis ich durch den Nappsund-Tunnel auf die Flakstadøya gelangte.
Im Süden begann der spektakulärste Teil der Lofoten. Die Landschaft zwischen Flakstad und Reine fand ich wahrhaft atemberaubend und fast beängstigend schön. Ich hielt am Straßenrand an, stieg aus und sah mich um: Die Landschaft schien bizarr übersteigert und erinnerte mich an die surrealistischen Bilder der Fantasy-Art. Es hatte den Anschein, als stünden die steilen, spitzen Berge direkt im Ozean – die Ufer waren so schmal und felsig, dass kaum Platz für Straßen oder Häuser blieb. Das Örtchen Reine, umgeben von gewaltigen Bergen, erstreckt sich über ein halbes Dutzend kleiner bis winziger Inseln, die alle durch Brücken verbunden waren.
Ich fuhr bis zum Ende der Straße in den Ort mit dem kurzen Namen Å, aber eine Ansiedlung namens Ånstad fand ich nicht. So weit im Norden wird es im Sommer abends nicht sehr dunkel, daher täuschte ich mich in der Tageszeit: Es war bereits spät am Abend, als ich ankam.
Gleich hinter den ersten Häusern wurde ich durch einen kurzen Tunnel auf einen Parkplatz geleitet, von hier ging es zu Fuß weiter. Den einsetzenden Regen ignorierend schlenderte ich durch das Fischerdorf. Die typischen roten Holzhäuser verteilten sich zwischen Hafenbecken und Felsen, aber es war kaum ein Mensch auf der Straße. Schließlich fand ich jemanden, der mir ein Quartier im Museum vermitteln konnte. Ich fragte mich gerade, was das für ein Museum sein sollte, das gleichzeitig Fremdenzimmer anbot, da führte mich die Frau über einen Holzsteg zu einem zweistöckigen Holzgebäude mit der Aufschrift Tørrfiskmuseum. Wir kamen an riesigen Gestellen für Trockenfisch vorbei, aber der Geruch war nicht so unangenehm, wie ich erwartet hatte. Der berühmte Lofotfisch ist Kabeljau oder Dorsch, der in den Monaten Januar bis April zum Laichen aus dem Nordmeer in die Gewässer rund um die Lofoten kommt. Dieser Umstand hatte früher den besonderen Status und den Reichtum der Inseln begründet; ein Reichtum freilich, der nur wenigen Großgrundbesitzern zugutegekommen war. Die einfachen Fischer der Inseln hatten nicht viel davon gehabt – noch weniger die Saisonarbeiter. Die extrem schlechten Bedingungen, unter denen sie während der Fangzeit lebten und arbeiteten, sind in die Literatur eingegangen.
Ich war stehen geblieben, aber die Frau wurde ungeduldig und führte mich über eine Rampe direkt in die obere Etage, wo sich die Gästeräume befanden. Sie sagte, sie müsse sich beeilen, da sie Leute von der Bodø-Fähre erwartete, und gab mir den Schlüssel.
Es war ein einfach, aber gemütlich eingerichtetes Eckzimmer mit Fenstern in zwei Richtungen. Nachdem ich mein Auto nähergeholt und meine Tasche ausgepackt hatte, ging ich zu Bett. Ich war todmüde, hörte eben noch weitere Gäste eintreffen und schlief rasch ein.
Am Morgen war ich sehr verschlafen, hatte aber Lust, mich ein wenig umzusehen. Ich trat vor die Türe, fröstelte etwas im Wind und im peitschenden Regen, setzte aber meinen Weg fort. Plötzlich riss der Himmel auf, und innerhalb weniger Sekunden war die Szenerie um mich herum in blendendes Licht getaucht. Alles glänzte und strahlte, die Nässe intensivierte das Schwarz der Felswände, das Grün der Vegetation und das Rot der Holzhütten – es wirkte fast kitschig. Freudig erregt unternahm ich eine Entdeckungstour durch den Ort. Südlichster Punkt war der Campingplatz, von dort waren es nur ein paar Schritte zu der Anhöhe Litlandstabben. Seitlich ragte der Andstabben auf, und ich hatte eine tolle Aussicht auf die im Süden vorgelagerten Inseln Mosken und Værøy. Ich setzte meinen Rundgang fort. Der ausladende Pier und ein auf Stelzen im Wasser stehender Gebäudekomplex bildeten das Ortszentrum. Die »Brygga« aus dem ortstypisch rot-gefärbten Holz beherbergte neben einem Restaurant und einem einfachen Hotel auch eine gemütliche Bar.
Auf dem Rückweg kam ich zum inneren Hafen, wahrscheinlich Keimzelle des Ortes. An der Westseite befanden sich die Bäckerei und der Lebensmittelladen, eines der wenigen Häuser aus Stein, und auf der Nordseite ein großes, flaches Holzgebäude mit einer Arkaden-Front zum Wasser hin – das Bootshaus, heute ein Teil des Fiskeværs-Museums. Ich ging hinein und verschaffte mir einen Überblick über die Vielzahl von Gebrauchsgegenständen aus alter Zeit, aber die historischen Fischerboote interessierten mich am meisten. Die offenen Holzboote waren gut konserviert, und bei einem davon fiel mir der Heckspiegel auf, der besonders reich verziert war. Die abstrakten Ornamente gefielen mir, zwei Runen waren zu sehen und an einer unauffälligen Stelle die Jahreszahl 1940 und Initialen, die schwer zu entziffern waren: »J.F.« meinte ich zu lesen. Witzig, dachte ich, der Bootsbauer oder Holzschnitzer hat die gleichen Initialen wie mein Großvater.
Die Runen schlug ich später in meinem Reiseführer nach: Sie galten symbolisch für Liebe und Stärke, wenn ich das richtig verstand.
Zurück in meinem Quartier betrat ich den Frühstücksraum. Schnell entwickelte sich ein Gespräch mit den Gästen, die in der Nacht ihr Zimmer auf meiner Etage bezogen hatten. Der Mann arbeitete als Architekt. Da er aus Frankfurts Partnerstadt Lyon stammte, hatten wir einen ersten Anknüpfungspunkt. Ein zweiter war die Liebe zu dieser nördlichen Landschaft. Das Ehepaar, ich schätzte beide auf Mitte 50, kam seit mehreren Jahren in jedem Sommer hierher, so begeistert waren sie von den Lofoten. Für diesen Tag planten sie einen Bootsausflug: »Das Ziel ist Refsvika auf der Außenseite von Moskenesøya. Dort gibt es eine Höhle mit steinzeitlichen Wandmalereien«, erklärte der Mann und seine Frau meinte spontan: »Kommen Sie doch mit, Sonja. Das wird Ihnen sicher auch gefallen.«
Sie freuten sich, als ich einwilligte, und ich merkte, wie gut es für mich war, nach der langen Zeit alleine wieder in Kontakt mit freundlichen Menschen zu sein.
Das Boot lag am Pier neben dem Hotel; der Bootsführer war pünktlich da und ließ uns einsteigen. Es war ein etwas komplizierter Vorgang, da wir eine senkrecht stehende Leiter tief hinuntersteigen und über ein schmales Deck, das kaum breiter als ein Fuß war, in die Kabine klettern mussten. Ich selbst kam gut klar; nur die beiden Franzosen zögerten und waren für meine Hilfe dankbar.
Es handelte sich um ein Sportboot mit flachem Boden, wie ich es aus Hamburg kannte. Oft hatte ich als Kind Großvater und die Eltern auf Bootsausflügen über die Seitenarme der Elbe begleitet. Einzige Fahrgäste außer dem Paar aus Frankreich und mir war ein norwegisches Ehepaar. Der Bootsführer war nicht sehr gesprächig, aber das Wetter war großartig, die Sonne schien und es regten sich kaum Wellen, als wir aus dem Hafen fuhren. Wir alle waren guter Laune. Im Osten hatte es aufgeklart, die 80 km entfernte Küste des Festlandes war deutlich zu erkennen. Nur der Wind frischte auf, und ich fragte mich, was uns auf der Außenseite der Insel erwarten würde. Wegen der hohen Berge im Westen konnte man nicht sehen, wie das Wetter draußen auf dem offenen Nordatlantik war.
Ich fragte Jean-Pierre, den französischen Architekten, nach dem Ort Ånstad, aber auch er kannte ihn nicht. Der ältere Norweger hatte mitgehört und schaltete sich in einem stark akzentgefärbten Englisch ein: »Ånstad ist ein verlassener Ort hier im Süden von Moskenesøya«, er deutete auf die an Steuerbord vorbeiziehende Küste, »Lofotodden, die Südspitze der Lofoten, war nicht immer unbesiedelt. Bis in die fünfziger Jahre gab es hier und an der Außenseite drei Ortschaften: Ånstad, Tuv und ganz im Süden, am Moskstraumen, noch ein Ort, dessen Name mir im Moment nicht einfällt.« Er blickte Hilfe suchend zu seiner Frau, und sie ergänzte: »Der Ort hieß Hell und wurde erst 1950 verlassen. Aber auch da, wo wir jetzt hinfahren, war einst ein kleines Dorf: Refsvik.«
Ich blickte hinüber auf die lebensfeindlich erscheinende Szenerie aus wild geformten Felsen und hohen Bergen, deren steile Hänge direkt ins Meer abfielen. Nirgendwo waren Zeichen früherer Besiedelung zu erkennen. Der Norweger lächelte über meine Enttäuschung: »Von hier draußen sieht man nichts mehr. Warum interessierst du dich denn dafür?«
Einen Moment zögerte ich mit der Antwort, aber dann meinte ich: »Ich glaube, ein Teil meiner Vorfahren stammt von hier. Meine Großmutter väterlicherseits wurde in Ånstad geboren.«
Alle sahen mich mit plötzlicher Neugier an, aber ich konnte nicht viel mehr berichten, außer dass ich selbst erst vor Kurzem davon erfahren hatte. Abschließend sagte der Norweger: »Genaueres weiß ich auch nicht über die verlassenen Orte. Meine Frau und ich sind erst in den 70er Jahren auf die Lofoten gekommen. Wir wohnen jetzt in Leknes auf Vestvågøy.«
Das Boot näherte sich nun der Spitze von Lofotodden und damit dem berüchtigten Mahlstrom Moskstraumen. Das Boot begann sich heftiger zu bewegen, und wir hielten uns nahe an der wilden und schroffen Steilküste. Der Bootsführer steuerte auf einen felsigen Fortsatz der Insel zu – dann sah ich, dass sich ein schmaler Durchlass wie ein aus Stein gehauener Kanal öffnete, durch den das Boot gerade so hindurchpasste.
Die abenteuerlichen Geschichten über den »alles verschlingenden Mahlstrom« waren sicher übertrieben, aber der schnelle Gezeitenstrom war deutlich zu sehen, er schien an einigen Stellen ein richtiges Gefälle zu erzeugen, und es bildeten sich weit ausgreifende Strudel.
Das Wetter war auf einmal nicht mehr so ungetrübt schön. Rasend schnell hatten Wolken den Westhimmel bedeckt, und der Wind schwoll stetig an. Als wir aus dem schmalen Reidsundet ins offene Wasser kamen, war die Dünung sehr eindrucksvoll. Die Franzosen suchten in der Kajüte Schutz, und ich folgte ihnen bald darauf. Jetzt bekamen wir zu spüren, dass wir uns in einem schnellen Gleitboot ohne richtigen Kiel befanden, das nicht für Fahrten auf dem stürmischen Nordatlantik gebaut war.
Wir drehten nach Steuerbord und gingen auf Nordkurs in Richtung Refsvika. Die Sicht wurde schlechter und die schräg von vorn ankommenden Wellenkämme nahmen erschreckende Ausmaße an. Der Bootsführer sagte nichts, aber ich sah ihm an, wie er mit dem instabilen Boot kämpfte. Im Cockpit hing ein Krängungsmesser mit einer bis 30 Grad reichenden Skala, dessen Zeiger wild von Anschlag zu Anschlag pendelte.
Seekrank wurde ich nicht, aber ein wenig Angst beschlich mich schon. Wir alle hielten uns krampfhaft irgendwo fest und versuchten, auf den Beinen zu bleiben. Es war klar, dass an ein Anlanden in der Bucht bei diesem Seegang nicht zu denken war. Ich fragte mich, warum wir immer noch nordwärts fuhren, bis ich begriff, dass wir im Moment ein Wendemanöver einfach nicht wagen konnten. Bei querab ankommender See wäre das Boot gekentert. Ich schaute dem Bootsführer genau zu und überlegte, wie sich das Ruder des Bootes in dieser Situation anfühlen mochte, wie ich manövrieren würde. Ich blickte mich um und bemerkte, dass die anderen Passagiere in die Kajüte gekommen waren; nur der Norweger stand noch in der offenen Schotttür, die zum hinteren offenen Deck führte. Plötzlich gab es bei einer Korkenzieherbewegung des Bootes einen lauten Knall, und die Stahltür fiel zu!
Fassungslos sah ich, dass der Mann seine Hand noch im Türrahmen hatte – seine Finger waren eingeklemmt! Ich sprang zur Tür und wuchtete sie auf, wobei mir das schwere Ding bei den Schwankungen des Boots beinahe wieder aus der Hand geglitten wäre. Jetzt sah ich, dass sich die Laschen der Halterung gelöst hatten.
Der Mann lehnte sich an die Bordwand und starrte totenblass auf seine Hand. Ich hatte erwartet, dass einige Finger fehlten, aber sie waren alle noch dran. Nur ein tiefer Schnitt zog sich auf beiden Seiten über die Finger und begann heftig zu bluten. Seine Frau hatte gar nicht genau gesehen, was passiert war; nun aber stützte sie ihn, als er ohnmächtig zu werden drohte. Angesichts der Wunde wurde mir schlecht. Das Blut strömte so heftig, dass ich fast in Panik geriet; vergeblich suchte ich nach etwas, mit dem ich die Blutung stillen könnte.
Der Bootsmann sah zu uns herüber, aber im Moment konnte er nicht vom Ruder weg, ohne unser aller Leben zu gefährden. Kurz entschlossen zog ich mein Hemd aus, das ohnehin schon blutbefleckt war, zerriss es und band den Arm oberhalb der Wunde ab.
Nun trug ich nur noch einen BH, und gleich darauf fröstelte mich. Der Bootsführer rief: »Kennt sich einer mit so einem Boot aus?«
Niemand rührte sich, und ich hegte die Befürchtung: Jetzt muss ich wohl ran! Ich glaubte mit einem solchen Boot umgehen zu können – zumindest hatte ich es früher einmal gekonnt, wenn auch in eher ruhigen Küstengewässern. Unsicher trat ich ans Ruder, legte das zerfetzte Hemd zur Seite und griff in die Speichen.
Der Bootsführer holte den Verbandskasten und kümmerte sich um den Verletzten, während ich versuchte, das Boot in den Griff zu bekommen. Eine Welle hob das Boot an und es drohte, aus dem Ruder zu laufen – zu meinem eisigen Schrecken krängte es stark und schien quer schlagen zu wollen. Hektisch korrigierte ich, aber das Boot reagierte kaum. Erst als nach endlosen Sekunden das Heck wieder im Wasser war, hatte ich Druck auf dem Ruder, und langsam schwenkte der Bug den Wellen entgegen. Es gab bei jedem Anprall der See einen dröhnenden Schlag, doch die Gefahr des Kenterns war gebannt.
Dann löste mich der Bootsführer wieder ab. Im Lee einer kleinen vorgelagerten Felseninsel ging der Seegang leicht zurück, und nun wagte er das Wendemanöver. Das Boot legte sich extrem weit auf die Seite, und ich hielt den Atem an, glaubte schon, wir würden wirklich kentern. Da richtete es sich wieder auf, der Bug zeigte nach Süden, und wir fuhren vor den Wellenfronten her.
Der Bootsführer musste gut zielen, um bei den heftigen Wellenbewegungen die enge Einfahrt zum Reidsundet zu erwischen, aber so blieb uns der noch gefährlichere Moskstraumen erspart.
Im ruhigeren Wasser auf der Innenseite der Lofoten fiel die Anspannung von mir ab; mir wurde übel, und ich kauerte mich auf das Deck. Die Franzosen und die norwegische Frau kümmerten sich weiter um den Verletzten und betteten ihn bequem, während der Bootsführer über Funk eine Ambulanz zum Fährhafen Moskenes bestellte.
Beim Anlegen in Moskenes und während des Abtransports des Verletzten beachtete mich glücklicherweise niemand. Am Holzpier in Å kletterte ich als Erste von Bord. Ich hastete durch den peitschenden Regen, die fleckigen Überreste meines Hemds notdürftig um Kopf und Oberkörper gewickelt, und gelangte zum Tørrfiskmuseum.
Auf meinem Zimmer zog ich mich aus und trocknete mich kurz ab. Ich hatte nur noch den Wunsch, mich hinzulegen.
Ich schlief ein wenig, aber die Ereignisse des Tages ließen sich nicht so leicht abschütteln. Daher versuchte ich am Abend herauszufinden, was aus dem verletzten Norweger geworden war. Leider fand ich weder an der Anlegestelle noch im Restaurant Brygga jemanden, der mir etwas darüber sagen konnte. Schließlich stieg ich die Treppe hoch zur Bar. Im Gegensatz zum Restaurant war der gemütliche Raum im Dachgeschoss gut besucht, und fast alle Tische waren besetzt. Es war ein jüngeres Publikum als im Restaurant, und mir schien, hier mischten sich Norweger und Touristen. Das gefiel mir.
Der junge Mann hinter dem Tresen hatte von dem Unfall bei der Bootstour gehört und deutete auf einen der Tische: »Dort sitzen ein paar Leute vom Museum; vielleicht wissen die mehr.«
Ich ließ mir ein sündhaft teures Bier zapfen und steuerte den Tisch an, an dem noch ein Stuhl frei war.
Die Runde schaute auf, und ein junger Mann lud mich ein, Platz zu nehmen, wobei er mich neugierig musterte. Die anderen unterhielten sich zunächst weiter, aber er erzählte mir bereitwillig von seinem Ferienjob hier im Museum und dass er aus Bodø stammte. »Wo kommst du denn her?«, erkundigte er sich dann.
Ich versuchte, mein dürftiges Norwegisch anzubringen, das ich in dem zweimonatigen Sprachkurs in Trondheim gelernt hatte, aber der Norweger ging gleich zu Englisch über, das alle offenbar gut beherrschten.
»Ich bin als Touristin hier und habe heute die Bootstour zur Außenseite mitgemacht, bei der sich ein Norweger die Hand verletzt hat. Hast du davon gehört?«
Er bezog zwei Norwegerinnen, die ebenfalls für das Museum arbeiteten, in das Gespräch ein, und eine davon rief einen Rettungssanitäter, der am Nebentisch saß, herbei.
»Sverre, ihr habt doch heute Nachmittag an der Pier einen Verletzten abgeholt. Weißt du etwas von ihm?«
»Das war die Schicht vor mir. Die Kollegen haben ihn nach Leknes gebracht. Eigentlich dürfen wir Außenstehenden keine Informationen geben …«
Als ich erwähnte, Zeugin des Vorfalls gewesen zu sein, lächelte er und meinte: »Es kann ja nicht schaden, wenn ich dir sage, dass sein Gesundheitszustand bei der Einlieferung in die Klinik stabil war.«
»Da bin ich aber beruhigt. Seine Verletzung sah grausig aus; ich hatte an Bord noch versucht, die Blutung zu stillen.«
Sverre kehrte wieder an seinen Tisch zurück. Ich wurde von den Museumsleuten in weitere Gespräche verwickelt, hatte aber den Eindruck, dass Sverre am Nebentisch von mir sprach. Mehrmals streiften mich Blicke von dort. Dabei fiel mir eine junge Frau auf. Sie hatte ein schmales, dreiecksförmiges Gesicht, umschmeichelt von rötlichen Haaren, die als ungebärdige Mähne bis auf ihre Schultern fielen. Vielleicht war sie gar nicht besonders schön, aber sie wirkte souverän und lässig. Mein Herz klopfte, als ihre graugrünen Augen auf mir lagen.
Ich hatte gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen war, und nun war Sperrstunde. Ausgerechnet als ich mir gerade vorgenommen hatte, sie anzusprechen. Der Keeper sperrte die Bar zu und alles begab sich auf den Nachhauseweg.
Beim Frühstück am folgenden Tag stellte mich der französische Architekt einem anderen Ehepaar vor: »Das ist Sonja Feldhoff aus Deutschland – die Heldin vom gestrigen Bootsausflug.«
Mir war es peinlich, so tituliert zu werden, aber die Bekannten des Architekten wollten nun alles über die Tour wissen. Es stellte sich heraus, dass es sich um deutsche Touristen handelte, die wie die Franzosen seit Jahren die Lofoten besuchten.
Als der Franzose mein Interesse an den verlassenen Orten erwähnte, horchte der Deutsche auf: »Ich habe mich mit der Geschichte der Lofoten beschäftigt. Die Außenseite und die Südspitze von Moskenesøya waren früher bewohnt, und es gab einige Ortschaften, die man heute wie damals nur mit dem Boot oder zu Fuß über die Berge erreichen kann.« Er zählte die Namen auf, darunter Ånstad. »Das waren früher alles blühende Fischersiedlungen. Heute sind von diesen Orten außer Grundmauern, verwilderten Gärten und einigen Wegbefestigungen kaum noch Spuren zu finden.«
Die meisten Anwohner hatten anscheinend bei der Umsiedelung ihre Holzhäuser zerlegt und auf der Innenseite wieder aufgebaut.
»Vielen, vor allem älteren Umsiedlern fiel die Umstellung schwer. Das Leben in den abgelegenen Dörfern hatte seine Härten, besonders im Winter, aber die Bewohner waren auch frei und unabhängig.«
»War das denn auf der Innenseite anders?«, fragte ich.
»Allerdings. Dort gehörte aller Grund und Boden den mächtigen Dorfbesitzern. Die Bewohner auf der Außenseite, aber auch die Leute in Ånstad und Tuv südlich von Å hatten jahrelang vergeblich um Molen, Wellenbrecher und bessere Häfen gekämpft. An Stromversorgung und den Anschluss an das Straßennetz, den berühmten Kong Olafs Veien, war nicht zu denken. Ich frage mich, ob damals alles mit rechten Dingen zuging, oder ob dabei nicht Machtpolitik oder wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielten.«
Ich fragte speziell nach Ånstad, aber er wusste nur, dass die Bewohner 1949 nach Sørvågen umgesiedelt worden waren – ein Ort, der dem mächtigen Andersson-Clan gehört hat.
Das Buffet war schon abgebaut worden, und die Bedienung begann aufzuräumen. Die deutschen und französischen Touristen standen auf, und auch ich erhob mich, ehe man mir den Stuhl unter dem Hintern wegziehen konnte. Wir wünschten uns alle einen schönen Tag, und jeder ging seiner Wege.
Es war inzwischen fast Mittag. Wind und Regen hatten aufgehört, und ich ging zur Tourist-Info. Ich versuchte ein Boot für eine Tour nach Ånstad zu chartern, doch die ältere Mitarbeiterin dort reagierte auf mein Ansinnen seltsam: Zunächst meinte sie, das Wetter sei viel zu schlecht für eine solche Fahrt. Als ich darauf hinwies, dass sich der Sturm gelegt hatte, riet sie mir auf einmal generell davon ab, die verlassenen Orte zu besuchen.
»Ich muss dich warnen; die Anlegestellen sind unsicher, die Wege dort sind überwuchert und nicht mehr gefahrlos begehbar.«
An ihrem Revers fiel mir das Namensschildchen Ingrid Andersson auf. Wenn das mal kein Zufall war!
Am Pier fragte ich den Bootsmann von der Refsvika-Tour. Er freute sich mich wiederzusehen und bedankte sich nochmals für die Hilfe beim Versorgen des Verletzten und dem Steuern des Bootes. Als ich aber mein Anliegen vorbrachte, wich seine Freundlichkeit einem gewissen Misstrauen: »Was willst du denn in Ånstad? Dort gibt es überhaupt nichts zu sehen.«
Schließlich lehnte er es rundweg ab, mich hinzubringen. Auch die Erwähnung meiner dort geborenen Großmutter konnte ihn nicht umstimmen. Es war mir, als verletzte ich mit meinem Wunsch, nach Ånstad zu fahren, ein Tabu …
Ich ging zur Mole des Fischereihafens und sprach einige mit Stockfisch hantierende Fischer an. Es dauerte eine Weile, bis ich jemanden fand, der sich bereiterklärte, mir – gegen eine Kaution – ein offenes Boot mit Außenbordmotor zu geben. Der Mann kam mit zum Pier und holte das an einer langen Leine vertäute Boot herbei. Beim Einsteigen fragte er: »Wo ist denn Ihr Angelzeug?«
Als ich sagte, es gehe mir nur um Sightseeing, blickte er verwundert; mein wirkliches Fahrtziel nannte ich ihm nicht. Den kleinen Johnson Außenborder bekam ich beim ersten Versuch mit der Reißleine in Gang, und mit gestärktem Selbstvertrauen steuerte ich das Boot in elegantem Bogen aus dem Hafen.
Draußen im großen Vestfjord, immerhin waren es über 80 km bis zum Festland, kam mir das Holzboot furchtbar winzig vor. Ich beruhigte mich damit, dass ich ja nicht auf die Außenseite fahren wollte, aber auch die Wellen hier auf der Innenseite brachten das Boot stark zum Schaukeln. Dicht unter der Küste fahrend, versuchte ich mich zu orientieren und zog die zusammengefaltete Karte aus meiner Jeanstasche. Es war nur eine Touristenkarte 1: 50.000 Vest-Lofoten mit wenigen Einzelheiten. Eine richtige Seekarte wäre mir lieber gewesen. Aufgrund der Perspektive knapp über der Wasseroberfläche fand ich es schwierig, optische Eindrücke und Kartenbild in Einklang zu bringen. Ich passierte eine flache, lang gezogene Schäre; war das Amundholmen?
Direkt dahinter ragte die schroffe Spitze des Andstabben auf, den ich von meinem Spaziergang durch Å kannte. Ich ließ das kleine Boot durch die Wellen tuckern und bog in die übernächste Bucht ein: War das schon Ånstadvika? Nirgendwo fand ich den Sand- oder Kiesstrand, wie er auf meiner Karte in der Bucht von Ånstad eingezeichnet war. Waren die flachen Stellen bei Hochwasser überhaupt erkennbar? Ich ärgerte mich nun über meinen überstürzten Aufbruch; noch nicht einmal eine Gezeitentabelle hatte ich mir besorgt. Und so hatte ich keine Ahnung, ob gerade Ebbe oder Flut herrschte.
Die nächste Bucht war tiefer eingeschnitten. Im Südwesten gab es ein flaches Stück Ufer, wo ich den Ånstadvatnet vermutete. Tatsächlich gab es sogar eine Art Anleger, geformt aus flachen Steinplatten, an dem ich mein Boot vertäuen konnte. Das musste Ånstad sein, auch wenn ansonsten nichts darauf hindeutete, dass hier eine menschliche Ansiedlung existiert hatte.
Ich stolperte über das Geröll hinauf an Land und stand am Ufer eines Sees, der von hohen Bergen umsäumt war. Nach den freundlichen Farben direkt am Meer umgaben mich hier nur das Schwarzgrau der Felsen und das feuchte Grün von Gras und Moos. Es lag eine merkwürdige Stimmung über dem Ort. Die Sonne war hinter Wolken verschwunden, der Wind war ganz eingeschlafen, und selbst die sonst allgegenwärtigen Möwen ließen sich nicht blicken.
Ich schaute auf meine Karte und ging am Ufer entlang nach Südosten. Der Ort Ånstad selbst hatte gar nicht in der großen Bucht gelegen, sondern an einem kleinen Küsteneinschnitt im Osten, direkt unterhalb eines fast 300 m hohen Berges dicht an der Küste.
Als ich die Stelle erreichte, wo sich der Ort befunden haben musste, sah ich zunächst keinerlei Zeichen einer Ansiedlung. Enttäuscht blickte ich mich um; es schien hier wie überall nur Gestrüpp, Felsen und Berge zu geben. Doch dann erblickte ich, fast ganz von Moos und Büschen überwuchert, ein paar Steine, die regelmäßiger aussahen, als von der Natur geformt. Ich richtete mich auf und erkannte eine Struktur, ein kaum noch erkennbares Karree von Grundmauern. Einzelheiten, denen ich zuvor keine Bedeutung beigemessen hatte, ergänzten jetzt das Bild. Spuren eines befestigten Weges, gesäumt von Stauden und verwilderten Gemüsebeeten.
Ich erschauerte, mir war plötzlich unheimlich zumute. Eine Aura von Depression und Verzweiflung lag über den verwitterten Ruinen, als hätten die Bewohner bei ihrer unfreiwilligen Umsiedelung vor 47 Jahren mehr als nur diese Grundmauern zurückgelassen. Was auch immer hier passiert war – es war nicht vorbei. Grauenvolle Dinge würden hier noch geschehen. Eine Vorahnung von kommendem Unheil lag in der Luft …
Gespenster der Vergangenheit. Was für ein Quatsch, sagte ich energisch zu mir. Mein Wissen um die Geschichte von Ånstad hatte diese seltsamen Gefühle ausgelöst. Ich hatte eine erste Ahnung davon bekommen, was sich hier während des Krieges und später bei der Aufgabe des Ortes zugetragen haben mochte. Diese Wüstung – ein aufgegebener Ort, eine verlassene Ansiedlung, an der vor langer Zeit einmal Menschen gewohnt hatten –, regte augenscheinlich meine Fantasie an. Hinzu kam das befremdliche Verhalten der Leute in Å, die mir so dringend abgeraten hatten, hierherzukommen.
»Du musst diese Umgebung nur einmal mit anderen Augen ansehen. Das ist ein Landstrich der norwegischen Küste, wie du ihn schon öfters gesehen hast«, redete ich mir gut zu. Aber trotz aller Bemühungen blieb ein Gefühl der Beklemmung. Mit übernatürlicher Klarheit zogen Bilder von Häusern, Gärten und Menschen an meinem inneren Auge vorbei, und ich versuchte mir vorzustellen, wie Elin Håkonsen hier gelebt haben mochte. Tief in Gedanken schlenderte ich umher.
Zwischen Felsen, Geröll und Trümmern von Grundmauern – alles drei war schwierig auseinanderzuhalten – fanden sich auch verwitterte, ausgebleichte Holzsplitter und Reste von Balken. Ich bückte mich und griff wahllos nach einem kleinen, silbergrauen Stecken, drehte ihn um und fand unverhofft ein paar Verzierungen, die mich sofort an das Boot im Fiskeværs-Museum erinnerten.
Plötzlich fühlte ich mich wie eine Schatzsucherin und sah mich nach weiteren Fundstücken um. Ich fand aber lediglich eine altmodische Nadel zum Netzeflicken, wie ich sie aus Hamburg kannte, immerhin war ein Dekor rudimentär erkennbar.
Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es schon ziemlich spät war, aber ich konnte mich nur schwer von diesem Ort losreißen. Ich stapfte den Hang des Berges empor, an dem Ånstad lag, und setzte mich auf einen Felsvorsprung. Von hier oben waren noch mehr Grundmauern und Wege zu erkennen.
Eine Gruppe von Schafen zog dicht an mir vorbei. Der vertraute Anblick tröstete mich irgendwie. Die Tiere wichen mir aus und gingen gelassen den Hang hinab – aber als das vorderste Schaf die Ruinen erreichte, blökte es auf einmal, und die kleine Herde rannte im Galopp davon. Irritiert schaute ich mich um, entdeckte aber nichts, was die Schafe erschreckt haben konnte. Wieder überkam mich ein unbestimmtes Angstgefühl. Ich stand auf und lief hastig am Hang nach Westen, um am Seeufer entlang zum Strand zu gelangen. Da lag das Boot. Erleichtert beschleunigte ich meine Schritte und rannte fast, bis ich es erreicht hatte. Ich schob es ins Wasser und startete den Motor, wobei mir das Knattern in dieser stillen Bucht unerträglich laut vorkam. Ich steuerte in Richtung offenes Meer, immer noch mit einem Gefühl der Bedrohung im Rücken, und schaute mich mehrmals nach der Stelle um, wo Ånstad gelegen hatte.
Es war mittlerweile Nacht. Die Sonne stand im Norden und wurde von der Landmasse der Lofoten verdeckt. Sie ging aber jetzt im Hochsommer nicht unter, und so war es einigermaßen hell, als ich in Å ankam. Wie es mir der Fischer gezeigt hatte, vertäute ich das Boot. Bezahlt hatte ich ja im Voraus; da niemand zu sehen war, musste ich mir die Kaution am nächsten Morgen abholen.
In Gedanken war ich noch in Ånstad, meine Gefühle befanden sich in Aufruhr, und ich schlief erst sehr spät ein. Mein Handy weckte mich. Träge schaute ich auf meine Armbanduhr: 11 Uhr. Es war wieder Alex: »Hallo, Sonja! Habe ich dich geweckt?«
»In der Tat, ich habe gerade so gut geschlafen«, brummelte ich.
»Macht nichts«, meinte meine Mutter mit einer Fröhlichkeit, die ich morgens unerträglich fand: »Ich habe Neuigkeiten für dich. Rate mal, was ich in der Kiste von Manuel noch gefunden habe: das Kriegstagebuch seines Vaters!«
Plötzlich war ich hellwach.
»Dachte ich mir doch, dass dich das interessiert! Ich bin inzwischen wieder in Trondheim und habe es dir mit einigen anderen Büchern ins Hotel geschickt.«
Ich erzählte ihr nicht, dass ich gar nicht in Svolvær war. Doch während ich mich bei ihr bedankte, beschloss ich, sofort zurückzufahren.
»Sag mal, Alex, hast du in der Zwischenzeit etwas von Manuel gehört? Ich habe nur erfahren, dass er auf einer Geschäftsreise ist.« »Mehr weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass wir ihm nichts von unseren Entdeckungen erzählt haben. Er wollte ja früher schon nie über seine Eltern reden.«
Eilig brach ich auf. So bezahlte ich zwar meine Hotelrechnung, vergaß jedoch, bei dem Fischer meine Kaution abzuholen. Gespannt auf das Tagebuch meines Großvaters fuhr ich über Ramberg, den Nappsundtunnelen und Vestvågøy nach Svolvær. In meiner Ungeduld war ich wieder zu schnell unterwegs und kam in der Nähe des Wikingermuseums erneut in eine Polizeikontrolle. Das machte mir nun nicht mehr so viel aus. Ich bezahlte das Bußgeld und sah zu, dass ich auf dem weiteren Weg nicht noch einmal erwischt wurde.
Das Paket war angekommen. Ich nahm es mit auf mein Zimmer und begann sogleich zu lesen.
Kapitel 1.2Das Tagebuch(Moskenes, Juli 1997)
Ich hatte mich zu einer Fahrt nach Narvik entschlossen, um den Originalschauplätzen der Ereignisse von 1940 näher zu sein. Von Svolvær aus war ich mit dem Katamaran-Schnellboot Lofotekspressen in Richtung Narvik gefahren und befand mich nun im Vestfjord nördlich der Hamarøya.
In dem Paket, das mir Alex ins Hotel geschickt hatte, hatte ich neben historischen Sachbüchern ein dickes, zerfleddertes Büchlein mit abgeschabtem Ledereinband gefunden. Es fiel mir nicht leicht, die altmodische Schrift meines Großvaters in verblasster Tinte zu entziffern – aber ich las darin stundenlang.
Auch das 1996 erschienene Buch »Brennpunkt Erzhafen Narvik« [1], geschrieben von dem englischen Autor Peter Dickens in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hans Dehnert, vermittelte mir viele Informationen über den Kampf der Zerstörer in Narvik.
Aber die Aufzeichnungen meines Großvaters waren für mich wesentlich eindrucksvoller. Ich erfuhr viel über seine Anfänge in der Marine, seine Ausbildung und seine Kommandierung als blutjunger Obermaat auf den Zerstörer Georg Thiele.
Die Sicht meines Großvaters veränderte meine Einstellung zur Geschichte und mein Bild vom Deutschland dieser Zeit. Nicht, dass ich das Unrecht, das damals durch Deutsche oder im Namen Nazi-Deutschlands geschehen war, relativieren wollte; aber ich konnte jetzt die damaligen Handlungen von Normalbürgern wie Soldaten besser verstehen. Ich konnte nicht mehr so pauschal urteilen.
Das Alltagsleben, die Situation des Landes zu Kriegsbeginn hat Johannes Feldhoff recht genau und in nachdenklicher Weise geschildert. Seine Aufzeichnungen bestehen aus flüssig formulierten Berichten, die Notizen in knappen Stichworten ergänzen.
7. April 1940
Gerüchte, die in W'haven kursierten, hatten sich bestätigt: Am Morgen sind wir mit Nordkurs ausgelaufen. Das Ziel Norwegen wurde im Laufe des Tages zur Gewißheit, um 2100 befanden wir uns auf der Höhe von Stavanger.
Wir werden also das neutrale Land Norwegen angreifen, trotz aller gegenteiligen Parolen von Seiten der Partei. Ich habe dabei ein mulmiges Gefühl. Als Jugendlicher habe ich von diesem Land geträumt, für das auch Kaiser Wilhelm II. geschwärmt hat.
Das extrem schlechte Wetter auf der Fahrt beutelte unser Schiff ganz schön, da erging es den Kameraden auf den Schlachtschiffen Gneisenau und Scharnhorst oder dem schweren Kreuzer Admiral Hipper besser. Von der eindrucksvollen Streitmacht, die ich beim Sammeln in der Nordsee voller Stolz betrachtet hatte, war bald kaum noch etwas zu sehen. Auf der Brücke der Georg Thiele waren wir froh, wenn wir Fühlung zu unserem Vordermann, der Erich Koellner, halten konnten.
Ich tat Dienst auf dem Signaldeck; dick vermummt, aber trotzdem zitternd vor Kälte. Wenigstens hatte ich auf meiner Station einigermaßen Überblick über die Situation.
8. April 1940
Um 0300 verloren wir einen von den Gebirgsjägern, die mit solchem Wetter überhaupt keine Erfahrungen haben. Er war trotz Verbotes aufs Achterdeck gegangen. Manfred am Geschütz E hat ihn noch gesehen, ehe ihn die große See, die unser Heck überrollte, über Bord gespült hat. An ein Wendemanöver war bei Südweststurm nicht zu denken, wir mußten ihn seinem Schicksal überlassen. Wir hatten alle vor der mächtigen Home Fleet der Engländer Angst gehabt, nun forderte das Wetter das erste Opfer.
Am Morgen war der Verband völlig durcheinandergeraten. Die Hans Lüdemann und Bernd von Arnim hatten Feindberührung mit einem britischen Zerstörer, den die Admiral Hipper im Verlauf des Gefechts versenkte. Wir konnten den Kampf nur über Funk verfolgen. Unklar bleibt, wieviele von den Engländern davongekommen sind.
Am Mittag um 1300 verließ uns die Admiral Hipper mit ihren vier Zerstörern mit Ziel Drontheim. Gneisenau und Scharnhorst scherten um 2100 aus dem Verband aus, um Handelskrieg zu führen.
Unser Verband von noch zehn Zerstörern lief weiter nach Norden: Das Ziel heißt Narvik! Der Führer der Zerstörer, Kommodore Bonte persönlich, hatte sich auf der Wilhelm Heidkamp eingeschifft, wir waren die Nummer zwo, es folgten die restlichen Zerstörer von der 3. und 4. Flottille in mehr oder weniger exakter Kiellinie.
Ein Schiff war den ganzen Tag über nicht mehr in Sicht gekommen, die Erich Giese – hoffentlich ist da nichts passiert … Ich hörte unseren Käpt'n, Korvettenkapitän Max-Eckart Wolff, mit dem Wachoffizier besorgt darüber sprechen, als ich Dienst als Assistent des Navigationsoffiziers auf der Brücke tat.
Die Navigation war äußerst heikel, denn wir konnten lange Zeit mangels Landsicht nur koppeln. Um 2200 glaubten wir, querab von Skomvær Fyr am Eingang des Vestfjords zu stehen, hatten aber keine Bestätigung dafür.
Der Sturm war zuletzt von Backbord vorn gekommen, also aus Nordwest, später schwächte sich der Seegang ab. Ein erstes Anzeichen dafür, daß wir im Lee der Lofoten sein mußten. Wir atmeten auf, als sich die Hinweise verdichteten und wir einigermaßen sicher waren, auf Kurs im Vestfjord zu sein.
Ich dachte heute viel an meinen Vater Erich Feldhoff, der als Schiffszimmermann auf den Flying-P-Linern unterwegs gewesen war. Diese legendären Schiffe der Hamburger Reederei F. Laeisz waren die größten und schnellsten Großsegler, die jemals auf den Weltmeeren unterwegs waren. Wäre er stolz auf mich, auf unsere Navigationsleistung? Von ihm habe ich die Begeisterung für Seefahrt geerbt, auch wenn er es nicht gerne gesehen hatte, daß ich nach meiner Tischler-Lehre auch auf See gegangen bin, als Soldat der Kriegsmarine.
Ich betrachtete die Berge und Inseln, das blaue Wasser des Fjordes um mich herum im Licht der Sommersonne und versuchte, mich in die damalige Zeit zurückzuversetzen. Es war schwer, mir vorzustellen, wie sich die deutschen Zerstörer mit Johannes Feldhoff an Bord damals bei heftigem Sturm hier durch den Fjord gekämpft hatten.
9. April 1940
Am Morgen gegen 0400 Uhr näherten wir uns der Insel Barøya und der Vestfjord verengte sich zum Ofotfjord. Noch 32 sm bis Narvik! Wir liefen wegen schlechter Sicht nur etwa 20 kn, mehr wäre in den engen Gewässern zu gefährlich.
Ein Schneesturm gab uns Schutz und verhinderte unsere Entdeckung. Wir hatten das ungute Gefühl, daß uns die Briten auf den Fersen sind. Bonte signalisierte und Diether von Roeder scherte aus, um Vorposten zu beziehen.
Nach Passieren der Evenes-Enge wurde der Fjord wieder breiter und die drei Boote der 4. Flottille scherten nach Backbord aus. Als graue Schemen erkennbar, liefen sie nach Nordosten in den Herjangsfjord.
Die Fjordlandschaft ist wunderschön – der Gedanke, hier Krieg zu führen, erscheint mir absurd.
0515 Uhr. Narvik in der Morgendämmerung. Drei Boote, das Führerboot Wilhelm Heidkamp, wir, die Georg Thiele, und die Bernd von Arnim unter Korvettenkapitän Curt Rechel umrundeten die Halbinsel Framnes und sahen plötzlich den Hafen vor uns: Viele Schiffe waren versammelt, manche auf Reede, manche an den Kais. Unübersichtliche Lage. Die Bernd von Arnim als Vorhut tastete sich zwischen den plumpen Handelsschiffen hindurch zum Pier. Schneeböen behinderten meine Sicht. Plötzlich krachte ein Schuß, und vor dem Bug des Führerzerstörers stieg eine Wasserfontäne hoch! Wo kam der Schuß her? Sollten die Norweger etwa Widerstand leisten wollen?
In diesem Moment wurde mir schmerzlich bewußt, daß wir als Feinde hier sind – so hatte ich mir die erste Begegnung mit dem Land meiner Träume nicht vorgestellt.
Wolff murmelte etwas von einem Küstenpanzerschiff, da kam auch schon das alte Trumm in Sicht. Die Wilhelm Heidkamp setzte ein Boot mit einem Parlamentär aus, das zum norwegischen Panzerschiff tuckerte. Nach kurzer Zeit kehrte das Boot zurück und schoß ein rotes Sternsignal. Mir wurde speiübel; als Signalgast wußte ich, was das zu bedeuten hat. Die Wilhelm Heidkamp feuerte vier Torpedos, die unter Wasser Richtung auf ihr Ziel nahmen. Dann eine riesige Detonation … Als die Sicht wieder besser wurde, war das Panzerschiff gesunken.
0545 Uhr. Rechel manövrierte die Bernd von Arnim an den Postpier. Wieder Geschützfeuer – ein zweites Panzerschiff!
Die Georg Thiele hatte keinen Befehl einzulaufen, und so saßen wir draußen vor dem Hafen wie auf Kohlen und rätselten, warum Rechel keine Torpedos einsetzte.
Dann eine erneute Explosion – ein Flammenmeer markierte das Ende des zweiten Panzerschiffs. Also hatte er es doch getan.
Auf Bontes Signal scherten wir – endlich – mit langsamer Fahrt an die Kaimauer und machten fest.
Die Truppen der Bernd von Arnim hatten den Pier unter Kontrolle, und unsere Leute konnten problemlos von Bord gehen.
Brände erhellten die Szenerie im Hafenbecken – es war ein richtiges Inferno aus untergehenden Schiffen, getroffen von den quer durch den Hafen laufenden Torpedofächern.
Die Stadt Narvik und das Land Norwegen sind für die Wirtschaft des Deutschen Reiches sehr wichtig, und wir haben den Briten zuvorkommen müssen. Ich bin nur ein winziges Rädchen im Getriebe, trotzdem regt sich mein schlechtes Gewissen.
Der Rest des Tages ging für die Beseitigung der Seeschäden und die Ergänzung von Brennstoff drauf.
Verspätet war auch die Erich Giese aufgetaucht, die wegen schwerer Seeschäden zurückgeblieben war.
Abends wurde neu gruppiert; Wilhelm Heidkamp und die anderen Zerstörer der neuen Klasse blieben in Narvik, die 4. Flottille im Herjangsfjord. Bernd von Arnim und wir liefen nach Ballangen.
Das Wetter wurde schlechter. Als die »Lofotekspressen« die Evenes-Enge passiert hatte und wir in den Ofotfjorden kamen, hatte sich der Himmel mit düsteren Wolken bezogen. Das Schnellboot lief in den Hafen von Narvik ein, wo mir als Erstes die hässlichen Anlagen des Erz-Kais auffielen, umkurvte ein paar wartende Erzfrachter und legte am Postpier an.
Ich dachte an ein Foto aus dem Narvik-Buch, auf dem die Bernd von Arnim am Postpier zu sehen war, und auf einmal stand mir die Szenerie von 1940 deutlich vor Augen.
Ich ging zu Fuß die Hauptstraße hinauf in Richtung Rådhuset, als es zu regnen begann. Ich flüchtete mich in ein Café und las in dem Geschichtsbuch. Obwohl ich mich früher wenig für Geschichte und das Militär interessiert hatte, zog mich die Sache in ihren Bann. Es war beklemmend, beängstigend, aber auch faszinierend – vor allem, wenn ich mir vorstellte, dass mein eigener Großvater dabei gewesen war.
Es regnete weiter unaufhörlich, als ich mich wieder hervorwagte und durch die Stadt schlenderte. Ich weiß nicht, ob es nur am Wetter lag, aber ich fand die Stimmung bedrückend und trostlos; vielleicht war ich aber auch nur zu sehr in der Vergangenheit gefangen. Schließlich waren hier viele Menschen gestorben: Norweger, Briten und Deutsche. Das Kriegsmuseum, das ich besuchte, verstärkte diesen Eindruck zusätzlich.
Spontan entschloss ich mich, einen weiteren Tag hierzubleiben. Ich ließ mir in der Touristen-Information ein Hotelzimmer reservieren und fragte mich zu einer Autovermietung durch, wo ich mir einen Chrysler Stratus mietete. Der Wagen sah gut aus; ich fand nur die goldene Schrift der Verleihfirma auf der silberfarbenen Karosserie etwas unpassend. Nach dem gewohnten Charly war es eine gewisse Umstellung, aber ich kam gut mit dem in Norwegen beliebten Auto zurecht. Ich fuhr nach Südosten die E6 entlang nach Ballangen, wo Johannes Feldhoff seine letzte Nacht auf der Georg Thiele verbracht hatte.
Im Kriegstagebuch war nach dem Eintrag vom 9. April 1940 ein Strich diagonal über den Rest der Seite gezogen. Ein deutscher Behörden-Stempel aus Narvik in der rechten unteren Ecke überdeckte zum Teil einen Vermerk in anderer Handschrift. Ich konnte nur so etwas wie »vermißt« entziffern. Das konnte ich mir nicht erklären, bis ich auf der Folgeseite Johannes' handschriftliche Notiz las: »Ab hier im Juli 1940 aus der Erinnerung nachgetragen«.
Ich wunderte mich über die Genauigkeit der Eintragungen, die drei Monate später erfolgt waren, da bemerkte ich ein paar eng beschriebene Notizzettel, die hinten in dem Tagebuch eingelegt waren.
10. April 1940
Endlich eine ruhige Nacht. Die Georg Thiele hatte keinen Vorpostendienst, aber Schlaf fand ich keinen – wie stolz waren wir auf die Eroberung von Narvik gewesen, aber die Bilder der brennenden Schiffe haben sich mir unauslöschlich eingebrannt.
Frühmorgens Alarm! Ich rannte auf die Brücke. Die britische Flotte hatte den Vestfjord blockiert und ging nun mit zahlreichen Zerstörern zum Angriff über!
Wir liefen sofort aus, gefolgt von der Bernd von Arnim.
Meine Rolle als Signalgast war sofort gefragt: Unser Hintermann signalisierte und schlug vor, die großen Erkennungs-Signalwimpel zu setzen. Wolff hielt das für eine gute Idee, da Bey mit unserer 4. Flottille aus dem Herjangsfjord dazukommen würde. Ein grandioses Durcheinander war zu befürchten. Ich ging aufs Signaldeck und zog den Wimpel auf.
Eine Linie von fünf Schiffen auf Westkurs kam in Sicht: britische Zerstörer! Hektische Gefechtsvorbereitungen in unerträglicher Anspannung, dann Feuerbefehl. Meine ersten scharfen Schüsse an Bord der Georg Thiele!