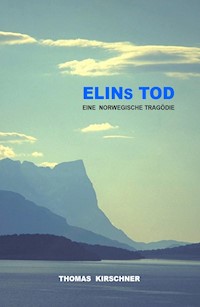2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Theresa-Themis-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Bei einem Kriminologen-Seminar in London lernt der deutsche Polizist Thomas Conrad Kollegen aus verschiedenen Ländern kennen. Kontakte, die sich später als sehr wichtig erweisen. In Cornwall, er hat ein paar Tage Urlaub angehängt, wird er Zeuge der dramatischen Havarie. Ein rostiger Kahn vollgepfropft mit afrikanischen Flüchtlingen scheitert an den berüchtigten Klippen von Kynance Cove … Zurück in Stuttgart, wo er nach dem Tod seiner Frau Quartier bei seiner Schwester Iris genommen hat, bekommt er neue Aufgaben. An seiner neuen Partnerin findet er schnell Gefallen, aber als Rebecca Van Valckenburgh seine Schwester kennenlernt, weiß er nicht mehr, wem die Zuneigung der Südafrikanerin mehr gilt. Ein Amtshilfeersuchen von Scotland Yard führt Conrad wenig später erneut nach London. In dem undurchsichtigen Fall mit zwei Drogentoten scheint eine Musikerin aus Cornwall verdächtig, die er von einem früheren Fall her kennt. Das passt gut in das Klischee von Sex & Drugs & Rock'n'Roll … Bei den Ermittlungen wird klar, dass die Schmuggler-Tradition Cornwalls keineswegs ausgestorben ist. Die Beamten geraten an ein Netzwerk von äußerst gewalttätigen Schleusern und Menschenschmugglern. In Falmouth fällt Thomas und Rebecca der Trimaran Antares auf, dessen Besatzung zunächst verdächtig erscheint. Und was hat die charismatische Musikerin Theresa Themis mit diesem Schiff zu tun? Ein neues Schiff mit afrikanischen Flüchtlingen nähert sich der Küste Cornwalls, aber gleichzeitig zieht Sturm auf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
KYNANCECOVE
THOMAS KIRSCHNER
© 2021 Thomas Kirschner
Autor: Thomas Kirschner
Umschlaggestaltung: Thomas Kirschner
Lektorat, Korrektorat: Deutsches Lektorenbüro
Würzburg
Dr. Ursula Ruppert & Rudolf Langer
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-347-31525-9
ISBN Hardcover: 978-3-347-31526-6
ISBN e-Book: 978-3-347-31527-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
INHALTSVERZEICHNIS
TEIL EINS
Kapitel 1.1
London. Auf vielfältige Weise anregend
Kapitel 1.2
Cornwall. Die Havarie
TEIL ZWEI
Kapitel 2.1
Stuttgart. Iris beweist ein großes Herz
Kapitel 2.2
Stuttgart, Pretoria.Neue Aufgabe, neue Partnerin
TEIL DREI
Kapitel 3.1
Cornwall. Ein Fall für Scotland Yard
Kapitel 3.2
London. Wieder in dem mysteriösen Club
TEIL VIER
Kapitel 4
Exeter. Plötzlich Zielscheibe
TEIL FÜNF
Kapitel 5.1
Lizard-Halbinsel.Die Organisation der Menschenschmuggler
Kapitel 5.2
Burnthouse.Spedition Velyanov, Koslowski & Burns
Kapitel 5.3
Kynance Cove. Die Höhlen
TEIL SECHS
Kapitel 6.1
Kynance Cove. Rettung aus Seenot
Kapitel 6.2
Porthleven. 12 Meilen Zone
EPILOG 1
Exeter und London. Nachspiel
EPILOG 2
Stuttgart. Die Heimkehr
ANHANG
Über dieses Buch
Biografie Thomas Conrad
Glossar
Bildnachweis
Dank
Landkarten
PERSONEN
Thomas Conrad
Polizeibeamter aus Frankfurt aus der Bahn geworfen vom Tod seiner Frau
Leticia Alvez-Conrad
Architektin in Frankfurt im März 2010 an Krebs gestorben
Iris Conrad
Anwältin in Stuttgart Schwester von Thomas, gibt ihm große Unterstützung
Rebecca VanValckenburgh
Sergeant der Polizei aus Kaapstad gibt Thomas neuen Lebensmut
Sidney Carlisle-St John
Detective Sergeant aus Newcastle lernt Thomas im Seminar kennen
Melora Linaï-Johnson
Studentin in Exeter gibt ihm ungeahnte Lebensfreude
Bryan Linwood
Detective Chief Inspector in London weiß zunächst nichts mit der Unterstützung der neuen Kollegen anzufangen
Vincent Trevail
Detective Inspector aus Newquay kennt die lokalen Eigenheiten
Phil Bradley
Detective Inspector aus Newquay Spezialist im Sondereinsatzkommando
Patricia DeMulder
Tänzerin in London Erpresserin
Steven Newcombe
ihr Freund aus Exeter, Devon legt falsche Spuren
Enid Trevelyan
Musikerin aus Lizard, Cornwall Hauptverdächtige
Tony Trevelyan
ihr Bruder in Penzance berufstätig
Raynah
seine Partnerin arbeitet in St Ives
Carina von Salis
Enids Stiefmutter, verwitwet Schweizer Adlige, klassische Sängerin
Sir Charles Marriner
ihr Freund aus Marazion, Cornwall Freund der Familie
Jonathan
Flüchtling aus Asmara, Eritrea sucht Schutz bei den Trevelyans
Senaït
seine Schwester
Dennis Coleman
Seefahrtexperte in Falmouth, GB gibt die »Schiffsmeldungen« heraus
Jonathan Crawley
Anwalt in Truro, Cornwall Rechtsbeistand der Familie Trevelyan
Alexander Moras
Yachtbesitzer aus Stavanger ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird
Jadi Moras
Yachtbesitzerin, seine Schwester gute Seefahrerin
Theresa Themis
Musikerin aus Neuseeland nimmermüde Kämpferin
Kevin Burns
Yachtbesitzer aus Nassau, Bahamas verfolgt in Cornwall geheime Interessen
Marlon Burns
Spediteur in Exeter, Devon betreibt ein undurchsichtiges Geschäftsmodell
Sabrina Burns
Reederin in Vigo, Spanien die Namensgleichheit erscheint verdächtig
Marushka Veljanov
Spediteurin in Exeter, Devon Geschäftspartnerin von Marlon
Justin Koslowski
Spediteur in Exeter, Devon Geschäftspartner von Marlo
TEIL EINS
Kapitel 1.1 London. Auf vielfältige Weise anregend
Auf der Taxifahrt durch das nächtliche, verregnete London in Richtung Chelsea kam ich ins Grübeln. Meine ursprüngliche Hoffnung auf Ablenkung von meinen trüben Gedanken verblasste zusehends. Und die düstere Umgebung mit den grauen Häusern und dem nassen Kopfsteinpflaster, über welches das altmodische Fahrzeug holperte, spiegelte meine eigene Gemütslage nur zu gut wider.
Das Seminar, das den offiziellen Anlass für diese Reise bot, versprach, sehr interessant zu werden. Die Veranstaltung war international besetzt und wurde von der Metropolitan Police ausgerichtet.
Die Worte meiner Schwester kamen mir in den Sinn: »Vielleicht tut es dir gut, Stuttgart und deine traurigen Erinnerungen hinter dir zu lassen.«
Sie hatte mir ein großzügiges Taschengeld aufgedrängt, »damit du es dir am Wochenende richtig gut gehen lassen kannst«.
Iris war eigentlich selbst in schwerwiegende Probleme verstrickt, aber finanzielle Engpässe gehörten nicht dazu. Durch eine bizarre Laune des Schicksals war ihr ein beträchtliches Vermögen in den Schoß gefallen, das von ihrem auf mysteriöse Weise verschwundenen Gatten stammte.
Von ihr kam der Tipp mit dem Privatclub, der in dieser Nacht mein Ziel war. Der Club sei gerade besonders angesagt, hatte sie angedeutet; er habe eine spektakuläre Einrichtung und würde künstlerische Tanzauftritte zu extravaganter Musik bieten. Iris hatte manchmal etwas merkwürdige Vorlieben, und so dämpfte ich meine Erwartungen; notfalls konnte ich ja gleich wieder gehen.
Das Taxi hielt an der Straßenecke. Ein anachronistisch anmutendes Vehikel, das sich aber schon am Nachmittag bei meiner Ankunft bewährt hatte: In der uralten Konstruktion des Austin FX4 London Taxi konnte man sein Gepäck problemlos vorne neben den Fahrer stellen und es sich hinten in großzügigen Sitzen bequem machen. Zudem war das Gefährt im Stadtverkehr durch seinen extrem großen Lenkeinschlag überaus wendig.
Ich bezahlte den Fahrer, stieg aus und wartete, bis das Taxi davongefahren war. Die Gegend war unbelebt und trostlos; außer mir war keine Menschenseele in Sichtweite, und auch an den Fassaden der großen Häuserblocks ringsum zeigten sich kaum erleuchtete Fenster. Ich ging ein paar Schritte den Gehsteig entlang, da hörte ich das Geräusch von Reifen auf nasser Fahrbahn. Ein weiteres Taxi hielt keine hundert Meter entfernt an. Der Fahrgast stieg aus und schlug meine Richtung ein. Energisch versuchte ich, mein als Polizist erworbenes Misstrauen abzuschütteln. Du bist nicht dienstlich unterwegs, sagte ich mir.
Das Gebäude, vor dem ich stehen blieb, war zwar groß, aber ansonsten unscheinbar, und ich vergewisserte mich, dass die Adresse mit Iris' Angaben übereinstimmte, ehe ich die Stufen zu dem Kellereingang hinabstieg. Erst dort bemerkte ich das Türschild mit der Aufschrift »Cyrah's Gothic Club«. Ich klingelte an der Tür mit dem eingelassenen, verspiegelten Fenster.
Ein paar Sekunden lang tat sich nichts, und ich vermutete schon, der Club sei geschlossen. Vielleicht wurde ich auch gerade insgeheim gemustert. Wahrscheinlich war ich nicht cool oder stylish genug für diesen Privatclub – oder mit meinen 36 Jahren schlichtweg zu alt.
Plötzlich öffnete sich die Tür, und ein elegant gekleideter Portier bat mich freundlich herein. Drinnen umfing mich in denkbar krassem Kontrast zu draußen ein Ambiente von exquisitem Luxus und künstlerisch ambitionierter Gestaltung. Der Mann begrüßte mich liebenswürdig. Nur an seiner Statur war zu erkennen, dass er nötigenfalls auch eine ganz andere Seite an den Tag legen konnte. Am Counter im Vorraum erfasste er in einem Lesegerät meine Kreditkarte, nahm mir an der Garderobe den Mantel ab und geleitete mich zu einem stilvoll gestalteten Clubraum.
Es lief Rockmusik, an sich gar nicht mein Geschmack – ich war mit Barock und Klassik groß geworden –, doch dann horchte ich auf. Die Songs, die aus einer hervorragenden Surround-Anlage erklangen, waren tiefgründiger und dramatischer als erwartet. Sie schufen eine erregende und zugleich mystische Atmosphäre. Trauer und Sorgen schienen auf einmal ganz weit weg.
Die Beleuchtung war gedämpft. In dem unübersichtlichen Salon erkannte ich lediglich einen Tresen, hinter dem eine Barkeeperin Gläser putzte; dahinter verlor sich der Raum im Dunkel. In gemütlichen Sitzgruppen saßen einzeln oder paarweise Personen beiderlei Geschlechts – soweit ich erkennen konnte alle jung, attraktiv und elegant gekleidet. Passte ich überhaupt in diese Umgebung und zu dieser Gesellschaft? Energisch suchte ich meine Selbstzweifel abzuschütteln.
Plötzlich öffnete sich die Eingangstür erneut, und ich wandte mich neugierig um. Der Portier führte einen weiteren Gast herein – eine große, dunkle Gestalt, vermutlich der Fahrgast aus dem anderen Taxi. Im ersten Moment hielt ich diese Person für einen schmalen, hochgewachsenen Schwarzen. Doch aus dem schwarzen Ledermantel schälte sich eine ausgesprochen weibliche Figur. Auch wenn diese junge Frau mit schmalen Hüften und breiten Schultern fast maskuline Proportionen hatte, war ihre Taille doch gertenschlank, und unter ihrem Top wölbten sich unübersehbar hoch angesetzte Brüste. Um ihren Hals trug sie einen schweren Anhänger, und ich erkannte den aus massiven Silber-Lettern geformten Namen Rebecca. Sie hielt inne, um sich an das Halbdunkel zu gewöhnen – gut, so war ihr hoffentlich entgangen, wie hingerissen ich sie angestarrt hatte. Leider ließ sie sich in einem weit entfernten Sessel nieder. Aus ihrem flachen Lederrucksack, den sie anstelle einer Handtasche bei sich hatte, ragte eine Zeitung hervor, und ich meinte, den Schriftzug »CapeTimes« zu erkennen. Aus dem Hintergrund kam eine junge Frau zu meiner Sitzgruppe, offenbar eine Angestellte des Clubs. Ihre roten Locken erinnerten mich an meine Schwester, aber im Gegensatz zu der lebenslustigen Iris wirkte sie betont distinguiert, fast arrogant. Sie servierte mir einen Drink und zeigte mir anschließend den Zugang zu den verschiedenen Bühnen.
Schon der Clubraum und die Musik hatten mir gut gefallen, aber jetzt packte mich die Neugier auf die weiteren Attraktionen des Clubs. Ich trat durch das mir gewiesene Portal, ging einen dunklen Gang entlang und hielt an einer Alu-Brüstung. Unterhalb der Galerie befand sich eine große Halle mit Mauern, die wirkten, als seien sie aus natürlichem Stein gehauen. Jetzt verstand ich, weshalb meine Schwester das Attribut spektakulär gebraucht hatte. Es entstand der surreale Eindruck eines abgrundtiefen, kathedralenartigen Felsengewölbes. Am Boden ergossen sich türkis leuchtende Wasserkaskaden in ein unregelmäßig geformtes Becken, in dem sich mehrere Schwimmer bewegten. Spontan bedauerte ich, keine Badesachen dabei zu haben, bis ich bemerkte, dass die Badegäste nackt waren.
Die Galerie führte mich zu der ersten von mehreren unterschiedlich dimensionierten Bühnen. Ich schloss die Tür hinter mir. Es herrschte Stille; langsam gewöhnte ich mich an das bläuliche Dämmerlicht. Die Leute hier – etwa zehn an der Zahl – verteilten sich auf unregelmäßig gruppierte Ledersessel und erwarteten anscheinend einen Auftritt. Auf der Bühne, deren Bretter sich auf Augenhöhe befanden, regte sich noch nichts. Der Mann links neben mir erzählte etwas von zwei Asiatinnen aus Seattle – dann drehte die Frau zu meiner anderen Seite den Kopf zu mir, ihre Zähne blitzten im fluoreszierenden Licht. »Freuen Sie sich auf die beiden«, lächelte sie, »ich kenne sie schon!«
Rhythmische Musik erklang, und zwei Tänzerinnen traten auf das Podest, die sich so ähnlich sahen wie Schwestern. Ihre Performance erinnerte mich an das progressive künstlerische Tanztheater, das ich in Frankfurt kennengelernt hatte, nur war die erotische Komponente hier viel stärker. Die beiden anmutigen Asiatinnen bewegten sich artistisch und virtuos. Die komplexen Tanzfiguren führten das Duo immer enger zusammen, bis das Stück in einer zärtlichen Umarmung endete. Während das Publikum applaudierte, kehrte ich zur Galerie zurück.
Neugierig wandte ich mich den anderen Bühnen zu und schaute mir weitere ebenso künstlerische wie erotische Darbietungen an. Schließlich nahm ich unter den Zuschauern im letzten Saal Platz. Musik setzte ein, und ich horchte erstaunt auf: Das war unverkennbar Rockmusik mit all ihrer Dynamik und den treibenden Rhythmen, aber rein instrumental und als Fuge komponiert, als hätte sie ein moderner Johann Sebastian Bach ersonnen.
Eine Solo-Performance stand auf dem Programm. Gelassen trat die Tänzerin auf die Bühne. Sie war schlank und hochgewachsen, wirkte aber mit ihrem athletischen Körperbau eher androgyn. Mit einem Mal wurde mir klar: Das war Rebecca, die Frau, die mich im Clubraum so fasziniert hatte! Seltsam, sie war eben noch unter den Gästen des Clubs gewesen. Doch obwohl die Tänzerin nur als
Silhouette erschien und ihre Gesichtszüge in der Dunkelheit verschwammen, war ich mir sicher. Ihre Ausstrahlung war von animalischer Grazie, ihre unbändige Energie absolut überwältigend. Dieser Eindruck wurde auch nicht durch ein paar kleine, gut verheilte Narben auf ihrem Körper geschmälert. Überraschend verließ sie das Podium, mischte sich unter das Publikum und wirbelte durch den Saal – dann stand sie direkt vor mir. Hatte sie gespürt, wie sehr ich sie begehrte?
Sie sah mich an, und die Zeit schien still zu stehen. Ihr Teint war dunkel, die langen Rastalocken schwarz, aber ihr schmales Gesicht mit der geraden Nase und den fein geschwungenen Lippen zeigte keine negroiden Züge.
Unvermittelt küsste sie mich auf die Lippen!
Ehe ich mich von diesem lustvollen Schock erholt hatte, tanzte sie schon wieder auf der Bühne, bis der Vorhang fiel. Den Druck ihrer festen, weichen Lippen spürte ich da noch immer auf meinem Mund.
Es war spät in der Nacht, als ich den Club verließ. Ich hatte von der Galerie aus hinunter in den Poolbereich geschaut und mich noch eine Weile im Clubraum aufgehalten, auch als die meisten Gäste schon gegangen waren. Aber Rebecca ließ sich an diesem Abend nicht mehr blicken.
Für mich war ein Zimmer in dem altehrwürdigen, etwas heruntergekommenen Strand Palace Hotel reserviert, und ich schaute aus meinem Dachfenster in den wolkenverhangenen Himmel. Es war Sonntag. Ich hatte nichts Besonderes vor – und außerdem keine Lust, mich in die Warteschlange vor dem Frühstücksraum einzureihen. Also drehte ich mich um und schlief noch eine Runde. Am späten Vormittag bummelte ich durch das Theaterviertel Covent Garden, ging am Royal Opera House vorbei zu den Markthallen, die heute mehr eine touristische Attraktion mit Shopping Mall als ein echter Markt sind. In der King Street aß ich Muffins in einem Bistro mit dem Namen Canadian Muffin Company.
Nachmittags strandete ich in einem Pub, der für die Tageszeit erstaunlich voll war. Die meisten Gäste starrten auf einen großen Bildschirm in der Ecke, ich suchte mir mit meinem Pint of Lager einen stilleren Platz. Es dauerte eine Weile, bis mir einfiel, dass gerade eine Fußballweltmeisterschaft im Gang war. Davon waren schon in Deutschland die Medien voll gewesen, aber ich hatte keine Ahnung, wo auf der Welt dieses Ereignis stattfand. Die Leute im Pub feuerten eine Mannschaft an, daher vermutete ich, dass England spielte. Doch gut gestimmt waren die Gäste nicht. Einer stieß mich an: »Where you're from, man?«
Eben hatte ich geantwortet, dass ich aus Deutschland stammte, da erhaschte ich einen Blick auf den Bildschirm und las »Worldcup 2010 Round of 16 Bloemfontein England – Germany 1:2«. Jetzt bedauerte ich, die Wahrheit gesagt zu haben, aber man trat mir nicht feindselig gegenüber. Deutschland schoss noch zwei weitere Tore, und am Schluss wurde mir sogar gratuliert.
Kaum hatte ich den Pub verlassen, war die Erinnerung an das Fußballspiel verflogen, und ich dachte nur noch an den kommenden Abend. Ich freute mich unbändig auf Cyrah's Gothic Club. Schon am ersten Abend war mein Vorsatz, dieses Etablissement mit ironischer Distanz zu betrachten, dahingeschmolzen; die besondere Stimmung hatte mich voll und ganz gefangen. Aber vor allem hoffte ich, Rebecca wiederzusehen.
Die Zeit verging quälend langsam, und ich fuhr viel zu früh nach Chelsea, wo ich noch eine Weile ziellos durch die Straßen lief. Dann endlich öffnete der Club. Aufgeregt trat ich ein, und das Ritual lief ab wie am Vortag, allerdings ohne dass sie auftauchte. Wahrscheinlich jagte ich Hirngespinsten nach. Trotzdem gab ich nicht auf und wanderte von Bühne zu Bühne, um mir keine Darbietung entgehen zu lassen – ohne den erhofften Erfolg. Immerhin erlebte ich bei einer der Performances eine geradezu fantastische Erscheinung: Die schwarze Tänzerin war noch größer als Rebecca, und ihre langen Haare leuchteten in hellem Türkis.
Schließlich saß ich noch eine geschlagene Stunde – mit einer Resthoffnung – im Clubraum, wo mich wie am Vorabend die vornehme Rothaarige bediente. Unverhofft sprach sie mich mit freundlichem Lächeln an: »Schön, dass Sie wieder da sind. Hat Sie die gestrige Show angesprochen?«
Das konnte ich uneingeschränkt bejahen, und ich nutzte die Gelegenheit, nach Rebecca zu fragen: »Mir ist unter uns Gästen eine gut aussehende Dame aufgefallen, die ich später auf einer der Bühnen beim Tanz gesehen habe.«
»Das ist ungewöhnlich, meinen Sie?«, entgegnete die Frau lächelnd. »Bei uns treten öfters talentierte Gäste als Akteure auf.«
Mir kam die letzte Darbietung in den Sinn, und ich erkundigte mich nach der geheimnisvollen Tänzerin mit den türkisfarbenen Haaren.
»Sie meinen Cyrah, sie ist hier der Boss! Cyrah leitet den Club und sucht auch persönlich die Musik aus.«
Das war ein interessanter Punkt. »Ich hätte in diesem Etablissement eher Swing oder Jazz erwartet.«
»Sind Sie enttäuscht?«
»Nein. Ich bin selber überrascht, wie gut mir diese Musik gefällt. Meine Lieblingskomponisten sind eher Bach und Beethoven.«
Sie lächelte erneut: »Es ist auch nicht irgendeine Rockmusik. Wir spielen Gothic Metal von Bands wie Tristania und Epica, Progressive Rock von Dream Theater, aber auch Subkultur-Avantgarde von Godspeed, Tool und Crippled Black Phoenix.«
Die Bandnamen sagten mir nichts. »In einem der Säle hat mich die Rockmusik tatsächlich an Johann Sebastian Bach erinnert. Ein polyphon durchkomponiertes Instrumental, wie ich es heutigen Musikern gar nicht zutrauen würde.«
»Sie meinen sicher Black Rose. Das ist Cyrahs Lieblingsgruppe.« Die Bedienung verschwand, um ihren Verpflichtungen nachzugehen. Den Namen Black Rose hatte ich schon einmal gelesen, mir fiel nur nicht ein, wo.
Der Morgen graute schon, als ich den Club mit zwiespältigen Empfindungen verließ. Die Atmosphäre dort gefiel mir immer besser, aber ich war enttäuscht, Rebecca nicht wiedergetroffen zu haben.
Am Montag klingelte mein Wecker grausam früh. Wieder verzichtete ich auf das Hotelfrühstück und ging zu Fuß den Strand entlang in Richtung Trafalgar Square.
Am Charing Cross in Whitehall schaute ich die historischen Bauten und die Machtzentren Großbritanniens mit einer gewissen Ehrfurcht an. Es war ein ziemlich langer Weg quer durch Westminster in die Victoria Street, aber der Marsch durch die kühle Luft tat mir gut. Der moderne Bau des New Scotland Yard, der in dieser Umgebung wie ein Fremdkörper wirkte, lenkte meine Gedanken auf das, was mich heute dort erwartete. Das Thema des Workshops, neueste Entwicklungen in der Technologie von Handfeuerwaffen, interessierte mich sehr. Der romantisch verklärte Name Scotland Yard stand recht prosaisch für das Hauptquartier des
Metropolitan Police Service, in dem die Crime Academy dieses Seminar veranstaltete. Diese Einheit gehörte zwar zum Specialist Crime Directorate, aber um das Thema Schusswaffen erschöpfend zu behandeln, war die Abteilung Specialist Firearms Command hinzugezogen worden.
Im Foyer wurde ich nach Prüfung meiner Anmeldung und meiner Personalien zügig weitergeleitet. Ich fuhr mit dem Lift in die oberste Etage, wo mich ein hochrangiger Beamter, immerhin ein Chief Superintendent, höflich begrüßte. Im Seminarraum herrschte erfreulicherweise eine weniger formelle Atmosphäre. Die Aura des Seminarleiters, der Kompetenz und Lässigkeit ausstrahlte, gefiel mir.
Am ersten Tag diskutierten wir mit Ingenieuren der Waffenindustrie über Verschlusssysteme und Munition, über konventionell gezogene und Polygonläufe sowie andere Konstruktionsmerkmale moderner Pistolen.
In der Mittagspause erzählten mir britische Kollegen von dem ersten Teil des Seminars in der Vorwoche, an dem ich nicht hatte teilnehmen können.
»Bei den Waffentests fiel uns diese farbige Südafrikanerin durch ihre brillanten Schießergebnisse auf, sowohl mit ihrer eigenen Pistole als auch mit dem Sturmgewehr«, erinnerte sich ein Specialist Firearms Officer, und einer der Taktiklehrer der Crime Academy warf ein: »Nicht nur ihre Leistungen im Prüffeld waren super, auch im Seminar hat die junge Frau beeindruckt. Ein cooler Typ, kompetent und energisch; wenn auch nicht besonders sexy mit ihren athletischen Proportionen.«
Ein älterer Kollege, ein Chief Inspector aus dem Protective Security Command, konnte sich den Lobeshymnen nicht anschließen: »Die Schwarze war doch vor allem arrogant. Ohnehin nur ein Sergeant des South African Police Service. Und attraktiv ist etwas anderes. So große und muskulöse Frauen finde ich eher hässlich. Sie sieht ja fast aus wie ein Bodybuilder!«
Ich warf ein: »Auch in Deutschland kommen immer mehr Frauen in den Polizeidienst. Und die meisten Kolleginnen machen eine ziemlich gute Figur!«
Mich ärgerte der abfällige Kommentar, egal ob nun Rassismus oder Sexismus dahintersteckte. Viele meiner Kolleginnen fand ich überdurchschnittlich attraktiv; vielleicht weil ein trainierter Körper in diesem Job vorausgesetzt wurde. Außerdem gehörten für eine Frau immer noch besonderer Mut und viel Selbstvertrauen dazu, sich in dieser einstigen Männerdomäne zu behaupten.
Der Kollege, der die Südafrikanerin zuerst erwähnt hatte, ließ sich nicht beirren und blieb bei seiner Meinung. Sie sei nicht umsonst Mitglied einer Eliteeinheit der südafrikanischen Special Task Force. »Schade, dass sie heute nicht da ist. Ich hatte eigentlich mit ihr gerechnet, denn sie hat ihre Rückreise nach Capetown extra um eine Woche verschoben, um hier weiter dabei sein zu können.« Capetown – das Wort hatte ich doch kürzlich irgendwo gehört oder gelesen. Wo nur?
Der Specialist Firearms Officer kam auf das Schießtraining zurück und erwähnte die Waffe der Südafrikanerin, eine Denel Vektor CP1 aus ihrem Heimatland. Diese hochmoderne Pistole in futuristischem, ergonomisch optimiertem Design, Kaliber 9 mm mit Polygonlauf hatte wie meine Heckler & Koch P7M13 einen gasgebremsten Masseverschluss.
»Eine ungewöhnliche Waffe mit hervorragenden Trefferquoten, wie wir gesehen haben.«
Der ältere Kollege machte eine wegwerfende Handbewegung: »Die Vektor wird doch nach dieser Rückrufaktion im Jahr 2000 gar nicht mehr produziert.«
»Das ändert nichts an der Qualität ihrer Waffe, die in gutem Zustand war. Ich vermute sogar, die Südafrikanerin hat sie selber optimiert, und das dürfte eine aufwendige Handarbeit gewesen sein.« Am Nachmittag ging der Workshop weiter, und gegen Abend erwähnte auch der Seminarleiter die Südafrikanerin und teilte mit, Miss VanValckenburgh lasse sich entschuldigen: Sie habe sich krankgemeldet, hoffe aber, am Dienstag wieder da sein zu können. Ein Kollege warf despektierlich in die Runde, sie habe wohl am Wochenende etwas zu viel gefeiert.
Am Dienstagmorgen kam ich etwas zu spät in den Seminarraum; fast alle waren schon da, und ich schaute mich neugierig nach der hochgelobten Südafrikanerin um.
Da sah ich sie und erstarrte: Es war die faszinierende Rebecca aus dem Nightclub, die mir in dieser erotischintimen Atmosphäre so nahegekommen war. Jetzt war sie in einen eleganten, gut geschnittenen Hosenanzug gekleidet, dessen helles Beige reizvoll mit ihrem dunklen Teint kontrastierte. Ihre langen schwarzen Rastalocken milderten den strengen Kleidungsstil. Sie saß angespannt da, wirkte hohlwangig und hatte die schmalen Lippen zusammengepresst.
Ihr Blick fiel auf mich, und auch sie erkannte mich sofort: Sie hielt kurz den Atem an, wirkte gleichzeitig erfreut und irritiert, bevor ihr Gesicht neutral wurde. Wir stellten uns höflich vor: »Rebecca VanValckenburgh from Capetown, South Africa« – »Thomas Conrad from Stuttgart, Germany« –, blieben aber distanziert. Nur mancher ihrer Blicke schien auf unser gemeinsames Geheimnis Bezug zu nehmen und strahlte Sympathie und Erregung aus; aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Ansonsten wirkte sie eher bedrückt und verschlossen, was so gar nicht zu der wilden Ausgelassenheit vom Samstagabend passte.
Erst in der Mittagspause sprachen wir miteinander. Es waren aber immer Kollegen dabei, sodass wir nie über Cyrah's Gothic Club reden konnten. Nur als einer anzüglich fragte, ob denn ihre Unpässlichkeit vom Vortag etwas mit ihren Vergnügungen am vergangenen Wochenende zu tun gehabt hätte, befürchtete ich, sie würde sich verraten. Aber sie blieb ruhig und verwies auf familiäre Probleme zu Hause.
Verliebt wie ein Schuljunge sehnte ich das Ende des Seminars herbei, in der Hoffnung, Rebecca wieder näher zu kommen.
Als wir die Kollegen außerhalb des Polizeigebäudes abgeschüttelt hatten, sprach ich sie hastig an und fragte, ob ich sie für den Abend zum Essen einladen dürfe. Sie blieb stehen, drehte sich zu mir um und sah mir direkt in die Augen. Jetzt war es nicht mehr vorrangig ihre aggressive physische Präsenz, die mich fesselte; ich fand ihr ausdrucksvolles Gesicht überirdisch schön. Doch ihr Lächeln war traurig: »Vielleicht klappt es, aber zu Hause ist etwas Schlimmes passiert. Möglicherweise muss ich kurzfristig nach Südafrika zurück. Auf jeden Fall wäre ich keine fröhliche Gesprächspartnerin.«
Sie wollte sich nicht näher dazu äußern, aber ich sagte: »Trotzdem würde ich gerne den Abend mit dir verbringen. Freunde sind auch dafür da, Traurigkeit miteinander zu tragen und nicht nur …«
Sie lächelte und unterbrach meine pathetischen Worte: »Ich weiß, was du sagen willst, Thomas. Probieren wir es doch im Rules um 9:00 p. m. Aber ich kann nichts versprechen.«
Wir küssten uns zum Abschied auf die Wangen. Plötzlich grinste sie übermütig: »Du hast mich schon inniger geküsst, Thomas, erinnerst du dich?«
Wie hätte ich das jemals vergessen können …
Voller Vorfreude fand ich mich zur verabredeten Zeit in dem bekannten Lokal in der Maiden Lane ein, doch dann bekam ich eine SMS-Nachricht: »Kann leider nicht kommen, muss sofort nach Hause. Sei nicht böse, Thomas.«
Ich war extrem enttäuscht; der Inhalt der Nachricht blieb für mich kryptisch. Wenigstens musste ich die Absage nicht auf mich beziehen.
Am nächsten Morgen verkündete der Seminarleiter, Miss Van-Valckenburgh sei wegen eines Todesfalls in der Familie abgereist. Tief betroffen versuchte ich, Mitgefühl und Traurigkeit zu verdrängen und mich wieder auf das Seminar zu konzentrieren.
Gegen Ende der Woche, zum letzten Thema des Seminars, stieß eine junge Kriminalpolizistin zu unserer Gruppe, und wieder hatte mein spezieller Freund etwas zu lästern: »Detective Sergeant Sidney Carlisle-St John«, er sprach den Namen betont hochnäsig aus, »ist am Yard wohlbekannt: gescheitertes Wunderkind aus englischem Hochadel; hat in Cambridge studiert, ist dann aber doch hier als einfache Polizistin gelandet.«
Ein Kollege, der mit uns in der Kantine beim Mittagstisch saß, relativierte die Aussage: »Man sagt, sie habe ihr Studium der Philosophie und Geschichte summa cum laude bestanden und ihr IQ sei höher als der des Polizeichefs.«
»… dazu gehört ja auch nicht viel«, warf einer der Kollegen am Tisch lachend ein.
»Es ist wohl so, dass die Familie wenig begeistert war, als ihr supertalentiertes Töchterlein diesen nicht gerade standesgemäßen Beruf ergriff.«
In diesem Moment kam die Polizistin herein, und er brach ab. Sie nahm ausgerechnet an unserem Tisch Platz und stocherte lustlos in ihrem Salat herum. Falls ihr aufgefallen war, dass mit ihrem Eintreffen die Gespräche am Tisch verstummten, zeigte sie es nicht. Vielleicht war sie das auch gewöhnt, entweder als Mitglied der Upperclass oder als attraktive Frau in einem klassischen Männerberuf. Und schön war sie wirklich: schlank und topfit, mit kurzem, glattem Haar, das intensiv rot schimmernd ihr schmales Gesicht umgab.
Ich versuchte, ein Gespräch mit ihr anzufangen und über das nächste Seminarthema zu reden, aber sie blieb schweigsam und abweisend. Plötzlich sah sie auf und sprach mich auf Deutsch an: »Sind Sie der Kollege aus Stuttgart?«
Als ich überrascht nickte, erläuterte sie: »Der Seminarleiter hat Sie erwähnt. Kommen Sie; wir haben noch ein wenig Zeit. Gehen wir ein paar Schritte!«
Ich war ohnehin mit dem Essen gerade fertig; so gingen wir hinaus und ließen die überraschten Kollegen zurück. Auf der Straße vor dem Gebäude gab sie mir die Hand und sagte recht formell: »Ich heiße Sidney. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Ganz meinerseits. Wenn wir uns schon mit den Vornamen anreden, ich heiße übrigens Thomas, können wir auch du zueinander sagen. Im Englischen gibt es die Unterscheidung ja glücklicherweise nicht.«
Sie nickte lächelnd und übernahm die Führung die Victoria Street entlang, an der Westminster Abbey vorbei in Richtung Themse. Gerade als wir zur Westminster Bridge hinauf spazierten, schlug der Big Ben ein Uhr. Wir wandten uns am Ufer nach links und flanierten über das Victoria Embankment. Das Wetter hatte sich gebessert, die Sonne schien; nur ein kühler Wind kam den Fluss heraufgezogen, was aber die Engländerin nicht zu stören schien.
Nachdenklich sagte ich: »Der Anblick des breiten Stromes mit den kleinen Schaumkronen auf der blauen Wasserfläche, der frische Wind und die Schiffe im Hintergrund wecken in mir die Sehnsucht nach Meer und Seefahrt. Ich habe nach dem Seminar zwei Wochen Urlaub; vielleicht sollte ich einfach hier in England bleiben und an die Südküste fahren, oder nach Südwesten, nach Cornwall …«
Sidney lächelte: »Ohne diese Möglichkeit, zum Fluss zu kommen, wäre es im Yard kaum auszuhalten. Cornwall ist eine gute Idee; ich stamme zwar aus dem Norden Englands, war aber als Kind schon oft auf Urlaubsreisen dort.«
Sie sprach mit deutlichem Akzent, aber fehlerfrei und sorgfältig formuliert. Ich machte ihr ein entsprechendes Kompliment, und sie erklärte: »Ich habe schon auf der Schule Deutsch gelernt und später auf dem Trinity College in Cambridge meine Kenntnisse vertieft. Sie wirken erstaunt; ist das so ungewöhnlich?«, hastig korrigierte sie sich: »Du wirkst erstaunt …«
Lächelnd bemühte ich mich, den nächsten Satz nicht wie einen Affront wirken zu lassen: »Man sagt den Engländern nach, sie würden die Sprachbarriere nur als Problem der anderen betrachten. Verstehst du, was ich meine?«
»Ja, das stimmt wohl oft«, grinste sie, »aber die junge Generation ist da etwas anders.«
»… obwohl es mit Englisch als Muttersprache verführerisch einfach ist: Auf vielen Gebieten ist Englisch die Fachsprache, und man kann sich fast überall auf der Welt verständlich machen.«
»Im Studium ging es mir nicht nur um die Sprache. Ich finde die komplexe Geschichte und die vielfältige Kultur Deutschlands faszinierend. Ich liebe die Literatur und Musik des Barock, der Klassik und der Romantik …«
Ich schüttelte ungläubig den Kopf: »Und ich dachte, diese Generation hielte alles, was musikalisch vor den Beatles lag, für Klassik und würde einen weiten Bogen darum machen.«
»Ich bin nicht wie die meisten dieser Generation!«
Spontan rief ich »wahrhaftig nicht!«, und stockte verlegen: »Das klang jetzt ziemlich platt, aber ich meine das als echtes Kompliment.«
Sie lächelte, entgegnete aber nichts.
Auf dem gegenüberliegenden Ostufer der Themse entdeckte ich hinter dem Riesenrad London Eye die Royal Festival Hall. Sidney war meinem Blick gefolgt: »In diesem Komplex liegt auch der Purcell Room; dort habe ich schon viele Konzerte gehört, vor allem von den deutschen Meistern des 17. Jahrhunderts.«
»Henry Purcell, der Namensgeber dieses Konzertsaals, beweist, dass es auch bedeutende englische Barock-Komponisten gibt. Ich mag Purcells Musik sehr. Schade, dass ihm nur eine kurze Schaffensperiode vergönnt war.«
»Ja, er ist 1695 mit nur 36 Jahren gestorben. Was hätte er noch alles schreiben können, wenn er länger gelebt hätte.«
Ich kam wieder auf das Thema Deutschland zurück, und wir sprachen über die spürbare Abneigung vieler Engländer, die so lange nach dem Krieg längst hätte überwunden sein sollen, wie sie meinte. Ich sagte dazu nur, dass ich mir darüber angesichts der großen Schuld Deutschlands kein Urteil erlauben könne.
Sidney wurde ernst und wechselte das Thema: »Thomas, ich habe dir doch von meinem Gespräch mit dem Seminarleiter erzählt …«
»Ich hoffe, er hat nur Gutes über mich gesagt«, frotzelte ich, aber sie blieb ernst: »Er hat sich bei deiner Dienststelle in Deutschland nach dir erkundigt. Angesichts deiner positiven Beurteilungen ist es verwunderlich, dass du noch nicht weiter aufgestiegen bist.«
Ich schluckte und fühlte mich in diesem Moment nicht in der Lage, auf ihre unausgesprochene Frage einzugehen. Ich murmelte etwas von familiären Problemen, und sie verstand sofort, dass sich hinter meinen dürren Worten eine seelische Wunde verbarg. Spontan strich sie mir begütigend mit der Hand über den Arm – eine erstaunlich intime Geste für diese beherrschte Person. Mein Blick fiel auf die Uhr, es war Zeit umzukehren.
An diesem Nachmittag ging es in unserem Workshop um die elektronische Ausrüstung der Polizei, unter anderem um moderne Nachtsichtgeräte, wie sie den Sondereinsatzkommandos bereits zur Verfügung standen. Die Frage war, ob sich der Aufwand lohnen könnte, auch Streifenpolizisten oder Ermittler der Kriminalpolizei damit auszurüsten. Ich war von der Technik überzeugt und schlug vor, mit dem Mustergerät des Seminarleiters am Abend einen Feldversuch zu machen. Die Kollegen murrten, dass ihre Freizeit dadurch beschnitten würde, aber Sidney setzte sich vehement dafür ein, und so konnten wir den Seminarleiter für das Vorhaben gewinnen.
Also saßen Sidney, zwei Kollegen und ich am Abend in einem zivilen Rover 75 der Fahrbereitschaft und fuhren durch die Stadt. In Knightsbridge, westlich vom Stadtzentrum, ging es die Brompton Road entlang, wo linker Hand Chelsea und der Club lagen. Meine Gedanken schweiften ab und blieben bei der Erinnerung an Rebecca hängen. Erst das hell erleuchtete Kaufhaus Harrods holte mich in die Gegenwart zurück. Die Dunkelheit war schon hereingebrochen, aber die Lichter der Stadt machten die Nacht zum Tage.
»Das ist das Problem, das ich meine«, sagte ich. »Bei diesen vielen Lichtquellen wirkt alles, was dazwischenliegt, umso dunkler.«
Sidney nahm den Faden auf: »Das stimmt; es sind diese extremen Kontraste, die uns Probleme bereiten. Zum Beispiel, wenn die Bebauung neben der Straße von einer Grünanlage abgelöst wird.«
In Kensington bog der am Steuer sitzende Kollege von der Cromwell Road nach rechts Richtung Queen's Gate ab und fuhr an der imposanten Royal Albert Hall vorbei zum Hyde Park. Auf der Carriage Road nahmen wir einen unauffälligen Beobachtungsposten am Straßenrand ein.
Die Schatten unter den Sträuchern und Bäumen schienen undurchdringlich. Ein Kollege nahm das Nachtsichtgerät und suchte den Park ab: »Die sind aber spät dran«, murmelte er und erläuterte, dass ein paar Jogger den Weg entlang der Serpentine nahmen, »… recht gut zu erkennen!«
Gerade als er das Glas weitergab, verschwanden sie aus dem Blickfeld. Enttäuscht starrte ich durch das Okular und reichte es an Sidney weiter. So spät am Abend schien kaum jemand im Park unterwegs zu sein.
»Soll ich mal rausgehen?«
»Als Lockvogel?«, witzelte der Fahrer, als der Kollege vom Rücksitz aus sagte: »Da kommt jemand!« Und nach kurzem Schweigen. »Ihr glaubt nicht, was ich gerade sehe: Die hat ja gar nichts an!« Der Fahrer entriss ihm das Nachtsichtgerät; Sidney und ich starrten ins Dunkel, wo außer diffusen Schemen nichts zu erkennen war. Die Situation war mir eher peinlich, doch Sidney grinste breit, als sie das Glas an die Augen hielt. Als Letzter schaute ich durch das Okular: Eine groß gewachsene Frau tänzelte anmutig durch das Gras. Auch mit den verfälschten Farben in der Nachtsichtoptik war zu erkennen, dass sie eine sportliche Figur hatte, umweht von langen, tiefdunklen Haaren. Plötzlich tauchten zwei weitere Figuren auf, eilten auf die Frau zu, und es schien ein Handgemenge zu entstehen.
Ich fragte zweifelnd: »Sollen wir eingreifen?« und gab Sidney das Glas zurück. Sie schaute auf das Treiben und fing an, lauthals zu lachen: »Die haben eher großen Spaß miteinander.«
Um wieder zur Tagesordnung überzugehen, suchten wir uns neue Einsatzziele. Einer schlug vor: »In manchen Kneipenvierteln geben uns die unübersichtlichen Hinterhöfe bei Dunkelheit Rätsel auf.«
Südlich der Themse in Southwark fanden wir ein entsprechendes Umfeld. Dort gerieten wir in eine Situation, die tatsächlich unser Eingreifen erforderte: Vier Männer, angetrunkene Kneipengäste, schlugen in der hintersten Ecke eines unbeleuchteten Hofes auf einen jungen Inder ein. Er wehrte sich schon nicht mehr und ging schließlich zu Boden, wo er eine eingerollte Embryohaltung einnahm. Trotzdem traten die Rowdies weiter nach ihm. Während wir uns zu dritt auf die Männer stürzten, forderte unser Fahrer über Funk Verstärkung an. Der Körpereinsatz meiner jungen Kollegin zeigte, dass sie richtig gut trainiert war. Das war auch nötig, denn nur in gemeinsamer Anstrengung konnten wir die Schläger von ihrem Opfer wegzerren.
Ausgerechnet der Kollege, den ich so unsympathisch fand, kümmerte sich um das Opfer; der junge Mann schien glücklicherweise keine schweren Verletzungen davongetragen zu haben.
Ein Krankenwagen und die Verstärkung kamen bald darauf, und wir übergaben die Rowdies an die uniformierten Kollegen vom London Borough of Southwark, denen wir unsere Rolle erst einmal plausibel machen mussten. Nachdem der Verletzte versorgt und abtransportiert war sowie die Verhaftungen vorgenommen waren, versprachen wir dem Einsatzleiter einen ausführlichen Bericht und zogen uns zurück.
Am Morgen in Scotland Yard gab es eine Abschlussbesprechung, in der jede Gruppe Bericht erstattete. In unserem offiziellen Operation Report kam neben der Hinterhofschlägerei auch die Szene im Park zur Sprache. Der Chef fragte nach und wollte genau wissen, was geschehen war. Alle grinsten verstohlen; Gerüchte hatten längst die Runde gemacht. Sidney erzählte in knappen Worten: »Wir haben drei junge Leute beim nächtlichen Sex im Park beobachtet.«
»Das habt ihr euch natürlich ganz genau angeschaut?« Seine Stimme klang leicht tadelnd, und Sidney fügte entschuldigend hinzu: »Wir dachten erst, es sei eine Vergewaltigung im Gange.« Der Test konnte als voller Erfolg gewertet werden, und ich erreichte sogar, dass unter Umgehung der üblichen Beschaffungswege direkt bei dem Hersteller einige Versuchsgeräte angefordert wurden, um sie ausgesuchten Abteilungen von Scotland Yard zur Verfügung zu stellen.
Am Samstag fuhren wir für das Abschlusswochenende des Seminars mit mehreren Bussen nach Nordengland in die Yorkshire Moors. Auf dem Programm stand eine Trainingseinheit im Zentrum der Special Forces. Bei den harten Übungen konnte ich meine körperliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen, sah aber Defizite in den verschiedenen Combat-Techniken. Die Londoner Kollegen ließ ich knapp hinter mir; Sidney konnte erstaunlich gut mithalten. Ich schnappte eine Bemerkung auf: »Die Südafrikanerin hätte auch die Ausbilder hier in den Schatten gestellt.«
Sidney fragte mich nach ihr, und ich sagte, dass ich Miss Van-Valckenburgh nur flüchtig kennengelernt habe. Diese Aussage war nicht falsch, trotzdem kam ich mir unaufrichtig vor und meinte, weder Sidney noch Rebecca gerecht zu werden.
Als Belohnung nach dem anstrengenden Seminar waren für uns Zimmer in einem Wellness-Hotel gebucht, und wir verbrachten den Rest des Wochenendes im luxuriösen Aldwark Manor Golf & Spa Hotel, York.
Am Samstagnachmittag sprachen mich Kollegen auf die Fußballweltmeisterschaft an und schlugen vor, zum nächsten Spiel in die Hotelbar zu gehen: »Die zeigen um 4 p. m. das Viertelfinale auf Sky Sports.«
Mir fiel das Spiel ein, das ich in London gesehen hatte. »England ist doch in der vorigen Runde ausgeschieden«, meinte ich.
»Ja, gegen Deutschland«, rief einer, und ich befürchtete kurz, er nähme mir das persönlich übel. Da fuhr er fort: »Und genau diese deutsche Mannschaft spielt heute gegen Turnierfavorit Argentinien.« Ich verstand nicht viel von Fußball, aber dass Argentinien eine Spitzenmannschaft war, hatte ich mitbekommen. »Da verlieren die Deutschen ohnehin.«
»Das ist noch nicht sicher. Diese junge Mannschaft ist bisher sehr überzeugend aufgetreten, und uns geht es hauptsächlich um ein gutes Spiel. Das können wir Engländer ganz entspannt genießen. Wenn Argentinien gewinnt, haben sie sozusagen England gerächt; wenn Deutschland weiterkommt, haben wir den kleinen Trost, gegen den neuen Favoriten rausgeflogen zu sein.«
Ich zögerte noch mit einer Antwort, da fragte Sidney, die hinter mir aufgetaucht war: »Kommst du mit in den Spa-Bereich?«
Damit war die Sache entschieden. Ich folgte der Kollegin, während ihre Landsleute anzüglich feixten. Nachdem wir ausgiebig in dem edel gestalteten Schwimmbad gebadet hatten, schlug Sidney vor, in die Sauna zu gehen. Angesichts ihrer sportlichen Konturen dachte ich an Rebecca und wünschte, sie wäre auch dabei. Wären sie eifersüchtig aufeinander? War ich dabei, mich in jede Frau zu verlieben, mit der ich zu tun hatte?
Sidney stupste mich an, und wir traten durch die satinierte Glastür. Schon der Eingangsbereich war gemütlich warm, und die hohe Luftfeuchtigkeit legte sich wie ein leichter Nebel um uns. Wir traten in die Sauna, legten unsere Handtücher auf die Holzbänke und nahmen unsere Plätze ein. Während die feuchte Hitze sinnlich unsere Körper umschmeichelte, spürte ich intensiv die Nähe Sidneys, auch wenn ich die Umrisse ihres Körpers neben mir mehr erahnen als erkennen konnte.
Nach einer Weile verließ der letzte Gast die Sauna, wir waren allein. Leise begann sie mit intim-vertraulichem Tonfall das Gespräch und brachte mich dazu, von meiner verstorbenen Frau zu erzählen.
»Du hast neulich nach meinem beruflichen Werdegang in Stuttgart gefragt«, begann ich und berichtete von dem »Karriereknick«, der eine indirekte Folge des Todes meiner Ehefrau war – und meiner Unfähigkeit, die Trauer zu bewältigen.
In der entspannenden Wärme und Intimität der Sauna offenbarte ich ihr mein Gefühlsleben, ging aber weniger auf die Trauer ein als auf den Trost, den ich bei meiner Schwester fand …
»Iris' Zuneigung und ihre bedingungslose Solidarität haben mir Halt gegeben«, murmelte ich.
»Deine Schwester muss wirklich eine ganz besondere Frau sein«, meinte Sidney.
Es wurde spät. Diskret wies man uns darauf hin, dass der Sauna-Bereich nun geschlossen würde. Auf dem Weg zum Treppenhaus kamen wir an der Hotelbar vorbei, und die werten Kollegen machten spitze Bemerkungen, als wir nebeneinander die Treppe hinauftrabten. Aber wir gaben uns nur einen züchtigen Gutenachtkuss, und jeder ging friedlich in sein Zimmer.
Am Sonntag umringten mich die englischen Kollegen am Frühstücksbuffet: »Da hast du was verpasst: Die Deutschen haben Maradonas Jungs mit 4:0 vom Platz gefegt!«
Ich antwortete nicht gleich; der Abend mit Sidney war mir wichtiger gewesen als Fußball, aber das wollte ich ihnen nicht so unverblümt mitteilen. Außerdem befürchtete ich Gerüchte über eine Affäre.
Sidney kam dazu: »Ihr könnt Thomas ja am Tisch von dem Spiel erzählen. Wir beide haben uns gestern auch ohne Fußball gut amüsiert.«
Wieder wanderten die Blicke der Kollegen zwischen uns hin und her. Beim Frühstück hörte ich mir die Schilderung der Tore von Thomas Müller, Miroslav Klose und Arne Friedrich an, war aber in Gedanken bei Sidney, die neben mir saß. Die unausgesprochenen Mutmaßungen über uns schienen ihr nichts auszumachen. Ich fand aber auch keinen Weg, dem entgegenzutreten, ohne Sidney zu kränken. Außer Hörweite der anderen deutete ich meine Befürchtung an, aber sie flüsterte völlig unaufgeregt: »Die denken doch ohnehin, wir hätten was miteinander.«
»Und das macht dir nichts aus?«
Sie grinste: »Warum sollte es das. Es gibt schlechtere Partien.« Verspottete sie mich jetzt?
Ich wandte mich den Kollegen zu und versuchte wieder, dem Fußballgespräch zu folgen.
Am Vormittag gab es für uns einen offiziellen Empfang mit hochrangigen Polizeibeamten sowie einem Staatssekretär, der eine kurze Rede hielt. Diesem Event wie auch dem folgenden üppigen Mittagsmenü konnten Sidney und ich nicht allzu viel abgewinnen. Lustig fand ich nur ihre geflüsterte Bemerkung über den Polizeichef: »Gut, dass Sir Alfred keine Rede gehalten hat. Als Polizeichef ist er die schlimmste Fehlbesetzung, seit Caligula sein Pferd Incitatus zum Konsul ernannt hat.«
Ehe wir am Nachmittag auseinandergingen, verabschiedete uns der Seminarleiter mit aufrichtig freundlichen Worten. Ich lud Sidney für den Abend in London zum Essen ein, aber sie lehnte bedauernd ab: »Das wird nicht gehen, Thomas. So leid es mir tut, aber ich habe schon eine Verabredung.«
Ihr Platz im Bus blieb leer. Wie ich später von Kollegen erfuhr, war sie weiter nach Norden gereist. Sie stammte aus der Gegend zwischen York und Newcastle upon Tyne und besuchte dort ihre Familie.
Für die anschließenden zwei Urlaubswochen beschloss ich, meine Idee wahr zu machen und in Richtung Cornwall zu fahren, dem sagenumwobenen Landstrich im äußersten Südwesten der Insel. Die neuen Eindrücke und die Menschen, die ich kennengelernt hatte, hatten mir gutgetan. Aus vierzehn Tagen »Leere«, vor der ich insgeheim etwas Angst gehabt hatte, wurde so eine Urlaubsreise, die ich voller Freude antrat, auch wenn es für mich ungewohnt war, alleine unterwegs zu sein.
Mit meinem Mietwagen, einem rechts gelenkten Ford Focus, und dem Linksverkehr kam ich schnell erstaunlich gut zurecht. Am ersten Abend kam ich bis Exeter, eine historische Universitätsstadt nahe der Südküste.
Es war schon dämmrig, als ich von dem kleinen Great Western Hotel zu einem Erkundungsgang aufbrach. Ich war voller Unternehmungslust und schaute mir die berühmte Kathedrale Saint Peter an, ehe es mich mit Eintritt der Dunkelheit in Richtung Hafen zog. Ich fuhr vom Stadtzentrum zum River Exe hinunter und parkte an der Lower Coombe Street. Zu Fuß ging ich den Quay Hill hinab bis zum alten Pier direkt am Wasser, wo ich nach einem traditionellen englischen Pub Ausschau hielt. Meine Wahl fiel auf den Pub On the Waterfront, der in einem umgebauten Lagerhaus untergebracht war.
Kaum hatte ich die Tür geöffnet, umfing mich lebhafte Kneipenatmosphäre mit lauter Rockmusik. Viele Menschen drängten sich in dem alten Backsteingewölbe, und ich musste mich zur Theke durchkämpfen. In der obersten Flaschenreihe des Regals erspähte ich einen Talisker, genau das Richtige für den Moment. Der Barkeeper schien sich in seiner eigenen Bar allerdings nicht so gut auszukennen, zumindest was die Whisky-Spezialitäten anging. Vielleicht war ja dieser teure Single Malt von der Insel Skye wenig gefragt. Schließlich fand er die Flasche und schenkte ein, während mich jemand von der Seite ansprach.
»Talisker ist etwas für Spezialisten.«
Die junge Frau in Leder-Jeans war so hübsch, dass ich mich wunderte, sie zuvor übersehen zu haben. Kurze schwarze Haare mit einer blau gefärbten Strähne darin umgaben ein dreiecksförmiges Gesicht, aus dem mich hellblaue Augen herausfordernd anblickten.
Ich wandte mich zu ihr: »Das ist einfach einer der besten Whiskys, die ich kenne.«
Während ich ihr einen Talisker spendierte, entspann sich zwischen uns eine kurze Expertendiskussion über verschiedene Whisky-Sorten wie Highland-Park, Ardbeg und Lagavulin. Der Barkeeper mischte sich kurz in unser Gespräch ein: »Ich bin hier nur die Vertretung«, und grinste plötzlich: »Ihr scheint ja wirkliche Kenner zu sein; vielleicht solltet ihr heute Abend meinen Part übernehmen.«
Die laute Musik drängte sich wieder in mein Bewusstsein – aggressiver Hardrock, wie er nicht mehr sonderlich modern war, mich aber an Cyrah's Gothic Club erinnerte. Extrem dynamische, rhythmische Klänge, differenziert und spannungsgeladen. Auf eine entsprechende Bemerkung ergänzte meine Gesprächspartnerin: »Das ist die Formation Threshold.« Auch ihr gefiel die Musik. Und weil wir ohnehin gerade intellektuell in höheren Sphären schwebten, setzte sie hinzu: »Künstlerisch ist das natürlich noch steigerungsfähig. Es gibt Besseres.«
»Große Worte, Vorsicht: Mein Maßstab ist Johann Sebastian Bach.«
»Okay«, sagte sie gedehnt und nachdenklich, »aber die Band, die ich meine, hält diesen Vergleich aus.«
»Du machst mich neugierig.«
»Kennst du Black Rose und Theresa Themis?«
Theresa Themis sagte mir nichts, aber Black Rose war die Band aus dem Londoner Club: »Kürzlich erst habe ich in einem Club ihre Musik gehört – ja, nicht schlecht.«
Die Glocke läutete, und der Wirt rief: »Last Orders!« Ich hatte gar nicht bemerkt, dass es schon 11 p. m. war.
»Kommst du mit? Wir treffen uns nach Kneipenschluss immer privat auf dem Campus.«
»Wer ist wir?«
»Wir sind Studenten und haben uns dort einen Partyraum eingerichtet. Ein paar von uns sind oder waren auch hier; ich habe sie nur aus den Augen verloren.«
Sie sah sich unter den aus dem Lokal strömenden Leuten um und zog mich schließlich zu zwei Freundinnen. Wir traten auf die Straße.
»Bist du mit dem Auto hier? Der Knabe, der mich hierher mitgenommen hat, ist nirgends zu sehen.«
Sie sah sich auf dem Quay um, als eine ihrer Freundinnen meinte: »Der ist schon längst weg – offenbar verärgert, weil du mit dem Deutschen hier geflirtet hast.«
»Geflirtet haben wir nicht. Das waren hochgeistige Gespräche«, sagte sie mit einer Spur von Ironie in der Stimme, wandte sich dann wieder mir zu und fügte an, »was aber nichts daran ändert, dass ich dich ziemlich nett finde. Wie heißt du eigentlich und kommst du wirklich aus Deutschland?«
»Mein Akzent müsste mich verraten: Ich bin Deutscher, mein Name ist Thomas Conrad.«
»Melora Linaï-Johnson«, stellte sie sich vor, und eine Freundin ergänzte: »Wir nennen sie Milla wegen ihrer Ähnlichkeit mit Milla Jovovich, dem russischen Hollywood-Star.«
Melora fuhr fort: »Dass wir Studenten sind, habe ich ja schon gesagt. Wir studieren alle Physik an der Uni hier, sind aber auch große Musikfans. Manche von uns sind anscheinend mit der Physik nicht ganz ausgelastet und haben sich nebenher am Exeter College for Music eingeschrieben.«
Jetzt musste auch ich meinen Beruf preisgeben: »Ich bin Polizist in Stuttgart«, sagte ich und wartete gespannt auf die Reaktion. Aber Melora sagte nur »cool«, und wir gingen weiter.
»Mein Auto steht an der Lower Coombe Street, das ist gar nicht weit«, meinte ich. Auf dem Weg durch die nächtliche Stadt sprachen wir wieder über Musik. Wir stiegen ein, ihre Freundinnen auf den Rücksitzen, und ich ließ sofort eine Bach-CD laufen. Es war eine selbst gebrannte Zusammenstellung der französischen Ouvertüre für Cembalo, einer Orchestersuite und der c-Moll-Passacaglia für Orgel. Während der Fahrt über die Prince of Wales Road hörten alle schweigend zu, und beim Aussteigen bat mich Milla, die Disc doch einfach mitzunehmen.
»Der Streatham Campus ist schön gelegen und bietet eine gute Aussicht auf die Stadt« – die lebhafte Milla spielte Reiseleiterin, und ich ließ meinen Blick über die Lichter der Stadt Exeter schweifen. An der St German's Road standen viktorianische Reihenhäuser mit hohen Fenstern und aufwendigen Dekorationen, die als »self catered residences« an Studenten vermietet wurden. Wir betraten eines davon und kamen in einen großen, sparsam möblierten Raum, in dem einige Studenten Musik hörten, tanzten oder sich einfach unterhielten. Milla und in ihrem Gefolge auch ich wurden mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht. Sie kannte jeden und galt wohl als besonders cool.
Milla steuerte auf ein Podium am Ende des Raumes zu. Dort standen die Bierkisten, aus denen sich die Studenten bedienten, aber auch die hochkarätige Ayon-HiFi-Anlage neben einer luxuriösen Sitzecke, die offenbar Millas Stammplatz war.
»… stammt aus dem Wohnzimmer meines Elternhauses«, kam sie meiner Frage zuvor. Wir ließen uns in die Lederpolster fallen. Milla beugte sich über den Player und unterbrach die Musik, um meine Bach-CD einzulegen. Die ersten Akkorde ertönten, und die Gespräche im Raum ebbten ab, weil immer mehr Studenten den Klängen lauschten. Nach einigen Stücken kamen ein paar Leute herbei und erkundigten sich nach der Musik. Sie waren überrascht, wie modern Bach klingen konnte.
»Jetzt ist aber Black Rose dran.« Milla wechselte die CD, und erneut begeisterte mich die Musik dieser Band, die das kompositorische Repertoire des Barock in die Welt des Gothic Metal transportierte. Und das mit so unterschiedlichen Instrumenten wie E-Gitarre, Querflöte, Gambe, Violine, Cembalo und Orgel. Ein Student urteilte: »Musik für Intellektuelle; anspruchsvoll, progressiv, ein bisschen Barock, ein bisschen Gothic Metal.« Mir war unklar, ob er das als Lob oder Kritik meinte, bis eine Studentin ergänzte: »Stimmt schon, aber die Harmonien gehen einem direkt ans Gemüt.«
Als nächstes Stück folgte eine grandiose Orgeltoccata, wie ich sie von einer Rockband nicht erwartet hatte, und Milla sagte: »Ich kenne Theresa Themis. Sie ist Eurasierin, hochtalentiert. Sie spielt die Orgel und komponiert auch alle Sachen für diese Band.«
Ich war beeindruckt – ebenso die Studentin: »Toll, was diese Frau hier leistet!«
Immer mehr Studenten standen am Podium. Einer fragte: »Ist das nicht diese deutsche Band, der Underground-Tipp aus Frankfurt?«
Das Stichwort Frankfurt rief eine Erinnerung an das als Academy bekannte Institution in meiner Heimatstadt wach. Dort hatte Black Rose als »Artist in Residence« Konzerte gegeben. Mit meiner Fixierung auf Barock und Klassik hatte ich dem bisher keine größere Bedeutung beigemessen.
Milla protestierte: »Wieso sagst du deutsch? Soviel ich weiß, stammen die Musiker aus Neuseeland, San Francisco, Toronto, München, Norwegen, Vancouver und Cornwall.«
Das muss ja eine bunt zusammengewürfelte Multikulti-Truppe sein, dachte ich.
»Black Rose gibt es schon ewig«, wusste ein anderer. »In Seattle und im pazifischen Nordwesten haben sie bereits Ende der Neunziger grandiose Erfolge gefeiert. Damals war auch von kriminellen Verwicklungen der Organistin die Rede. Wahrscheinlich ist nichts dran gewesen, aber das hat sie in den Augen ihrer Fans noch interessanter gemacht.«
Die Gegenwart war für die Studenten freilich wichtiger. »Schade, dass so wenige Songs darunter sind«, sagte eine Studentin. »Dabei ist das doch die Band von Enid Trevelyan, der berühmten Folk-Rock-Sängerin.«
Der Abend im Kreis der Studenten bei Musik und guten Gesprächen verging wie im Fluge …
»Du kannst nicht mehr fahren!« Es war tief in der Nacht, die Studenten hatten sich zerstreut, und nur Milla und ich waren noch da. Die meiste Zeit hatte sie neben mir gesessen, und wir waren uns immer näher gekommen – wobei ich ihre unbändige Lebenslust und Energie spürte, einen Sexappeal, der mir den Atem raubte. Natürlich hatte ich inzwischen eine ganze Menge getrunken und hätte nicht mehr verantworten können, mich in diesem Zustand ans Steuer zu setzen.
»Bleiben wir über Nacht doch einfach hier im Gemeinschaftsraum; ich hab das schon ein paar Mal gemacht.«
Milla trieb ein paar Decken auf und warf mir eine zu. Ich streckte mich auf dem längeren Teil der üppig gepolsterten Sitzecke aus und spürte erst jetzt so richtig die Wirkung des Alkohols. Sie glitt auf den anderen Teil des Sofas. Die Länge war knapp bemessen, und wir mussten unsere Füße sortieren, aber da fiel ich schon in tiefen Schlummer.
Im Halbschlaf geisterten Traumsequenzen durch meinen Kopf, diffus erst, dann immer deutlicher werdend. Zunächst eine dunkle Gestalt, die mit animalischer Grazie tanzte – der flache Bauch mit ausgeprägtem Sixpack direkt vor meinen Augen. Es folgte eine helle Gestalt mit kurz geschnittenem Rotschopf – umhüllt von feuchtheißem Nebel. Sie wurden abgelöst von einer lasziven Schwarzhaarigen, die federleicht über mich glitt. War es ein Trugbild, war es Realität?
Begierde, Lust, Hektik, Schweiß, Stöhnen, rhythmisch quietschende Sprungfedern und eine Explosion der Gefühle – das war echt …
Ich erwachte leicht verkatert und brauchte eine Weile, um in der Wirklichkeit anzukommen. Ich wälzte mich auf die Seite und wäre fast vom schmalen Sofa gefallen, aber nur die kratzige Stoffdecke glitt von mir, und ich spürte kühle Luft an meinem Körper. Komisch, ich konnte mich nicht daran erinnern, mich am Abend ausgezogen zu haben. Ich war völlig verschwitzt, ein paar Haare, darunter eines in leuchtendem Blau, kitzelten schweißverklebt meine Haut.
»Endlich bist du wach, du Polizist!«, ertönte eine spöttische Stimme. Ich drehte den Kopf und sah Milla unbekümmert nackt durch den Gemeinschaftsraum hüpfen. Sie hatte gelüftet. Hastig griff ich nach der Decke.
»Tu jetzt nicht so prüde!«
Also war die Liebesnacht nicht bloß ein feuchter Traum gewesen! Auf einmal kam die klare Erinnerung wieder und mit ihr euphorische Freude – völlig ohne moralische Bedenken oder Peinlichkeit.