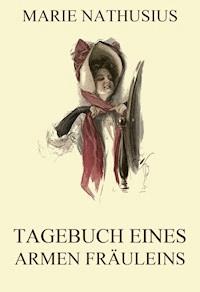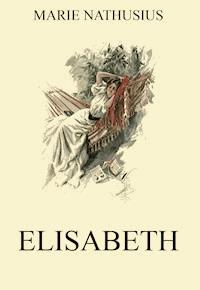
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit "Elisabeth. Eine Geschichte, die nicht mit der Heirat schließt" hatte sich Marie N. der Frauenwelt zugewandt. In dieser Familiengeschichte überzeugt sie mit der Behandlung der Details und der epischen Breite, die sich dem Zeitmaße nach über ein volles halbes Jahrhundert erstreckt. Als das Eigentümliche der Erzählung erscheint der innere abgeschlossene Blick über das ganze Leben. Und aus dem reifen Blick, welcher nicht mehr am Einzelnen hängt und darum doch der warmen Liebe nicht entbehrt, entspringt dann der eigene Humor, der feine taktvolle Frauenhumor, welcher den Bildern Reiz und Würze gibt. Der Erfolg dieser Erzählung war damals (1858) ausgezeichnet. Sie erlebte bis jetzt unzählige Auflagen und ist in sämtliche Sprachen, von denen man es irgend erwarten kann, übersetzt worden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 888
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth
Marie Nathusius
Inhalt:
Marie und Philipp Nathusius – Biografie und Bibliografie
Elisabeth
1. Des Großvaters Bruder.
2. Wie der Großvater ein Bräutigam ward.
3. Der Großeltern Hochzeit.
4. Bis zur Silberhochzeit.
5. Die Frau Geheimeräthin.
6. Vorbereitungen zum Ball.
7. Ein gefährlicher Mensch.
8. Nach dem Ball.
9. Ein Reiseplan.
10. Unverhofftes Begegnen.
11. Bei den Großeltern.
12. Der Kürassier zur rechten Zeit.
13. Ein bedenklicher Auftrag.
14. Auf der Höhe des Glücks.
15. Familien-Aufregungen.
16. Blauer Himmel und Wolken im Brautstande.
17. Der letzte Winter in Berlin.
18. Die Hochzeit.
19. Keine Flitterwochenliebe
20. Die allerlei lieben Verwandten
21. Notwendige Geselligkeit
22. Neuer Reichthum und neue Zuversicht.
23. Die kluge Großmama
24. Durch Glück oder Unglück, nur zum Herrn
25. Durch Unglück
26. Erschütterung und Besinnung
27. Eine neue Bekanntschaft
28. Die Berge, von denen Hilfe kommt
29. Ein neuer Anfang im Frieden
30. Ein anderes Ehepaar
31. Versuche zur Demuth
32. Neue Kämpfe
33. Die bittere Freiheit
34. Thörichte Gefühle
35. Süßigkeit in der Pflicht
36. Die Freundschaft der Welt
37. Die lieben Großeltern
38. Unvermeidliche Szenen
39. Hoffen und Zagen
40. Komödie der Irrungen
41. Neue Brautliebe
42. Die Welt dreht sich mit dem Winde
43. Schwere Stunden und selige Stunden
44. Der Hausfreund
45. Nicht ohne Kampf, aber zum Frieden
46. Die kluge Enkelin
47. Ein Streiter Christi
48. Die goldene Hochzeit
Elisabeth, M. Nathusius
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849632519
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Marie und Philipp Nathusius – Biografie und Bibliografie
Marie N. war die Tochter des Predigers an der Heiligen Geistkirche zu Magdeburg, Friedrich Scheele. und wurde hier am 10. März 1817 geboren. Schon nach zwei Jahren kam sie mit den Eltern nach Calbe a. d. Saale, wohin der Vater als Superintendent und Oberpfarrer berufen worden war, und hier verlebte sie eine glückliche Kinder- und Jugendzeit. Mit der Schulbildung sah es in jenen Tagen nur dürftig aus, und was die Stadtschule in Calbe dem jungen Mädchen bot, war bald gelernt; indessen gehörte doch auch Marie N. zu jenen Naturen, von welchen Bogumil Goltz sagt: „Ein Mädchen erlangt Bildung und Erziehung, ohne dass man begreift wie, wann und wodurch. Für ihren poetischen Sinn, ihren sympathetischen und symbolischen Verstand, für ihren sittlichen Instinkt werden alle Erlebnisse ebenso viele Bildungsmittel. Eben die ungeschulte Natur des Weibes, die Tatsache, dass ein Weib mit diesen Bruchstücken von Elementarkenntnissen, und selbst ohne sie, allen Zauber der Weiblichkeit, der Menschenschöne, der Menschengesittung gewinnen und effektiv machen kann: dies nie aussterbende Zeugnis aus dem Paradiese ist es ja, was den Reiz der Frauen für den schulgeübten Mann in sich fasst.“ Eine Fülle von Poesie und Lebenseindrücken der mannigfachsten Art knüpfte sich für Marie an verschiedene Ortschaften in der Nachbarschaft, die sie in Begleitung des Vaters auf seinen Visitationsreisen oft besuchte, und die sie uns in ihren Schriften zum Teil mit großer Treue geschildert hat. Im J. 1834 zog sie zu ihrem Bruder, der in Magdeburg Lehrer war und die Söhne einiger befreundeten, wohlhabenden Familien zu sich in Pflege genommen hatte, um diesem neuen Haushalte selbständig vorzustehen, und als der Bruder im folgenden Jahre ein Pfarramt in Eikendorf angetreten, war fortan Mariens Leben zwischen Calbe und Eikendorf geteilt. Das Leben auf dem Lande und besonders das Zusammenleben mit den Dorfbewohner lieferte denn auch den Stoff zu ihren späteren „Dorf- und Stadtgeschichten“ (1858; der „Gesammelten Schriften“ 1. Band); es sind dies zehn Erzählungen voll lebendiger Treue, in denen uns wirkliches, selbst angeschautes, selbst mitgelebtes Dorfleben zur Anschauung gebracht wird. Kurze Besuche in Magdeburg und Berlin unterbrachen diese stille Idylle, bis sie endlich derselben durch ihre Vermählung mit Philipp N. gänzlich entzogen ward. – Philipp Engelhard N. war der Sohn Gottlob Nathusius’ (s. o.) und wurde am November 1815 zu Neuhaldensleben bei Magdeburg geboren. Nach Beendigung seiner Schulzeit trat er, 16 Jahre alt, in die Geschäfte seines Vaters ein, die er trotz des großen Umfanges (Brauerei, Branntweinbrennerei, Öl-, Graupen-, Kartoffelmühlen, Obstkelterei, Zuckerfabrik, Ziegelei, Steingut- und Porzellanfabrik u. s. w.) nach des Vaters Tode (1835) im Alter von 20 Jahren schon selbständig fortführte. Im Winter von 1836 bis 1837 lag er in Berlin seinen Studien ob und unternahm dann in den beiden folgenden Jahren eine größere Reise durch Deutschland, Italien, Frankreich, Griechenland und die Türkei. Im August 1840 verlobte er sich mit Marie Scheele, und nachdem am 4. März 1841 die Vermählung vollzogen und der letzteren eine Reise des jungen Paares in die Provence, durch Italien bis Neapel und ein dreiwöchentlicher Aufenthalt in der Schweiz gefolgt war, bezog es die neue Heimat Althaldensleben. Hier bot sich bald ein ausgiebiges Feld für die humanitären Bestrebungen der jungen Frau. Das sittliche und leibliche Elend, das sich neben verhältnismäßig viel Verdienst und Wohlstand in jedem größeren Fabrikorte findet, regte sie zur Gründung einer Kinderbewahranstalt an, der sich dann in der Folge ein Frauenverein für die Ortsarmenpflege, ein Rettungshaus für Knaben, ein solches für Mädchen und eine Mädchenarbeitsschule anschlossen. In der letzteren lehrte Marie N. die Kinder des Dorfes selber nähen und stricken. Zu Anfang des Jahres 1849 beschloss Philipp N., seine großen Geschäftsetablissements in Althaldensleben aufzugeben. Da indes auch an einen künftigen Wohnsitz sich wieder Gedanken eines großen Rettungshauses knüpften, so beschlossen die Gatten, sich die Erfahrungen fremder Völker auf diesem Gebiete nutzbar zu machen, und unternahmen deshalb im Frühjahre 1849 eine größere Reise nach Paris, von hier in das Herz Frankreichs hinein und dann nach England hinüber, das nach allen Richtungen durchstreift ward. Heimgekehrt, lebten die Gatten ein halbes Jahr in Giebichenstein bei Halle, bis sie am 1. Mai 1850 nach dem neuerworbenen Gute Neinstedt bei Thale am Harz übersiedelten, wo denn auch bald nach dem Muster des Hamburger „Rauhen Hauses“ ein neues „Knabenrettungs- und Bruderhaus gegründet ward. Bereits im Februar 1849 hatte Philipp N. die Redaktion des vom Pastor v. Tippelskirch in Giebichenstein geleiteten „Volksblattes für Stadt und Land“ übernommen, des einzigen Blattes in der vormärzlichen Zeit, das die Grundsätze und Anschauungen der konservativen und streng kirchlichen Partei vertrat, und dadurch wurde Marie N. ganz ungesucht in die Bahn einer Schriftstellerin hineingeführt. In ihren ersten Erzählungen, die seit 1849 im „Volksblatt“ ausgingen, hielt sie sich noch zu den Kleinen herab; jeder Zug war aus der Kinderstube erwachsen; ein Odem wirklicher Jugendpoesie weht durch sie hindurch, und die schönsten unter ihnen haben wirklich etwas vom Märchen mitten im wirklichen Leben. Sieben derselben erschienen unter dem Titel „Die Geschichten von Christfried und Julchen“ (“1858; Ges. Schr. 2. Bd.), während andere, kleinere Arbeiten für die „Sextaner- und Quintanerfreunde“ als „Kleine Erzählungen“ (II, 1859; Ges. Schr. 3. u. 4. Bd.) in die Welt flogen. Von den Geschichten für die Kinderstube stieg dann Marie N. auf Verlangen etwas höher zu den Erzählungen für junge Mädchen. In „Langenstein und Boblingen“ (1855; Ges. Schr. 6. Bd.) schildert die Verfasserin ihren eigenen Mädchencharakter am gelungensten. Man kann einen wahren Trost aus diesem Buche schöpfen und sich ermuntern an den herrlichen Charakteren, die unter all den Gefahren und dem Kampfe mit der Welt doch den Gottesfrieden so treu in ihren Herzen bewahren. Dann folgten „Tagebuch eines armen Fräuleins“, „Rückerinnerungen aus einem Mädchenleben“ und ihr erster Roman „Johann von Kamern“, welche drei den 5. Bd. der Ges. Schr. (1859) füllen, „Die alte Jungfer“ und „Der Vormund“ (7. Bd. der Ges. Schr., 1859). Mit ihrem letzten und reifsten Werke „Elisabeth. Eine Geschichte, die nicht mit der Heirat schließt“ (II, 1858; Ges. Schr. 8. u. 9. Bd.) hatte sich Marie N. der Frauenwelt zugewandt. In dieser Familiengeschichte erging sie sich von vorn herein ganz frei; davon zeugt, bei aller wohl im Auge behaltenen festen Schürzung, der Reichthum und die Freiheit in der Behandlung der Details, überhaupt die echt epische Breite, die sich dem Zeitmaße nach über ein volles halbes Jahrhundert erstreckt. Als das Eigentümliche der Erzählung erscheint der innere abgeschlossene Blick über das ganze Leben. Und aus dem reifen Blicke, welcher nicht mehr am Einzelnen hängt und darum doch der warmen Liebe nicht entbehrt, entspringt dann der eigene Humor, der feine taktvolle Frauenhumor, welcher den Bildern Reiz und Würze gibt. Der Erfolg dieser Erzählung war ganz ausgezeichneter Art. Sie erlebte bis jetzt 14 Auflagen und ist in sämtliche Sprachen, von denen man es irgend erwarten kann, übersetzt worden. Nach menschlichen Gedanken war Marie N. mit diesem Buche erst in die ihr eigenste Weise eingetreten, hatte sich eben volle Bahn gebrochen. Noch stand sie, da bisher eines ihrer Werke das andere eigentümlich überboten, vielleicht nicht auf dem Gipfel; aber „Elisabeth“ sollte auf Erden ihr „Schwanengesang“ sein. Am 22. Dezember 1857 schied sie aus dem Leben. Nach ihrem Tode erschienen noch aus ihrem Nachlasse „Tagebuch einer Reise nach der Provence, Italien und der Schweiz“ (Ges. Schr. 10. Bd., 1860) und zwei Jugendnovellen „Familienskizzen.“ „Herr und Kammerdiener“ (Ges. Schr. II. Bd., 1860); außerdem gab ihr Gatte im Verein mit Ludwig Erk „Hundert Lieder, geistlich und weltlich, ernsthaft und fröhlich, in Melodien von Marie N. und mit Klavierbegleitung“ (1865) heraus. – Philipp N., der 1861 in den Adelstand erhoben wurde, starb am 16. August 1872 zu Luzern auf einer Reise ins Bad Engelberg, das er wegen seines Brustleidens besuchen wollte. Auch er hatte sich in jüngeren Jahren als Dichter versucht. Seine „Fünfzig Gedichte, Probesammlung“ (1839) und „Noch fünfzig Gedichte. Der Probesammlung anderes Heft“ (1841) überraschen durch den frischen, einfachen und innigen Ton seiner Lyrik und lassen bedauern, dass er diesen Sammlungen nicht noch weitere folgen ließ. Als meisterhafter Nachbildner hat sich Philipp N. bewährt in „Hundert drei Lieder [des Pariser Chansonnier P. J. de Béranger] gibt hier im Deutschen wieder mit seinem wohlgemeinten Gruß Philipp Engelhard Nathusius (1839).
Elisabeth
1. Des Großvaters Bruder.
Ich weiß gar nicht, warum gerade ich heirathen soll! sagte Herr Karl von Budmar ärgerlich und ging dabei heftig im Zimmer auf und ab. Friedrich, sein jüngerer Bruder, saß im Sofa und trommelte mit den Fingern auf die Lehne. Warum gerade ich, – fuhr der ältere wieder fort: das Leben ist schon voller Mühe und Sorge, und nun dazu diese Unannehmlichkeit.
Er blieb jetzt fragend vor dem Bruder stehen. Die Sache ist ganz einfach, entgegnete dieser lächelnd, Du sollst heirathen, weil Du Dich verlobt hast.
Ja, das war der Fehler! sagte Karl lebhaft, es ist unbegreiflich, wie ich dazu gekommen bin. – Lieber Fritz, ich bin sehr unglücklich! setzte er mit einem tiefen Seufzer hinzu.
Was ist denn wieder vorgefallen? fragte der Bruder jetzt theilnehmend. Vorgefallen ist gar nichts, fuhr der Bräutigam auf, es ist nur ein Factum da, eine Thatsache mit ihren unvermeidlichen Folgen. Heute komme ich hin, – ich versäume keinen Morgen, mich nach dem Befinden meiner Braut und dem Befinden meiner Schwiegermutter zu erkundigen, – heute nimmt mich die Schwiegermutter schon auf dem Flur in Empfang und flüstert: Morgen ist Charlottchens Geburtstag, es ist Ihnen wohl lieb, das zu wissen. – Ich frage Dich nun, Fritz, warum mir das lieb sein soll?
Du wirst Dich doch freuen, daß Deine Braut geboren ist, entgegnete dieser lachend.
Ja, freuen, – das ist ganz gut, seufzte Karl, seit heute Morgen aber zerbreche ich mir den Kopf, was ich morgen anfangen soll.
Du sollst ihr etwas schenken, das ist wieder ganz einfach, war des Bruders Antwort.
Das weiß ich auch, nahm Karl eifrig das Wort, nun aber stürmen Fragen und Bedenken auf mich ein, die Frage ist: soll ich etwas Nützliches oder etwas Ueberflüssiges schenken. Das letzte ist gegen meine Grundsätze, und wenn ich mich auch darüber hinwegsetze, was die Kaffee-Gesellschaft den Nachmittag zu meiner Bräutigams-Gabe sagt, ob sie mich poetisch, oder prosaisch, oder splendide, oder geizig nennt, was mich doch wieder im Grunde in eine unangenehme Aufregung versetzt, – kurz und gut, wenn ich mich auch über alles hinwegsetzen wollte, so bin ich heute Abend eben so weit als heute Morgen, ich habe kein Geschenk, ja es ist mir nicht einmal eine annähernde Idee von etwas Passendem gekommen; ich bin überzeugt, der morgende Tag kommt heran und ich weiß noch nichts. Ich sage Dir, seitdem ich verlobt bin, stürzen mich so ähnliche Vorfälle von einer fieberhaften Aufregung in die andere, ich kann gar keinen klaren Gedanken mehr fassen, außer dem einen: wenn ich nur nicht verlobt wäre!
Das wird alles aufhören, wenn Du verheirathet bist, tröstete Fritz.
Nein, Fritz, das wird nicht aufhören, versicherte Karl, man wird immer größere Ansprüche an mich machen. Wenn meine Schwiegermama erzählt von ihrem Mann selig, von seinen liebenswürdigen Eigenschaften, von der glücklichen Ehe, die sie geführt, dann wird mir angst und bange, denn alle diese liebenswürdigen rücksichtvollen Eigenschaften gehen mir ab, und ich sehe meine Zukunft deutlich vor Augen, ich werde mich fortwährend in einer entsetzlichen Spannung befinden, um nur herauszustudieren, wie ein glücklicher Ehemann sich betragen muß, und das halten meine Nerven nicht aus.
Du willst aber Charlottchen und nicht ihre Mutter heirathen, nahm der Bruder wieder das Wort, und Charlottchen ist das anspruchsloseste, einfachste Mädchen, was ich kenne.
Ja, ja, unterbrach ihn Karl, das weiß ich, aber ich verstehe nicht mit Frauenzimmern umzugehen, und – Fritz, setzte er kopfschüttelnd hinzu, Du mußt zugeben, es ist doch ein wunderliches Volk.
Fritz sah sehr spaßhaft aus, aber er nahm sich zusammen und fragte ernsthaft: Wie meinst Du das?
Zum Beispiel, begann der Gefragte eifrig, gestern war ich den ganzen Nachmittag drüben, wir haben uns wohl zwei Stunden schön unterhalten, ich habe erzählt, sie haben zugehört, wie es sich gehört. Die Frauenzimmer begriffen vollständig, daß ich mein Gut in kurzer Zeit auf doppelten Werth bringen muß, erstens wenn wir die Brache ganz und gar abschaffen und durch Anbau von Futterkräutern dem Futtermangel abhelfen, und zweitens, was die natürliche Folge davon ist, die Stallfütterung einführen. Fritz, Du lächelst, unterbrach sich der Redende ärgerlich, Du glaubst das nicht.
Die Verdoppelung des Werthes habe ich noch nicht vollständig begriffen, entgegnete der Bruder, und Du siehst, daß Charlottchen und die Schwiegermama vortreffliche Damen sind und weit mehr praktischen Verstand haben als ich. Aber Du wolltest noch etwas anderes erzählen.
Ja, nahm Karl wieder seufzend das Wort, nun denke Dir, nach dieser vernünftigen Unterhaltung, wobei Charlottchen Filet machte und ich ihr immer den Zwirn auf die Nadeln wickelte, denn wie gesagt, wenn mir irgend wie eine bestimmte Pflicht obliegt, die versäume ich nie, nach dieser Unterhaltung trat die Dämmerung ein, die Mama ging in die Küche, Charlottchen legte die Arbeit fort, wir traten unwillkürlich an das Fenster, weil der Mond schien. Da legt Charlottchen ihren Kopf an meine Schulter und flüstert: O, Karl, sieh, wie golden der Mond über den grünen Baumgipfeln aufsteigt! – Jetzt, Fritz, denke Dir meine Lage. – Mir fiel nicht ein sterbendes Wörtchen ein, was auf den goldnen Mond paßte, ich sah schweigend den unglücklichen goldnen Mond an und überlegte mir, wann dieser penible Zustand ein Ende nehmen würde, und tröstete mich damit: daß er jedenfalls ein Ende nehmen müsse. Da stand plötzlich die Mama an meiner andern Seite, beide Damen mißverstanden mein Schweigen und meine Stimmung völlig, sie stimmten an: »Guter Mond, du gehst so stille in den Abendwolken hin.« Ich habe das ganze Lied anhören müssen, dann schwiegen wir alle, und dann sprach die Mama von ihrem lieben Mann selig, wie er auch so gern singen hörte, und wie sie ein Herz und eine Seele waren, und wie er überhaupt eine zarte, seine Seele war. Ich war sehr froh, als ich wieder zu Hause war. – Lieber Bruder Fritz, setzte er nach einer Pause hinzu, liebst Du Mondenscheinlieder?
Warum nicht? entgegnete Fritz lächelnd; wenn Du sie aber nicht liebst, so sage das Charlottchen, und ich bin überzeugt, sie wird aus Güte und Gefälligkeit zu Dir in Deiner Gegenwart nie singen.
Ja, sie ist sehr gütig und sehr freundlich, sagte der Bräutigam nachdenklich.
Du hättest kein passenderes Mädchen auf der ganzen Welt wählen können, versicherte der Bruder.
Sie ist auch sehr verständig, fuhr der Bräutigam fort.
Und sehr hübsch, fügte der Bruder wieder hinzu.
Ich bin überzeugt, sie muß einen jeden andern Mann glücklich machen, nahm Karl jetzt feierlich das Wort. Lieber Fritz, die Menschen sind sehr verschieden in der Welt, – Du liebst die Mondenscheinlieder –
Du darfst mich nicht mißverstehen, unterbrach Fritz ihn schnell, ich habe Charlottchen lieb, ich wünsche, daß sie Deine Frau wird, aber weiter reicht meine Liebe nicht.
Also weiter nicht! seufzte der Bruder, – dann weiß ich nicht, was aus dem armen Mädchen werden soll, es fällt schwer, so jemandes Hoffnungen zu täuschen, und doch kann ich nicht anders, ich bin keine feine, zarte Seele und kann kein Charlottchen glücklich machen, mit dem besten Willen nicht, und das ist ärgerlich. Wenn ich heirathe, will ich auch ein glücklicher und liebenswürdiger Ehemann sein.
Du mußt Dir das nicht zu schwer denken, unterbrach ihn der Bruder.
Und Du mußt erst Deine Erfahrungen machen, fuhr der Bräutigam eifrig fort, meine Schwiegermutter z. B. sagt: »Wir Frauenzimmer sind zartbesaitete Seelen, nichts thut uns wohler, als wenn der Freund unserer Seele aufmerksam, rücksichtsvoll, zartfühlend gegen uns ist; ist er das nicht, so verkümmert unsere Liebe, und mit der Liebe unser Leben.« Nun aber, lieber Fritz, denke Dir lebhaft solch ein Feld von zarten Rücksichten, die meistens so zart sind, daß man gar nichts davon ahndet, ja deren Verstoß wir nur merken an den verkümmerten Blicken der zartbesaiteten Seele, die neben Dir wandelt, – ich begreife nicht, daß die Menschen einen glücklichen, liebenswürdigen Ehemann nicht als das größte Wunder anstaunen.
Du betrachtest die Sache von einem rein egoistischen Standpunkt, nahm Fritz das Wort. Die Lebensaufgabe von uns Männern ist, die zartbesaiteten Seelen, wie Du sie nennst, – oder wie wir Herren der Schöpfung sagen, das schwache Geschlecht, – glücklich zu machen; wenn das auch nicht immer leicht ist, so ist und bleibt es unser Beruf, unsere Lebensaufgabe, die Ehe soll eben eine Prüfungsschule des Lebens für uns werden.
Karl hatte dem Bruder verwundert zugehört. Richtig! – nahm er jetzt schnell das Wort: Du nennst die Ehe eine Prüfungs- oder Leidensschule, damit bin ich einverstanden; ich sehe aber nicht ein, warum ich mich ohne Noth hinein begeben soll.
Du siehst das nicht ein, weil Du eben ein Egoist bist, entgegnete Fritz, obgleich Du mit dem guten Charlottchen gar keine Prüfungen zu fürchten hättest. Ich muß Dir gestehen, Charlottchen wäre mir zu gütig, zu nachgebend, sie macht zu wenig Ansprüche; wenn ich mir eine zartbesaitete Seele erwähle, muß sie etwas lebhafter und selbständiger sein und mir die Prüfungsschule nicht gar zu leicht machen. – Karl sah den Bruder wieder verwundert an, dies war ihm völlig unverständlich, er verlangte aber auch kein Verständniß, er verlangte jetzt etwas anderes. Beide Brüder saßen zusammen im Sofa, überlegten reiflich, und Fritz überzeugte sich, daß Charlottchen von der Stimmung ihres unglücklichen Bräutigams wenigstens hören müsse; er zweifelte aber auch nicht, daß sie ihn in ihrer großen Herzensgüte gleich freilassen würde. Freilich wurde das arme Mädchen in den Erwartungen ihrer Zukunft sehr getäuscht. Sie lebte mit ihrer Mutter, einer armen Offizierswittwe, in ziemlich dürftigen Umständen, und die Aussicht, Frau von Budmar zu werden, war zwar eine sehr bescheidene, aber war doch immer eine Aussicht. Dagegen konnte Fritz den Bruder bei der Verlobung auch nicht des Leichtsinns beschuldigen, ja es war diesem selbst die größte Ueberraschung, den Bräutigamsstand von einer so sonderbaren Seite kennen zu lernen.
Der alte Herr von Budmar war vor einem Jahre gestorben, der älteste Sohn, Karl, erbte das Gut, welches an der Stadtmauer von Woltheim, einer kleinen Provinzialstadt gelegen, schon seit Jahrhunderten der Patrizier-Familie von Budmar zu eigen war. Das Gut war sehr unbedeutend, und obgleich in der Familie Budmar adelige Sitte und Bildung herrschte, so durfte sie doch äußeren Aufwand kaum mehr machen als die reichen Ackerbürger des Städtchens. Seit den letzten zehn Jahren war das Budmarsche Haus ganz und gar vereinsamt, die Mutter, eine vortreffliche, liebenswürdige Frau, war gestorben, der Vater lag fortwährend krank, Karl, der als ältester Sohn die Leitung des Gutes übernommen, vertiefte sich in landwirtschaftliche Studien und überließ sich dabei ungestört seinen Eigentümlichkeiten, die ihn mehr zur Arbeit und Abgeschlossenheit als zum Vergnügen und zum Verkehr mit Menschen zogen. Der jüngere Sohn Fritz war Kürassier-Offizier in Braunhausen, der benachbarten Garnison, und eine weit jüngere Schwester wurde von einer Tante in Schlesien erzogen. Daß man nach dem Tode des alten Herrn dem jungen Herrn Karl eine Frau wünschte, war ganz natürlich, er selbst fand das. Der Verkehr mit der alten Wirthschafterin und die Aufsicht über Bettkisten und Wäscheschränke war ihm ärgerlich, eine Frau sollte ihn von diesen Unbequemlichkeiten befreien. Ebenso leicht als ihm der Entschluß zum Heirathen wurde, wurde ihm auch die Wahl. Ganz nahe dem Gute, ebenfalls vor dem Thore, wohnte Frau von Lindeman mit ihrer Tochter Charlottchen. Charlottchen war ein verständiges und anspruchsloses Mädchen und ihre Mutter eine sehr gescheite Frau. Wenn Herr Karl von Budmar aus dem Felde kam und an der Gartenlaube vorbei passirte, knüpfte er nicht selten eine Unterhaltung mit der zuvorkommenden Frau an, sie nahm ja so lebhaften Theil an seinen ökonomischen Interessen, hatte selbst die Werke des Edlen von Kleefeld gelesen, und sprach über Bodenverbesserungen und Klee- und Esparsettenbau wie ein Buch. So war der Umgang angeknüpft, und die Verlobung mit Charlottchen war eine einfache Sache, bei der die Schwiegermama die Hauptrolle spielte. – Gleich nach der Verlobung war der Bräutigam sehr glücklich und zufrieden, er sprach mit der Schwiegermama gründlich über Ausstattung und Einrichtung, und über Charlottchens Pflichten als fleißige und umsichtige Hausfrau. Daß sie außer der umsichtigen Hausfrau auch eine zartbesaitete Seele war und er sich als glücklicher Bräutigam in einem Felde von unendlichen Rücksichten bewegen müsse, das ahnete er nicht. Je mehr ihm das klar ward, und je mehr seine Schwiegermama ihn zur zarten feinen Seele heranbilden wollte, je größer ward die fieberhafte Aufregung seiner Nerven. Er sah seinen Beruf deutlich vor Augen, nämlich nicht zu heirathen und ein guter alter Onkel zu werden, der an den Familienfreuden der Geschwister so viel Theil nimmt als er gerade Lust hat, und außerdem den Werth des Familiengutes durch sein ausgezeichnetes Wirtschaften auf den doppelten Werth bringt.
Als er heute dem Bruder seine Kämpfe und seine Pläne mittheilte, wurde er besonders lebhaft als er auf den letzten Punkt kam, er vergaß sein Unglück, schwelgte in grünen Klee- und rothen Esparsettenbreiten, und zauberte mit seiner Fantasie veredelte Viehherden in neugebaute Ställe. Er bat den Bruder dringend, zu heirathen, und versprach ihm beträchtliche Geldsummen und Fuhren von Lebensmitteln in die Lieutenantswirthschaft zu liefern. Fritz lächelte bei diesen Versprechungen und er war nicht mit Unrecht mißtrauisch; es war bei dem langjährigen Wirthschaften des guten Bruders noch wenig herausgekommen, was er ihm übrigens nicht zum Vorwurf machen konnte, da er selbst wenig von solchen Dingen verstand und wenig darauf gab. Daß, wenn der Bruder solchen Entschluß faßte, seine eigene äußere Lage sicherer wurde und er eher an Heirathen denken konnte, war ausgemacht, besonders da er entschlossen war, bei seiner Wahl nicht auf Geld zu sehen. Er verschwieg jetzt dem Bruder nicht, daß er allerdings die Absicht habe, sich in die Prüfungs- und Leidensschule der Ehe zu begeben, und daß sein Herz schon längst die Wahl getroffen.
2. Wie der Großvater ein Bräutigam ward.
Noch an demselben Abend, es war im Monat August, saß Fritz von Budmar mit Charlottchen und der gescheiten Frau von Lindeman in der Gartenlaube, und theilte den beiden Damen die Gesinnungen des Bruders mit.
Fritz hatte sich nicht getäuscht, Charlottchen war augenblicklich bereit ihre Ansprüche aufzugeben. Sie versicherte, sie habe das kommen sehen, sie erzählte von allerhand Ahnungen und seltsamen Zeichen, und tröstete selbst die Mutter, die ihre Klagen und Seufzer nicht ganz zurückhalten konnte. Auf diese Klagen war Fritz vorbereitet, er versicherte, die beiden Damen würden immer als zu ihrer Familie gehörig betrachtet werden, die Hochachtung des Bruders für Frau von Lindeman sei unbeschreiblich, und derselbe hoffe, die Zeit würde die Vorgänge der letzten Wochen verwischen, und er dürfe als guter Nachbar wieder in der Gartenlaube vorsprechen und in einem vernünftigen Gespräche mit den Damen sein Vergnügen finden. Es sollte sich von selbst verstehen, daß der Nachbar für den kleinen Haushalt der Damen zu sorgen habe, ja nach dem Tode der Mutter wollten beide Brüder für Charlottchen als für eine Schwester sorgen.
Charlottchen vergoß sanfte Thränen der Rührung bei diesen Worten, und Frau von Lindeman versicherte: Ja der Karl, er ist wunderlich und seltsam, aber er ist ein braver und edler Mann, wie Schade, daß er nicht glücklich sein will!
Die Menschen sind so verschieden, entgegnete Fritz.
Nur in dem einen sind sie gleich, sie suchen alle ihr Glück, sagte Frau von Lindeman wieder und: Lieber Herr von Budmar, fügte sie aufrichtig hinzu, ich wünsche von Herzen, daß Sie es finden mögen.
Fritz drückte ihr die Hand und entfernte sich. Charlottchen sah ihm mit feuchten Augen nach.
O du arme junge Seele, dachte sein teilnehmendes Herz, ich kann dir freilich nicht helfen, aber du hättest ein besseres Schicksal verdient, als einsam und sehnend durch das Leben zu ziehen; zwanzig Jahre erst zurückgelegt, fünfzig vielleicht hast du noch vor dir. Fünfzig schöne Frühlinge und Sommer mit goldenem Mondenschein und Nachtigallensang, fünfzig lange Winter, die lang in der Einsamkeit und schnell im traulichen Kreise vergehen. Vergehen, ja vergehen, und wenn das Leben vorüber, was folgt dann? – Von Charlottchen und von ihrem jungen Herzen kam er mit seinen Gedanken auf sein eigenes Leben. Vier und zwanzig Jahre liegen hinter dir, fünfzig Jahre auch vielleicht noch vor dir, was wird dir das lange Leben bringen? Wird es heißen: wenn es köstlich gewesen, ist es Mühe und Arbeit gewesen? Die Hoffnungen sind dann vielleicht verblühet, die Thatkraft verschwunden, der Reiz des Lebens abgestumpft, ja was folgt dann? Ueber diese Frage hinaus konnte der Frager nicht kommen. – Er war ein vortrefflicher junger Mann, ein edler Mann, doch ist das alles nicht genug, es kann eine Zeit lang wohl befriedigen, es kann Umgebungen beglücken, aber das Glück und den Hausfrieden im eigenen Herzen bringt es nicht. Die Welt ist schön, die Welt ist wunderschön, – ging er in seinen Betrachtungen weiter, – was willst du, Herz, nur mit dieser Sehnsucht, mit diesem Drängen und Streben und Unruhen? Ja du Herz bist eben thöricht, fragst nicht nach Gründen und Verstand, jetzt treibt es dich mit Ungestüm in eine Prüfungs- und Leidensschule hinein, in ein Feld von zarten Rücksichten, du stellst dir Freud und Leid gleich hold und süß vor, du zwingst selbst den Geist dir unterthänig zu sein und thöricht zu denken und zu träumen, ja der ganze Mann muß auf seiner Hut sein, damit er nicht durch solch ein Herz zum Thoren wird und Hoheit und Kraft und Würde aus den Augen verliert.
Während dieser Gedanken war der junge Mann an der Stadtmauer entlang nach dem entgegengesetzten Ende gelangt, wo ein prächtiger Eichenwald an das Städtchen grenzt. Unter den ersten hohen Eichen lag die Oberförsterei, ein altes befreundetes Haus der Budmarschen Familie. Der Oberförster Braumann war ein Kriegskamerad des verstorbenen Herrn von Budmar, er hatte eine Frau und eine achtzehnjährige Nichte, war ein rechtschaffener Mann, der gern Moral predigte, aber weder eine feine zarte Seele, noch ein guter Christ. Daß seine Frau beides war, wußte er nicht zu schätzen, er lobte sie aber: Sie ist eine vortreffliche Frau, pflegte er zu sagen, versteht Disziplin und weiß wer der Herr im Hause ist. An das Lob seiner Frau knüpfte er gern die Klagen über seine Nichte. Es ist ein Blitzmädchen, sagte er, sie hält nie an der Stange, ist voller Kapriolen, und muß einen jeden braven Mann kreuzunglücklich machen. Daß sie einen Mann kriegen wird, dies Blitz-Mariechen, daran zweifle ich gar nicht, setzte er seufzend hinzu, denn sie kann es einem anthun. – Wenn ihm über solche Strafrede die Pfeife ausgegangen war, und sein Pflegetöchterchen geschäftig den brennenden Fidibus holte, um das angestiftete Unheil wieder gut zu machen, dabei aber höchst respectwidrig zu lächeln wagte, dann wußte er nicht, ob er sich ärgern oder sich freuen sollte, und hätte die gute freundliche Tante nicht als Vermittlerin dazwischen gestanden, wäre es wohl ein Kampf ohne Ende gewesen; denn Marie, dem Onkel an Geist überlegen und äußerst selbständig, fand keinen Hebel in ihrer Seele, der sie zum Nachgeben und Fügen in ein tyrannisches und wunderliches Regiment bewegen sollte.
Als der junge Herr von Budmar sein Ziel erreichte, war es dämmrig geworden, der Abendstern tauchte golden am blauen Himmel auf, und es war überaus schön und friedlich in der Welt. Er trat durch die Gatterthür in die Oberförsterei, die Hunde schlugen nicht an bei seinem Kommen, sie kamen ihm wedelnd entgegen, begrüßten ihn und liefen dann nach dem Hause zurück. Vor der Hausthür stand die schlanke Marie mit der weißen Stirn und den großen hellen Augen, sie trug ein schlichtes weißes Kleid mit sehr kurzer Taille und langem Rocke, und auf den lichtbraunen Locken ein rothes Fanchon-Tüchelchen. Sie hatte den Kommenden jedenfalls bemerkt, aber sie that, als habe sie es nicht, und ging mit den Hunden spielend nach der andern Seite des Hauses hin.
Da stand nun der junge Mann mit thörichtem Herzklopfen. Er fand sich sehr getäuscht, denn bei seinen Betrachtungen vorhin waren ihm nebenher gar wunderbare Bilder durch die Seele gegangen. Er hatte sich vorgestellt, er sähe sich beim Eintreten in die Oberförsterei mit freudigen Blicken und holdem Lächeln empfangen, darauf fand er sich neben dem Oberförster, dem alten Freunde, er theilte ihm die Auflösung von des Bruders Verlobung mit, und ebenso des Bruders dringenden Wunsch, ihn selbst, den jüngeren Bruder, bald verheirathet zu sehen, auch von dem zu hoffenden doppelten Werth des Gutes ließ er einfließen, ein Wort hätte ja das andere geben können, und schließlich wäre eine vorläufige Anfrage um Mariechens Hand ganz natürlich gewesen. Wie seltsam geht es nicht zuweilen in der Welt her, es war ja möglich, er wurde heute noch ein glücklicher Bräutigam.
Nach solchen Bildern war dieser Empfang, obwohl er dessen Grund zu kennen glaubte, eine bittere Täuschung. Als er gestern auf der Oberförsterei war, hatte das übermüthige Mädchen mit vieler Kunst und mit vielem Vergnügen den alten Magister Loci dargestellt, wie er mit dem Onkel von der Jagd kommt, dann mit ihm eine wilde Ente verzehrt. Es war das sehr spaßhaft und unterhaltend anzusehen und anzuhören, aber dem liebenden Herzen unseres edlen jungen Mannes war nicht wohl dabei, er konnte diesen Spaß nicht schön finden, und ließ die Geliebte zwar in ganz leidlich angenehmen Worten, aber doch deutlich seine Meinung merken. Sie sah ihn mit ihren hellen Augen groß an, erröthete, schwieg, und schwieg so lange als er dort war. Sie hatte sich die Sache zu Herzen genommen, das war klar, aber in einer anderen Art als er hoffte. – Als sie jetzt so schnöde seinen Blicken entschwand, begann sein Herz zu demonstriren: Du hast ihr gestern Weh gethan, sie ist einmal ein fröhliches Gemüth und hat es nicht böse gemeint, sie war bei dem Schauspiel wirklich äußerst kindlich und gutherzig, und es muß bitter sein von jemand getadelt zu werden, den man lieb hat, und gar mit Unrecht getadelt zu werden. Nun eile ihr nach, so schnell du kannst, und bitte sie um Verzeihung. – Aber der Mann war auf seiner Hut. Halt ein du thörichtes Herz! sagte er zürnend; wo bliebe da meine Hoheit und Würde, nein, ich habe Recht und sie hat Unrecht, und wenn sie meine Liebe durch solchen Tadel nicht hindurch fühlen kann, dann klingen und stimmen unsere Herzen nicht zusammen, und Freud und Leid der Herzen wird nicht hold und süß sein.
Mit trauerndem Herzen aber festen Schritten trat er in das Haus und in die offene Stube. Die Frau Oberförsterin saß allein und feiernd in der dämmrigen Stube am Fenster.
Ich störe wohl? fragte Herr von Budmar.
Durchaus nicht, lieber Fritz, entgegnete die freundliche Frau, und nöthigte ihn, ihr gegenüber Platz zu nehmen.
Sie haben gelesen, fuhr er fort. Eine offene Bibel lag neben ihr.
Sie nickte nur, beide schwiegen. – Nach einer Pause begann sie: Auch Ihnen gehört dieser Reichthum. Sie legte bei diesen Worten ihre seine weiße Hand auf das große Bibelbuch.
Ja, auch mir, entgegnete er seufzend, und doch –
Sie sind noch kein Hilfsbedürftiger, fuhr sie lächelnd fort, Sie sind jung und stolz und kühn, und erwarten viel von sich und von der Welt.
Ja, jung und stolz, sagte er mit etwas wehmüthigem Ton, ein rechter König nach dem Schein, aber man darf nicht immer in sein Königreich hinein schauen, da ist es oft eine Armseligkeit und ein Schwanken und eine Mutlosigkeit, man weiß nicht, ob man darüber weinen oder lachen soll.
Es giebt nichts Schöneres, als wenn ein kluger und begabter und großer Mann in Demuth seine Knie beugt vor Einem, der noch größer und erhabener über ihm ist, sagte die Oberförsterin wieder.
Es wäre wohl gut, wenn unsere Hoffnung und unsere Sehnsucht ein besseres Ziel hätte, als diese arme Erde, entgegnete der junge Mann.
Bemühen Sie Sich nicht daran zu zweifeln, lieber Fritz, fuhr die Oberförsterin fort, kommen Sie mit Kindes Sinn und Kindes Recht, und bleiben Sie nicht außen stehen wie ein armer fremder Bettler.
Marie trat jetzt ein und unterbrach die Unterhaltung. Komm her, Mariechen, ich habe lieben Besuch, sagte die Tante.
So –? sagte Mariechen und kam langsam nähen
Wir haben uns schon gesehen, entgegnete Fritz sehr ruhig.
Die Tante war aufgestanden um Licht zu holen, Marie ging verlegen in das andere Fenster, an den ernsten Mienen des Freundes hatte sie gesehen, wie die Sachen standen. Sie hatte einmal versuchen wollen, ob sie nicht die Königin eines unterthänigen Dieners spielen könne, und da saß nun der König, und ihre Liebe und Verehrung zu ihm war mit seiner Größe gestiegen. Dieser Liebe zu Gefallen wollte sie jetzt gern demüthig sein und wußte es nur gar nicht anzufangen.
Fritz trat zu ihr und fragte: Wollten Sie mich vorhin nicht sehen?
Die Wahrheit zu umgehen kam ihr nicht in den Sinn; das Nein aber wollte nicht über ihre Lippen.
Morgen reise ich ab, und dann werde ich Sie in langer Zeit nicht mehr stören, sprach er weiter, und obwohl er es versuchte ruhig und kühl zu reden, so konnte er doch den eigenen Schmerz im Tone der Stimme nicht verhehlen.
Sie schwieg immer noch, aber sie mußte sich wohl zum Reden entschließen, er griff schon nach der Mütze, vielleicht noch eine Minute, und er hatte das Zimmer verlassen. Verzeihen Sie mir erst, begann sie stockend.
Ein Freudenstrahl ging durch sein Herz und leuchtete aus seinen Augen. Ich werde nie wieder spotten, fügte sie etwas muthiger hinzu.
Er reichte ihr die Hand und lächelte. Er hätte nun auch allerhand sagen können, vielleicht: daß er es besser lernen wolle mit ihr umzugehen; aber es war nichts nöthig, sie verstanden sich wohl und es war alles gut.
Des Onkels laute Stimme störte sie, er kehrte eben von einer Geschäftsreise zurück, und seine Frau, Licht bringend, trat mit ihm in das Zimmer. Nun ja, da ist der Fritz, sagte der Oberförster und begann mit dem jungen Freunde die Unterhaltung, wie er es seit Jahren gewohnt war, in ganz vertraulicher Weise. Er sollte sich zu ihm auf das Kanapee setzen, und während dem die Frauenzimmer das Abendessen besorgten, mit ihm eine Pfeife rauchen.
Nun Marie, die Pfeifen her! rief der Onkel im gewöhnlichen Commandoton. Das Mädchen reichte eine Pfeife dem Onkel, und eine dem Gast, darauf wollte sie der Tante in die Küche folgen.
Fidibus! rief der Onkel ärgerlich. Marie kehrte schnell zurück, in glücklicher Zerstreuung hatte sie den gewohnten Dienst vergessen, sie steckte den Fidibus am Lichte an und, blieb gebückt damit vor dem Onkel stehen, bis die Pfeife brannte. Der Onkel machte jetzt ein befehlendes Zeichen nach den Gaste hin, sie weigerte sich gar nicht dem Freunde zu dienen, aber er war eine zu zarte Seele, er konnte unmöglich einen solchen Commandodienst von ihr annehmen, er sprang auf, groß und hoch stand er vor ihr, nahm ihr mit einer Verbeugung das Papier aus der Hand und bediente sich selbst. – Der Onkel brummte und schüttelte den Kopf und Marie eilte aus dem Zimmer.
Jetzt saßen beide Männer allein neben einander, und Fritz bedachte mit Herzklopfen, daß die Sache wirklich so weit war, als er Angesichts des Abendsterns geträumt, und ein Wort das andere geben könne. Er erzählte genau des Bruders Herzenskämpfe und Entschlüsse und Wünsche. Der Oberförster zankte tüchtig über den Sonderling und war dagegen sehr einverstanden mit den Heiraths-Absichten des jüngeren Bruders. Ein Wort gab nun wirklich das andere, und die Anfrage um Mariechens Hand ward gemacht ohne große Schwierigkeit.
Der Onkel war sehr erstaunt, ja er wollte dem jungen Freunde vorreden, das Mädchen passe nicht für ihn, er sei zu nachgebend; aber der junge Freund war gescheit genug, er ließ den alten Herrn erst reden, machte dann seine Entgegnungen, und der Schluß der Unterredung war des Onkels Versicherung: das Mädchen gäbe er doch niemanden lieber als ihm. – Als der glückliche Bewerber, um die Sache so weit als möglich zu bringen, erwähnte, Mariechen müßte doch gefragt werden, – fuhr der alte Herr wieder ärgerlich auf: in seinem Hause solle die verderbliche Mode, daß ein Mädchen gefragt würde, nicht aufkommen; so jemand gefragt werde, so habe er auch das Recht zu antworten, Marie aber solle auf der Stelle wissen, was zu ihrem Glück beschlossen sei.
Tante und Nichte wurden gerufen, der alte Herr begann seine Rede, die aber nicht recht fließen wollte, ja als er das Mädchen vor sich sah, ward es ihm bedenklich, ob sie sich ihr Glück von ihm anbefehlen lassen würde. Er athmete tief auf und es fiel ihm ein Stein von der Brust, als der Fritz dem Mädchen freundlich die Hand gab, und sie ihn so bescheiden und glücklich ansah. Tante und Nichte wurden nach einigen gegenseitigen feierlichen Redensarten wieder entlassen und der arme Bräutigam mußte auf dem Kanapee sitzen bleiben, um eine Geschäftsfrage anzuhören, bei der die Frauenzimmer überflüssig waren. Endlich fiel dem alten Herrn die Pfeife aus der Hand, und er saß nach lieber Gewohnheit schlummernd neben dem ungeduldigen Gaste.
Dieser verließ jetzt schnell genug das Zimmer, der helle Mondenschein leuchtete ihm die Treppe hinauf über den großen Saal nach dem wohlbekannten Rückzugs-Stübchen der guten Tante. Die Thür war nur angelehnt, er hörte flüstern, noch einmal stand er nachdenklich vor der ersehnten Minute seines Glückes und vor den Pflichten und Würden seines neuen Amtes. Ja du willst rechtschaffen sein, dachte er bewegt, und willst sie sehr glücklich machen, willst sie auf Händen tragen und es nicht immer zu genau nehmen mit der Hoheit; es sind Frauen zarte Wesen, sie sind schwach, und unsere Kraft besteht darin, daß wir nicht auch schwach sind.
Er trat leise ein, Tante und Nichte knieten auf dem Tritt im Fenster und der Mondenschein lag lieblich auf den beiden Gestalten. Darf ich kommen? fragte er leise.
Er kniete neben sie, und die mütterliche Frau legte die Hände der jungen Leute in einander und sagte: Ja, so sollt Ihr Euren Brautstand anfangen, mit gefalteten Händen und den Blick da hinauf, der Herr führe Euch, Er sei Euer bestes Theil; wenn Euch das wunderbar klingt, glaubt es nur erst, Ihr werdet es dann erfahren.
O nein, es klang ihnen nicht wunderbar, Marie hatte trotz ihrer fröhlichen Natur und ihres scheinbar leichten Sinnes eine warme Liebe zum Herrn wohlverborgen in ihrem Herzen, und was war es denn, was den jungen Mann seit lange zu der stillen würdigen Frau in der Oberförsterei und zu ihrem Zögling hinzog? Ein Anknüpfungspunkt mit dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, war sicher in ihm, ein Faden, der schon außer der vergänglichen Welt seinen Halt hatte. Der Herr selbst wollte den Faden weiter spinnen und schaffte daran auch in dieser Stunde.
Die drei saßen noch lange beisammen. Der Herr zieht die Seinen durch Glück und Unglück zu sich, sagte die Tante; wir möchten uns alle wohl lieber durch Glück ziehen lassen, doch ist es noch eine Frage, ob uns das leichter ist. Wo der Herr mehr Last auflegt, giebt er auch mehr Kraft, ja es erschließt sich uns bei den oft äußeren drückenden und einförmigen Lebensverhältnissen eine Wunderwelt, die uns alles um uns vergessen läßt, die uns mit unbeschreiblichem Frieden erfüllt, die förmlich unsere menschlichen Gefühle umzaubern kann: der Aerger wird abgestumpft, der Kummer aufgelöst, die Einsamkeit zur Wonne. Wollte ich von mir reden, setzte sie zögernd hinzu, so könnte ich nur sagen, daß der Herr mich einzig zum Glück und zur Freude geführt.
O liebe Tante, Sie sprechen so, damit wir Sie nicht bedauern sollen, flüsterte Marie mit feuchten Augen und legte ihren Kopf an des Freundes Brust.
Du irrst Dich, entgegnete die Tante lächelnd, und ich wünschte, Du möchtest mich verstehen. Ich freue mich Deines Glücks, ja Dein Glück ist eben wieder ein Freudenbecher, den der Herr mir reicht, für andere ist das Herz zaghafter als für sich selbst, ich habe mich sehr gefürchtet Dich je unglücklich zu sehen.
Ihre Stimme wurde hier bewegt, und Marie ergriff die Hände der theuren Frau und küßte sie mit lautem Schluchzen.
Nicht so, sagte die Oberförsterin mit schneller Fassung, ich will Euer Herz nicht weich machen, Ihr seid glücklich und ich bin glücklich, und Ihr müßt es jetzt dulden, daß ich Euch Verse vorlese, recht zu Eurem Vergnügen und passend auf Euren Stand.
Die Tante griff nach einem alten Liederbuche und begann zu lesen. Dem Bräutigam war das sehr lieb, sie saßen Hand in Hand, den Worten lauschend, die in der Seele wiederklangen.
Ein getreues Herze wissen Hat des höchsten Schatzes Preis. Der ist selig zu begrüßen. Der ein treues Herze weiß. Mir ist wohl bei höchstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.
Läuft das Glücke gleich zu Zeiten Anders als man will und meint: Ein getreues Herz hilft streiten Wider alles was ist feind. Mir ist wohl bei höchstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.
Sein Vergnügen steht alleine In des andern Redlichkeit, Hält des andern Noth für seine. Weicht nicht, auch bei böser Zeit. Mir ist wohl bei höchstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.
Nichts ist süßers, als zwei Treue, Wenn sie eines worden sein: Dies ists deß ich mich erfreue, Und sie giebt ihr Ja auch drein. Mir ist wohl bei höchstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Heize.
Gefällt Euch das? fragte die Tante freundlich. – Das Brautpaar nickte sehr einverstanden. – Ja es ist ein schönes Lied, fuhr die Tante fort, aber ein noch schöneres will ich Euch am Hochzeitstag vorlesen, und so ist es gut für heute.
Fritz war durch das Gatterthor getreten, er sah noch einmal zurück auf das Gehöft, das so hell und friedlich im Mondenscheine lag, der tiefblaue Himmel breitete sich weit darüber hin, und am Himmel schimmerten unzählige Sterne. Warum war denn sein Herz so selig? Ja du lieber Verstand, das kann ich dir nicht erklären, das ist eben ein Wunder, und du bist ein zu armseliger Wicht um Wunder zu begreifen.
3. Der Großeltern Hochzeit.
Am 12. Mai 1805 war der Himmel besonders strahlend und der junge Wald duftend, die Blüthen silberweiß, die Aurikeln glänzend in den farbigen Sammetkleidern, und aus der frischen thauigen Wiese schauten hundert und tausend bunte helle Aeuglein heraus und schimmerten wie lichte Seide und Edelgestein.
Aus der Gartenmauer am Budmarschen Gute führte eine kleine Pforte auf eine große Wiese, durch die Wiese hindurch schlängelte sich ein heller Bach, von hohen Rüstern umschattet, bis eine halbe Stunde weiter das Bächlein eine Seitenrichtung nahm und dieser Wiesengrund von grünen Tannenhöhen beschlossen wurde. Nach dieser Höhe wanderte an seinem Hochzeitmorgen das Brautpaar, von hier aus waren die Thürme von Braunhausen, der Garnison des Bräutigams, zu sehen, und von hier aus und zugleich von der Höhe des Glückes, auf die ihr schönster Festtag sie geführt, wollten sie hinabsehen auf ihren künftigen Wohnort und auf die Zukunft, die gar weit und reich vor ihnen lag. So einsamer Spaziergang war ihnen im ganzen Brautstande nicht geworden, das Spazierengehen war noch nicht so recht an der Mode, und noch dazu ein solches Umherlaufen in Feld und Flur, wie es der Oberförster nannte. Aber heute mußte er schon seine Einwilligung dazu geben, er durfte auch nicht schelten über unnütze Zeitverschwendung, denn die Freundinnen und Basen des Hauses hatten ihn versichert, an ihrem Ehrentage dürfe eine Braut nichts schaffen, wenn nicht ihr ganzes Leben voller Unruhe und Sorgen bleiben solle.
Auf der Spitze des Tannenberges saß also feiernd das Brautpaar. Sie sagten sich nicht nur: Ich liebe Dich! und wieder: Ich liebe Dich sehr! und: Wie sehr lieb ich Dich! – nein sie hatten beide die bestimmte Sehnsucht, daß diese Liebe ihnen der Leitstern zu etwas Besserem sein sollte, und wußten auch etwas Besseres zu reden.
Mir klingen heute immer die Worte in der Seele, begann Marie: »Ich habe dich je und je geliebet, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.« Ja, ich fühle es wohl, der Herr will mich durch Güte ziehen, fügte sie hinzu.
Bist Du dessen so gewiß? fragte der Bräutigam lächelnd.
Sie sah ihn mit ihren hellen Augen nachdenklich an. Ja, Fritz, ich weiß was ich an Dir habe, sagte sie, ich weiß auch was der Herr mir mit Dir geben will, und ich muß auch darin des Herrn Willen und Thun deutlich erkennen, es könnte mir sonst bange werben.
Warum bange? fragte der Bräutigam verwundert.
Weil ich nicht recht begreifen kann, warum Du mich lieb hast, und warum Du mich immer lieb haben sollst.
Das läßt sich auch schwerlich vordemonstriren, entgegnete Fritz; ebenso wenig wirst Du mir erklären können, warum Du mir folgen willst in das kleine Häuschen dort unten, das zu klein ist für schimmernde Lust und lautes Vergnügen und doch groß genug zu vielen Sorgen, und warum Du heut das Gebot annehmen willst: Er soll dein Herr sein.
Es ist wirklich seltsam, sagte Marie und freudig leuchteten ihre Augen, daß mir nichts lieber ist als dies Gebot.
Das ist eben das Schöne der Liebe, daß sie sich nicht erklären und nicht verdienen läßt, sagte Fritz.
Du zweifelst aber dennoch nicht an unserer Liebe, nahm Marie lebhaft das Wort.
Ich denke, ich weiß nichts Gewisseres als dies, war des Bräutigams vergnügte Antwort.
Nun ja, ich zweifle auch nicht, fuhr Marie fort, ich habe aber in der letzten Zeit viel darüber nachgedacht, unsere begabten großen Dichter verstehen es schön zu schildern das Wunderbare in der Liebe, sie müssen es zugeben, daß es etwas Unerklärliches ist um den Zug, der Herzen zusammenführt; wenn diese gescheiten Leute das annehmen zwischen zwei armen schwachen Menschenherzen, weil sie es eben an sich erfahren, warum wollen sie ein wunderbares Liebesgeheimniß zwischen dem Herzen Gottes und seinen Kindern nicht annehmen?
Der Bräutigam hörte der Schülerin der guten theuren Tante lächelnd zu, aber er hörte sie gern, und im Grunde seines Herzens fanden diese Worte einen ernsteren Anklang, als er sich augenblicklich bewußt war.
Ich weiß nicht, ich meine, wer nur irgend aufmerksam ist auf die Irrgänge seiner Natur und seines Lebens, fuhr die Braut fort, der müßte leicht auf den Schluß kommen: daß die Auflösung alles Irrens nur in einer Erlösung aus großer Liebe und aus Gnaden sei. Wenn diese Menschen sagen: ich bedarf der Gnade nicht, ich bin ein rechtschaffener Mensch, bin gescheit und vernünftig, kann mir wohl durch eigene Kraft, durch eigenes Verdienst die Liebe Gottes erwerben, wozu bedarf es da erst so wunderbarer und geheimnißvoller Dinge als eines Liebes- und Erlösungsrathes aus Gnaden ganz ohne eigenes Verdienst und eigene Würdigkeit! – es ist ebenso, als wenn ich zu Dir sagen wollte: Du mußt mich lieben, ich bin ein braves rechtschaffenes Mädchen, habe den besten Willen und fühle jugendliche Kraft in mir zu schönen Thaten und zu großem Schaffen; ich habe freilich Fehler, die haben aber alle Menschen, und es wäre sehr ungerecht, wolltest Du mir die anrechnen. Wäre diese Forderung nicht unverschämt und müßte sie nicht gerade Deine Liebe von mir abwenden? Der einzige vernünftige Grund, der sich hören ließe, wäre nur der: Liebe mich doch, weil ich Dich so sehr liebe!
Gewiß ein Grund, der sich gern hören läßt, entgegnete der Bräutigam, das aber will ich auch gern festhalten, daß unsere Ehe im Himmel geschlossen und unsere Liebe der Wille und das Thun des Herrn ist. Es kann mir dann nicht bange werden um Deine Liebe. Und wenn Zeiten kommen, die sicher nicht ausbleiben, wo ich Dir nicht ganz ein rechtschaffener und vernünftiger Herr bin, so bist Du doch vergnügt, weil Du weißt, unsere Ehe ist im Himmel geschlossen, und weil Du weißt, daß es des Herrn Wille ist, daß Du auch einmal einem wunderlichen Herrn folgen sollst. Und wenn dann die wunderlichen Wolken vorüber sind, dann werde ich Dich desto herzlicher lieben. Nun denke Dir, Mariechen, wenn so unsere Liebe immer wächst, wie das sein wird, wenn wir unsere goldene Hochzeit feiern.
Die goldene? fragte die Braut verwundert.
Warum nicht? fuhr der Bräutigam fort, es kann ja wohl des Herrn Wille sein. Fünfzig Jahre? das ist lange! entgegnete die Braut, dann werde ich nicht mehr – sie stockte und lächelte.
So hübsch sein? fragte er. – Sie nickte. – O, das wollen wir abwarten, tröstete er vergnügt, und nun gingen sie heim.
Sie hatten dem Bruder einen Morgenbesuch versprochen, sie mußten ja sehen, wie er ihre Hochzeit feiern ließ. Das alte graue Haus mit den Wappen über den Thüren, den hohen Fenstern und großen Räumen war festlich mit Blumen geschmückt, und sonderbar genug, die guten Nachbarinnen, Frau von Lindeman und Charlottchen, hatten dabei geholfen. Dagegen war ihnen in einer schönen weißen Serviette ein hoher Kuchenberg hinüber geschickt, denn Herr Karl von Budmar ließ es sich angelegen sein, bei dieser Gelegenheit, und wie immer bei ähnlichen, ihnen seine unveränderte Freundschaft zu bezeugen. Er war heute besonders glücklich. Alle Leute im Hofe wurden mit Kuchen, Braten und Wein tractirt. Er versicherte dem Brautpaar ganz ernstlich, er sei so froh, daß er den Bruder so weit habe, und sei noch froher, daß er nicht selber mit Hochzeit feiern müsse.
Mit dem Hochzeitstage an und für sich hatte er nicht ganz Unrecht; es war für das Brautpaar eine Aufgabe, erst des alten Magisters Traurede anzuhören, und sich dann durch ein Heer von Vettern und Muhmen und Basen durchzuschlagen. Die schönste Viertelstunde des ganzen Tages war die, als der Bräutigam in schöner Uniform, den Myrthenstrauß vor der Brust, zur Tante kam, um die geschmückte Braut zu holen. In dem kleinen bekannten Stübchen waren sie einige Minuten vor dem Hochzeiten und Basentrubel gesichert, und der Tante Abschiedsworte und ihr Segen waren dem Brautpaar wohl sehr lieb. Zum Schluß reichte sie ihnen das versprochene Hochzeitslied. Sie las es nicht selbst vor, sie verließ das Zimmer, und das Brautpaar war ganz allein und konnte die schönen Worte recht in das Herz einschließen:
Wohl einem Haus, wo Jesus Christ Allem das All in Allem ist! Ja, wenn er nicht darinnen war: Wie finster wärs, wie arm und leer.
Wohl, wenn ein solches Haus der Welt Ein Vorbild vor die Augen stellt, Daß ohne Gottesdienst im Geist Das äußre Werk nichts ist und heißt.
Wohl, wenn das Rauchwerk im Gebet Beständig in die Höhe geht, Und man nichts treibet fort und fort, Als Gottes Werk und Gottes Wort!
Wohl, wenn im äußerlichen Stand Mit fleißiger, getreuer Hand Ein jegliches nach seiner Art Den Geist der Eintracht offenbart!
Wohl, wenn die Eltern gläubig sind, Und wenn sie Kind und Kindeskind Versäumen nicht am ewgen Glück! Dann bleibet ihrer keins zurück.
So mach ich denn zu dieser Stund Samt meinem Hause diesen Bund: Wich alles Volk auch von ihm fern, Ich und mein Haus stehn bei dem Herrn.
Nachdem die Hochzeit mit aller Freude und Unruhe vorübergegangen, war der Oberförster sehr verstimmt; er wollte es sich nicht gestehen, daß er die Nichte vermisse, und doch war es so. – Es waren einige Monate so vergangen, als er eines Morgens in die Wohnstube trat und ganz verwundert stehen blieb. Ueber dem Sofa hingen in goldenen Rahmen zwei Bilder, o so ähnlich als das Leben selbst. Der Fritz im dunklen Uniform-Oberrock, mit der hohen Stirn, der kühnen feinen Nase und dem sprechenden Munde, und daneben Marie mit den lichten strahlenden Augen, den hellbraunen Locken, im zarten weißseidenen Brautkleid, eine Rose vor der Brust: Der Oberförster stand schweigend davor, und seine Frau, ungesehen, beobachtete mit freudiger Spannung sein Erstaunen. Jetzt wandte er sich, er sah sie und errieth den Zusammenhang. Hast Du das veranstaltet? fragte er mit stockender Stimme. Sie nickte nur. Er setzte sich davor auf einen Stuhl und kämpfte wie ein Kind mit den Thränen. Die größte Freude, die mir noch passiren konnte! sagte er wieder und reichte seiner lieben zartfühlenden und zartsorgenden Frau dankbar die Hand.
Die Bilder hingen hier im Festtagskleide und in Festtagsruhe von einem Jahr zum andern, während das junge Paar dort drüben hinter den Bergen lebte und Freuden und Sorgen viel Raum fanden in dem kleinen Häuschen.
4. Bis zur Silberhochzeit.
Fünfundzwanzig Jahre sind vorüber, das alte graue Haus mit den Wappen über den Thüren ist wieder festlich mit Blumen geschmückt, der Himmel steht so weit und rein und blau darüber, duftend ist der junge Wald, die Aurikeln prangen im farbigen Sammet, die Nachtigallen singen am silberhellen Bach, und im jungen Grün der Wiese hatte sich wieder die liebe lichte buntschimmernde Blumengesellschaft eingefunden. Ja, die Frühlingswelt war dieselbe als vor fünfundzwanzig Jahren, aber die Menschenwelt war sehr verändert. In der Oberförsterei waren neue Bewohner, die wenig Verkehr mit den Bewohnern des alten grauen Hauses hatten. Die beiden stattlichen Bilder in den goldenen Rahmen waren hierher übergesiedelt, sie hingen in der Familienstube über dem künstlich geschnitzten Nußbaum-Sofa mit dem kirschrothen Damast-Ueberzuge. Auf dem Sofa saßen zwei Leute, den Bildern sehr ähnlich, nur – hübscher geworden, nach gegenseitiger Uebereinkunft. Klang das thöricht? Nein, so soll es immer sein. Das Fleisch macht Raum dem Geiste, die Züge waren wohl schmaler und scharfer geworden, aber die in fünfundzwanzig Jahren erlebte Liebe und Freude war darin zu lesen, und die zusammen erlebten Sorgen und Prüfungszeiten, die der Herr seinen Kindern schickt, um sie zu ziehen und wachsen zu lassen in dem, das, wie die selige Tante so gut zu schildern wußte, eine Wunderwelt sich aufschließt, darinnen alle menschlichen Gefühle umgezaubert werden. Das alles lebte in den Augen und in den Zügen, und es war kein Wunder, daß sich die Leute mit so getreuen Herzen schöner fanden als vor fünfundzwanzig Jahren.
Aber auch die Welt und der Kreis, in dem sie lebten, war ihnen schöner und reicher geworden. Die Tante war zwar gestorben, und das war für beide ein großer Verlust, aber die fünfzehn Jahre, die sie noch mit ihr zusammen verlebt hatten, waren auch wieder ein Reichthum zu nennen. Und welch ein reicher Kinderkreis war um sie versammelt, ja selbst zwei Enkel nahmen die Herzen der Großeltern in Anspruch, fast mit wärmerer Liebe als die eigenen kleinen Kinder es gethan.
Daß der jugendliche Großvater nicht mehr Offizier, sondern Rentmeister war, und nicht in dem kleinen Hause hinter den Tannenbergen, sondern hier im geräumigen väterlichen Hause wohnte, hatte der Krieg veranlaßt. Ein Jahr hatte er mit seiner jungen Frau im ungestörten Glück verlebt, da kam das unglückliche Jahr 1806. Er mußte in das Feld, und obgleich der Frieden des nächsten Jahres ihn wieder in die Garnison zurückführte, so ruhten die Folgen des Krieges und selbst die des Friedens schwer auf ihm und seiner Familie. Bruder Karl, der so viel für den verheirateten Bruder thun wollte, wußte in den Jahren der Bedrückung selbst nicht ein und aus, konnte sich selbst kaum über Wasser halten. Bruder Fritz mußte von dem Lieutenants-Gehalte leben, und es war natürlich, daß Sorgen und Noth hier oft recht laut an die Thüre pochten. Die gute Tante Oberförsterin, die noch zehn Jahre als Wittwe ihren eigenen kleinen Haushalt in Woltheim hatte, brachte ein Stück nach dem andern, um die nöthigsten Lücken in dem jungen Haushalt auszufüllen, und nahm der Nichte dadurch manche schwere Sorge ab. Sie that aber noch mehr, sie nahm Theil an den Sorgen der reichen Kinderstube, Sorgen, die von der Welt wenig getheilt und nie hoch genug gewürdigt werden. Da heißt es wohl: das Kind ist krank, und nach Wochen heißt es: das Kind ist wieder gesund; welche Kämpfe diese Wochen in sich fassen, wie da ein Mutterherz ringen muß in Geduld und Glauben, wie es auf den Wogen der Hoffnung hoch hinauf und sehr tief hinab getragen wird, und wie es wohl ganz verzagen müßte, wenn es nicht die eine treue Hand vor sich sähe, die es ergreifen und bittend rufen darf: Herr, hilf mir, denn ich verderbe! das alles wird nur von Eingeweihten ermessen.
In diesen kleinen und doch so bangen Sorgen in der Kinderstube des kleinen Häuschens dort hinter den Tannenbergen gesellten sich ernstere. Ein liebliches Kind starb im zarten Alter, der Vater mußte mit dem anbrechenden Befreiungskriege von neuem ins Feld ziehen, und Armuth und Noth wurden immer drückender. Aber der Herr half immer hindurch, Trost fehlte nicht, selbst in den bittersten Stunden, die Kinder blühten fröhlich auf bei schmaler Kost, und die schweren Zeiten gingen an ihnen fast unbemerkt vorüber, ja Glück und Lust der Kinder nahmen das ganze Häuschen so in Anspruch, daß Sorgen und Noth der Eltern davor fliehen mußten.
In der Schlacht von Leipzig lähmte ein Schuß des Vaters linken Arm, er war nun zum Dienst unfähig und erhielt nach dem Frieden die Rentmeister-Stelle in seiner Vaterstadt. Die ganze Familie siedelte nun in das alte große Haus mit den geräumigen Stuben und Kammern über, die, wie Onkel Karl zufrieden versicherte, doch nun ihre Zinsen brachten. Mit der Familie zog aber auch Charlottchen ein, ihre Mutter war gestorben, und es war sehr einfach und wünschenswerth, sie als liebreiche und helfende Kinderfreundin im Hause zu haben. Außerdem wurde noch ein Hauslehrer genommen, der nach dem Ausspruch einer Familienkonferenz billiger zu erhalten war, als die vielen Jungens auf einem Gymnasium.
Das war nun ein großer Kreis und ein rechter Umschwung in dem alten Hause, es gab auch wunderliche Verwickelungen, und es gehörte eben dazu ein Bruder Fritz, der bei aller Hoheit und Würde eine so seine zarte Seele war, und die Frau seines Herzens mit ihrer frischen Gewandtheit, und das gefühlvolle Charlottchen und der wunderliche gutherzige Onkel Karl, und die ganze lustige Kinderschaar, um die Verwickelung immer wieder gemächlich auszugleichen.
Meinen Sie, Charlottchen, daß der Wilhelm schon wieder eine neue Hose braucht? so fragte einst Onkel Karl bedenklich, indem er sich mit seiner Pfeife in der Kinderstube etablirte; ich weiß nicht, zu meiner Zeit konnten Jungens in dem Alter noch Flecken vor den Knien tragen.
Ei wenn sie von derselben Couleur sind, sagte Charlottchen freundlich.
Natürlich, fiel Onkel Karl ihr in das Wort, von derselben Couleur müßten sie sein; die Großtante hatte damals mit ihren blöden Augen dem Max einen Changeant auf das Braune gesetzt, das sah abscheulich aus, und ich bin dafür, wir müssen unseren Stand respektiren.
Darin haben Sie sehr recht, versicherte Charlottchen.
Es gehört eben die rechte Umsicht dazu, fuhr der Onkel fort, in keinem Stücke darf man zu weit gehen, und ich muß mit Schmerz gestehen, meinem Bruder gehen die rechten praktischen Eigenschaften eines Hausvaters völlig ab. Zu dem Changeant hat er gelacht, der Max hat ihn wirklich aufgetragen, und dagegen kann meine Schwägerin die Hand immer im Beutel haben, wenn es ihr beliebt, den Kindern etwas anzuschaffen. Ich bin durchaus nicht für Wilhelms Hose, und es ärgert mich sehr, wenn die Hose gekauft wird.
O Herr von Budmar, tröstete Charlottchen, die Sache muß sich ändern lassen, sie ist allerdings von Wichtigkeit.