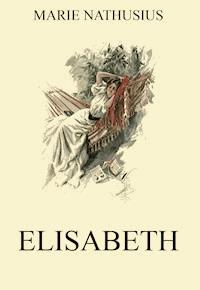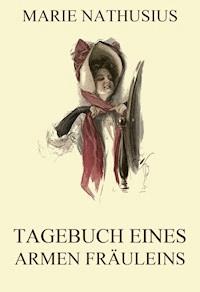
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Erinnerungen aus einem Mädchenleben. Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer Sammlung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tagebuch eines armen Fräuleins
Marie Nathusius
Inhalt:
Marie und Philipp Nathusius – Biografie und Bibliografie
Tagebuch eines armen Fräuleins
Allein und doch nicht ganz alleine.
Brief von Lulu nach Haus.
Lulu an Trinchen.
Lulu an Trinchen.
Lulu an die Tante.
Lulu an Trinchen.
Trinchen an Lulu.
Braunsdorf, den 18. März.
Tante Julchen an Lulu.
Lulu an Tante Julchen und Lucie.
Tagebuch eines armen Fräuleins, M. Nathusius
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849632526
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Marie und Philipp Nathusius – Biografie und Bibliografie
Marie N. war die Tochter des Predigers an der Heiligen Geistkirche zu Magdeburg, Friedrich Scheele. und wurde hier am 10. März 1817 geboren. Schon nach zwei Jahren kam sie mit den Eltern nach Calbe a. d. Saale, wohin der Vater als Superintendent und Oberpfarrer berufen worden war, und hier verlebte sie eine glückliche Kinder- und Jugendzeit. Mit der Schulbildung sah es in jenen Tagen nur dürftig aus, und was die Stadtschule in Calbe dem jungen Mädchen bot, war bald gelernt; indessen gehörte doch auch Marie N. zu jenen Naturen, von welchen Bogumil Goltz sagt: „Ein Mädchen erlangt Bildung und Erziehung, ohne dass man begreift wie, wann und wodurch. Für ihren poetischen Sinn, ihren sympathetischen und symbolischen Verstand, für ihren sittlichen Instinkt werden alle Erlebnisse ebenso viele Bildungsmittel. Eben die ungeschulte Natur des Weibes, die Tatsache, dass ein Weib mit diesen Bruchstücken von Elementarkenntnissen, und selbst ohne sie, allen Zauber der Weiblichkeit, der Menschenschöne, der Menschengesittung gewinnen und effektiv machen kann: dies nie aussterbende Zeugnis aus dem Paradiese ist es ja, was den Reiz der Frauen für den schulgeübten Mann in sich fasst.“ Eine Fülle von Poesie und Lebenseindrücken der mannigfachsten Art knüpfte sich für Marie an verschiedene Ortschaften in der Nachbarschaft, die sie in Begleitung des Vaters auf seinen Visitationsreisen oft besuchte, und die sie uns in ihren Schriften zum Teil mit großer Treue geschildert hat. Im J. 1834 zog sie zu ihrem Bruder, der in Magdeburg Lehrer war und die Söhne einiger befreundeten, wohlhabenden Familien zu sich in Pflege genommen hatte, um diesem neuen Haushalte selbständig vorzustehen, und als der Bruder im folgenden Jahre ein Pfarramt in Eikendorf angetreten, war fortan Mariens Leben zwischen Calbe und Eikendorf geteilt. Das Leben auf dem Lande und besonders das Zusammenleben mit den Dorfbewohner lieferte denn auch den Stoff zu ihren späteren „Dorf- und Stadtgeschichten“ (1858; der „Gesammelten Schriften“ 1. Band); es sind dies zehn Erzählungen voll lebendiger Treue, in denen uns wirkliches, selbst angeschautes, selbst mitgelebtes Dorfleben zur Anschauung gebracht wird. Kurze Besuche in Magdeburg und Berlin unterbrachen diese stille Idylle, bis sie endlich derselben durch ihre Vermählung mit Philipp N. gänzlich entzogen ward. – Philipp Engelhard N. war der Sohn Gottlob Nathusius’ (s. o.) und wurde am November 1815 zu Neuhaldensleben bei Magdeburg geboren. Nach Beendigung seiner Schulzeit trat er, 16 Jahre alt, in die Geschäfte seines Vaters ein, die er trotz des großen Umfanges (Brauerei, Branntweinbrennerei, Öl-, Graupen-, Kartoffelmühlen, Obstkelterei, Zuckerfabrik, Ziegelei, Steingut- und Porzellanfabrik u. s. w.) nach des Vaters Tode (1835) im Alter von 20 Jahren schon selbständig fortführte. Im Winter von 1836 bis 1837 lag er in Berlin seinen Studien ob und unternahm dann in den beiden folgenden Jahren eine größere Reise durch Deutschland, Italien, Frankreich, Griechenland und die Türkei. Im August 1840 verlobte er sich mit Marie Scheele, und nachdem am 4. März 1841 die Vermählung vollzogen und der letzteren eine Reise des jungen Paares in die Provence, durch Italien bis Neapel und ein dreiwöchentlicher Aufenthalt in der Schweiz gefolgt war, bezog es die neue Heimat Althaldensleben. Hier bot sich bald ein ausgiebiges Feld für die humanitären Bestrebungen der jungen Frau. Das sittliche und leibliche Elend, das sich neben verhältnismäßig viel Verdienst und Wohlstand in jedem größeren Fabrikorte findet, regte sie zur Gründung einer Kinderbewahranstalt an, der sich dann in der Folge ein Frauenverein für die Ortsarmenpflege, ein Rettungshaus für Knaben, ein solches für Mädchen und eine Mädchenarbeitsschule anschlossen. In der letzteren lehrte Marie N. die Kinder des Dorfes selber nähen und stricken. Zu Anfang des Jahres 1849 beschloss Philipp N., seine großen Geschäftsetablissements in Althaldensleben aufzugeben. Da indes auch an einen künftigen Wohnsitz sich wieder Gedanken eines großen Rettungshauses knüpften, so beschlossen die Gatten, sich die Erfahrungen fremder Völker auf diesem Gebiete nutzbar zu machen, und unternahmen deshalb im Frühjahre 1849 eine größere Reise nach Paris, von hier in das Herz Frankreichs hinein und dann nach England hinüber, das nach allen Richtungen durchstreift ward. Heimgekehrt, lebten die Gatten ein halbes Jahr in Giebichenstein bei Halle, bis sie am 1. Mai 1850 nach dem neuerworbenen Gute Neinstedt bei Thale am Harz übersiedelten, wo denn auch bald nach dem Muster des Hamburger „Rauhen Hauses“ ein neues „Knabenrettungs- und Bruderhaus gegründet ward. Bereits im Februar 1849 hatte Philipp N. die Redaktion des vom Pastor v. Tippelskirch in Giebichenstein geleiteten „Volksblattes für Stadt und Land“ übernommen, des einzigen Blattes in der vormärzlichen Zeit, das die Grundsätze und Anschauungen der konservativen und streng kirchlichen Partei vertrat, und dadurch wurde Marie N. ganz ungesucht in die Bahn einer Schriftstellerin hineingeführt. In ihren ersten Erzählungen, die seit 1849 im „Volksblatt“ ausgingen, hielt sie sich noch zu den Kleinen herab; jeder Zug war aus der Kinderstube erwachsen; ein Odem wirklicher Jugendpoesie weht durch sie hindurch, und die schönsten unter ihnen haben wirklich etwas vom Märchen mitten im wirklichen Leben. Sieben derselben erschienen unter dem Titel „Die Geschichten von Christfried und Julchen“ (“1858; Ges. Schr. 2. Bd.), während andere, kleinere Arbeiten für die „Sextaner- und Quintanerfreunde“ als „Kleine Erzählungen“ (II, 1859; Ges. Schr. 3. u. 4. Bd.) in die Welt flogen. Von den Geschichten für die Kinderstube stieg dann Marie N. auf Verlangen etwas höher zu den Erzählungen für junge Mädchen. In „Langenstein und Boblingen“ (1855; Ges. Schr. 6. Bd.) schildert die Verfasserin ihren eigenen Mädchencharakter am gelungensten. Man kann einen wahren Trost aus diesem Buche schöpfen und sich ermuntern an den herrlichen Charakteren, die unter all den Gefahren und dem Kampfe mit der Welt doch den Gottesfrieden so treu in ihren Herzen bewahren. Dann folgten „Tagebuch eines armen Fräuleins“, „Rückerinnerungen aus einem Mädchenleben“ und ihr erster Roman „Johann von Kamern“, welche drei den 5. Bd. der Ges. Schr. (1859) füllen, „Die alte Jungfer“ und „Der Vormund“ (7. Bd. der Ges. Schr., 1859). Mit ihrem letzten und reifsten Werke „Elisabeth. Eine Geschichte, die nicht mit der Heirat schließt“ (II, 1858; Ges. Schr. 8. u. 9. Bd.) hatte sich Marie N. der Frauenwelt zugewandt. In dieser Familiengeschichte erging sie sich von vorn herein ganz frei; davon zeugt, bei aller wohl im Auge behaltenen festen Schürzung, der Reichthum und die Freiheit in der Behandlung der Details, überhaupt die echt epische Breite, die sich dem Zeitmaße nach über ein volles halbes Jahrhundert erstreckt. Als das Eigentümliche der Erzählung erscheint der innere abgeschlossene Blick über das ganze Leben. Und aus dem reifen Blicke, welcher nicht mehr am Einzelnen hängt und darum doch der warmen Liebe nicht entbehrt, entspringt dann der eigene Humor, der feine taktvolle Frauenhumor, welcher den Bildern Reiz und Würze gibt. Der Erfolg dieser Erzählung war ganz ausgezeichneter Art. Sie erlebte bis jetzt 14 Auflagen und ist in sämtliche Sprachen, von denen man es irgend erwarten kann, übersetzt worden. Nach menschlichen Gedanken war Marie N. mit diesem Buche erst in die ihr eigenste Weise eingetreten, hatte sich eben volle Bahn gebrochen. Noch stand sie, da bisher eines ihrer Werke das andere eigentümlich überboten, vielleicht nicht auf dem Gipfel; aber „Elisabeth“ sollte auf Erden ihr „Schwanengesang“ sein. Am 22. Dezember 1857 schied sie aus dem Leben. Nach ihrem Tode erschienen noch aus ihrem Nachlasse „Tagebuch einer Reise nach der Provence, Italien und der Schweiz“ (Ges. Schr. 10. Bd., 1860) und zwei Jugendnovellen „Familienskizzen.“ „Herr und Kammerdiener“ (Ges. Schr. II. Bd., 1860); außerdem gab ihr Gatte im Verein mit Ludwig Erk „Hundert Lieder, geistlich und weltlich, ernsthaft und fröhlich, in Melodien von Marie N. und mit Klavierbegleitung“ (1865) heraus. – Philipp N., der 1861 in den Adelstand erhoben wurde, starb am 16. August 1872 zu Luzern auf einer Reise ins Bad Engelberg, das er wegen seines Brustleidens besuchen wollte. Auch er hatte sich in jüngeren Jahren als Dichter versucht. Seine „Fünfzig Gedichte, Probesammlung“ (1839) und „Noch fünfzig Gedichte. Der Probesammlung anderes Heft“ (1841) überraschen durch den frischen, einfachen und innigen Ton seiner Lyrik und lassen bedauern, dass er diesen Sammlungen nicht noch weitere folgen ließ. Als meisterhafter Nachbildner hat sich Philipp N. bewährt in „Hundert drei Lieder [des Pariser Chansonnier P. J. de Béranger] gibt hier im Deutschen wieder mit seinem wohlgemeinten Gruß Philipp Engelhard Nathusius (1839).
Tagebuch eines armen Fräuleins
Zur Unterhaltung und Belehrung für junge Mädchen.
Plettenhaus, den 2. April.
Liebes Kind, sagte heute meine Tante zu mir, bilde dir nie etwas darauf ein, daß du ein Fräulein von Plettenhaus bist; vergiß es aber auch nie! Trinchen in ihrer Nähecke räusperte sich, die Tante warf ihr einen strengen Blick zu und fuhr fort: Dein seliger Großvater war erster Minister und wenn dein seliger Vater – nicht den Engel geheiratet hätte, – platzte Trinchen dazwischen. Jungfer Katharine, Sie schweigen! sagte die Tante. Trinchen weiß, was die »Jungfer Katharine« zu bedeuten hat, und begnügte sich mit einigen Seufzern. Die Gute! Je höher die Tante thut und in die Luft wächst, je mehr beugt und fügt sie sich, bis sich plötzlich ihre Zunge teilt und sie mit Flammenworten redet. Wie dann der Tante Größe verschwindet, ihre Worte verwehen, wie Nebel vor den reinen Sonnenstrahlen. Ich dachte darüber nach und hörte nicht was die Tante sprach, sie ward böse und sehr feierlich: – Rang und Stand sind Gottes Ordnung. Die Rose muß ihm als Rose blühen, das Gänseblümchen als Gänseblümchen. Es würde der Rose schlecht anstehen, sich hinabzubeugen zum Schmutz des Angers, und das Gänseblümchen wird sich vergebens bemühen, als eine Rose zu strahlen. So sprach die Tante und noch mehr; als sie schwieg, sang Trinchen leise:
Du bist ein guter Hirt, Und wirst es ewig bleiben, O Jesu gieb, daß ich Dies mög' von Herzen glauben; Laß hören deine Stimm, Daß ich davon erwach Und als ein Schäflein dir Gehorsam folge nach.
Ich kenne deine Stimm Und hör der Fremden keinen, Nie meine Seele nicht, Sich aber selber meinen! Der Mietling hält ohn dies In Not bei mir nicht Stand, Drum folg ich deiner Stimm Und deiner Hirtenhand.
O! daß ich möcht auf dich, O Jesu, mein Anliegen Stets werfen, und in dir Allein mein Herz vergnügen. Hingegen stille sein, Und sorgen ferner nicht. Weil du als Hirte weißt, Was deinem Schaf gebricht.
Bei diesen letzten Worten rannen der Tante die Thränen über die Wangen. Sie griff nach dem Taschentuch, ihre Finger waren so steif, sie konnte kaum zu den Thränen kommen. Ich kniete vor sie hin und mußte weinen, und Trinchen verließ schnell das Zimmer. Die arme Tante! Schmerzen quälen sie Tag und Nacht. Dazu die Sorge um meine Zukunft. Ich weiß nicht, was sie aus mir machen will. O du lieber Herr, sei auch ihr ein treuer Hirt, nimm die vielen Schmerzen von ihr und die Sorgen, gieb ihrem Herzen Glauben, laß es stille sein und sorgen ferner nicht, weil du als Hirte weißt, was allen uns gebricht.
Den 6. April.
Ich war schon früh auf, stand am offnen Fenster, die Luft so lau, und Duft und Tau und Frühling unter mir. Alles war noch still, nur Jakob stand unten im Garten am frischen braunen Grabeland. Ich lief ihm zu helfen, sein Rücken scheint mir seit einiger Zeit sehr steif und der Spaten schwer in der Hand; wenn es ihm nur nicht wie der Tante geht. Jakob wollte meine Hilfe nicht annehmen, er sah oben nach dem Fenster. Sie schlief noch, und Sünde ist es nicht, wenn ich ihm helfe; habe ich als Kind meinen Garten graben dürfen, darf ich jetzt ein größeres Stück. Er litt es aber nicht eher, als bis ich Handschuh angezogen und den großen Hut aufgesetzt hatte. Das war eine Luft! ich habe zweimal so flink gegraben als Jakob, dazu sangen die Amseln und Finken im Fliederbusch und die Lerchen hoch in der Luft, und am Himmel zogen lichte Wölkchen. Die Veilchen sahen dunkel aus dem frischen Grün, und die Vergißmeinnicht lichtblau und rosenrot im schimmernden Tau. Den Kastanienbaum aber über uns haben wir wachsen sehen; erst leuchteten die dicken braunen Knospen gegen den tiefblauen Himmel, es war uns als hörten wir die Käpslein springen und fünf goldene Blüthen dehnten sich der warmen Sonne entgegen. Wenn ich nur wüßte, warum Trinchen jetzt trauriger ist als im Winter, sagte ich zu Jakob; ich kann mich vor Lust nicht lassen; kann es irgendwo schöner sein als bei uns? Jakob schüttelte traurig den Kopf. Unser Haus ist nicht zu groß und nicht zu klein, fuhr ich fort, es liegt auf einem Hügel und ist doch nicht viel daran zu klettern. Dort oben ist Schatten und Buchenwald und hier vorn Wiesen und Sonnenschein. Es ist einsam hier, man hört nur Mücken und Bienen summen, und doch sieht man vom Dorf dort die Schornsteine rauchen und hört in der Nacht den Wächter singen.
Das ist's gerade, unterbrach mich Jakob, wir hängen nun gar zu sehr an diesem Stücklein Land! Aber unser Kapitälchen schmilzt, liebes gnädiges Fräulein, der Garten aber wird nicht größer, und, Kindchen, du gebrauchst immer mehr. – Nahrungssorgen? stotterte ich erschrocken. – Haben wir! ja, fuhr Jakob fort, das alte Fräulein darf es nicht wissen. Meine Meinung ist nun die: – Jakob! rief Trinchen am Küchenfenster. Er wischte sich über den Mund und schwieg. Ich werde es aber noch erfahren.
Den 8. April.
Ich saß mit der Tante am offnen Fenster, es war dämmerig, der Abendstern stand am lichten Himmel, der Mond stieg voll und golden über dem feinen Buchengezweig hinauf, der Kinder Lärmen tönte vom Dorf herüber, mir war zu Mut, ich weiß nicht wie. Ich hatte nicht Ruhe in der Stube, ich hätte mögen in den Frühlingsabend hinaus, mit den Kindern lärmen, oder allein unter der Buche sitzen und nach dem Abendstern schauen. Die Tante war erst schweigsam. Du wirst wahrlich dem Trinchen ähnlich, sagte sie dann. Das freut mich! entgegnete ich. Die Tante aber sah wehmütig aus, mir fiel ein, wie sie vor einiger Zeit erzählte: Trinchen hätte es nie weiter als zu einer Zofenschönheit gebracht. Die Tante träumt wachend und schlafend von ihrer Vergangenheit, vom Leben am Hof. Sie ward bewundert und gefeiert, alles ist vorbei. Sie mochte in mir eine zweite Louise von Plettenhaus sehen, sie erzieht daran so lange. Bewege dich nicht so schnell, sagt sie oder: Sage nicht immer, was du denkst, oder: Wünsche nicht immer, etwas vorzunehmen. Nachdem sie mich jetzt eine Zeit lang sinnend betrachtet hatte, sagte sie ganz leise: Das wäre die einzige Rettung! Ich merkte, daß es nur laut gedacht war, sie thut das seit einiger Zeit, besonders wenn sie den Tag viel Schmerzen hatte, und müde und abgespannt ist. Liebe Lulu, sagte sie dann laut, faltete die Hände und schaute nach dem Himmel: ich wünsche und bete jetzt nur, daß du Hofdame wirst. Ich küßte ihr die Hand. Wenn die Liebe zu mir ihr nur nicht so viel Sorge machte. Und warum sorgt sie sich? Ich bin so zufrieden, ich möchte nichts, nichts weiter, als leben wie ich jetzt lebe. Nur eines möchte ich, dem alten Jakob eine neue Livree schenken. Ich verschwieg ihr, daß mir Trinchen erst gestern sagte, ihr einziges Gebet sei, daß ich nicht Hofdame würde, und auch dem Onkel Hofmarschall nicht in die Hände fiele. So beten sie beide für mich, was wird der liebe Gott wohl ihm?
Den 9. April.
So schöne Frühlingstage lassen einen nicht ruhen im Haus. Trinchen klagt über mein Zeitverthun. Doch stehe ich früh auf; Trinchen hatte heut zu plätten, Jakob war bei dem Kartoffellegen, ich half ihm die Stücken in die Löcher werfen. Wir säen jetzt, wer weiß, wie es aussieht zur Ernte, sagte er seufzend. Der Himmel wird wie jetzt über uns sein, und der liebe Herr auch, entgegnete ich. Der Alte wird mich bald mit seinen Seufzern ärgerlich machen. Er wischte sich mit der Hand über den Mund, ein Zeichen, daß er schweigen will. Es that mir fast leid, es wäre jetzt gute Gelegenheit gewesen, seine Geheimnisthuerei zu erforschen. Doch war der Morgen zu schön und ich zu fröhlich. Ich ging, für die Ziege Futter zu holen. Oben an der Weißdornhecke standen die blauen Veronika fußhoch, ich machte mir eine hohe blaue Krone und die Liese hat sich mit meinem Kopfputz ein Gütchen gethan, sie geriet so in Eifer, daß mir fast um meine Locken bange wurde.
Den 10. April.
Ich war gestern sehr traurig, auch heut morgen. Trinchen fragte mich, ob mir so ein Lungerleben gefallen könne? Was soll ich aber thun? Die Tante versichert, ich habe so viel gelernt, um den höchsten Ansprüchen zu genügen. Ich machte gern zuweilen eine englische oder französische Ausarbeitung oder eine Tapisseriearbeit, es fehlt mir an Papier und an Wolle und Kannevas. Die Tante findet beides unnütz, Trinchen auch. Was verlangt sie nur? Ich übe täglich zwei Stunden auf dem Klavier, und zeichne auch, außerdem weiß ich nichts vorzunehmen, die Tante versichert, in unserem Stande sei das nicht anders. Trinchen schüttelte den Kopf. Sollt' ich mit an Trinchens Chemisettes nähen? Für wen sind die? Für irgend einen Vetter? – das würde sich nicht schicken.
Den 11. April.
Ich ging mit dem Strickzeug am Bach entlang. Unten auf dem Anger war Gänseriekchen mit ihrer ganzen Gesellschaft. Wie die weißen stattlichen Mamas so eifrig mit einander parlierten, und wie die weichen goldenen Gisselchen so geschäftig an den weißen Blümchen und grünen Gräslein herumputzten. Gänseriekchens Rufen und Schreien klang recht häßlich dazwischen. Sie beklagte sich, wie die Tiere so unartig seien, seitdem ihr Hund gestohlen ist, sie lief von einem Ende zum andern, bald sollten sie dort nicht fressen, bald nicht in den Kot gehen, und während sie für ihre Gänsekinder so große Sorge hatte, kümmerte sie sich nicht um die eigenen, die gar schmutzig am Bache lagen. Warum hast du deine Zöpfe nicht glatt gekämmt und warum hast du dich nicht gewaschen? fragte ich das älteste Mädchen. Sie sah mich sehr dumm an, und ich glaube, in ihrem Gesichte war zu lesen: warum soll ich mich waschen, und kämmen? Ich ärgerte mich über das Mädchen, denn das kleine Schwesterchen, das neben ihr auf dem Rücken lag, sich nicht allein aufrichten konnte, ließ sie ruhig weinen, und plätscherte gleichgiltig mit den Füßen im Bach. Ich richtete das Kleine auf, es sah entsetzlich schmutzig aus, ich wusch ihm die Hände und Gesicht und strich ihm das Haar glatt, da wurde es allerliebst. Das große mußte sich in den Bach sehen, wie es zottelig aussah, es mußte sich auch waschen und die Zöpfe glatt streichen, und dann wieder sehen, wie es nun hübsch aussah. Es lachte mich jetzt freundlich an. Weißt du nun, warum man sich waschen und kämmen muß? fragte ich wieder. Wenn es nicht blöde war, hätt es gewiß gesagt: Weil es gut aussieht. Ich freute mich, aber ich muß gestehen, daß es mich ekelte bei der Arbeit, auch könnt ich mich nicht entschließen, mein Taschenkämmchen dazu zu nehmen. Das Mädchen hat mir versprochen, sich und das Schwesterlein morgen früh zu waschen und zu kämmen.
Den 12. April
Sie hat es doch nicht gethan und sah so schlimm als gestern aus. Ich hielt ihm eine Strafpredigt und sagte auch Rieken, warum sie die Kinder mehr verwildern lasse als die Gänse. Rieke sang ein Klagelied, wie die Kinder sich so beschmutzen und das Zeug vom Leibe reißen, und sie gar nicht Zeit genug habe, ihre Wildheit zu bändigen. Die Große könnte schon stricken, sagte ich, sie thut den ganzen Tag nichts, und Müßiggang ist aller Laster Anfang. O dazu ist das Mädchen zu dumm, entgegnete Rieke, sie begreifts im Leben nicht, es steckt gar kein Menschenverstand in ihr, Gott sei's geklagt, die Kinder sind dümmer wie die Tiere. Ja Fräulein, die Tiere sind nicht dumm, die Große mit den schwarzen Flügeln kennt mich und versteht jedes Wort. So ähnlich sprach Rieke mehr, ich ließ sie ausreden und machte die Menschenkinder rein und glatt, und nahm heut auch meinen Taschenkamm. Dann habe ich zwei Nadeln aus dem Strickzeug gezogen und machte mit dem Mädchen einen Versuch zum Stricken, ich glaube gewiß, sie würde es lernen. Das sollte mich gar zu sehr freuen. Als ich nach Hause kam, war die Tante sehr ungehalten über meine langen Wanderungen. Trinchen bat für mich: Wandern durch Wiese und Wald ist ihre Jugendfreude, sie hat sonst wenig hier. Die Tante schwieg und gab damit die Erlaubnis zu ferneren Wanderungen. Aus Liebe zu mir thut sie es, sonst möchte sie mir gern vornehmere Zerstreuungen anbieten.
Den 18. April.
Hinter dem alten Gewächshaus habe ich jetzt meine Schule eingerichtet. O, es ist sehr hübsch. Dortchen lernt stricken und die kleine Liese lernt artig sein, und dazu lernen sie beide schöne Verse. »Ich bin klein, mein Herz ist rein, niemand soll drin wohnen als Herr Jesus allein.« So haben sie beide heute gelernt. Dem Dortchen erkläre ich, was ein reines Herz sei, sowie die Hände und das Gesicht könnten rein und schmutzig sein, so könnt es auch das Herz. Vor den einfältigen Kindern darf ich auch in meiner Einfalt reden, und ich weiß wohl, daß der Herr dort oben kann meiner Einfalt Kraft geben. O, wenn ich doch den Kindern helfen könnte!
Den 20. April.
Meine Schule ist bis zu sechsen angewachsen. Zwei Mütter brachten mir selbst ihre Kinder. Die Tante findet es sehr herablassend von mir, Trinchen lobt mich. Aber nicht deswegen freut es mich allein, ich fühle mich nie so wohl und freudig. Die Kinder waren zwei Stunden bei mir, zugleich nähte ich an Trinchens Chemisettes. Nachmittag habe ich geübt, gezeichnet, im Hause geholfen, und kam erst spät zu meinen Wanderungen. Trinchen, das Lungerleben soll aufhören, sagte ich. Mit Gottes Hilfe, Amen, entgegnete sie. Die Tante ging früh zu Bett, Trinchen saß mit mir unter der Buche. Liebe Lulu, du hast bis jetzt noch wenig Lust zu nützlichen Beschäftigungen gehabt, sagte sie. Ich schwieg. Sie hatte wohl recht, mir war es nie angenehm, lange bei einer Arbeit zu sitzen; die Tante sagt zwar, ich habe es nicht nötig, auch thut Amtmanns Adelheid noch weniger als ich. Das letzte sagt ich Trinchen. Ja wohl ists betrübt, daß die meisten jungen Mädchen nichts thun, daß so viele junge Kräfte vergebens in der Welt sind. Denke dir, auf welch ein Heer von Nichtsthuern die liebe Sonne scheint. Mir ward bange bei diesen Worten, ich mußte mir gestehen, daß ich ein Mitglied dieses Heeres sei. Der Herr hat jedem jungen Mädchen ein reichlich Pfund gegeben, fuhr Trinchen fort, sie könnten herrlich damit wuchern, aber sie vergraben es tief und lassen die Nesseln und Dornen der Eitelkeit und der thörichten und unreinen Gedanken darüber wuchern. Der Herr wird sie einst zur Rechenschaft ziehen. Trinchen sprach noch mehr, ich will es in meinem Herzen behalten. Sie sagte auch: Daß Mädchen, die in der Welt leben und mit der Welt leben, ihre Zeit verthun und verschlafen, wie die thörichten Jungfrauen, das ist nicht zu verwundern; wenn es aber Mädchen, die den Herrn kennen und ihn lieben und ihm dienen möchten, den thörichten Jungfrauen nachthun, ist es zu verwundern und sehr betrübend. Trinchen ging fort und ich mußte weinen. Was habe ich denn gethan dem Herrn zu Liebe? Nichts, gar nichts. Ich bin des Morgens aufgestanden und habe mich gefreut und gedankt, daß ich lebe und daß ich glücklich bin, ich habe auch gesagt: ich bin zu geringe aller Barmherzigkeit; aber ich habe nichts gethan, ich habe nur gedacht, wie ich den schönen Tag möchte schön hinbringen, und wenn es anders ging, wie ich dachte, war ich verdrießlich, konnte auch unfreundlich sein gegen die, die mich lieben. Ich danke dir, lieber Herr, daß du mir die Augen aufgethan, und nun gieb mir Kraft, dir zu dienen. Aber wie? In der Nacht wacht ich auf, ich sprach mit Trinchen. Wie kann ich nur ein anderes und nützliches Leben führen? fragte ich. Kind, sorge dich darum nicht, für dich wird der Herr selber sorgen. Er wird dir ein Kräutlein schicken, daß heißt: Muß und Not. Ich verstand sie nicht, doch sollt ich in der Nacht nicht weiter sprechen. Trinchen will mich demütig machen, weil sie fürchtet, die Tante macht mich hochmütig; sie hat es aber gewiß nicht nötig. Die Geschichte mit dem Kleide wird ihr im Sinne liegen, ich war sehr unfreundlich, aber ich habe mir vorgenommen, ich will mit allem zufrieden sein, was sie mir auch anziehen mag.
22. April.
Der Frühling wird immer prächtiger, alles strebt und treibt der Sonne entgegen, die grünen Erbsenpflänzchen stehen wie die Soldatenreihen auf dem braunen Boden, Gesträuch und Unterholz schimmert wie in lichter grüner Seide, und die Knospen werden sich nicht mehr lange halten können. Jakob war unzufrieden mit meiner Kolonie am alten Gewächshaus; seitdem Lieschen und der kleine David ihm die Sperlinge von den Saatbeeten verjagen müssen, ist ers zufrieden, ja fürstlich will er die Kinder belohnen.
Den 26. April.