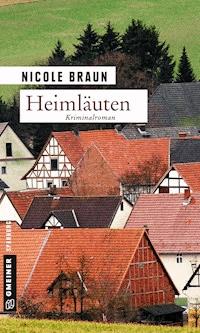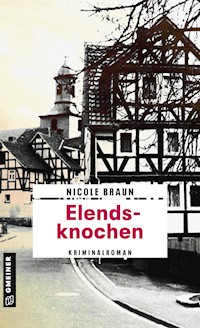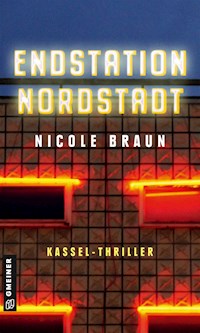Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Landarzt Edgar Brix
- Sprache: Deutsch
Dem jüdischen Arzt Edgar Brix fällt eine Fotografie aus dem Jahr 1945 in die Hände: Fünf Bergarbeiter feiern das Kriegsende. Drei von ihnen starben in den vergangenen Wochen an Herzversagen, zwei sind noch am Leben: Der letzte in der Reihe ist Albrecht Schneider. Edgar Brix glaubt schon lange nicht mehr an einen Zufall, doch Albrecht tut die Befürchtungen seines Freundes als Hirngespinst ab. Aber was ist, wenn Edgar Brix doch Recht behält?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicole Braun
Elsternblau
Der zweite Fall für Edgar Brix
Zum Buch
Herzlos Aus heiterem Himmel sterben einige alte Bergarbeiter in Wickenrode an Herzversagen. Als Landarzt Edgar Brix eine Fotografie findet, die die Pensionäre in der Reihenfolge ihres Ablebens zeigt, kommen ihm Zweifel an der Todesursache, die er selber diagnostiziert hatte. Erklären die Untersuchungsergebnisse des Grundwassers, die von den Behörden unter Verschluss gehalten werden, die seltsamen Todesfälle oder mordet hier jemand mit System? Mit ihren Nachforschungen treten Landarzt Brix und Pensionär Schneider einigen Behördenvertretern mächtig auf die Füße. Der Wirbel, den sie veranstalten, ruft wieder einmal Kommissar Matthias Frank auf den Plan, der von den Alleingängen endgültig genug hat. Edgar Brix steht mit seinem Verdacht allein da und selbst Albrecht Schneider findet seine Serienmordtheorie abenteuerlich. Bis er einsehen muss, dass auch für ihn die Luft langsam dünn wird, denn der letzte Überlebende auf dem Foto ist er selber.
Nicole Braun, geboren 1973 in Kassel, ist fest verwurzelt in Nordhessen. Mit ihrer neuen Thriller-Reihe hat sie einen Gang hochgeschaltet, bleibt jedoch ihrer Heimat und deren jüngerer Vergangenheit treu. Die studierte Betriebswirtin lebt seit 2014 vom Schreiben. Sie unterrichtet Storytelling, betreibt Schreibwerkstätten und gibt musikalische Lesungen.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Butterfly Hunter / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-5292-5
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Wickenrode, März 1945
»Melde: der Fasshauer kricht schon wieder ’nen Koller!«
Steiger Manfred Kuhfuß salutierte zackig und stand stramm wie eine Eins. Gott sei Dank hielt der Helm auf dem Kopf vom Kollegen Fasshauer den hämmernden Schlägen gegen die Grubenwand stand.
Obersteiger Friedrich Lenz wunderte sich gerade einmal die Dauer eines Wimpernschlages über die seltsame Art der Meldung und verfolgte ungerührt, wie Georg Fasshauer mit dem Kopf gegen die Grubenwand schlug. So etwas brachte Lenz schon seit Längerem nicht mehr aus der Fassung. Unter normalen Umständen nahm er sich hier im Berg nicht viel Zeit für Grübeleien; es mussten Entscheidungen getroffen werden, erst recht, wenn einer durchzudrehen drohte. Doch was war schon normal in diesen Tagen? Er schüttelte resigniert den Kopf. Mehr als einmal hatte er den Herrn Baron darauf hingewiesen, dass es keine gute Idee sei, Georg Fasshauer wieder unter Tage einzusetzen. Doch als Lenz zuletzt einen geeigneteren Einsatzort für den Kriegsversehrten forderte, hatte der Bergwerkseigner seine Bedenken in den Wind geschlagen.
»Da hat sich der Mann um das Vaterland verdient gemacht, und dann soll ich ihn in die Schreibstube abschieben, nur weil er nicht mehr ganz intakt ist?«, hatte der Herr Baron in der ihm eigenen etwas gestelzten Sprache zu seinem Obersteiger gesagt.
Das war nun das Ergebnis. Der Fasshauer konnte unmöglich alleine aus dem Stollengewirr über Tage gehen, und Lenz musste schleunigst eine Entscheidung treffen, um den verwirrten Kerl aus dieser misslichen Lage zu befreien.
In den letzten Monaten verließen mehr zitternde Männer den Schacht als volle Loren. Friedrich Lenz war entnervt. Alles, was sich noch auf den Beinen halten konnte, musste ran in diesen Tagen. Die jungen kräftigen Männer waren an der Front oder tot. Eine Schande, diese Verschwendung.
Lenz starrte auf seinen Grubenplan. Jetzt hockte er hier, mit Greisen, die kaum noch aufrecht gehen konnten, oder Grünschnäbeln, die sich bei der kleinsten Gelegenheit in die Hosen machten, und sollte retten, was zu retten war. Jeden Tag standen absurdere Fördermengen auf seinem Plan, dabei schaffte er mit den frontuntauglichen Männern kaum noch die Hälfte. Allenthalben Gejammer, es reiche vorn und hinten nicht. Die Leute erfroren in ihren Häusern, während die Schornsteine der Fabrik im nahen Hirschhagen das kostbare schwarze Gold sinnlos in die Luft pusteten. Und wofür? Für Sprengstoff und Bomben, die nur noch mehr Leid brachten, nur noch mehr Tote und Witwen und Waisen. Friedrich Lenz war es so leid. Doch es half nichts: Jeden Morgen ein aufmunterndes Nicken des Herrn Baron zu Schichtbeginn musste genug sein, um einen weiteren Tag in diesem finsteren Loch zu überstehen.
Lenz wischte die trüben Gedanken beiseite. In einer Stunde wäre die Schicht der »alten Knochen«, wie die Konradi in der Schichteinteilung scherzhaft zu sagen pflegte, ohnehin beendet. »Du, der Möller, der Luschek und der Fasshauer, ihr verlasst den Stollen.«
Er erntete einen dankbaren Blick von Manfred Kuhfuß, der schon seit Stunden die Schaufel, mit der er die Kohle in die Lore schippte, kaum noch zu heben vermochte.
Friedrich Lenz fürchtete, seine Großzügigkeit noch zu bedauern. »Tut mir nur den Gefallen und drückt euch bis Schichtende irgendwo hinter dem Lorenlager rum. Hauptsache, der Grubenleiter sieht euch nicht, bevor die Schicht rum ist, sonst kann ich mir wieder was anhören.«
»So wird’s getan!« Manfred Kuhfuß salutierte erneut. »Glücke uf, Herr Obersteiger!«
Nur noch Verrückte, dachte Lenz. Dieser Krieg war mit Sicherheit verloren.
Georg Fasshauer schlug noch immer mit dem Helm gegen die Wand, bis Gustav Möller ihn fest unterhenkelte und ihn unsanft in eine Lore schubste.
Lenz sah zu, wie die vier Männer in Richtung Stollenmund verschwanden, dann senkte er den Blick im schummrigen Licht der Karbidlampe über die Pläne der Stollenanlage.
Der letzte Abschnitt, den sie in aller Eile in den Hirschberg getrieben hatten, war allenfalls unzureichend gesichert, das hatte er dem Herrn Baron schon mehrfach mitgeteilt und beim letzten Mal sogar auf einer Aktennotiz bestanden. Doch noch nicht einmal der einflussreiche Bergwerkseigner war in der Lage, sich gegen den Druck der Heeresleitung zu wehren, und beugte sich den unmöglichen Forderungen, die ohne Skrupel täglich weitere Verluste in Kauf nahmen. Erst vor zwei Wochen war ein Kumpel ums Leben gekommen, als ein Stollenende einbrach. Doch was galt schon ein alter Bergarbeiter, während an der Front Abertausende ihr Leben ließen? Lenz starrte verzweifelt auf die Pläne. In diesen Tagen war Braunkohle mehr wert als ein Menschenleben, und sogar die edlen Vorsätze des Barons hatten gelitten. Immerhin steckte an dessen Revers noch immer kein Abzeichen der Partei, und das rechnete Friedrich Lenz ihm hoch an.
Er wischte sich schwarzen Schweiß aus dem Gesicht, rückte den Helm gerade und studierte weiter die Pläne.
Der flackernde Atem von Georg Fasshauer beruhigte sich, als die ersten Sonnenstrahlen am Ende des Stollens auftauchten.
Gustav Möller hatte sich redlich gemüht, ihn aus dem Berg zu schleifen, und so krochen die vier Männer wie die Maulwürfe aus dem Schatten des Stollenmundes. Endlich standen sie blinzelnd im grellen Licht eines klirrenden Märztages. Sie verharrten den Moment, bis das Tanzen der Sonnenflecken vor ihren Augen nachließ.
Obwohl sie alle nichts lieber getan hätten, als raus aus den Arbeitsklamotten, in der Waschkaue den Staub aus dem Gesicht waschen und ab nach Hause, hielten sie sich an die Anweisungen des Herrn Obersteiger. Sie hielten den Lenz zwar für einen studierten Schnösel, aber er hatte sich ihren Respekt verdient, denn er tat jeden Tag aufs Neue sein Möglichstes, um alle Kumpel heil bis Schichtende durchzubringen. Jeder, der nur einen kurzen Blick auf die lahmen und krummen Kerle werfen konnte, die sich da tagtäglich in mehreren Schichten in den Stollen quälten, wusste, dass die Braunkohle vom Hirschberg nicht mehr kriegsentscheidend war. Und Friedrich Lenz sprach diese Tatsache, so oft es ihm möglich war, aus, auch wenn er damit nicht das Geringste änderte. Und deswegen taten sie ihm den Gefallen und verzichteten nun schweren Herzens darauf, ihre müden Knochen auf dem kürzesten Weg nach Hause zu schleppen.
Georg Fasshauer stöhnte unter dem kräftigen Druck von Gustav Möllers Armen. Die Kriegsverletzung an der Schulter schmerzte.
»Kann ma jemand anfassen? Hä wird alszus schwerer.« Der Möller ging ganz schief unter der Last.
»Kommt, wir setzen uns hinnern Schuppen. Da sieht uns kinner. Es hot nit zufällig einer ein Kartenspiel einstecken?«, fragte Manfred Kuhfuß.
Piotr Luschek zog einen zerfledderten Stapel Karten aus seiner Brusttasche: »Aaber natierrlich. Ist immer bei Piotr in die Daasche.«
»Na, was ein Glücke. Da können wir die Stunde gut rumbringen, was?«, mischte sich Gustav Möller ein.
Hinter einem überdachten Lagerplatz fanden die Männer ein geschütztes Plätzchen und ließen sich ächzend nieder. Ein altes Fass war schnell herangerollt. Die verbeulte Unterseite gab einen hervorragenden Spieltisch ab.
Piotr Luschek teilte die Karten aus, während Manfred Kuhfuß sich dazu durchrang, den Inhalt seines Flachmanns mit Georg Fasshauer zu teilen. Er musste bemerkt haben, dass der die Karten vor Zittern kaum festhalten konnte. Vorsichtig flößte er ihm einige Schlucke ein. »Geht’s widder?«
Fasshauer atmete tief durch, dann sagte er: »Ich weiß auch nit, was da über mich kimmet. Aus heiterem Himmel wird alles schwarz, und ich honn das Gebrüll vom demm Flackgeschütz in den Ohren, als stünd ich geradewegs daneben.«
Gustav Möller schaute ihn mitleidig an. »Kannst froh sinn, dass de heile uss Minsk russgekommen bist. Damitte hättste nit ernsthaft rechnen dürfen.«
Alle Männer nickten und ihre Mienen verfinsterten sich. Jeder von ihnen kannte einen, der nicht nach Wickenrode heimkehrte, als die britischen Bomber ohne Vorwarnung Kassel in Schutt und Asche legten.
Piotr Luschek unterbrach das betretene Schweigen »Häärz liegt auf. Guustav, du bist draan.«
Gustav Möller warf einen Blick auf sein Blatt und zog die Lippen kraus. Er hielt inne, senkte die Karten und schaute die drei anderen Männer an. »Hobt ihrs au gehört, dass de Amis schon kurz vor Melsungen stehen? Wartet’s ab, kinne paar Wochen und die machen hier alles platte.«
»Biste sicher? In der Wochenschau honn se gesprochn, dass die Front gehalten wird und wir de Amis noch alszus zurückeschlagen.«
Drei Augenpaare wanderten zu Manfred Kuhfuß und sahen ihn an, als habe er den Verstand verloren.
Gustav Möller sagte: »Spreche moh, biste jetzte auch demm Wahnsinn anheim gefallen? Das ist doch alles nur dummes Geschwätzer. Mir können dankbar sinn, wenn die Amis um unser kleines Dorfe ’nen großen Bogen machen, weil es hier nichts zum holen gibbet.«
Piotr Luschek nickte. »Goott sei Daank kommen die Amerikaner und niicht die Ruussen.«
Georg Fasshauer zuckte zusammen. Immer wenn er »Russen« hörte, fiel es ihm schwer, nicht in diesen Zustand abzutauchen, der ihm die Erinnerung erträglich machte. Wenn das Dröhnen in seinem Schädel die Qual der Erinnerung übertönte, beruhigte das auf seltsame Weise seine Nerven. Gegenwehr war zwecklos – ein winziger Auslöser, und sein Kopf wurde geradezu magisch von allem angezogen, was hart genug war, um die Gedanken zum Schweigen zu bringen. Eingeschlossen im Stollen genügte der Hauch von Staubgeruch, so wie er ihn im Schützengraben in der Nase gehabt hatte, als um ihn herum die Bomben einschlugen, während das unerträgliche Geschrei der Kameraden erstarb. Neben ihm landeten die abgerissenen Körperteile wie Schneeflocken, als ein Splitter sich in seine Schulter bohrte und nur um Haaresbreite die Lunge verfehlte. Die folgenden Wochen im polnischen Lazarett waren ein Zuckerschlecken verglichen mit der Front, aber noch immer war er umgeben vom Gewimmer der Verletzten. Es wimmelte von Läusen und Wanzen, und der Gestank von faulendem Fleisch hing ihm seitdem in der Nase. Seit seiner Rückkehr hatte er keine Metzgerei mehr betreten, ohne dass ihm speiübel geworden wäre. Er schüttelte sich und warf einen sehnsüchtigen Blick auf den Flachmann vom Kuhfuß, doch der hatte mittlerweile die Runde gemacht und war leer.
»Du bist!«, holte ihn Gustav Möller aus den trüben Gedanken.
Ohne lange zu überlegen, legte Georg Fasshauer wahllos eine Karte auf den Stapel. »Spreche moh, Piotr, du bist doch selber aus dem Osten. Musst du nit zu deinen Landsleuten halten?«
Der Luschek schüttelte den Kopf. »Daas sind nicht meine Landsleute. Daas sind Schlächterr in Uunifoorm. Besserr die Amerikaner. Die haaben wenigstens Schokolade.«
SCHOKOLADE. Die bloße Erinnerung erzeugte ein Quartett aus knurrenden Mägen. Gustav Möller zog eine Blechbüchse aus seinem Rucksack und warf einen skeptischen Blick hinein. Zwischen zwei dünnen Brotscheiben glänzte eine Schicht guter Butter. Dieser Tage mehr, als er beim Blick in die Brotdose erwarten durfte. Er biss in das trockene Brot und kaute gelangweilt darauf herum.
»Wie lange müssen wir dann noch hier rumhocken? Ich will endlich uss denn Klamotten raus un heim«, beschwerte sich Georg Fasshauer. Sein Kopf bedankte sich für die Schläge gegen die Grubenwand mit einem dröhnenden Schmerz. Ganz gleich, wie sonnig dieser Märztag auch daherkam, hier im Schatten des Lorenlagers zog es wie Hechtsuppe. Die Kälte war ihm bereits unter die feuchte Kleidung gekrochen und er schlug die Arme um den Körper.
»Noch eine Runde Karten, dann können wir uns langsam onne machen.« Gustav Möller erntete allenthalben Zustimmung, und Piotr Luschek mischte erneut die zerfledderten Karten.
Während die Männer noch ihre Blätter auf der Hand sortierten, hob Georg Fasshauer den Kopf und sah sich um. Etwas bereitete ihm Unbehagen. Seine Augen tasteten nun schon zum wiederholten Mal den mannshohen Stahlzaun ab, der das Bergwerksgelände umgab und auch das Lorenlager vom dichten Wald trennte. Jenseits des Zauns warfen die Bäume dunkle Schatten, sodass sein Blick bereits das dritte Mal über dieselbe Stelle geglitten war, bevor eine winzige Bewegung ihn verharren ließ.
Er musste sehr genau hinsehen, dann erst erkannte er, was ihn so irritiert hatte: Zwei Augenpaare fixierten die Männer von der anderen Seite des Zaunes und beobachteten sie regungslos. Er stieß seinen Ellenbogen in die Seite von Gustav Möller, ohne den Blick von der Stelle am Zaun abzuwenden, von wo aus die vier Männer beim Kartenspiel beobachtet wurden.
Gustav Möller nahm die Spannung wahr, die von Georg Fasshauers Körper Besitz ergriffen hatte, und folgte ohne weitere Aufforderung seinem Blick. Piotr Luschek und Manfred Kuhfuß bemerkten, dass die beiden zum Zaun sahen, und drehten nun ebenfalls ihre Köpfe.
Scheinbar endlose Sekunden vergingen so. Die Männer starrten auf die beiden zerlumpten Gestalten, deren Finger sich dürr wie Reisig um das Zaungitter klammerten. Auf den rasierten Schädeln sprossen dunkle Haare, und aus den abgemagerten Gesichtern schauten riesige Augen aus tiefen Höhlen. Unwirklich wie Gespenster standen die zwei am Zaun, als die ältere der beiden ein Wort hauchte, das sich mit einer Nebelschwade in der kalten Märzluft verlor. Obwohl die Worte nicht bis zu Georg Fasshauer vordrangen, verriet der helle Klang ihrer Stimme, dass es sich um eine Frau handelte, auch wenn sonst nichts an ihrem ausgemergelten Körper in der Sträflingskleidung darauf schließen ließ. Noch einmal hauchte sie, nun etwas lauter, ein unverständliches Wort und ruckelte vorsichtig an dem Zaungitter, während sie sich hektisch umblickte.
Gustav Möller tauchte als Erster aus der Starre auf: »Wos spricht’s?«, wisperte er zu Piotr Luschek.
»Ist kein Rruusisch und kein Boolnisch. Ich verrstehe niicht.«
Die Männer sahen sich der Reihe nach an. Längst hatten sie alle die Karten abgelegt und sich zu den Frauen am Zaun umgedreht.
»Was solln wir denn jetzte machen?«, wisperte Manfred Kuhfuß so leise in die Runde, als habe er Angst, dass die Frauen, die bestimmt 30 Meter entfernt standen, ihn hören könnten.
Wieder wechselten die Blicke von einem Mann zum anderen, als die Frau am Zaun, nun jedoch deutlich hörbar, in die Richtung der Männer rief: »Heelfen, biitte«.
Georg Fasshauer erhob sich und ging einen Schritt auf die beiden zu, während die übrigen Männer stocksteif sitzen blieben und die Frauen anglotzten. Bereits nach wenigen Metern verharrte er und lauschte. Auch die ältere der beiden Frauen sah sich hektisch um.
Aus der Ferne gellten Geschrei und Hundegebell.
Georg Fasshauer ging noch einen weiteren Schritt auf die Frauen zu, doch da hatte die Ältere die Jüngere bereits am Kragen gepackt und davon gezogen. Das Mädchen stolperte völlig entkräftet hinterher. Als er bemerkte, dass beide Frauen barfuß waren, hatte sie das Dunkel des Waldes fast schon verschluckt. Er drehte sich zu den anderen Männern um und kratzte sich am Kopf. »Was machen wir denn jetzte?«
Manfred Kuhfuß guckte verständnislos. »Wos willste denn da machen?«
»Na hinnerher! Vielleicht gibbets ja noch was zu tun, bevor die über den Haufen geschossen werden.«
»Willste selber erschossen werden? Du host wohl’n Dachschaden!« Der Kuhfuß war aufgesprungen. Er schaute so unerbittlich drein, als verhinderte er zur Not auch mit Gewalt, dass der Fasshauer eine Dummheit beging.
Doch das erwies sich als unnötig: Im nächsten Augenblick hallten Gewehrsalven durch die Bäume. Die Männer zuckten zusammen.
Georg Fasshauer war kein Haarbreit davon entfernt, wieder in den Zustand abzutauchen, aus dem er gerade erst aufgetaucht war. Das war unerträglich. Er hatte das Bild förmlich vor Augen, wie die beiden Frauen von Gewehrkugeln getroffen durch die Luft flogen, weil ihre dürren Körper der Wucht der Geschosse nichts entgegenzusetzen hatten. Er presste die Hände auf die Ohren und schüttelte wie wild den Kopf: »Nein, nein …«
Dieses Mal war es Piotr Luschek, der aufstand und ihn drückte wie einen kleinen Jungen. »Ist guut. Aalles ist guut.«
»Aber wir können doch nicht hier sitzen und nichts tun.« Georg Fasshauer hatte den Luschek abgeschüttelt und starrte die Männer auffordernd an.
»Was willste denn tun? Setz dich hin und sei stille. Oder willste etwa vor der Wachmannschaft strammstehen?«, sagte Manfred Kuhfuß.
Georg Fasshauer schüttelte den Kopf. Auf eine Unterhaltung mit der SS konnte er gut verzichten. Womöglich hätte man sie noch der Fluchthilfe verdächtigt. »Die waren doch aus Hirschhagen, oder?«
»Ja sicher. Wo sollen die denn sonst her sinn? Und jetzt halt die Klappe und tu wenigstens so, als ob du Karten spielst«, sagte Gustav Möller wütend und zog Georg Fasshauer und den Luschek an den Ärmeln zurück zu ihrem Sitzplatz am Lorenlager.
Er behielt Recht. Wenige Augenblicke später schob sich ein Trupp aus fünf Männern in SS-Uniform durch den Wald auf den Zaun zu. Zwei von ihnen führten Schäferhunde, die kaum zu bändigen waren. Die Tiere winselten voller Jagdfieber und sprangen an das Zaungitter.
»Heil Hitler!«, salutierte einer der Uniformierten. »Sind hier gerade zwei Frauen vorbeigekommen?«
Georg Fasshauer schöpfte Hoffnung. Wenn er noch danach fragte, hatten die Schüsse die Frauen vielleicht verfehlt. Er stand erneut auf und ging ein paar Schritte auf den Zaun zu, die Anspannung der Kumpel hinter seinem Rücken lag wie eine Last auf seinen Schultern. Sag jetzt bloß nichts Falsches, dachte er bei sich und hätte geschworen, dass die anderen genau dasselbe dachten. Er hob lahm den Arm zum Gruß und nuschelte: »Hl Htler«. Gott, wie er sich dafür hasste, wenn er das tat, aber was blieb ihm übrig? »Wir honn niemanden gesehen. Was ist dann lose?«, fragte er so unbeteiligt wie möglich.
»Beim letzten Zählen vor dem Abtransport fehlten Häftlinge.«
»Abtransport?« Georg Fasshauer konnte sich die Frage nicht verkneifen.
»Wir räumen Hirschhagen, und die gehen nach Buchenwald.« Der junge SS-Mann spuckte neben sich auf den Waldboden.
Georg Fasshauer war schockiert: Der Schnösel hätte sein Sohn sein können und redete von den Häftlingen wie von Vieh. Nach Buchenwald, dachte er. Vielleicht wäre es für die Frauen besser, gleich hier, an Ort und Stelle, erschossen zu werden, das wäre doch weniger grausam als …, er brach den Gedanken ab. »Was heißt: Sie räumen?«
»In drei Tagen muss die komplette Fabrik evakuiert sein«, entgegnete der Uniformierte zackig.
Bevor Georg Fasshauer noch eine Frage anschließen konnte, kamen drei weitere Männer in Uniform aus dem Dickicht gelaufen. »Hier entlang!«, brüllte einer. »Sie sind da lang!«
Ohne Gruß verschwanden die Männer mit den Hunden so schnell im Wald, wie sie aufgetaucht waren. Noch einige 100 Meter weit konnten die Kumpel das Getrampel der Stiefel und das Gebell der Hunde hören, dann wurde es still.
In die Stille hinein schallten erneut Gewehrsalven.
Georg Fasshauer drehte sich traurig um. »Das war’s wohl«, sagte er, während er mit hängenden Schultern zu den anderen zurückging.
Die hatten die Unterhaltung nur bruchstückhaft mitverfolgen können und schauten ihn neugierig an.
»Die räumen Hirschhagen«, wiederholte er. Er mochte selber noch nicht glauben, dass der riesige Komplex in drei Tagen mit Mann und Maus verlassen sein sollte.
Manfred Kuhfuß schien es nicht anders zu gehen: »Wie jetzte? Die räumen die ganze Fabrik? Und die Lager?«
»Und die Lager. Die beiden Frauen honn beim Zählappell vor dem Abtransport nach Buchenwald gefehlt.«
»Nach Buchenwald?«, wisperte Gustav Möller.
Georg Fasshauer nickte. Es bedurfte keiner weiteren Worte.
»Aber es is doch nit möglich, dasse die ganzen Gefangenen mit Zügen abtransportieren. Nit in drei Tagen. Das ist schlichtweg nit möglich.« Manfred Kuhfuß schaute noch immer völlig ungläubig drein, als erwarte er, dass ihm jeden Augenblick jemand mitteilte, man habe ihm einen Bären aufgebunden.
»Ich honn au keinen Schimmer, wie se das anstellen wolln«, dachte Gustav Möller laut.
Georg Fasshauer hatte seinen Platz in der Runde wieder eingenommen und sagte tonlos: »Ich weiß, wie se das hinnekriegen.«
Alle sahen ihn stumm an.
»Die jagen die zu Fuß in die Arme der Angreifer. Wer’s schafft, hat Glücke gehabt, der Rest verrecket unnerwejens. So honn sie es bei der Räumung von Majdanek au gemacht.«
»Waarst du etwa dabey?«, fragte Piotr Luschek.
»Ne.« Georg Fasshauer schien nach Worten zu suchen. »Uf dem Heimmarsch durch Polen stapelten sich die Leichen rechts und links des Weges. Host ja die zerlumpten Gestalten gesehen, die kommen doch nit weit, erst recht jetzte bei der Kälte. Erschedemoh die Lager leer honn und die Beweise vernichten. Ich sprech’s dir, es dauert keine 24 Stunden, da findest du in keinem Haus mehr auch nur den Fitzel einer braunen Uniform.«
Gustav Möller packte seine Brotbüchse weg. »Ich glaub, mer honn jetzte lange genug gewartet und solltn zusehen, dass mer heimkommen. Ich könnt mir vorstellen, dass sich die Neuigkeiten schon rumgesprochen honn.«
Die vier stimmten den Vorschlag durch einen kurzen Blickwechsel ab, und Piotr Luschek sammelte die Karten ein. In angemessen bedrückter Stimmung machten sie sich auf den Weg Richtung Waschkaue.
Ihr Weg kreuzte den der Kumpel von der Spätschicht.
Einer von ihnen, Albrecht Schneider, blieb stehen. »Ihr seid aber früh dran heute. War was los?«
Die Männer sahen sich nacheinander an. Gustav Möller gab den anderen Dreien mit einem Handwedeln zu verstehen, dass sie schon vorausgehen sollten, dann antwortete er: »Nö, alles wie immer. Mir sind früher ruff, weils dem Fasshauer nit besonnersd gut ging.«
Georg Fasshauer deutete zur Erklärung mit dem Zeigefinger auf seinen Helm, dann wurde er vom Kuhfuß weiter gezogen.
Möller sagte noch etwas zum Albrecht Schneider, aber Georg Fasshauer war bereits außer Hörweite. Kurz vor der Waschkaue drehte er sich noch einmal um und sah, wie der Möller dem Albrecht Schneider etwas ins Ohr flüsterte, was diesen sichtlich verwirrte. Doch ganz egal, was es war, er hatte genug für diesen Tag. Ihn zog es nur noch nach Hause zu seiner Emmie und einer Riesenportion Steckrübensuppe.
Albrecht Schneider blieb verwirrt zurück. Was war denn in den Möller gefahren? Im Verteilen guter Ratschläge war der doch sonst nicht so freigiebig.
»Die Amerikaner stehn vor Melsungen, und die räumen schon Hirschhagen. In allerspätestens drei Tagen sin die hier. Frag den Söder, der wirds dir uss erster Hand sprechen«, hatte er Albrecht ins Ohr geflüstert und sich verschwörerisch umgeschaut.
Albrecht Schneider blieb nichts übrig, als erstaunt zu tun, dabei wusste er ganz genau, wovon der alte Möller sprach: »Wieso? Was soll der Söder wissen?«
»Mach es, wie de meinst, aber denk dran: Wenn der Kriech vorbi is, is des Nazischwein immer noch dinn Nachbar.« Mit diesen Worten ließ er Albrecht Schneider stehen und eilte den vorausgegangenen Männern bis zur Waschkaue hinterher. Der sah ihm nach und überlegte, ob die Umstände einen akuten Anfall von Unwohlsein rechtfertigen konnten, doch dann fiel ihm ein, dass es trotz dieser Nachrichten nichts gab, was er hätte tun können. Es gab in der Tat Leute im Dorf, die sich weitaus mehr Sorgen über die bevorstehende Ankunft der Amerikaner machen sollten als er. Der Söder zum Beispiel. Zwar hatte man schon so viel gehört von Plünderungen und abgebrannten Höfen. Aber fliehen? Womöglich Fiona und Katharina in Sicherheit bringen. Vor seinem geistigen Auge sah er ausgehungerte Soldaten durch das Dorf ziehen, und es grauste ihn beim Gedanken an seine halbwüchsigen Töchter. Albrecht Schneider fiel kein Ort ein, der sicherer sein konnte als das bisher vom Krieg verschonte Wickenrode. Ihm blieb nicht viel Zeit, länger über die Unterhaltung mit Gustav Möller nachzudenken. Ein auffordernder Pfiff der wartenden Kumpel riss ihn aus den Gedanken: die Schicht ging immer geschlossen unter Tage oder gar nicht.
Er packte seinen Helm und die Thermoskanne und machte sich auf die Socken, überaus neugierig, was der Herr Obersteiger Lenz wohl zu den Neuigkeiten zu sagen hatte.
1964
Kassel, Anfang Oktober
»Wenn Sie in Hirschhagen ein Problem haben, kümmern Sie sich doch gefälligst …« Mitten im Satz hielt Oberregierungsrat Wendelin Koch inne. Er guckte Fiona Schneider erschrocken an und schob fahrig einige Zettel unter einen Papierstapel.
Fiona Schneider hätte bemerken müssen, dass das, was sie zufällig durch den Türspalt gehört hatte, nicht für ihre Ohren bestimmt war, denn Wendelin Koch ließ den Satz unbeendet, während sie zögernd im Türrahmen stehen blieb. Nachdem er sich nicht rührte, stöckelte sie zielstrebig auf ihren Pfennigabsätzen, mit wippendem Haar und einem Stapel Akten unter dem Arm, in das Büro. Sie passierte einen Herrn im grauen Anzug, den sie in der Behörde noch nie gesehen hatte.
Eine peinliche Pause entstand. Sie wartete darauf, dem Unbekannten vorgestellt zu werden, aber aus irgendeinem Grund hatte Wendelin Koch es plötzlich sehr eilig, seinen Besucher zu verabschieden. Er überging diese höfliche Formalität und schob den Mann mit festem Griff am Ellenbogen geradewegs zur Tür.
Dem blieb gerade einmal die Zeit für ein knappes Nicken in Richtung Fiona, bevor die Tür hinter seinem Rücken ins Schloss fiel.
Dann erst widmete Wendelin Koch ihr seine Aufmerksamkeit: »Was kann ich denn für Sie tun, Fräulein Schneider?«
»Ich habe hier die angeforderten Akten aus dem Archiv. Stellen Sie sich vor, die waren allesamt falsch abgelegt. Wenn wir nicht zufällig einmal die Aktenzeichen auf Zahlendreher verglichen hätten, wären wir noch tagelang am Suchen gewesen und …«, kaum hatte Fiona Anlauf genommen, sich ordentlich in Rage zu reden, als sie auch schon wieder unterbrochen wurde.
»Jaja, legen Sie sie dort hin.« Geistesabwesend deutete Wendelin Koch auf eine beliebige Stelle auf dem Schreibtisch. »Das klären wir später mit dem Archivar.«
Fiona überlegte, ob sie diese Angelegenheit auf sich beruhen lassen konnte. Mit Mühe schluckte sie ihren Unmut hinunter und entschied sich dafür, das Gespräch zu vertagen. Sie arbeitete jetzt seit knapp zwei Jahren im Regierungspräsidium für Oberregierungsrat Koch und wusste genau, wann ein Zeitpunkt günstig war, um sein Gehör zu finden; im Augenblick war es offensichtlich nicht der Fall. Sie platzierte die Akten sorgsam auf dem Schreibtisch, an dem Wendelin Koch bereits wieder Platz genommen hatte.
Vertieft starrte er auf einige Schreiben auf seinem Arbeitsplatz. Sie trat neben dem Schreibtisch unsicher von einem Fuß auf den anderen und strich sich verlegen das Kleid glatt.
Erst nach einer Weile blickte Koch von seinen Akten auf. »Ist noch etwas?«, fragte er barsch.
Seine grundlose Übellaunigkeit brachte Fiona aus dem Tritt. »Die, ähm, die Unterschrift.« Sie deutete zaghaft auf den Entnahmeschein des Archivs, der zuoberst auf dem Aktenstapel lag. »Sie müssen noch den Empfang quittieren.«
Fahrig kritzelte Koch seine Unterschrift auf den Zettel und schob ihn unwirsch in ihre Richtung.
»Gut, wenn dann nichts mehr ist, würde ich wieder …« Sie deutete mit dem Zeigefinger zum Ausgang.
Koch würdigte sie nicht einmal eines Blickes.
Sie ließ sie den Satz unvollendet und versuchte, so leise es ihre Pfennigabsätze zuließen, auf dem Eichenparkett Richtung Tür zu gehen.
Noch bevor sie die Klinke hinuntergedrückt hatte, stockte sie und drehte sich um. Sie wusste selber nicht genau, welcher Teufel sie in dem Augenblick ritt, aber bevor sie sich auf die Zunge beißen konnte, war es auch schon aus ihrem Mund geplumpst: »Was ist denn in Hirschhagen?«
Während die Worte auf dem Weg in das Ohr von Oberregierungsrat Koch waren, hallte in Fionas Kopf bereits die strenge Stimme ihres Vaters wider: »Fi! Erst denken, dann reden!« Doch ihr Vater war ja nicht da, und insgeheim wusste Fiona, dass es sich auch Albrecht Schneider nicht hätte nehmen lassen, selber noch einmal nachzufragen. Nicht, wenn ihm erst das Stichwort »Hirschhagen« durch den Türspalt zu Ohren gekommen, und er anschließend Zeuge dieser seltsamen Situation mit dem fremden Herrn im grauen Flanell geworden wäre.
Die Zeit, die die Worte brauchten, um durch den Raum bis zu Wendelin Koch vorzudringen, war längst verstrichen, doch der machte keine Anstalten, darauf zu reagieren, und Fiona begann zu zweifeln, ob er sie verstanden hatte. »Ich habe vorhin gehört, dass Sie über Hirschhagen gesprochen haben.«
Koch hob so langsam den Kopf, als wäre er mit Kaugummi an die Akte geklebt, die vor ihm lag. »Sie haben doch sicherlich den Schreibtisch voller Arbeit, Fräulein Schneider. Oder muss ich ein Gespräch mit Ihrer Büroleiterin über Ihre Auslastung führen?«
Diese Drohung hätte er sich bei jeder Schreibkraft erlauben dürfen, aber nicht bei Fiona Schneider. Sie verließ mit angeknackstem Stolz mucksmäuschenstill das Büro. Undenkbar, diese Angelegenheit einfach auf sich beruhen zu lassen.
Sie passierte den Schreibtisch ihrer Vorgesetzten Annegret Fromm, die in einen Vorgang vertieft war, dann drehte sie sich kurzerhand auf dem Absatz um. Sie wartete, bis sich der ordentlich frisierte Dutt von Frau Fromm hob. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber hat sich Herr Koch über meine Arbeitsleistung beschwert?«
Annegret Fromm blinzelte kurzsichtig durch die dicken Brillengläser ihrer Hornbrille. »Wie kommen Sie denn darauf? Herr Koch schreibt immer beste Beurteilungen über Sie. Ist etwas vorgefallen?«
»Nein, ich dachte nur. Vielleicht hat er heute auch einfach schlechte Laune, aber er hat sich noch nicht einmal für den Zahlendreher im Archiv interessiert.«
Die Augenbrauen von Annegret Fromm schoben sich über den schmetterlingsförmigen Rand der Brille. »Das ist in der Tat ungewöhnlich. Vielleicht nimmt ihn eine andere Angelegenheit gerade sehr in Anspruch.«
Fiona ignorierte die etwas zu gezirkelte Ausdrucksweise ihrer Vorgesetzten, die so hervorragend zu deren knitterfreiem grauem Kleid passte, und hakte nach: »Der Herr, der bei ihm war … kennen Sie den?« Ein schräger Blick verriet Fiona, dass Frau Fromm ihre Neugierde für unangebracht hielt, doch Fiona hielt dem Blick stand.
»Nein, der Herr hat sich nicht bei mir angemeldet. Herr Koch hat ihn persönlich in Empfang genommen und in sein Büro geleitet«, antwortete Frau Fromm spitz.
Offenbar eine eigenmächtige Handlung des Herrn Oberregierungsrates, die seine Schreibbüroleitung schwerlich billigen konnte, dachte Fiona. Nun ja, er wird seine Gründe haben, den Mann an seiner allwissenden Büroleitung vorbei zu lotsen, überlegte sie und bedankte sich artig bei Frau Fromm, deren Dutt keinen Millimeter wackelte, als sie den Kopf wieder über die Akte senkte.
Diese kurze Unterhaltung hatte nicht im Mindesten dazu beigetragen, Fionas Neugier zu stillen. Im Gegenteil. Bereits auf dem Weg zu ihrem Schreibtisch grübelte sie darüber nach, wie sie es anstellen könnte, einen Blick auf die Unterlagen zu werfen, die Oberregierungsrat Koch so mächtig schlechte Laune verursachten.
Wickenrode, Mittwoch, der 14. Oktober
Edgar Brix saß frühmorgens vor einem geöffneten Paket und einer dampfenden Tasse Kaffee in seiner kleinen Küche und kämpfte mit der Wehmut. Obenauf lag ein Brief mit Gutmunds Handschrift. Die wenigen Zeilen, die ihm sein Bruder geschrieben hatte, hatte er in kürzester Zeit überflogen. Typisch Gutmund: kurz und bündig. Bloß kein Wort zu viel verlieren. Trotzdem genügte die gute Absicht, die hinter dem Paket mit dem Absender »Frankfurt am Main« steckte, um Edgar Brix rührselig zu stimmen.
Gutmund hatte ernst gemacht und die Professur in Frankfurt angenommen und den gut bezahlten Job als Klinikleiter in New Haven aufgegeben, um wieder ganz und gar in der geliebten Forschung aufgehen zu können. Ob es am untadeligen Conrad Brix lag, dass seine Söhne als jüdische Ärzte lieber in Deutschland praktizierten, anstatt in den USA zu bleiben? An der Unmöglichkeit, in seiner Nähe ein Leben ohne Selbstzweifel und Vorwürfe zu führen? Keine Frage: Die USA boten genügend Platz, um sich gepflegt aus dem Weg gehen zu können, aber zumindest Edgar war deutlich wohler, seitdem er zwischen sich und seinem Vater die Weite eines Ozeans wusste.
Er legte den kurzen Brief, in dem Gutmund ihn herzlich auf Besuch zu sich und seiner Frau Ruth nach Frankfurt einlud, beiseite und begann, den Karton auszupacken.
Gutmund hatte gut gewählt. Oder war es das Werk von Ruth? Nein, der Gutmund, den Edgar kannte – der schweigsame Mann mit dem trockenen Humor und der ausgeprägten zwischenmenschlichen Kommunikationsschwäche – wusste trotz seiner Eigenbrötlerei genau, womit er seinem kleinen Bruder auf dem Dorf eine Freude machen konnte. Edgar freute sich jetzt schon auf den gemütlichen Abend mit den Schallplatten von Roy Orbison und den Supremes und der Auswahl an Hersheys- und Baby Ruth-Riegeln. Ein Trikot und eine Kappe der Connecticut Tigers und diverse Jeanshosen gehörten auch zum Inhalt des Kartons.
Er hatte so eine Idee, wem er damit eine große Freude machen konnte. Immerhin schuldete Edgar dem jungen Lukas Söder noch ein Dankeschön dafür, dass der Garten der alten Brix’schen Familienpraxis nach den langen Jahren des Leerstandes wieder eines Arzthauses angemessen daherkam.
Zu guter Letzt holte er noch einen Stapel an Fachzeitschriften aus dem Karton, in denen er Veröffentlichungen von Gutmund vermutete. Er kannte kaum einen Psychiater, der so fleißig Forschungsergebnisse veröffentlichte wie sein großer Bruder. Und der durfte auch stolz sein, immerhin hatte er Meilensteine gesetzt.
Edgar Brix seufzte. Als Meilensteine in seiner Karriere konnte er die letzten Wochen nicht gerade bezeichnen, obwohl die Praxis ganz gut lief. Der Herbst war über Wickenrode hereingebrochen, und die Schornsteine der kleinen Fachwerkhäuschen stießen dunklen Rauch aus. Erkältungszeit. Allmorgendlich war die Praxis gut mit Schniefnasen und hustenden Dorfbewohnern gefüllt, und jetzt, wo die Erntezeit sich dem Ende neigte, nahmen sich die Bauern auch wieder Zeit dafür, ihre über das Jahr verschleppten Wehwehchen kurieren zu lassen.
Noch am Ende des Sommers hatte Edgar befürchtet, dass sich seine Einmischung in die alten Geschichten negativ auf die Patientenzahlen auswirken würden. Das Gegenteil war der Fall. Er war so etwas wie eine kleine Berühmtheit geworden, und neuerdings kamen immer häufiger Patienten aus Helsa oder Großalmerode. Immerhin war er der Arzt aus Amerika, der sich mit der Polizei angelegt und Albrecht Schneider das Leben gerettet hatte.
Ob man es nun wissen wollte oder nicht: Jeder bekam von Albrecht ausführlich die Geschichte von Edgars Heldentat erzählt. Gleichzeitig waren sie sich darüber einig, künftig auf solche Abenteuer verzichten zu wollen, denn die Knochenbrüche heilten in Albrechts Alter verdammt langsam. Erst seit wenigen Wochen konnte er sich wieder einigermaßen selber um das Haus und seine Tiere kümmern. Auch in diesem Fall hatte Lukas sich als Retter in der Not erwiesen. Er hatte wirklich alles Menschenmögliche getan, um seinen Fehler auszubügeln, der Albrecht Schneider in diese lebensgefährliche Situation gebracht hatte. Dabei brauchte man Albrecht nicht besonders gut zu kennen, um zu wissen, dass seine nordhessische Sturheit einen guten Teil dazu beigetragen hatte und er nur seinem sprichwörtlichen Dickschädel verdankte, dass die Sache für ihn glimpflich ausgegangen war.
Tatsächlich hatten die Ereignisse des Sommers keinen schlechten Eindruck hinterlassen, und Edgar Brix hatte gut in seiner kleinen Praxis zu tun. Und in dem Maß, in dem sich die Patientenkartei füllte, vergaß er, was ihn ursprünglich hierher, an das Ende der Welt, verschlagen hatte. Er begann jeden Tag, so gut es eben ging, mit dem Versuch, sich mit den Geistern der Vergangenheit zu arrangieren. Und zunächst sah es so aus, als ob es ihm gelingen könnte. Doch seit dem Sommer spukte ein überaus lebendiger Geist der Gegenwart in seinem Kopf herum.
Noch war es eine Art von höflicher Distanz, die zwischen ihm und Fiona Schneider herrschte. Sie tat noch immer so, als könne sie ihm nie verzeihen, in welche Gefahr er ihren Vater gebracht hatte, und Edgar ließ sie in dem Glauben, dass er ihre Blicke nicht bemerkte, während ihre braunen Augen eine Stelle mitten in seinem Herz berührten, die immer noch gewaltig schmerzte.
Edgar Brix schüttelte sich. Es war deutlich zu früh am Morgen für solche Überlegungen.
Er nippte an seinem Kaffee und sah auf die Gegenstände auf dem Küchentisch. Während er die Fachzeitschriften zur Seite legte, lächelte er. An einem ruhigen Abend würde er sie in Ruhe lesen und die eine oder andere Flasche Bier trinken. Dann würde er ordentlich angeheitert Gutmund anrufen und mindestens eine Stunde fachsimpeln. Darin waren sich die Brüder einig – es ging doch nichts über Fachgespräche, die mit zunehmendem Alkoholpegel an Ernsthaftigkeit verloren und denen bereits so sagenumwobene Diagnosen, wie etwa der »Apoplektische Zoster nach Hinterwandinfarkt« entsprungen waren. Edgar Brix musste grinsen. Vielleicht konnte er sich tatsächlich dazu aufraffen, Gutmund in Frankfurt zu besuchen. Bei dem Gedanken an den staubtrockenen Rotwein, den ihm sein Bruder servieren würde, zog sich sein Mund zusammen. Er spülte mit einem Schluck Kaffee nach und nahm sich vor, einige Flaschen Bier als Gastgeschenk mitzubringen, ganz so, wie es in den Staaten üblich gewesen wäre.
Edgar schaute auf die Uhr. Längst neun Uhr durch. Unter normalen Umständen wären die ersten Patienten längst verarztet. Doch wie jeden Mittwoch, war kaum mit unangemeldeten Patienten zu rechnen. Er hatte sich für den heutigen Morgen drei kleine Operationen einbestellt, und wenn ihn nicht alles täuschte, fiel davon mindestens eine wegen einer spontanen Erinnerungslücke aus.
Insgeheim rechnete er damit, dass Heiner Brand nicht auftauchte. Edgar hatte sein Humpeln zufällig bemerkt, als er Elsbeth Brand und ihrem Neugeborenen einen Hausbesuch abstattete. Entgegen jedem ärztlichen Rat hatte Heiner Brand den frisch entfernten Fußnagel wieder in die bakterienverseuchten Arbeitsschuhe gesteckt. Unter dem Druck seiner besorgten Gattin stimmte er zähneknirschend einer Nachuntersuchung zu. Doch Edgar machte jede Wette, dass ihm etwas Wichtiges dazwischenkam.
Er hatte sich getäuscht.
Vor dem Behandlungsraum saß Heiner Brand bereits mit reumütig gesenktem Kopf. Seine Frau Elsbeth hatte es sich nicht nehmen lassen, ihren Mann persönlich bis in das Wartezimmer zu begleiten und dort so lange zu warten, bis sie ihn in den Händen des Arztes wusste. Der Säugling in ihrem Arm gluckste zufrieden.
Edgar Brix beugte sich über das eingewickelte Bündel. »Schön, dass es ihm wieder besser geht. Ist das Fieber gesunken?«
»Alles in Butter, Herr Doktor. Nu seh’n Se ma zu, dass Se den Drüggeberjer hier widder auf Vordermann kriechn. Mir brauch’n dringend Brennholz für’n Winter.«
»Das bekommen wir schon hin, Frau Brand. Aber Sie müssen unbedingt dafür sorgen, dass Ihr Mann sich so lange schont, bis die Wunden verschlossen sind. Wenn der Zeh erneut bakteriell infiziert wird, besteht die Gefahr, dass er abgenommen werden muss.«
Heiner Brand wurde weiß um die Nase, und Edgar fürchtete, dass er auf dem letzten Meter doch noch kniff. Ohne langes Gerede nahm er ihn mit in das Behandlungszimmer und platzierte ihn auf der Liege.
Ein strenger Geruch entströmte der Socke, die Heiner Brand sich mit verzerrtem Gesicht vom Fuß zog. Der Zeh sah übel aus. So eine Unvernunft! Aber Edgar gewöhnte sich langsam daran, hier auf dem Dorf allzu oft dazu verdammt zu sein zu retten, was noch zu retten war. Diese nordhessischen Sturköpfe ließen sich erst dann zu einem Gang zum Arzt überreden, wenn die Arbeit getan und der Schmerz unerträglich wurde. Erst vor ein paar Tagen hatte er dem als »Schoppn-Schorsche« bekannten Georg Fuhrmann die Folgen einer in Heimarbeit mit Angelschnur durchgeführten Näharbeit an einer Platzwunde versorgen müssen. Der Gedanke entlockte Edgar erneut ein Grinsen. Er hatte mehr als genug Gesprächsstoff für ein langes Telefonat mit seinem Bruder Gutmund!
»Das piekt jetzt mal kurz«, warnte er seinen Patienten vor, als die Nadel schon längst in dem völlig vereiterten Zeh verschwunden war.
Ein Zischen entfuhr den zusammengepressten Lippen von Heiner Brand. Der hatte entgegen Edgars Anweisungen neugierig den Kopf gehoben, um zu verfolgen, was sich da an seinem Fuß tat. »Hörn Se ma, das hamm Se aber nit so ernst gemeint, mit der Ampudation das, oder?«
»Ich habe Ihnen schon beim letzten Mal gesagt, dass Sie eine solche Wunde ausheilen lassen müssen und der Fuß nichts in einem Schuh verloren hat. Verstehen Sie doch: Das ist der geeignete Ort für Bakterien. Und eine offene Wunde ist wie ein Scheunentor. Ich muss jetzt erneut Gewebe entfernen und …«, Edgar Brix beguckte sich den grüngelben Zeh von allen Seiten, »das wird nicht unerheblich viel sein. Sollten wir das wiederholen müssen, kann ich nicht garantieren, ob nicht zumindest ein Teil des Knochens entfernt werden muss. Und dafür müssen Sie dann in die Klinik.«
»Nit unerheblich viel?« Sichtliches Unbehagen bewegte Heiner Brand. Er ließ den Oberkörper seufzend auf die Liege sinken und hielt sich den Unterarm theatralisch vor die Augen. »Dann machen Se ma hinne.«
Edgar Brix schloss mit sich eine Wette ab, wie lange es dieses Mal dauerte, bis sein Patient jede ärztliche Anweisung in den Wind geschlagen haben würde. Dann begann er konzentriert das vereiterte Gewebe zu entfernen, nachdem er sich vergewissert hatte, dass der Zeh ordentlich betäubt war.
Er hatte gerade seine Arbeit beendet und das notwendige Verbandsmaterial zusammengesucht, da klopfte es zaghaft an der Tür.
Elsbeth Brand schob den Kopf durch einen möglichst kleinen Spalt, zuckte zurück, als ihr Blick auf das Gemetzel auf der Behandlungsliege fiel, und rief in den Türspalt: »Herr Doktor, das Telefon klingelt alszus. Das is bestimmt was Dringendes.«
Jetzt vernahm auch Edgar das Rappeln des Apparates im Flur. Er hatte sich derart konzentriert dem Fuß von Heiner Brand gewidmet, dass ihm das durchdringende Geräusch tatsächlich entgangen war. Mit dem Ellenbogen öffnete er die Tür. »Können Sie bitte rangehen? Ich bin gleich fertig und rufe dann zurück.«
»Wenn Se meinen?« Elsbeth Brand folgte mit skeptischer Miene dem Klingelton in das unbekannte Innere des Doktorenhauses.
Edgar Brix zog sich in den Behandlungsraum zurück, um sein Werk zu beenden. Doch kaum hatte er die erste Lage Verbandsmaterial um den Zeh gewickelt, als es erneut an der Tür klopfte. Er ahnte nichts Gutes, als das kreidebleiche Gesicht von Elsbeth Brand im Türspalt auftauchte. Und tatsächlich nahm dieser Morgen mit den Worten »Der Luschek is tot«, jene unheilvolle Wendung, die er in den letzten Wochen für seinen Geschmack eindeutig zu oft hatte erleben müssen.
*
Der Drahtesel stand abfahrbereit an den Gartenzaun gelehnt. Mit Hilfe von Lukas Söder war ein Gepäckträger entstanden, auf dem Edgar Brix mit einem schnellen Handgriff die Arzttasche festschnallen konnte, und schon ging es los. Er ließ sich die Ringenkuhle bergab rollen und überquerte die Hauptstraße. Um diese Uhrzeit war noch nicht mit viel Verkehr zu rechnen, sodass er, ohne lange nach rechts und links zu gucken, losradelte, um kurz darauf den Drahtesel vor der Alten Mühle an einen Pfosten zu lehnen.
In den letzten Monaten hatte der Blutdruck von Piotr Luschek schwindelerregende Höhen erreicht. Und Edgar war nicht müde geworden, den alten Kerl darauf hinzuweisen, dass er seine Medikamente einnehmen müsse.
Piotr Luschek war ein verschrobener Greis, an dem diese Art guter Ratschläge abprallte. Mit seinem unvergleichlichen Dialekt pflegte er zu entgegnen: »Wissen Sie, Dooktooorrrchen, wehn die Zeit gekohmen iiist, iiist sie gekohmen. Daas entscheidet derr Herrgott alleyn.«
Gegen das Herrgottsargument kam Edgar Brix in der Regel schlecht an, also beließ er es bei einem Lächeln, maß den viel zu hohen Blutdruck und nahm sich erneut vor, ein ernstes Gespräch mit Irina Platzek, der allseits hilfsbereiten Gemeindeschwester zu führen. Vielleicht ließ sich etwas an den Begleitumständen verbessern. Dass ein an die 90 Jahre alter Mann in einer Kammer auf dem Dachboden der Mühle hauste, war seinem Gesundheitszustand kaum zuträglich. Dort gab es noch nicht einmal eine Waschgelegenheit, geschweige denn einen Holzofen.
Zu spät, dachte Edgar, nun war das Gespräch nicht mehr notwendig.
Er öffnete das unverschlossene Tor und betrat eine Scheune. Blinde Oberlichter tauchten den Raum in einen staubigen Nebel, in dem Spinnenweben in der Zugluft zitterten. Es pfiff durch alle Ecken, und Edgar fröstelte in seinem dünnen Pullover.
Er war noch nicht bereit, den Sommer ziehen zu lassen, doch den Mantel rauszukramen, ließ sich nun nicht länger hinauszögern. Dies würde sein erster Winter in Wickenrode seit seiner Rückkehr werden. Geradezu erschreckend klar tauchten Erinnerungen aus seiner Kindheit auf.
Er war in jenem Winter sechs Jahre alt gewesen. Die Schneeberge türmten sich mannshoch rechts und links der Wege, und die Fahrspur war selbst für Pferdefuhrwerke zu schmal geworden. An einem Abend war das Schneegestöber derart undurchdringlich, dass sein Vater mit grimmiger Miene beim Abendessen saß. Er schob den Teller unangetastet weg und knetete nervös die Hände, bis die Knöchel weiß hervortraten. Im Gasthof auf dem Pfaffenberg lag die Wirtin in den Wehen, und es gab schlichtweg keine Möglichkeit, der Frau zu Hilfe zu eilen. Der kleine Edgar hätte eigenhändig die Straße den Berg hinauf freigeräumt, wenn er dadurch hätte verhindern können, dass er und sein Bruder Gutmund die schlechte Laune des Vaters ertragen mussten, die sich unweigerlich einstellte, nachdem er erfuhr, dass der Säugling bei der Geburt verstorben war. Aber Edgar war noch viel zu klein, um den Schneemassen auch nur das Geringste entgegenzusetzen. Und so ertrugen sie die Ausbrüche des Vaters in den folgenden Tagen, wenn es einer von ihnen nur wagte, den Blick zu erheben und rutschten am nächsten Tag unruhig auf dem schmerzenden Hinterteil auf der Schulbank herum und bekamen für diese Unaufmerksamkeit obendrein noch einige Schläge mit dem Rohrstock auf die Finger.
Edgar Brix seufzte. Das war in der Tat Schnee von gestern.
Er hatte den Schuppen durchquert und erreichte, versteckt hinter einem alten Kutschwagen, eine steile Holzstiege. Er schob seine Tasche vor sich her und erklomm die schmalen Stufen, die ihn auf den Dachboden führten. Tänzelnd überwand er einige scheinbar wahllos unter dem undichten Dach platzierte Töpfe und gelangte in einen kleinen Raum, den man ohne schlechtes Gewissen als Rumpelkammer bezeichnen konnte. Edgar stand mitten im Reich von Piotr Luschek.
Mit viel gutem Willen fühlte man sich an ein Gemälde von Spitzweg erinnert, doch in Wahrheit ließen die Umstände, in denen der alte Luschek hier hauste, selbst den geringsten Hauch von Romantik vermissen. Durch eine Dachluke fiel gerade genug Licht, dass Edgar Brix die Umrisse des Körpers erkennen konnte, der zusammengesunken in einem Sessel in der Ecke hing. Ein Buch war mitsamt einer Wolldecke von Piotr Luscheks Knien gerutscht und lag aufgeblättert auf dem Boden. Drei heruntergebrannte Kerzenstummel auf Untertellern hatten vermutlich vor Stunden das letzte Licht gespendet, und die Lesebrille baumelte dem alten Luschek quer vor dem Gesicht. Edgar nahm ihm vorsichtig die Brille von der Nase und legte sie zur Seite. Dann hob er in aller Ruhe das Buch auf. Anna Karenina. Er lächelte. Piotr Luschek und Anna Karenina? Schade, dass es Dinge gab, die man erst zu spät über einen Menschen erfuhr, dachte er.
Edgar Brix erledigte die notwendigen Handgriffe ohne Hast. Er verzichtete darauf, die üblichen Tests auf verbliebene Reflexe durchzuführen. Dieser Mann war so tot, wie man eben nur tot sein konnte, und er wollte dem alten Kerl die Ruhe gönnen, die er sich nach seinem beinahe unendlich langen Leben verdient hatte.
Er holte die Papiere aus der Tasche, um sie, nach einem kritischen Blick auf den verdreckten Tisch in der Ecke, unverrichteter Dinge wieder wegzupacken. Er legte dem alten Mann die Wolldecke über die Beine, fasste ihn noch einmal bei der Hand und prägte sich mit einem langen Blick in das runzelige Gesicht ein letztes Mal Piotr Luscheks greisenhafte Züge ein. Dann ging er die Stiege hinab und machte sich auf den Weg zur Mühlenbesitzerin.