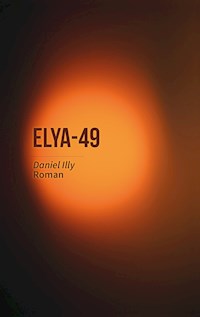
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Berlin im Jahr 2020. Nur wenige Menschen haben die weltweite Katastrophe einige Jahre zuvor überlebt. Emil Heuser, leitender Arzt und Psychiater der unterirdischen Anlage Berlin-III, ist einer von ihnen. In dieser postapokalyptischen Unwirklichkeit muss er sich mit den Folgen seiner Forschungen, einer radikalen Terrororganisation und nicht zuletzt mit sich selbst auseinandersetzen. Noch gibt es Hoffnung auf dieser Welt, die Emil auf eine lange Reise führen wird. Dr. Daniel Illy zeichnet in seinem packenden Debütroman das Bild einer dystopischen Gesellschaft und inszeniert vor dem Hintergrund einer erschreckend unter die Haut gehenden postapokalyptischen Welt ein temporeiches und psychologisch intelligentes Abenteuer. Ein Abenteuer, das den Leser so schnell nicht mehr loslassen wird. 2., überarbeitete Auflage
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Elisa
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Dreiundvierzigstes Kapitel
Vierundvierzigstes Kapitel
Fünfundvierzigstes Kapitel
Sechsundvierzigstes Kapitel
Siebenundvierzigstes Kapitel
Achtundvierzigstes Kapitel
Neunundvierzigstes Kapitel
Fünfzigstes Kapitel
Erstes Kapitel
Der letzte Gedanke, den er vor der immer weiter, mit langen, schwarzen Fingern nach ihm greifenden Bewusstlosigkeit hatte, war der Gedanke an sie gewesen. Er musste sie unbedingt erreichen, komme, was wolle. Dann sank er zu Boden, die Knie schlugen hart auf der meterdicken Eisschicht auf. Wie in Zeitlupe – die Kälte schien hier draußen auch die Zeit zu verlangsamen – folgte der Oberkörper. Dr. Emil Heuser, leitender Arzt und Psychiater der Anlage Berlin-III, drohte ein weiteres Opfer dieser unvorstellbaren Kälte zu werden. Das Zusammensacken des Thermoanzugs gab ihm einen kleinen Lebensaufschub. Zwei, vielleicht drei zusätzliche Atemzüge gegen die alles verzehrende Bewusstlosigkeit. Er hatte Glück, dass das Glas seines Helmes nicht durch den Aufprall beschädigt wurde. Ihm blieben noch ein paar Sekunden. Zeit, die er zum Nachdenken nutzte. Was würden seine Freunde und Kollegen mit schwarzer, nach Teer riechender und ebenso zähflüssiger Farbe auf die Wand der Toten in der Gemeinschaftshalle schreiben?
»Ging mit 35 Jahren viel zu früh von uns.«
»Gestorben 2020, am Tag 122, bei dem Versuch, eine finale Lösung herbeizuführen.«
Welcher Monat war der Tag 122? Seit der großen Katastrophe vor drei Jahren hatten Jahreszeiten, Monate und Tageszeiten an Bedeutung verloren. Man hatte beschlossen, die Tage einfach nüchtern durchzunummerieren, vielleicht auch, um deren Eintönigkeit und Gleichheit zu unterstreichen. Wie wünschte er sich die Monate zurück. Januar, Februar, März, April und Mai, sein Lieblingsmonat. Momente der Sehnsucht waren mit diesen Namen verbunden. Der Mai klang bereits nach Wärme, nach ersten langen Nächten im Freien, nach Schwimmbadchlor und sternenklarem Himmel. Er blickte nach oben und versuchte vertraute Sternbilder zu erkennen, ohne Erfolg. Der Thermostat seines Anzugs funktionierte tadellos, noch jedenfalls. Das Problem schien wirklich bei der Sauerstoffversorgung zu liegen. Vermutlich waren die Verbindungsschläuche von der Atemluft beschlagen, weil der Atemfilter zu ungenau arbeitete. Bei dieser extremen Kälte konnte selbst der kleinste Wassertropfen einen Atemschlauch irreversibel beschädigen. Die nun wieder aufkommende Bewusstlosigkeit – erneut lange, schwarze Finger vor seinen Augen – zeugte von den endgültig schwindenden Sauerstoffreserven. Lange nach seinem Ersticken würden die Energiereserven des Anzugs nachlassen, der Thermostat würde ausfallen und die schlagartig einsetzende Kälte bewirken, dass alles Flüssige in seinem Körper plötzlich zu Eis erstarren würde. Wie Mikrowellenpopcorn würde sein lebloser Körper von innen heraus platzen. Kein schöner Anblick, wenn ihn denn jemand finden sollte. Die vielleicht hundert Meter zur rettenden Tür der Anlage waren bei dieser Temperatur schließlich eine kleine Weltreise, die nicht von vielen auf sich genommen wurde. Er schloss die Augen und dachte wieder an sie. Dann wurde sein Kopf endgültig von einer tiefgreifenden Schwärze umfangen. Schwarz wie die ihn umgebende Nacht. Schwarz wie die Farbe an der Wand der Toten. Dr. Emil Heuser begann zu sterben.
Eigentlich egal, was an der Wand der Toten stehen würde, wenn Hannes sich um die Ausrichtung der kleinen Trauerfeier kümmern würde, so würde er wenigstens als Lächeln in dieser leichnamslosen Beerdigungsgesellschaft existieren. Dr. Mikrowellenpopcorn oder »Mister-ich-mache-wasich-will-und-gehe-einfach-raus-ohne-Bescheid-zu-sagendu-Arschloch!« Für einen kurzen Moment kehrte sein Bewusstsein zurück, auch wenn er sich nicht erklären konnte, wieso. Das waren nicht seine, von bereits mit Sauerstoff unterversorgten Neuronen kreierten, wirren Gedanken, das war ganz klar Hannes’ Stimme, die er da hörte. Er spürte, wie ein Schwall frischer Luft seine Lungen wieder zum Atmen brachte. Im nächsten Moment öffnete er die Augen und schaute in das wohlbekannte, spitzbubenhafte Gesicht seines besten Freundes, das sich nun, die tiefblauen Augen ebenfalls hinter Glas verborgen, über ihn und seine an Farbe zurückgewinnenden Lippen beugte.
»Du hängst an meiner zweiten Leitung, mach also ausnahmsweise mal keinen Scheiß, okay? Und jetzt hoch mit dir! Los! Old Shatterhand!«
Diese kleine Geste, das einander durch Griff an den Arm unterstützte Aufhelfen, war ein wiederkehrendes Zeichen ihrer Freundschaft. Noch leicht benommen, durch Hannes’ Schulter gestützt, eher schleifend als laufend, legte Dr. Emil Heuser den Weg zur Eingangsschleuse der Anlage zurück und versuchte sich zu erinnern, wann sie einander das letzte Mal mit einem »Old Shatterhand « aufgeholfen hatten. Es mochte viele Jahre her sein, bestimmt noch vor der großen Katastrophe, als man in Berlin noch vor die Tür gehen konnte, ohne fast zu sterben. Beim Grillen im Park vielleicht?
Sein Blick ruhte kurz auf den zu bizarren Eisexplosionen erstarrten Resten einiger den Weg säumender Bäume. Man kam unweigerlich ins Staunen, welche gewaltigen Kräfte hier am Werk waren. Eis, Stücke von Rinde, Eis, gesplittertes Holz, wieder Eis. Warum überhaupt hatte er sich den Strapazen hier draußen ausgesetzt? Er konnte sich nicht vollständig erinnern, die Dunkelheit schien auch seinen Kopf in Beschlag genommen zu haben. Es mochte die Erleichterung der nahenden Schleuse oder die Erschöpfung gewesen sein, erneut fiel es ihm zunehmend schwerer, die Augen offen zu halten.
»Ich muss zu ihr!«, drang es seinem Freund über das Kommunikationssystem ihrer Anzüge direkt ans Ohr.
»Ich muss zu ihr!«
Dann schlossen sich seine Augen von Neuem.
Zweites Kapitel
Als Emil die Augen wieder öffnete, befand sich kein schützender Helm mehr über seinem Kopf. Er blickte direkt in das grelle Licht der Leuchtstoffröhren über ihm. Die Maserung der Zimmerdecke war ihm bestens vertraut. Er befand sich an seinem Arbeitsplatz, genauer gesagt auf einer der Notfallliegen der Krankenstation in Berlin-III, etwa hundert Meter unter dem Erdboden.
Sein Körper fühlte sich bleischwer an. Es kostete ihn bereits einige Mühe, den Arm zu heben und nach den, von ihm zunächst nicht als solche erkennbaren, EKG-Elektroden zu tasten. In seinem Kopf herrschte ein heilloses Durcheinander. Er erinnerte sich an die Rettung durch seinen Freund Hannes, aber nicht daran, was er da draußen gewollt hatte.
Die vertraute Umgebung tat ihm gut. Die Anrichte aus Edelstahl mit den bereitliegenden chirurgischen Instrumenten, der ewig tropfende Wasserhahn über dem weißen Waschbecken in der Ecke des Raumes, er erinnerte sich sogar an die Kombination des Sicherheitsschrankes, gefüllt mit jenen Medikamenten, die man nicht unbedingt offen herumliegen lassen sollte. Er war der leitende Arzt von Berlin-III, es war der Tag 122 im Jahr 2020 und die Welt war nicht mehr, wie sie mal war, das alles war ihm unmissverständlich klar. Was aber hatte er dort draußen vor der Tür gesucht? Wo hatte er hingehen wollen?
Seine Augen glitten hektisch durch den Raum. Außer ihm befanden sich nur noch eine Handvoll ungenutzter Notfallliegen darin. Wie spät mochte es sein? Er kniff die Augen zusammen, um die Uhr an der gegenüberliegenden Seite lesen zu können. 20:48 Uhr, vielleicht auch eine 6 oder eine 3 am Ende, aber was machte das schon für einen Unterschied? Vor über 12 Stunden war er aufgestanden, hatte sich Hose und Pullover angezogen, den Kittel übergeworfen und nach einem schnellen Instantkaffee auf den Weg zu eben diesem Raum gemacht.
Er erinnerte sich daran, unmittelbar nach Arbeitsbeginn einen Notfall hereinbekommen zu haben. Eine junge Frau, keine zwanzig Jahre alt, die, wie so viele in dieser unendlichen Kälte und Dunkelheit, beschlossen hatte, ihrem wenig aussichtsreich erscheinenden Leben ein frühzeitiges Ende zu setzen. Gemeinsam mit Hannes hatte er zunächst die tief klaffenden Schnittverletzungen an ihrem linken Unterarm gesäubert, desinfiziert und anschließend vernäht. Er erinnerte sich daran, dass die junge Frau mehrfach nach ihnen geschlagen hatte, sodass schließlich sogar der Einsatz eines intravenösen Beruhigungsmittels notwendig wurde. Er hatte sich für 2,5 Milligramm Diazepam, aufgezogen auf eine 5 Milliliter fassende Spritze mit Natriumchlorid-Lösung, entschieden. Die daraufhin rasch einsetzende Ruhe der jungen Patientin hatte Hannes für die letzten Stiche genutzt.
Als die Patientin schließlich eingeschlafen war, hatten sie beide mit gedämpfter Stimme die lebhafte Diskussion geführt, ob Paris, oder das, was davon übrig ist, noch immer sein Wahrzeichen, den Eiffelturm, besitzt. Wie waren sie doch gleich auf Paris gekommen? Richtig, der Name der Patientin, Amélie Richter, geboren 2002 in Erfurt, kurz nachdem dieser Film mit dem eingängigen Klavierstück herausgekommen war. Sein Gedächtnis schien erstaunlich gut zu funktionieren.
Er erinnerte sich an das ausführliche Gespräch mit Amélie gegen Mittag. Das Nachlassen der Wirkung des Medikaments ließ ihn nun zum Hauptteil seiner psychiatrischen Arbeit, der psychotherapeutischen Behandlung der Patientin, kommen. Sie sprachen über Vergangenes, über Gegenwärtiges und vor allem über die grässliche Fratze der von ihr beschworenen Zukunft. Nach diesem längeren Gespräch hatte sie sich fürs Erste beruhigen können. Mit der neu aufkeimenden Hoffnung auf Linderung durch Medikamente, angedacht war die Niedrigdosistherapie mit Sunburn, und dem in die Hände gegebenen Versprechen, keinen weiteren Suizidversuch zu unternehmen, hatte er sie in eines der ruhigeren Krankenzimmer geschoben. Dann hatte er sich auf den Weg in das medizinische Labor gemacht, das unweit der Krankenstation lag, und stieß auf eine dicke, undurchdringliche Wand aus Vergessen. Ihm fehlten einige Stunden des aktuellen Tages, Stunden, die ihn scheinbar dazu bewogen hatten, die Station in Schutzkleidung zu verlassen und auf eigene Faust irgendwelche Unternehmungen zu beginnen. Was hatte er da draußen gesucht? Erschrocken durch die lückenhafte Erinnerung der letzten Stunden stieß er einen lauten Seufzer aus.
»Ah, gut, du bist wach.« Anna steckte den Kopf zur Tür hinein, näherte sich dann der Liege und schaltete auf dem Weg die Konsole zur Überwachung der Vitalzeichen aus. Emil war so in Gedanken versunken gewesen, dass er das Piepen der Apparatur und das wiederholte Aufpumpen der Blutdruckmanschette gar nicht wahrgenommen hatte.
»Willkommen unter den Lebenden! Was zur Hölle hast du dir dabei gedacht, ohne uns Bescheid zu sagen, rauszugehen?« Die Freude über das Wiedersehen überwog die Wut auf den unvernünftigen Freund und ein Lächeln zog über Annas Gesicht. Nie hatte er sich so sehr gefreut, ihre Zahnlücke zwischen den beiden oberen Schneidezähnen zu sehen. Eine lange Umarmung später half sie ihm auf. Anna hatte ihre Arbeitskleidung, hellblaue OP-Klamotten, bereits abgelegt und trug ihr typisches Freizeitoutfit: langer Wollrock, Bluse und große Ohrringe, die ihr einen Hauch Südländerin in das blasse Gesicht malten.
»Ich wollte gerade los, mir einen kleinen Snack reinziehen, da bringt mir Hannes eine halbe Leiche vorbei. Wo wolltest du denn hin?«, fragte Anna.
»Ich kann mich nicht erinnern«, antwortete Emil, bereits stehend, sich aber weiterhin am Rand der Untersuchungsliege festhaltend.
»Wie, an gar nichts mehr? Ich bin Anna, nett, dich kennenzulernen. «
»Ab Mittag fehlt mir jede Erinnerung.« Ihm war jetzt nicht nach Scherzen zumute.
»Was ist das Letzte, an das du dich erinnern kannst?« Sie hatte den Ernst seiner momentanen Situation begriffen und machte ein sorgenvolles Gesicht.
»Das Gespräch mit Amélie, dieser Patientin, die wir heute Morgen bekommen haben. Wie geht es ihr eigentlich?« Für einen Moment vergaß er über sein Verantwortungsgefühl seine eigenen Probleme. Das ging ihm, wie vielen Menschen in sozialen Berufen, häufiger so. Bislang wurden solche Gedanken allerdings höchstens mal von einem Schnupfen abgelenkt, jedoch nicht von einem partiellen Gedächtnisverlust bei zurückliegendem Beinahetod durch Ersticken.
»Mach dir keine Sorgen. Während ihr Jungs da draußen den Dicken machen musstet, habe ich mich um sie gekümmert. Sie hat die erste Dosis Sunburn bereits intus und schläft wie ein Baby.«
Ein Ausdruck der Entspannung keimte auf seinem Gesicht auf.
»Hannes hat mir nicht gesagt, dass du weg bist und er dich suchen geht. Ich musste den Laden mal wieder alleine schmeißen«, gab sie lachend zu Protokoll.
»Das tut mir wirklich leid, ehrlich, Anna!« Es tat ihm ernsthaft leid, aber in seiner Stimme lag auch so etwas wie ein Lachen, zum ersten Mal seit der Bewusstlosigkeit.
»Mach dir keine Sorgen«, entgegnete sie. »Ich bin es ja von euch so gewohnt.«
In der Tat war sie es gewohnt. Die Katastrophe hatte sie mitten aus dem Medizinstudium gerissen, sodass Anna eigentlich keine Ärztin war. Vor dem Studium hatte sie als Krankenpflegerin gearbeitet und dabei erstaunliche Kompetenz gezeigt. Wundversorgung war ihr Spezialgebiet, in dem sie längst ihre ärztlichen Kollegen überragte. Sie nähte und verband wie keine Zweite. Am liebsten dort, wo die Not am größten war. In Uganda hatte sie bereits ein Grundstück gekauft, um ein Krankenhaus zu errichten, das sich auf die Versorgung von Wunden spezialisieren würde. Das Medizinstudium schien eine nervige Formalität zu sein, eine, die sie vom Lernpensum herausforderte, aber so zu ihr passte wie – in ihren eigenen Worten – Arsch auf Eimer. Sie hatte so lange auf einen Studienplatz gewartet, und als alle Universitäten der Welt mit einem Schlag aufhörten zu existieren, hatte sie ganz selbstverständlich den Platz an Emils und Hannes’ Seite angenommen. Für die drei war es das größte Glück in dieser größtmöglichen Katastrophe, ihre seit vielen Jahren bestehende Freundschaft gerettet zu haben. Hierarchien mochten innerhalb der Anlage gelten, auf der Krankenstation waren alle gleich. Hannes, der Chirurg, wusch auch mal einen bettlägerigen Patienten. Emil, der Psychiater, schiente gebrochene Finger und Anna, die Krankenpflegerin, entfernte auch mal einen vereiterten Blinddarm. Sie hatten ihr Wissen einander weitergegeben und gelernt zu improvisieren. Anders konnte das kleine Krankenhaus tief unter der Erde nicht funktionieren. Auch wenn ihre Namensschildchen ein hierarchisches System vermuten ließen – wer hier leitender Arzt oder Krankenpflegerin war, spielte im Arbeitsalltag keine Rolle.
»Ich muss mich irgendwie wieder erinnern. Wenn ich nur wüsste, wie?«, sagte Emil, nun endlich ohne fremde Hilfe im Raum stehend. »Lass uns ins Labor gehen!«
Sie hielt ihn zurück.
»Erst musst du zu Sammler und ich muss dich warnen, er ist ziemlich sauer. Außerdem solltest du noch etwas wissen«, sie tippelte nervös von einem Fuß auf den anderen. »Kurz nach deinem eigenmächtigen Himmelfahrtskommando ist das Labor in die Luft geflogen. Sie konnten die Flammen erst vor einer Stunde löschen.«
Drittes Kapitel
Das Büro des Anlagenleiters befand sich, ebenso wie die Krankenstation, in Bezirk A. Dieser bestand darüber hinaus aus der sogenannten Schleuse, dem einzigen Eingang in den Komplex. Dahinter gliederte sich der Verwaltungstrakt mit diversen Büros, Aufenthaltsräumen für den Wachschutz der Anlage, einem kleinen Gefängnis sowie einigen Lagerräumen an. Vom Hauptkorridor zweigte der L-förmig angelegte EWL-Gang ab. EWL stand für Energie, Wasser und Luft. Die einzig mögliche Energiegewinnung stellte Kernenergie dar. Berlin-III konnte dazu auf insgesamt drei Deuterium-Tritium-Reaktoren zurückgreifen. Ein Großteil der Energie wurde für die Beheizung der Anlage verwendet. An der Decke verlaufende Lüftungsrohre verteilten die Wärme mit der Frischluft. Der Sauerstoff stammte, je nach Verfügbarkeit, entweder aus den Gewächshäusern im unteren Bereich der Anlage oder wurde in einem komplizierten und sehr energieaufwendigen Lösungsverfahren aus dem umliegenden Eis gewonnen. Je nach sonstigem Energiebedarf wurde die Temperatur entsprechend nach unten reguliert, meist waren es jedoch moderate 16 Grad Celsius. Die Wasserversorgung wurde durch aufgetautes und nachfolgend aufbereitetes Grundwasser gewährleistet. Mitsamt der Krankenstation und einigen Privaträumen der einflussreichsten Menschen in Berlin-III bildete Bezirk A gewissermaßen den lebenswichtigen Kopf der Anlage, die sich, wie ein gefräßiger Wurm, in den Untergrund gebohrt hatte.
Den Übergang zu Bezirk B bildete die Gemeinschaftshalle. Sie bot Platz für alle 5.000 Bewohner der Anlage, war Ort des Austauschs und der Zerstreuung, religiöser Versammlungsort und Austragungsort von Festlichkeiten. In den Anfangstagen der Anlage hatte die Gemeinschaftshalle noch sehr provisorisch gewirkt. Mittlerweile bot sie, dank dem Arbeitseifer und der Kreativität der Bewohner, sogar eine recht stattliche Bühne für Konzerte, Reden, Gottesdienste oder Beerdigungsfeiern, wie die am heutigen Tag so knapp verhinderte des leitenden Arztes. Die Halle lag aktuell verwaist da, hinter der stets gut bewachten Sicherheitsschleuse des Bezirks A brannte kein Licht. Solche Sicherheitsschleusen befanden sich an allen Übergängen der einzelnen Bezirke. Wie die Schotten eines riesigen, in der Erde gefangenen Schiffes trennten sie die jeweiligen Bereiche luftdicht und thermisch voneinander ab, um so im Notfall entsprechende Bezirke weiterhin am Leben erhalten zu können. Zudem hatte nicht jeder Bewohner die Erlaubnis, alle Bezirke zu betreten. Die Identitätskontrolle des Terminals an der Schleuse zum Kopf der Anlage ließ nur die dort beschäftigten Personen passieren, zusätzlich kontrollierten die jeweiligen Wachbeamten noch mal von Hand nach, ob Person und Ausweis übereinstimmten. Neben der Schleuse zur Gemeinschaftshalle zweigte ein Korridor zu den Laboratorien ab. Emil wandte sich unwillkürlich in diese Richtung. War es Neugier oder der nichts Gutes verheißende Geruch von Rauchresten, der ihn anzog?
»Komm, du weißt, er hasst es zu warten!«, sagte Anna und zog ihn weiter.
Martin Sammler, Kommandant und Leiter der Anlage Berlin-III drehte unruhig Kreise in seinem Büro. Wie gerne würde er bereits in seinem Bett liegen, einen guten Tropfen auf dem Nachttisch, nicht dieses unerträgliche Gebräu aus den unteren Bezirken, sondern was Gutes, was von früher, dazu ein Buch in der Hand, das ihm vielleicht etwas Entspannung bringen könnte. Aber die Ereignisse des heutigen Tages gönnten ihm keine Ruhe. Erst brachte dieser Idiot von einem Arzt sein Labor zur Explosion und dann hatte er auch noch die Dreistigkeit, wie ein feiger Hund einfach das Weite zu suchen. Er würde ihn gleich im Anschluss an ihr Gespräch festnehmen lassen. Dass er überhaupt auf ihn warten musste! Aber der Herr Doktor hatte scheinbar beschlossen, erst jetzt die Augen zu öffnen, das sah ihm ähnlich. Er brauchte dringend Fortschritte, die endgültige Lösung betreffend, und leider leistete die Forschungsarbeit des ärztlichen Teams dazu einen nicht unerheblichen Beitrag. Trotzdem traute er diesem Drogen verschreibenden Quacksalber keinen Meter über den Weg. Seine Gedanken wurden von einem Klopfen an der Tür unterbrochen.
»Herein!«
»Kommandant?«, sagte Emil.
»Sie sind es, Doc, na endlich! Lassen Sie uns bitte alleine«, sagte Sammler an Anna gewandt.
»Ich warte draußen auf dich«, entgegnete diese und schloss die Tür etwas zu energisch, wie Emil fand.
Die stahlblauen Augen des Leiters der Anlage blitzten unter seinem grauen Bürstenhaarschnitt und nahmen Emil ins Visier. Dieser blickte sich kurz in dem Büro um. Wuchtiger Schreibtisch, Lagepläne der Anlage an den Wänden, ein paar Bücher. Relikte aus vergangenen Tagen, jedoch keine persönlichen Gegenstände. So hätte sich Emil auch eingerichtet, wenn er Sammler gewesen wäre.
»Was haben Sie sich dabei gedacht, Heuser?«, donnerte es ihm entgegen.
»Ich kann es nicht sagen, ich habe mein Gedächtnis teilweise verloren«, entgegnete dieser. Seine Stimme klang seltsam weich und schwach.
»Das ist die mit Abstand dümmste Ausrede, die ich je gehört habe!«, blaffte Sammler zurück. »War das bevor oder nachdem Sie Ihr Labor mutwillig zerstört haben?«
»Ich habe garantiert nicht mutwillig mein eigenes …«, setzte er an, wurde jedoch sofort wieder von dem aufbrausenden Kommandanten unterbrochen, der allmählich die Beherrschung zu verlieren drohte.
»Das wird sich zeigen. Meine Leute werten gerade die Sicherheitsprotokolle der letzten Stunden aus. Bewegungen innerhalb der Anlage, verdächtige Personen und so weiter. Bis dahin behalte ich Sie in Gewahrsam. Vielleicht bringt Ihnen die Ruhe unserer Zellen wieder die Erinnerung zurück. Was meinen Sie?«, fragte er zynisch.
»Das können Sie nicht tun! Ich will zurück an die Arbeit. Ich muss mich irgendwie erinnern, nach Anhaltspunkten suchen, meine Aufzeichnungen ansehen, das kann doch nicht Ihr Ernst sein!« Seine Stimme wurde noch brüchiger.
»Sie lassen mir keine Wahl, Herr Doktor.« Er sprach seinen Titel aus, als würde er über einen Haufen Abfall sprechen. »Sie stellen gegenwärtig ein enormes Sicherheitsrisiko dar. Drogen, Explosionen, Flucht – was kommt als Nächstes? Wollen Sie, dass wir hier unten alle verrecken wie die armen Schweine drüben in Berlin-I? Ihr gedankenloses Vorgehen hat unsere Forschungen erheblich zurückgeworfen. Uns läuft die Zeit davon!«, redete sich Sammler in Rage.
»Ich will natürlich …«, wollte Emil entgegnen, aber in diesem Augenblick klopfte es energisch an der Tür.
Wutentbrannt stob der Kommandant zur Tür, um sie zu öffnen.
»Ich habe doch gesagt, ich will nicht gestört werden!«, schnauzte Sammler den Offizier des Wachschutzes an, der vor der Tür aufgeregt ein Stück Papier schwenkte.
»Es ist aber sehr wichtig, Herr Kommandant!«, verteidigte sich dieser und bemühte sich, noch gerader als sonst zu stehen.
»Heuser, entschuldigen Sie uns kurz?«, Sammler schob ihn aus dem Zimmer.
Anna, eben noch gelangweilt an der gegenüberliegenden Wand des Korridors lehnend, lief auf Emil zu und wollte gerade ansetzen, da öffnete sich die Tür zum Büro des Kommandanten wieder und dieser bellte hinaus: »Glück gehabt, Heuser. Zu besagtem Zeitpunkt befanden Sie sich bereits auf Ihrem hirnverbrannten Spaziergang da draußen.« Er deutete mit dem Finger nach oben in Richtung Decke. »Außerdem haben wir das hier gefunden.« Er entriss dem Offizier das eilig hergebrachte Beweismittel. Darauf war mit schwarzer Farbe ein Handabdruck zu sehen. Sonst stand auf dem Papier nichts geschrieben, aber die Botschaft war klar, jeder in Berlin-III wusste, was sie bedeutete.
»Das ist selbst für Sie eine Nummer zu groß, Heuser. Sie mögen vielleicht leichtsinnig sein, aber auf die würden Sie sich garantiert nicht einlassen«, fuhr Sammler fort. Es klang beinahe wie eine Entschuldigung, aber er setzte noch nach: »Finden Sie Ihr Gedächtnis wieder, so schnell es geht. Machen Sie sich umgehend an die Arbeit. Ich will in drei Tagen Ergebnisse sehen! Ich, wir alle können nicht mehr lange warten.«
»Aber …«, versuchte Emil noch anzubringen, doch da hatte Sammler bereits die Tür mit den Worten »Um diese Arschlöcher kümmern wir uns schon, keine Sorge!« geschlossen.
Emils fragender Blick lag auf Annas Gesicht. »Ein schwarzer Handabdruck?« Er konnte es nicht fassen. »Du meinst, die Dunkelsucher haben unser Labor zerstört?«
Viertes Kapitel
Bei einer Gemeinschaft von 5.000 Menschen blieb es nicht aus, dass sich Gruppen mit unterschiedlichen Weltanschauungen und Wertvorstellungen herausbildeten. Die Dunkelsucher waren die mit Abstand radikalste Gruppe unter ihnen. Ihr Markenzeichen, der schwarze Handabdruck, wurde zuletzt häufiger bei Verbrechen und Anschlägen jeder Art gefunden. Er stand für das Abwenden vom Fortschritt, die Hinwendung zur Dunkelheit. Ein Anschlag auf das medizinische Forschungslabor von Berlin-III passte sehr gut in das Portfolio der selbst ernannten Heilsbringer, die all jenen Erlösung versprachen, die sich ihnen anschlossen. Ein kalter Schauer lief Emil den Rücken herunter. Er glaubte, auch bei Anna eine flüchtige Gänsehaut zu bemerken.
Wie um seine Gedanken zu bekräftigen, sagte diese: »Wir sollten wirklich vorsichtig sein, ein Glück, dass niemand verletzt wurde. Erinnerst du dich an den Anschlag auf das Trinkwasser vor einigen Monaten?«
Er erinnerte sich nur zu gut. Zu Dutzenden hatten sie Bewohner mit starkem Erbrechen und Durchfällen behandelt. Zwei Wachen waren tot mit schwarz gefärbten Handflächen in einem Besenschrank in der Wasseraufbereitungsanlage aufgefunden worden. Die Suche nach dem augenscheinlich mutwillig dem Wasser zugesetzten Erreger, einem Vertreter der Cholera auslösenden Spezies, hatte drei Tage und Nächte in Anspruch genommen. Zwei Säuglingen und einem älteren Herrn, ein freundlicher, rundlicher Mann, der als Hausmeister in der Anlage tätig gewesen war, konnten sie nicht mehr helfen. Ihre Namen fanden sich auf der Wand der Toten wieder. Kurz danach zirkulierten einige Flugblätter der Dunkelsucher in der Anlage. Darauf die Aufschrift »Kehrt um oder sterbt«, die darunter abgebildete schwarze Hand fungierte als einprägsames Ausrufezeichen.
Sie folgten dem Geruch nach Rauch den Korridor entlang, vorbei an den Räumen der Maschinenbauingenieure, den Laboratorien der Chemiker, Physiker und Biologen und stießen in der Tür fast mit Hannes zusammen.
»Na, ausgeschlafen?«, empfing er Emil. »Gut, dass du nicht hier drin warst.« Er hielt den beiden die Tür auf und ließ sie passieren. Vor ihnen breitete sich ein Bild der Zerstörung aus.
Mikroskope, Zellkulturen, anatomische Präparate, Destillierkolben, Fotometer, Computer, die Käfige mit den Ratten, alles war zu einer undefinierbaren, schwarz glänzenden Masse zusammengeschmort, von der, schmelzender Schlagsahne gleich, der Löschschaum zu Boden tropfte.
»Übel, wirklich übel«, murmelte Emil in die gespenstische Stille hinein. »Fraglich, ob wir wieder so forschen können wie früher, geschweige denn Medikamente herstellen. Ich hoffe, unsere Vorräte an Sunburn sind groß genug.«
»Das hoffe ich auch«, sagte Anna mit einem sorgenvollen Blick in den Raum.
»Vermutlich Magnesiumbrandsätze.« Hannes tippte mit dem Fuß einen undefinierbar verformten Metallbehälter an, von dem ausgehend sich ein weißlich gefärbter Strahlenkranz in den Betonboden gefressen hatte.
»Dunkelsucher«, sagte Anna, wie um die enorme Zerstörung erklärbarer zu machen.
»Sammler hat uns eben das Bekennerschreiben gezeigt«, ergänzte Emil.
»Das dachte ich mir«, entgegnete Hannes. »Nun aber zu dir, mein Lieber, erklärst du uns, was du da draußen gewollt hast?«
»Ich kann mich nicht erinnern. Nachdem ich mit unserer Notfallpatientin gesprochen habe, bin ich hierhergekommen.« Emils Finger spielten gedankenverloren mit einem verbrannten Klumpen der Laboreinrichtung herum. »Ich muss irgendwas herausgefunden haben. Etwas, das so wichtig war …«
»… dass keine Zeit mehr blieb, uns darüber in Kenntnis zu setzen«, vollendete Anna den Satz.
»Und du erinnerst dich an gar nichts mehr?« Hannes’ Augen nahmen einen leicht vorwurfsvollen Blick an.
»Nein, das sage ich doch!«, entgegnete Emil.
»Da draußen …«, Hannes machte eine kleine Pause, um den Ernst der Situation heraufzubeschwören, »… da draußen hast du von einer Frau gesprochen. Du hast gesagt, du musst unbedingt zu ihr.«
»Habe ich einen Namen genannt?«, fragte Emil.
»Nein, keinen Namen, nur dass du zu ihr musst«, antwortete Hannes.
»Daran erinnere ich mich leider nicht«, sagte Emil.
»Das ist schlecht.« Hannes nagte an seiner Unterlippe herum. »Ich fasse mal zusammen: Du machst eine scheinbar sehr wichtige Entdeckung, hast es daraufhin so eilig, eine dir unbekannte Frau zu erreichen, dass du keinen von uns einweihen kannst. Du hinterlässt keine Nachricht, nur durch Zufall entdecke ich, dass dein Anzug fehlt, und finde dich oben fast tot vor der Schleuse liegen. Und als wäre all das noch nicht genug, zerstören die Dunkelsucher in der Zwischenzeit noch unser Labor?«
»Stimmt, das klingt alles sehr verwirrend und so gar nicht nach mir«, musste Emil zugeben. »Hatte ich dort oben etwas bei mir?«
»Nichts. Wobei, was ist mit deinem PDA im Anzug? Wir sollten die Speicherkarte auslesen, er müsste doch automatisch ein Backup deines Computers hier gezogen haben. Und zwar bevor dieser zu Brei zusammengeschmolzen ist«, schlug Hannes vor. Er verkniff sich die Bemerkung, dass das alles sehr wohl nach Emil klang.
»Er liegt drüben, ich bin sofort wieder da«, sagte Anna und stob aus der Tür.
Hannes und Emil begannen gerade, sich zu überlegen, wie man anfangen sollte, Ordnung in dieses Chaos zu bringen, da erschien Anna keuchend in der Tür.
»Hier!«, sie hielt ihm den kleinen Computer hin.
»Er geht an.« Emil blickte erwartungsvoll in die Runde. Der Startbildschirm tauchte die unheimliche Umgebung in ein dunkelblaues Licht, was den zerstörten Raum noch gespenstischer wirken ließ. Emil gab Benutzername und Passwort ein, bestätigte mit einem beherzt auf den Bildschirm gedrückten Zeigefinger und wartete auf das Hochfahren des Betriebssystems. Das schien zu funktionieren. Die Vorfreude legte sich jedoch binnen Sekunden, als ein Signalton eine nachfolgende Passwortabfrage ankündigte.
»Was ist das?«, entfuhr es Emil.
»Was ist die wichtigste Erkenntnis im Leben?«, las Anna vom Bildschirm ab. Darunter fand sich ein blinkendes Eingabefeld.
Ratlos blickte Emil auf sein sich im Display spiegelndes Gesicht. »Ein SecuScienceGate-Passwort der höchsten Stufe. Ich kann mich nicht erinnern, das eingerichtet zu haben. Ohne Passwort kommen wir jetzt nicht weiter, so eine Scheiße!«
»Du willst mich verarschen, oder?« Hannes riss ihm den PDA aus der Hand und gab wahllos Worte in die Maske ein, jeweils quittiert von einem kurzen, die Falscheingabe untermalenden Signalton, der ein bisschen so klang, als würde man eine Ente überfahren.
»Liebe, Sex, Bier. Du hättest es uns wenigstens einfach machen können. Ein SecuScienceGate-Passwort der höchsten Stufe, kurz bevor du dein Gedächtnis verlierst, ganz großes Kino, Emil!«, schnauzte er ihn an. »Du kannst dich doch an ein paar Hinweise erinnern, oder?«
Emil schüttelte den Kopf. Er hatte nicht mal den Hauch einer Ahnung. Was dieses Passwort oder seinen abenteuerlichen Ausflug vor einigen Stunden und die Zeit davor anging, stieß er auf eine gähnende Leere in seinem Gedächtnis. Eine ihn absolut erschreckende Leere.
Fünftes Kapitel
Am 28. März 2017 um 11:07 Uhr und 14 Sekunden mitteleuropäischer Zeit war die Sonne plötzlich erloschen. 8 Minuten und 22 Sekunden später erreichten die letzten Lichtstrahlen die Erde.
Um 11:15 Uhr und 36 Sekunden wurde es plötzlich schwarz. Es wurde sehr kalt. Alles Leben auf der Oberfläche erstarrte zu Eis. Binnen weniger Sekunden dehnte es sich aus und fand seinen Weg durch Rinde, Fell und Haut, ein grausames Ende der bislang stets nach vorne strebenden Evolution. Es regnete kilometerdicke Eisberge, Wolken, eben noch friedlich Tiere an den Himmel malend, begruben ganze Landstriche unter sich. Die Temperatur der Weltmeere sank innerhalb von Sekunden dem Gefrierpunkt entgegen, das Eis suchte sich seinen Weg, verleibte sich ganze Inseln und Landstriche ein. Wo es sich nicht ausdehnen konnte, sprengte es Länder und Kontinente entzwei. Ein Krachen und Zittern erfasste den vormals blauen Planeten. Der in der Atmosphäre gasförmig gebundene Lebensspender Sauerstoff fiel als gefrorener Niederschlag zu Boden. Die Leben hervorbringende und erhaltende Schutzhülle legte sich wie ein heftiger Schneeregen auf die Oberfläche des Planeten.
Sie hatten sich alle getäuscht. Die Theorie, dass sich die Sonne als Roter Riese die Erde erst in über 6 Milliarden Jahren einverleiben würde, klang zu verlockend. Es schien beruhigend, so viel Zeit zu haben. In Wahrheit wusste die Menschheit nichts von ihrem Stern. Er war allen Theorien, allen Modellen der Umwandlung von Wasserstoff in Helium mittels Kernfusion zum Trotz einfach ausgegangen. Wie eine Glühbirne auf einer steilen Kellertreppe, die seit vielen Jahrzehnten pflichtbewusst ihren Dienst tut und einen dann, ganz plötzlich, im Stich und Dunkeln lässt. Das massereichste Objekt des Sonnensystems hatte von einer Sekunde auf die andere seine gesamte Masse verloren, so unvorstellbar das allen Überlebenden zunächst auch vorgekommen sein mochte. Als habe sich innerhalb der Sonne ein schwarzes Loch aufgetan und diese verschlungen, was von vielen Wissenschaftlern als wahrscheinlichste Erklärung für den Verlust der wärmenden und Licht spendenden Freundin angesehen wurde, auch wenn damit der Massenverlust nicht mal ansatzweise erklärt werden konnte. Sicher war nur: Das Sonnensystem existierte nicht mehr.
Wie Kinder, die keine Kraft mehr haben, sich am Karussell auf dem Spielplatz festzuhalten, flogen die Planeten aus ihrer Umlaufbahn. Die meisten von ihnen würde die Erde nie wieder sehen. Lediglich die Venus begleitete sie auf der Reise durch die Unendlichkeit des Alls. Die Göttin der Liebe, dieser unwirtliche, vormals von dichten Wolken überzogene Planet, hatte einen ähnlichen Kurs eingeschlagen. Ihre Fliehkräfte zeigten nach dem Erlöschen der Sonne nahezu in dieselbe Richtung, als habe das Universum der Erde eine vertraute Begleiterin an die Seite stellen wollen. Allerdings befand sich die Venus in einem Abstand von vielen Millionen Kilometern in, wenn man so wollte, Fallrichtung voraus. Andere ehemalige Nachbarn entfernten sich mit jeder Sekunde weiter von der Erde. Mit dem Ziffernblatt einer imaginären riesigen Uhr hinterlegt, die ehemalige Sonne im Zentrum und mit der Reiserichtung der Erde auf 12 Uhr, befand sich Merkur auf Kurs 10 Uhr, Saturn hatte Position zwischen 9 und 10 Uhr bezogen und Mars machte sich in Richtung 4 Uhr davon. Die Menschheit würde ihn, wie all die anderen alten Bekannten, in der Unendlichkeit des Weltalls verlieren. Die Chancen, dass je ein Mensch eine Leiter hinuntersteigen und dabei bedeutungsvolle Worte sagen würde, um kurz darauf seinen Fußabdruck auf dem Roten Planeten zu hinterlassen, lagen bei nahezu null Prozent. War dies nicht die nächste große Aufgabe gewesen, nachdem der Mond bereits zu nahe erschienen war?
Im Unterschied zu den Planeten des ehemaligen Sonnensystems schien der Mond die Erde nicht im Stich gelassen zu haben. Zu sehen war er mangels Sonnenlicht nicht mehr, aber er verdeckte gelegentlich den Blick auf die unzähligen Sterne da draußen, die weiterhin, unbeirrt von der Rebellion der Sonne, ihren Dienst taten.
Als sich mit Beginn des Jahres 2017 die Anzeichen erhärteten, dass die Menschheit in wenigen Wochen ohne Sonne existieren müsste, und die Regierungen dieser Welt im Eiltempo Forschungsprojekte vorangetrieben und heimlich mit dem Bau von Schutzanlagen begonnen hatten, waren die anderen Sterne des Weltalls die wichtigste Variable in der Gleichung des Überlebens. Sie würden solange durch das All treiben, bis sie eine neue Sonne in ihre Umlaufbahn ziehen und dem Leben auf Mutter Erde so eine zweite Chance geben würde.
Viel konnte auf einer solchen Reise geschehen, der Heimatplanet, dieses intergalaktische Reisemittel, könnte etwa mit anderen Himmelskörpern zusammenstoßen, Asteroiden oder Planeten. In der Tat kam die Erde im November des Jahres 2018 dem ebenfalls orientierungslos durchs All trudelnden Saturn, diesem Gasriesen mit seinen charakteristischen Ringen, in galaktischen Maßstäben gesprochen recht nahe. Eine Kollision war jedoch nicht zu befürchten. Es blieb bei einer minimalen Einflussnahme auf die Reiseroute der vereisten Heimat, die nicht weiter ins Gewicht fiel, und der traurigen Erkenntnis, dass man den von den anderen Sternen schwach erleuchteten Saturn nie wieder so nah beobachten würde können. Den meisten verbliebenen Erdbewohnern blieb dieser Anblick ohnehin verwehrt, da nur einige wenige Wissenschaftler über einen entsprechenden Anzug für den Außeneinsatz verfügten, um den dreistelligen Minusgraden standhalten zu können. Natürlich bestand auch die Möglichkeit, dass die Erde einer Sonne zu nahe kam und in einem apokalyptischen Feuerregen verglühen könnte. Oder bis in alle Unendlichkeit tiefgefroren durch das All trudeln würde. Die Gleichung des Überlebens besaß dermaßen viele Fragezeichen, dass sie sich vor der Katastrophe nicht vollständig aufstellen ließ.
Jede Nation veranlasste ihr eigenes Überlebensprogramm, in atemberaubender Geschwindigkeit wurden weltweit geheime unterirdische Komplexe in die Erde gegraben. Man versuchte, dem weiterhin Wärme spendenden Erdkern näher zu kommen. Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit galten einige Hundert Meter bereits als großer Erfolg und amortisierten sich durch einen wesentlich geringeren Heizaufwand. Am tiefsten hatten sich die Australier eingegraben, am untersten Punkt ihrer größten Anlage unterhalb von Sydney maß man bei fast 700 Metern Tiefe immerhin 27 Grad Celsius. Die Franzosen versuchten ihr Glück unter dem Meeresboden, die Chinesen hatten ganze Gebirgsketten ausgehöhlt, und irgendwo tief unter dem, was einst die Vereinigten Staaten von Amerika gewesen waren, befand sich ein gigantischer Weltraumhafen, dessen ehrgeizige Bewohner das Ziel einte, in den nächsten Jahrzehnten ein Mutterschiff bauen zu können, das sich einfach selbst eine neue Heimat im Universum suchen würde, ohne auf einen Zufall hoffen zu müssen.
So unterschiedlich die Pläne der Weltbevölkerung auch waren, sie einte, dass sie lediglich einer Minderheit vorbehalten blieben. In geheimen Auswahlverfahren waren Kandidaten zum bislang größten Vorhaben der Menschheit bestimmt worden, wobei die Rekrutierung vielfach einer Entführung gleichkam. Familien wurden getrennt, wer nicht kooperierte, verschwand und wurde nicht wieder gesehen. Jeder erfuhr nur das Nötigste, die meisten gingen unwissend in eine neue Zukunft. Wer geschwätzig war, wurde aus dem Verkehr gezogen. Zu groß war die Angst vor einer Massenpanik. Und so kam es, dass an jenem schicksalhaften Tag im März 2017 die meisten Bewohner dieser Erde einem Tag wie jedem anderen entgegengetreten waren. Es herrschten zwar unruhige Zeiten. Leute waren verschwunden, unerwartete Territorialkriege weltweit ausgebrochen, aber die Sonne ging wie jeden Tag auf, lachte vom Frühlingshimmel herab und man machte sich auf den Weg zur Arbeit. In Deutschland gab es vierzehn Schutzanlagen, die jeweils 5.000 Überlebenden Platz boten, und während draußen die Welt unterging, verfolgte die innerhalb von Sekunden auf eine Kleinstadt zusammengeschrumpfte Bevölkerung der ehemaligen Bundesrepublik über Funk die Geschehnisse mit einer seltsamen Mischung aus Erleichterung, Wut, Trauer und Hoffnungslosigkeit.
Mit der Zeit gewöhnte man sich an das neue Leben im Untergrund oder fand sich wenigstens damit ab. Physiker und Astronomen fütterten ihre Computer mit neu gewonnenen Daten und es bewahrheitete sich: Die Erde, scheinbar ziellos durch das All taumelnd, würde in der Sonne Elya-49 eine zweite nährende Mutter finden. Eine stabile Umlaufbahn, gemäßigte Temperaturen, denen der alten Erde recht ähnlich – das Überleben der Menschheit war gesichert. ELYA, das stand für »earthlings’ lives years ahead«, die 49 blieb ein Geheimnis der Entdeckerin der Sonne, einer chinesischen Astronomin, die von einem auf den anderen Moment Weltruhm erlangte. Spontane Freudenumzüge ergossen sich auch in Berlin-III in den unterirdischen Gängen und Versammlungshallen. »ELYA, ELYA«, rief der Chor freudig erregter Menschen. Die Marschrichtung war klar, jetzt hieß es, Zähne zusammenzubeißen und durchzuhalten. Daran änderte auch die Tatsache nicht mehr viel, dass man sich in der ersten Hochrechnung ohne Einbeziehung der sich ändernden Klimadaten um 156 Jahre verrechnet hatte. ELYA würde die Erde schonend auftauen wie ein gefrorenes Mittagessen im Kühlschrank. Der Mensch würde wieder auf dem Erdboden stehen, mit der linken Hand durch Getreidehalme fahren und die rechte, zur Faust geballt, gen Sonne strecken, wie es Plakate in den Anlagen so anschaulich verkündeten. Er musste sich nur etwas gedulden.
Insgesamt 35.627 kalte und dunkle Jahre lang.
Sechstes Kapitel
Erst die sanft unter seinem Gewicht nachgebende Matratze auf seiner Pritsche im Wohnbezirk D ließ ihn wahrhaben, wie müde er eigentlich war. Auf der Kante der Pritsche sitzend, fing Emil an, sich die Zähne zu putzen. Er starrte an die gegenüberliegende Wand. Das Zimmer, in dem er sich befand, maß etwa neun Quadratmeter und außer dem Pritschenhochbett, dem Waschbecken und einem aus Sperrholz hastig zusammengezimmerten Regal standen keine weiteren Möbel darin. Wo hätten sie die auch hinstellen sollen? Die Wände waren mit unzähligen Fotos behängt. Fotos aus vergangener Zeit. Sonnenbeschienene karibische Strände, Hannes mit einem Löwenbaby im Arm, Anna und Emil auf einer Brücke in Amsterdam, einander mit Bierdosen zuprostend. Fotos von Familienfeiern und Geburtstagspartys, auf denen die meisten der abgelichteten Personen eine Gemeinsamkeit hatten: Sie alle waren im März vor drei Jahren gestorben.
Laut offiziellem Belegungsplan der Anlage Berlin-III bewohnte Emil als leitender Arzt ein etwas größeres Einzelzimmer im Bezirk A. Kurz nach dem Einzug hatten sie beschlossen, daraus eine Art Bereitschaftszimmer zu machen. Das Bett wurde gegen zwei Pritschen eingetauscht, und wer von ihnen dreien im nahe gelegenen Labor zu tun hatte oder das Funkgerät für den Bereitschaftsdienst bei sich trug, versuchte dort nach getaner Arbeit Schlaf zu finden. Das Zimmer im Wohnbezirk D war also, je nach Arbeitsaufkommen, unterschiedlich belegt und ihr privates Refugium. Heute Nacht hatten sie ihm diesen Rückzugsort tief im Bauch der Anlage gerne überlassen, es war ein ereignisreicher Tag gewesen und Emil brauchte dringend ein paar Stunden Schlaf. Vielleicht, so ihre Hoffnung, würde mit ausreichender Ruhe auch seine Erinnerung wieder Einzug in die Windungen seines Gehirns halten.
Er stand auf, um sich den Mund auszuspülen, in diesem Moment verschwand der kleine Lichtstreifen, der unter der Sperrholztür durchgefallen war. 23 Uhr, Nachtruhe, strikte Ausgangssperre in Zeiten, in denen vermehrt schwarze Handabdrücke im Umlauf waren. Einige Sekunden später wurde auch die einzige Lichtquelle in seinem Zimmer, eine fleckiges Licht werfende Deckenlampe, automatisch gedimmt. Draußen verstummten die Gespräche der Bewohner, die die Zeit vergessen hatten. Schnelle Schritte, Türen schlugen zu, in der Ferne fing ein Baby an zu schreien. Wer es nicht mehr in die Waschräume geschafft hatte, musste sich nun in das Waschbecken oder einen bereitstehenden Eimer erleichtern oder darauf hoffen, auf dem Weg zur Toilette keiner Patrouille des Wachschutzes über den Weg zu laufen. Prompt meldete sich Emils volle Blase. Er hatte zum Glück immer seinen Bezirk-A-Ausweis und die Ausrede eines wichtigen medizinischen Notfalls parat, nervig waren nächtliche Diskussionen mit dem Wachschutz aber in jedem Fall und gerade nach dem heutigen Tag konnte er sehr gut darauf verzichten.
Auf Zehenspitzen schlich er aus der Tür seiner kargen Behausung. Vorsichtig warf er einen Blick nach unten. In einer riesigen Spirale wanden sich die Treppen in diesem imposanten Gewölbe hinab. Tür reihte sich an Tür, schemenhaft durch die spärliche Notbeleuchtung in Szene gesetzt. Knapp 2.000 Bewohner zählte der Wohnbereich D. Über und unter ihm nahm er in ausreichendem Abstand die Lichtkegel zweier Taschenlampen wahr. Es blieb ihm genügend Zeit, den Waschraum zwölf Türen weiter zu erreichen – er zählte im Halbdunkeln sicherheitshalber noch einmal nach – und wieder in sein Bett zu schlüpfen. Die Luft war kalt, es roch nach zu vielen Menschen auf zu wenig Raum. Emil bereute es, sich die Schuhe nicht wieder angezogen zu haben, der steinerne Boden war kalt und schlüpfrig. Er konzentrierte sich darauf, auf den ausgelegten Bodenbrettern zu bleiben.
Es muss auf diesem rebellischen Toilettengang gewesen sein, dass Emil eine Möglichkeit in den Sinn kam, sich an das mysteriöse Passwort zu erinnern. Er war von einer inneren Sicherheit erfüllt, dass auch ein nun ausreichender Schlaf nicht in der Lage sein würde, ihm seine Erinnerung zurückzugeben.
»Was ist die wichtigste Erkenntnis im Leben?«
Wiederholt hatten sie mögliche Kennwörter in das blinkende Eingabefeld getippt. Ohne Erfolg, der Computer hatte ihnen irgendwann sogar unmissverständlich klargemacht, dass sie aufgrund der vielen Fehleingaben nur noch einen Versuch haben würden, ansonsten würden alle Daten unwiderruflich gelöscht werden. Was auch immer er hatte schützen wollen, es schien von äußerster Wichtigkeit zu sein. Der Algorithmus hinter einem SecuScienceGate-Passwort war unknackbar, weder durch entsprechende Programme noch durch das Auslesen der Hardware. Selbst die leistungsfähigsten Computer der vorkatastrophlichen Welt wären einige Tausend Jahre damit beschäftigt gewesen, das Passwort mittels Trial-and-Error-Methoden herauszubekommen. Solche Computer, geschweige denn die dafür notwendige Zeit, hatten sie nicht. Er brauchte dringend Zugriff auf seine Forschungsdaten, auf seine Kommunikationsprotokolle, auf sein digital gespeichertes Gehirn zu einem Zeitpunkt, bevor die offensichtlich teilweise bestehende Unterversorgung seiner Neuronen mit Sauerstoff aus seinem Erinnerungsvermögen einen Schweizer Käse gemacht hatte.
Barfuß zurück in sein Zimmer schleichend, fasste er den Entschluss, es mit luziden Träumen zu versuchen. Träume, bei denen sich der Träumende bewusst ist, zu träumen, und so das Drehbuch seiner Nacht selbst schreiben konnte. Er würde sein Leben chronologisch auf die Frage nach der wichtigsten Erkenntnis abklopfen und so das Passwort rekonstruieren. Wenn dies einigermaßen gut funktionierte, würde er es eventuell auch wagen können, sich direkt in die vergessenen Stunden zu begeben. Dann entfiel das zeitaufwendige Durchkauen seines bisherigen Lebens. Es musste doch möglich sein, sich wieder an die Stelle zu träumen, an der er dieses verdammte Passwort eingerichtet hatte. Was sollte das überhaupt sein mit der wichtigsten Erkenntnis im Leben? So spirituell und philosophisch hatte er sich gar nicht eingeschätzt. Alles in allem schien es eine halbwegs sinnvolle Lösung seines Problems zu sein.
Eine andere Chance hatten sie im Moment ohnehin nicht. Den Zustand luziden Träumens erreichte man durch mehrmonatiges Üben von Meditationstechniken oder die entsprechende Mischung cholinerger Medikamente mit dual wirksamen Antidepressiva. Zumindest theoretisch. Emil hatte das zwar noch nie ausprobiert, aber er würde gleich morgen, im bis dahin hoffentlich wieder provisorisch eingerichteten Labor, eine entsprechende Lösung herstellen. Das sollte recht einfach zu bewerkstelligen sein. Seine Freunde hatten bereits vorab mit ihm vereinbart, eine Nachtschicht für die benötigte Aufräumaktion einzulegen.
Er löschte das gedimmte Licht und zog sich die Bettdecke unter das Kinn. Wenn er sich morgen früh immer noch nicht erinnern würde, dann musste es halt so gehen. Unweigerlich dachte er vor dem Einschlafen an seinen früheren Nachbarn im Studentenwohnheim. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Indien war dieser geradezu versessen darauf, luzides Träumen zu erlernen. Und allen seinen propagierten Sicherheitsmaßnahmen zum Trotz – »Im Traum sieht man alles schwarz-weiß« oder »Wenn man im Traum auf einen Lichtschalter drückt, passiert nichts« – eines Morgens fand man seine Leiche im Innenhof liegen. Das Fenster zu seiner Wohnung im siebten Stock war geöffnet. Noch am Abend hatte er in der Kellerbar des Wohnheims einem Kommilitonen anvertraut, daran zu arbeiten, im Traum fliegen zu können.
Immerhin darin bestand für Emil keine Gefahr. Fenster gab es in ganz Berlin-III keine.
Siebtes Kapitel
Weihnachten im Krankenhaus. Mama braucht Zeit, das Weihnachtszimmer vorzubereiten. Papa röntgt unsere Kuscheltiere. Wenn ich groß bin, will ich auch Arzt werden, auch wenn ich noch nicht genau weiß, ob das »Z« im Wort vor oder hinter dem »T« steht. Mein Kuschellöwe hat anscheinend gar keine Knochen, enttäuschend. Ich darf im Malprogramm dieses klobigen Computers etwas mit der Maus krakeln, spannend. Der Ausdruck sieht seltsam aus, warum hat das Papier Löcher an der Seite?
Sie ist in einen dieser langhaarigen Jungs der »Kelly Family« verknallt und ich in sie. Auf der Freizeit in Holland versuchen wir, im Schwimmbecken unter Wasser zu knutschen. Klappt nicht ganz so gut. Jemand hat im Reisebus diese Bonbons dabei, die einem angeblich die Haarfarbe verändern. Ich lasse meins heimlich zwischen die Sitze fallen.
Urlaub in Südfrankreich. Ich sitze hinter meinem Vater auf der Rückbank, die rechte Seite gehört den Frauen der Familie: Mama vorne, neben mir meine Schwester. Aus den Lautsprechern tönt Gianna Nannini. Ich bin neun Jahre alt und kann nur »profumo« mitsingen.
Opa ist tot. Zuletzt hatte ohnehin nur noch eine Idee von ihm existiert, scheiß Alzheimer. Der schlimmste Moment? Als er vergisst, wer ich bin. Ich bewundere meine Oma, sie ist so stark. Wie schlimm muss es erst für sie sein, ihren Mann so zu sehen? Diesen wundervollen und intelligenten Menschen.
Sie überlebt auch meine andere Oma, ist im Kopf fit wie ein Turnschuh. Omas Stirn fühlt sich so kalt an. Das erste Mal allein mit einem toten Menschen. Wieder Alzheimer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und gebe ihr einen Kuss auf ihre kalte Stirn. Draußen wartet meine noch lebende Oma. Ich habe Angst um sie.
Eine selbsttönende Brille ist überhaupt nicht so praktisch, wie Mama sagt. Bei fehlender Sonne, also die meiste Zeit, ist sie gelb. »Piss-Auge« sagen sie zu mir. Das tut weh. Mama kann nichts dafür, sie meint es gut. Ich sage ihr nicht, was die anderen zu mir sagen, ich versuche, das mit mir selbst auszumachen.
Ich befinde mich in meinem Labor in Berlin-III. Die Sonne existiert nicht mehr. Ich habe etwas Wichtiges herausgefunden. Ich habe – sein Körper bäumte sich heftig auf, er schlug rhythmisch mit den Armen und Beinen um sich, ganz so als habe er einen Krampfanfall. Er wachte nicht auf, auch wenn er sich zwischenzeitlich sehnlichst wünschte aufzuwachen. Er verlor kurz die Kontrolle, dann hatte er sich wieder gefangen. Die Chronologie gab ihm Sicherheit. Er war jetzt wieder zwölf Jahre alt.
Gleich nach unserer Ankunft in Bayern müssen wir natürlich skaten gehen. Blöd nur, dass ich dabei böse auf die Fresse falle und mit einer blutenden Hand zurück zur Jugendherberge komme. Auf meinem Shirt steht ironischerweise »Aggressiver Skater«. Der Pfarrer ist natürlich nicht sehr begeistert. Ich werde zu einem nahen Tierarzt gebracht und dort genäht und das, obwohl die Betäubung noch gar nicht richtig wirkt. Einen Vorteil hat die Aktion aber auf jeden Fall, unser Zimmer ist sofort im Gespräch.
Ihm, einem meiner engsten Freunde, passt das alles natürlich überhaupt nicht. Er sieht uns Händchen halten und erwidert es mit einem strafenden Blick. Aber sie ist älter als ich, wunderschön und riecht nach Vanille-Deo. Ich finde, ich bin jetzt auch mal an der Reihe, glücklich zu sein. Wir fahren mit dem Bus zurück zur Jugendherberge und halten die ganze Zeit Händchen. Dann legen wir uns in mein Bett, hören »My heart will go on« und küssen uns zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung vom Küssen, ich will ihr nur einen Schmatzer auf den Mund geben, da bewegt sie ihre Lippen. Wir schaffen vierzig Sekunden mit Zunge, ich schaue ganz genau auf die Uhr.
Am Abend setzt er sich ans Fenster, betrinkt sich mit einem Schluck Wodka und will aus dem Fenster des zweiten Stockes springen, um sich umzubringen. Ich muss darüber herzlich lachen. Mit dem Lachen ist jedoch spätestens dann Schluss, als er mir mitten in der Nacht ein Messer an den Hals hält und droht, mich aufzuschlitzen. Heldenhaft und mit der festen Überzeugung, dass sie ewig um mich trauern würde, sage ich: »Dann bring mich halt um! Davon bekommst du sie auch nicht zurück!« Die Situation eskaliert, er drückt mich an den Schrank. Das Messer ist bloß ein Füller, die Situation klärt sich und er knutscht später mit ihrer Freundin herum. Wir bleiben sehr gute Freunde.
In der Woche danach kaufe ich mir sofort den Titanic-Soundtrack und schreibe ihr einen Brief. Ihre Antwort macht unmissverständlich klar: Sie will nicht mit mir zusammen sein. Niemand wird je erfahren, dass ich mit der schönsten Frau der Schule nächtelang geknutscht habe. Es würde sowieso keiner glauben, sie halten mich nach wie vor für einen »Streber«. Ich muss oft an sie denken. Zum Glück riecht das Eichhörnchen-Kuscheltier meiner Schwester noch wochenlang nach Vanille. Ich habe es ziemlich ordentlich damit eingesprüht.
Warum muss ich mir diesen Film mit meinen Freunden anschauen? Wurde die Altersfreigabe in Deutschland nicht deswegen erfunden? Um die seelische Entwicklung von Jugendlichen nicht zu gefährden? Wird dieser Film negative Auswirkungen auf meine geistige Entwicklung haben? Warum denke ich überhaupt über so was nach? Bin ich so »uncool«, wie alle sagen, oder sind mir einfach andere Dinge im Leben wichtiger? Immerhin rauchen wir nicht und trinken keinen Alkohol, davor habe ich nämlich noch mehr Angst als vor diesem Film. Als die Frau von der Kettensäge zerfleischt wird, schließe ich die Augen. Hoffentlich merken es die anderen nicht.
Der Computer ist mein ständiger Lebensbegleiter. Ich kenne fast niemanden in meiner Chatliste, aber rede mit ihnen, als wären es alte Freunde. Ich baue Level für »Half-Life« und Dienstagabend ist Training mit den Jungs vom Clan. Wir sind richtig gut. Ich habe auch noch ein paar wenige reale Freunde. Unsere LAN-Partys sind legendär. Wir zocken ganze Nächte durch. Es gibt sehr viel Cola, diese Gummibärchen, die nach verschiedenen Früchten aussehen und natürlich Pizza. Das Netzwerk rauscht spätestens dann immer ab, wenn wir anfangen, Pornos auszutauschen, und mindestens einer von uns muss Windows neu installieren, damit es wieder läuft.
Ich befinde mich in der Anlage Berlin-III. Ich bin der leitende Arzt dieser Einrichtung. Ich ändere das Passwort meines Computers in – erneut ein heftiger Anfall – ich ändere es in – Emil schlug wie wild um sich. Er sah all die wichtigen Menschen in seinem Leben, ihre Schädel platzten auseinander, rotes, halb gefrorenes Blut ergoss sich über ihn. Es war zwecklos, sein Verstand wehrte sich heftig gegen das gedankliche Stöbern in der jüngeren Vergangenheit, er musste chronologisch vorgehen und das Passwort auf diese Weise entschlüsseln. Was für eine Prüfung hatte er sich da selbst auferlegt? Ihm kam kurz der Verdacht, er habe sich gezwungen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Sein Laken triefte vor Schweiß, aber er war nicht aufgewacht und gewann nun langsam wieder die Kontrolle über seine Träume.
Klassenabschlussfahrt, es geht nach Berlin. Ich bestelle mir in der Kneipe vor versammelter Mannschaft einen Klopfer, um meinen Mut zu zeigen. Ich kriege den Deckel nicht ab, so sehr zittere ich. Immerhin lerne ich dort eine richtig gute Freundin kennen. Ich schlafe bei ihr im Mädchenzimmer, habe keine Lust auf die Jungs in meinem Zimmer. »You are snoring like a big, fat, old ox, but you are as nice as a flower in the wind.« Mit diesem Satz bricht das Eis zwischen uns. Wir sind beide Außenseiter in der Klasse. Sie kommt aus Südosteuropa, ich aus dem seltsamen Land in meinem Kopf.
Achtes Kapitel
»Du hast heute Nacht was noch mal gemacht?«, Anna verschluckte sich fast an ihrem Löffel Grießbrei, der die gleiche Farbe wie die Wand der Kantine in D-Mitte aufwies: drückendes Beige. »Luzides Träumen.«
Emil erklärte es ihnen.
Wie zu erwarten, hatte er sich am gestrigen Morgen trotz ausreichend langem Schlaf nicht erinnern können und deswegen in der vergangenen Nacht das Experiment gewagt. Er litt noch etwas unter den Nebenwirkungen seines Medikamentencocktails: Seine Pupillen waren klein, er schwitzte, sein Magen spielte etwas verrückt und er hatte leichte Kopfschmerzen. Alles vernachlässigbar verglichen mit dem Effekt, den dieser Cocktail hatte. Mit etwas Eingewöhnung hatte er sich durch sein bisheriges Leben blättern können, als habe er in der Nacht heimlich Tagebuch unter der Bettdecke gelesen. Viele Dinge hatte er bereits vergessen, nun waren ihm diese Erinnerungen wieder präsent. Er musste sich jedoch zwingen, chronologisch vorzugehen. Heute Nacht hatte er zwei Mal versucht, in die unmittelbare Vergangenheit zu springen und war von heftigen körperlichen Reaktionen und Albträumen daran gehindert worden. Das Vergessen schien sehr tief in ihm verwurzelt zu sein, er musste die Frage nach der wichtigsten Erkenntnis im Leben wohl oder übel durch tatsächliches Wissen beantworten, anstatt sich selbst im Traum beim Eingeben des Passworts über die Schulter zu spicken. Ihm kam es wirklich so vor, als habe er sich mit diesem Passwort zwingen wollen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Was hatte das alles mit seiner aktuellen Situation zu tun? Es hatte ihn erschrocken, seinem früheren Ich wieder ins Auge zu blicken. Er war schon ein seltsamer Mensch gewesen und sicherlich hatte seine Jugend Einfluss auf seinen Charakter gehabt. Aber wie konnte ihm ein verpickelter Streber mit gelber Brille dabei helfen, sich an ein Passwort der Postapokalypse zu erinnern?
»Deswegen warst du gestern noch mal im Labor, verstehe«, unterbrach Hannes seine Gedanken und schob die Reste seines Frühstücks von sich weg. »Wann gibt es eigentlich mal wieder Eier? Ich kann diese Pampe hier echt nicht mehr sehen!«
»Amélie, ihr wisst schon, die mit dem Suizidversuch, hat mir erzählt, sie kenne jemanden, der unten in F arbeitet. Angeblich läuft dort gerade einiges schief«, sagte Emil.
»Das wundert mich nicht«, entgegnete Hannes. »Eine super Idee, einen Haufen depressiver Landeier unter die Erde zu sperren und ihnen eine Harke in die Hand zu drücken!«
In der Tat schienen die Bauern und Landwirte die größten Schwierigkeiten mit ihrem postapokalyptischen Arbeitsplatz zu haben. Sie waren zeitlebens nordfriesische Salzwiesen, bayrische Kuhställe und mitteldeutsche Getreidefelder mit einer PS-starken Erntemaschine unter sich gewöhnt, nun arbeiteten sie in Gewächshäusern zweihundert Meter unter dem eisigen Erdboden. Das schlug sich auf die Psyche nieder, weswegen sie häufig zu den psychiatrischen Sprechstunden kamen. Berlin-III besaß einige Hirseplantagen, diese Getreidesorte wuchs bislang am besten unter den künstlichen Höhensonnen. Weizenprodukte waren eher die Ausnahme, Brot gab es sowieso nur an Feiertagen. Soja gewann nach leichten Startschwierigkeiten in der Anzucht so langsam die Oberhand, die Roggensetzlinge waren wenige Wochen nach der Katastrophe an Wurzelfäule eingegangen. Champignons, Tomaten und Gurken bildeten die überschaubare Gemüseauswahl und außer nach Essig und Mehl schmeckenden Äpfeln gab es zurzeit keine weiteren Zutaten für einen Obstsalat. Ganze zwei Dutzend Kühe, drei Bullen, zehn Schweine, fünfzig Hühner und fünf Hähne hatte man vor dem Kältetod bewahrt. Der Farmbezirk F bot allerdings keine Bauernhofidylle, in den Tierverschlägen war es dunkel und eng, der Geruch nach Ausscheidungen lag beißend in der Luft und die sogenannten Gewächshäuser erinnerten eher an vorkatastrophliche illegale Cannabisplantagen, wie sie hin und wieder in der Zeitung aufgetaucht waren.
Immerhin, das System schien zu funktionieren, der von den Pflanzen produzierte Sauerstoff wurde der in der Anlage zirkulierenden Atemluft zugesetzt, gleichzeitig wurde Kohlenstoffdioxid entfernt. Man kompensierte so den aufgrund der verschwundenen Atmosphäre fehlenden Sauerstoff außerhalb der Anlage und die daraus notwendig gewordenen sehr energieaufwendigen Lösungsverfahren aus den Eisschichten, in die sich der Sauerstoff nach der Katastrophe geflüchtet hatte. Natürlich versorgten der Farmbezirk und die in Bezirk E nachgeschalteten Verarbeitungsbetriebe die 5.000 Menschen vor allem mit Nahrungsmitteln. Jeder Bewohner bekam zwei Mahlzeiten am Tag, Zwischenmahlzeiten und Sonderwünsche erfüllten die Marktstände in den unteren Rundgängen der Wohnbereiche. Die Hühner schienen aktuell nicht sonderlich zum Eierlegen gestimmt zu sein. Hannes würde später die Marktstände nach dem ebenso kostbaren wie zerbrechlichen Lebensmittel absuchen müssen.
Hannes graute davor, mit einem dieser Sonderlinge um seine schmerzlich vermisste Frühstückszutat feilschen zu müssen. Die Leute des F-Bezirks waren in seinen Augen verkappte Traditionalisten, die den Sprung in die neue Zeitrechnung mehr schlecht als recht bewältigt hatten. Kürzlich hatten sie doch tatsächlich das offizielle Gesuch gestellt, Gewehre zu erhalten, um einen Schützenverein gründen zu können. Das musste man sich mal vorstellen. Sammler war von der Idee, den Farmern ein paar Gewehre zu überlassen, natürlich nicht sehr angetan gewesen. Waffen gab es in Berlin-III aus gutem Grund nur für den Wachschutz. Hannes hätte zu gerne Sammlers Gesicht beim Ablehnen dieser Anfrage gesehen.
»Hast du ihr eigentlich die Geschichte von dem Typen aus unserem Wohnheim erzählt, der im Traum dachte, er könne fliegen und dann aus dem Fenster gesprungen ist?« Hannes nickte in Richtung von Anna. Er wirkte durchaus besorgt um seinen Freund.





























