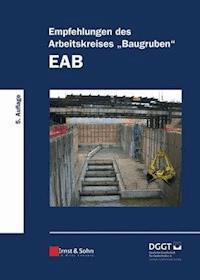Inhaltsverzeichnis
Mitglieder des Arbeitskreises „Baugruben“
Vorwort
Benutzerhinweise
1 Allgemeines
1.1 Bautechnische Voraussetzungen für die Anwendung der Empfehlungen (EB 1)
1.2 Maßgebende Vorschriften (EB 76)
1.3 Sicherheitskonzept (EB 77)
1.4 Grenzzustände (EB 78)
1.5 Stützung von Baugrubenwänden (EB 67)
1.6 Planung und Prüfung von Baugruben (EB 106)
2 Grundlagen für die Berechnung
2.1.Einwirkungen (EB 24)
2.2 Bodenkenngrößen (EB 2)
2.3 Erddruckneigungswinkel (EB 89)
2.4 Teilsicherheitsbeiwerte (EB 79)
2.5 Allgemeine Festlegungen für den Ansatz von Nutzlasten (EB 3)
2.6 Nutzlasten aus Straßen- und Schienenverkehr (EB 55)
2.7 Nutzlasten aus Baustellenverkehr und Baubetrieb (EB 56)
2.8 Nutzlasten aus Baggern und Hebezeugen (EB 57)
3 Größe und Verteilung des Erddruckes
3.1 Abhängigkeit der Erddrucklast von der gewählten Bauweise (EB 8)
3.2 Größe der Gesamtlast des aktiven Erddruckes bei unbelasteter Geländeoberfläche (EB 4)
3.3 Verteilung des aktiven Erddruckes bei unbelasteter Geländeoberfläche (EB 5)
3.4 Größe der Gesamtlast des aktiven Erddruckes aus Nutzlasten (EB 6)
3.5 Verteilung des aktiven Erddruckes aus Nutzlasten (EB 7)
3.6 Überlagerung von Erddruckanteilen bei belasteter Gelände-oberfläche (EB 71)
3.7 Ermittlung des Erdruhedruckes (EB 18)
3.8 Erddruckansatz in Rückbauzuständen (EB 68)
4 Allgemeine Festlegungen für die Berechnung
4.1 Nachweis der Standsicherheit (EB 81)
4.2 Allgemeines zu den Berechnungsverfahren (EB 11)
4.3 Ermittlung und Nachweis der Einbindetiefe (EB 80)
4.4 Ermittlung der Schnittgrößen (EB 82)
4.5 Anwendung des Bettungsmodulverfahrens (EB 102)
4.6 Anwendung der Finite-Elemente-Methode (EB 103)
4.7 Nachweis der Vertikalkomponente des mobilisierten Erdwiderstandes (EB 9)
4.8 Nachweis der Abtragung von Vertikalkräften in den Untergrund (EB 84)
4.9 Standsicherheitsnachweise für ausgesteifte Baugruben in Sonderfällen (EB 10)
4.10 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (EB 83)
4.11 Zulässige Vereinfachungen im Grenzzustand GEO-2 bzw. STR (EB 104)
5 Berechnungsansätze für Trägerbohlwände
5.1 Lastbildermittlung für Trägerbohlwände (EB 12)
5.2 Lastfiguren für gestützte Trägerbohlwände (EB 69)
5.3 Bodenreaktionen und Erdwiderstand bei im Boden frei aufgelagerten Trägerbohlwänden (EB 14)
5.4 Fußeinspannung bei Trägerbohlwänden (EB 25)
5.5 Gleichgewicht der Horizontalkräfte bei Trägerbohlwänden (EB 15)
6 Berechnungsansätze für Spundwände und Ortbetonwände
6.1 Lastbildermittlung für Spundwände und Ortbetonwände (EB 16)
6.2 Lastfiguren für gestützte Spundwände und Ortbetonwände (EB 70)
6.3 Bodenreaktionen und Erdwiderstand bei im Boden frei aufgelagerten Spundwänden und Ortbetonwänden (EB 19)
6.4 Fußeinspannung bei Spundwänden und Ortbetonwänden (EB 26)
7 Verankerte Baugrubenwände
7.1 Größe und Verteilung des Erddruckes bei verankerten Baugrubenwänden (EB 42)
7.2 Nachweis der Kraftübertragung von der Verankerung auf das Erdreich (EB 43)
7.3 Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge (EB 44)
7.4 Nachweis der Geländebruchsicherheit (EB 45)
7.5 Maßnahmen gegen mögliche Bewegungen von verankerten Baugrubenwänden (EB 46)
8 Baugruben mit besonderem Grundriss
8.1 Baugruben mit kreisförmigem Grundriss (EB 73)
8.2 Baugruben mit ovalem Grundriss (EB 74)
8.3 Baugruben mit rechteckigem Grundriss (EB 75)
9 Baugruben neben Bauwerken
9.1 Bautechnische Maßnahmen bei Baugruben neben bestehenden Bauwerken (EB 20)
9.2 Berechnung der Baugrubenumschließung mit aktivem Erddruck bei Baugruben neben Bauwerken (EB 21)
9.3 Ansatz des aktiven Erddruckes bei großem Abstand der Bebauung (EB 28)
9.4 Ansatz des aktiven Erddruckes bei kleinem Abstand der Bebauung (EB 29)
9.5 Berechnung der Baugrubenumschließung mit erhöhtem aktivem Erddruck (EB 22)
9.6 Berechnung der Baugrubenumschließung mit Erdruhedruck (EB 23)
9.7 Gegenseitige Beeinflussung gegeneinander ausgesteifter Baugrubenwände bei Baugruben neben Bauwerken (EB 30)
10 Baugruben im Wasser
10.1 Allgemeines zu Baugruben im Wasser (EB 58)
10.2 Strömungskräfte (EB 59)
10.3 Baugruben mit abgesenktem Grundwasser (EB 60)
10.4 Nachweis der Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch (EB 61)
10.5 Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwimmen (EB 62)
10.6 Standsicherheitsnachweis für Baugrubenwände im Wasser (EB 63)
10.7 Konstruktion und Bauausführung bei Baugruben im Wasser (EB 64)
10.8 Wasserhaltung (EB 65)
10.9 Überwachungsmaßnahmen bei Baugruben im Wasser (EB 66)
11 Baugruben in nicht standfestem Gebirge
11.1 Allgemeine Festlegungen für Baugruben in nicht standfestem Gebirge (EB 38)
11.2 Größe des Gebirgsdruckes (EB 39)
11.3 Verteilung des Gebirgsdruckes (EB 40)
11.4 Belastbarkeit des Gebirges durch Auflagerkräfte am Wandfuß (EB 41)
12 Baugruben in weichen Böden
12.1 Anwendungsbereich der Empfehlungen EB 91 bis EB 101 (EB 90)
12.2 Böschungen in weichen Böden (EB 91)
12.3 Verbaukonstruktionen in weichen Böden (EB 92)
12.4 Bauvorgang bei weichen Böden (EB 93)
12.5 Scherfestigkeit weicher Böden (EB 94)
12.6 Erddruck auf Baugrubenwände in weichen Böden (EB 95)
12.7 Bodenreaktionen bei Baugrubenwänden in weichen Böden (EB 96)
12.8 Berücksichtigung des Wasserdruckes bei weichen Böden (EB 97)
12.9 Ermittlung von Einbindetiefe und Schnittgrößen bei Baugruben in weichen Böden (EB 98)
12.10 Weitere Standsicherheitsnachweise bei Baugruben in weichen Böden (EB 99)
12.11 Wasserhaltungsmaßnahmen bei Baugruben in weichen Böden (EB 100)
12.12 Gebrauchstauglichkeit von Baugrubenkonstruktionen in weichen Böden (EB 101)
13 Nachweis der Tragfähigkeit der Einzelteile
13.1 Materialkenngrößen und Teilsicherheitsbeiwerte für Bauteilwiderstände (EB 88)
13.2 Tragfähigkeit der Ausfachung von Trägerbohlwänden (EB 47)
13.3 Tragfähigkeit von Bohlträgern (EB 48)
13.4 Tragfähigkeit von Spundbohlen (EB 49)
13.5 Tragfähigkeit von Ortbetonwänden (EB 50)
13.6 Tragfähigkeit von Gurten (EB 51)
13.7 Tragfähigkeit von Steifen (EB 52)
13.8 Tragfähigkeit des Grabenverbaues (EB 53)
13.9 Tragfähigkeit von Hilfsbrücken und Baugrubenabdeckungen (EB 54)
13.10 Äußere Tragfähigkeit von Bohlträgern, Spundwänden und Ortbetonwänden (EB 85)
13.11 Tragfähigkeit von Zugpfählen und Verpressankern (EB 86)
14 Messtechnische Überprüfung und Überwachung von Baugrubenkonstruktionen
14.1 Erfordernis und Zweck von Messungen und Überprüfungen (EB 31)
14.2 Messgrößen und Messverfahren (EB 32)
14.3 Planung von Messungen (EB 33)
14.4 Anordnung der Messstellen (EB 34)
14.5 Durchführung der Messungen und Weitergabe der Messergebnisse (EB 35)
14.6 Auswertung und Dokumentation der Messergebnisse (EB 36)
Anhang
A 1: Lagerungsdichte nichtbindiger Böden
A 2: Konsistenzbindiger Böden
A 3: Bodenkenngrößen nichtbindiger Böden
A 4: Bodenkenngrößen bindiger Böden
A 5: Geotechnische Kategorien für Baugruben
A 6: Teilsicherheitsbeiwerte für geotechnische Größen
A 7: Materialkennwerte und Teilsicherheitsbeiwerte für Bauteile aus Beton und Stahlbeton
A 8: Materialkennwerte und Teilsicherheitsbeiwerte für Bauteile aus Stahl
A 9: Materialkennwerte und Teilsicherheitsbeiwerte für Bauteile aus Holz
A 10: Erfahrungswerte für Mantelreibung und Spitzendruck von Spundwänden
Literatur
Kurzzeichen und Benennungen
Geometrische Größen
Baugrund- und Bodenparameter
Erddruck und Erdwiderstand
Sonstige Lasten, Kräfte und Schnittgrößen
Nachweise nach dem Teilsicherheitskonzept
Verschiedenes
Empfehlungen nach Nummern geordnet
Arbeitskreis AK 2.4 „Baugruben“ der
Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V.
Obmann: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Achim Hettler
Lehrstuhl Baugrund-Grundbau
Technische Universität Dortmund
August-Schmidt-Straße 8, 44227 Dortmund
Titelbild: Baugrube für das Projekt Desy XFEL Injektorkomplex in Hamburg, ausgeführt von der Züblin Spezialtiefbau GmbH, 2009 bis 2010 (Foto: Meyerfoto)
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2012 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Rotherstr. 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publisher.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie als solche nicht eigens markiert sind.
Umschlaggestaltung: Design Pur GmbH
Herstellung: pp030 – Produktionsbüro Heike Praetor, Berlin
Satz: Beltz, Bad Langensalza GmbH, Bad Langensalza
Druck und Bindung: Strauss GmbH, Mörlenbach
5. ergänzte und erweiterte Auflage
Print ISBN: 978-3-433-02970-1
ePDF ISBN:978-3-433-60244-7
ePub ISBN: 978-3-433-60245-X
mobi ISBN: 978-3-433-60246-8
oBook: ISBN: 978-3-433-60247-6
Mitglieder des Arbeitskreises „Baugruben“
Zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Sammelveröffentlichung setzte sich der Arbeitskreis „Baugruben“ wie folgt zusammen:
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. A. Hettler, Dortmund (Obmann)
Dipl.-Ing. U. Barth, Mannheim
Prof. Dr.-Ing. K.-M. Borchert, Berlin
Dipl.-Ing. Th. Brand, Berlin
Dipl.-Ing. P. Gollub, Essen
Dipl.-Ing. W. Hackenbroch, Duisburg
Dipl.-Ing. R. Haussmann, Schrobenhausen
Dr.-Ing. M. Herten, Karlsruhe
Dipl.-Ing. H.-U. Kalle, Hagen
Univ.-Prof. (em.) Dr.-Ing. H. G. Kempfert, Hamburg
Dr.-Ing. St. Kinzler, Hamburg
Dr.-Ing. F. Könemann, Dortmund
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Ch. Moormann, Stuttgart
Dipl.-Ing. Ch. Sänger, Stuttgart
Dipl.-Ing. W. Vogel, München
Weitere Mitglieder des Arbeitskreises waren:
o. Prof. em. Dr.-Ing. H. Breth, Darmstadt
Dipl.-Ing. R. Briske (†), Horrem
Dipl.-Ing. H. Bülow, Berlin
Dipl.-Ing. G. Ehl, Essen
Dipl.-Ing. E. Erler (†), Essen
Dipl.-Ing. I. Feddersen, Karlsruhe
Dipl.-Ing. H. Friesecke, Hamburg
Dipl.-Ing. F. Gantke, Dortmund
Dipl.-Ing. E. Hanke, Eckental
Dipl.-Ing. Th. Jahnke (†), Köln
o. Prof. Dr.-Ing. H. L. Jessberger (†), Bochum
Dipl.-Ing. K. Kast (†), München
Dr.-Ing. H. Krimmer, Frankfurt
o. Prof. em. Dr.-Ing. E. h. E. Lackner (†), Bremen
Dr.-Ing. K. Langhagen, Dietzenbach
Dipl.-Ing. K. Martinek, München
Dipl.-Ing. H. Ch. Müller-Haude (†), Frankfurt/Main
o. Prof. Dr.-Ing. H. Nendza (†), Essen
Prof. Dr.-Ing. E. h. M. Nußbaumer, Stuttgart
Dipl.-Ing. E. Pirlet (†), Köln
Dr.-Ing. H. Schmidt-Schleicher, Bochum
Prof. Dr.-Ing. H. Schulz, Karlsruhe
Dipl.-Ing. E. Schultz, Bad Vilbel
o. Prof. Dr.-Ing. H. Simons (†), Braunschweig
Dipl.-Ing. H. H. Sonder, Berlin
Dr.-Ing. J. Spang (†), München
Dr.-Ing. D. Stroh, Essen
Prof. Dr.-Ing. K. R. Ulrichs (†), Essen
Dipl.-Ing. U. Timm, Mannheim
Univ.-Prof. Dr.-Ing. B. Walz (†), Wuppertal
Dipl.-Ing. K. Wedekind, Stuttgart
Prof. Dipl.-Ing. H. Wind (†), Frankfurt/Main
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. A. Weißenbach, Norderstedt (Obmann bis 2006)
Vorwort
Um einem erkennbar gewordenen dringenden Erfordernis Rechnung zu tragen, rief die Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau e. V. – heute Deutsche Gesellschaft für Geotechnik – im Jahr 1965 den Arbeitskreis „Tunnelbau“ ins Leben und übertrug dessen Leitung dem allseits geschätzten, allzu früh verstorbenen Prof. Dr.-Ing. J. Schmidbauer. Die umfangreichen Aufgaben dieses Arbeitskreises wurden auf die drei Arbeitsgruppen „Allgemeines“, „Offene Bauweise“ und „Geschlossene Bauweise“ aufgeteilt. Die Arbeitsgruppe „Offene Bauweise“ beschäftigte sich unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Anton Weißenbach zunächst nur mit den vordringlichen Fragen der Berechnung, Bemessung und Konstruktion von Baugrubenumschließungen. Als erstes Zwischenergebnis dieser Arbeitsgruppe veröffentlichte die Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau e. V. die „Empfehlungen zur Berechnung ausgesteifter oder verankerter, im Boden frei aufgelagerter Trägerbohlwände für Baugruben, Entwurf März 1968“.
Die Bearbeitung der Fragen, die mit der Berechnung, Bemessung und Konstruktion von Baugrubenumschließungen zusammenhängen, erwies sich im Laufe der Bearbeitungszeit als so umfangreich, dass sich die Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau e. V. entschloss, diesen Aufgabenbereich aus dem Arbeitsgebiet des Arbeitskreises „Tunnelbau“ herauszunehmen und einem eigenen Arbeitskreis „Baugruben“ zu übertragen, dessen personelle Besetzung mit derjenigen der früheren Arbeitsgruppe „Offene Bauweise“ weitgehend identisch war. Die erste Veröffentlichung mit dem Titel „Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben“ erschien in der Zeitschrift „Die Bautechnik“, Jahrgang 1970. Sie beruhte auf einer grundlegenden Umarbeitung, Neugliederung und Ergänzung der im Jahr 1968 veröffentlichten Vorschläge und umfasste 24 durchnummerierte Empfehlungen, die sich im Wesentlichen mit den Grundlagen der Berechnung von Baugrubenumschließungen, mit der Berechnung von Trägerbohlwänden, Baugrubenspundwänden und Ortbetonwänden sowie mit dem Einfluss einer Bebauung neben der Baugrube beschäftigten.
In der Folgezeit veröffentlichte der Arbeitskreis „Baugruben“ in zweijährigen Abständen neue und überarbeitete Empfehlungen. Als sich ein Bearbeitungsstand abzeichnete, der vorerst weitere Änderungen nicht mehr erwarten ließ, entschloss sich die Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau e. V., die in den Jahrgängen 1970, 1972, 1974, 1976, 1978 und 1980 der Zeitschrift „Die Bautechnik“ verstreuten 57 Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ zusammenzufassen und im Jahr 1980 der Fachwelt in geschlossener Form zur Verfügung zu stellen.
In der im Jahr 1988 vorgelegten 2. Auflage sind diese Empfehlungen zum Teil überarbeitet und darüber hinaus um weitere neun Empfehlungen zum Thema „Baugruben im Wasser“ ergänzt worden, die in der „Bautechnik“, Jahrgang 1984 im Entwurf veröffentlicht wurden, und um weitere zwei Empfehlungen zum Thema „Lastfiguren für gestützte Baugrubenwände“, die in der „Bautechnik“, Jahrgang 1987 veröffentlicht wurden. Weitere vier Empfehlungen ergaben sich durch die teilweise Neugliederung und durch das Bemühen um bessere Verständlichkeit. Die vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen wurden in einem Aufsatz in der „Bautechnik“, Jahrgang 1989, erläutert.
In der 3. Auflage aus dem Jahr 1994 sind einige Empfehlungen überarbeitet und drei neue Empfehlungen zum Thema „Baugruben mit besonderem Grundriss“ aufgenommen worden. Die Änderungen an den bereits bestehenden Empfehlungen sind in der „Bautechnik“, Jahrgang 1995, erläutert. Im gleichen Heft wurden auch die drei neuen Empfehlungen als Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt. Darüber hinaus ist in die 3. Auflage ein Anhang aufgenommen worden, in dem die wichtigsten Bestimmungen aus bauaufsichtlich eingeführten Normen enthalten sind, die für Standsicherheitsnachweise benötigt werden.
Gleichzeitig mit der Erarbeitung der 3. Auflage der EAB beteiligte sich der Arbeitskreis „Baugruben“ auch intensiv an der Umsetzung des neuen Teilsicherheitskonzeptes im Erd- und Grundbau. Dies lag zum einen daran, dass mehrere Mitglieder des Arbeitskreises „Baugruben“ auch im Arbeitsausschuss „Sicherheit im Erd- und Grundbau“, der die DIN V 1054-100 zu erarbeiten hatte, vertreten waren. Zum anderen wurde immer deutlicher erkennbar, dass die Baugrubenkonstruktionen weit mehr als andere Konstruktionen des Grundbaues von den neuen Regelungen betroffen waren. Insbesondere die Festlegung in dem europäischen Normentwurf EN 1997-1, wonach zwei Berechnungen durchzuführen waren – zum einen mit Anwendung der Teilsicherheitsbeiwerte auf die Scherfestigkeit, zum anderen mit Anwendung der Teilsicherheitsbeiwerte auf die Einwirkungen – war nicht hinnehmbar. Sie führte im Vergleich mit der bisherigen bewährten Praxis zu Ergebnissen, die teilweise deutlich größere Abmessungen zur Folge hatten, teilweise aber auch zu Ergebnissen, die auf der unsicheren Seite lagen. Demgegenüber stand als Gegenmodell der Entwurf der neuen DIN 1054, in dem die Teilsicherheitsbeiwerte in gleicher Weise auf die äußeren Einwirkungen sowie auf den Erddruck und auf die Bodenwiderstände anzuwenden waren, die mit der herkömmlichen Scherfestigkeit ermittelt worden sind. In der EAB-100, die ebenso wie die ENV 1997-1 und die DIN 1054-100 im Jahr 1996 erschienen ist, wurden die beiden Konzepte in der praktischen Anwendung vorgestellt und die Unterschiede deutlich gemacht. Damit sollte der Fachwelt die noch offenstehende Entscheidung zugunsten der deutschen Vorschläge erleichtert werden.
In der Folgezeit wurden zwei wichtige Entscheidungen getroffen: Zum einen wurde die EN 1997-1 in einer Form veröffentlicht, welche die Vorschläge der neuen DIN 1054 als eine von drei zulässigen Varianten enthält. Zum anderen wurde das Konzept der DIN 1054-100 insofern geändert, als die ursprünglich vorgesehene Überlagerung von Bemessungswerten des Erddruckes mit Bemessungswerten des Erdwiderstandes nicht mehr zugelassen wird, weil sich dieser Weg nicht mit dem Grundsatz der strikten Trennung von Einwirkungen und Widerständen vereinbaren lässt. Außerdem erhält man jetzt mit Ansatz von charakteristischen Einwirkungen am vorgegebenen System charakteristische Schnittgrößen und charakteristische Verformungen, mit der Folge, dass für den Nachweis der Tragfähigkeit und für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit in der Regel nur eine einzige Durchrechnung erforderlich ist. Die 4. Auflage der EAB aus dem Jahre 2009 stützte sich voll und ganz auf diese Festlegungen, erweiterte sie aber wie schon in der Vergangenheit um ergänzende Regelungen. Darüber hinaus wurden sämtliche Empfehlungen aus der 3. Auflage einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Neu hinzugefügt wurden Empfehlungen über die Anwendung des Bettungsmodulverfahrens und der Finite-Elemente-Methode (FEM) sowie ein neues Kapitel über Baugruben in weichen Böden. Diese waren bereits auf der Grundlage des Globalsicherheitskonzeptes in der „Bautechnik“, Jahrgang 2002 und 2003, der Fachwelt zur Stellungnahme vorgelegt worden. Mehrere, teils sehr umfangreiche Zuschriften wurden in der 4. Auflage berücksichtigt.
Nach Abschluss der 4. Auflage 2006 beendete Anton Weißenbach nach über 40 Jahren seine Tätigkeit als Obmann und schied zusammen mit weiteren langjährigen Mitgliedern aus dem Arbeitskreis aus.
In der Folgezeit war ein Schwerpunkt des Arbeitskreises Baugruben – nun unter Leitung des Unterzeichners – die Empfehlung EB 102 „Bettungsmodulverfahren“, die völlig überarbeitet 2011 in der Zeitschrift „Bautechnik“ der Fachöffentlichkeit als Entwurf vorgestellt wurde. Mit der sich abzeichnenden bauaufsichtlichen Einführung der Eurocodes wurde eine Anpassung der 4. Auflage der Empfehlungen an die Vorgaben der DIN EN 1997-1:2009 in Verbindung mit dem Nationalen Anhang DIN 1997-1/NA:2010-12 und den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 erforderlich. Alle Empfehlungen wurden gründlich überprüft, soweit erforderlich überarbeitet und an neue Erkenntnisse angepasst. Der erfahrene Anwender wird feststellen, dass die Änderungen in der vorliegenden 5. Auflage verhältnismäßig gering sind. Die meisten der seit Jahren bewährten Regelungen konnten erhalten bleiben, weil sich die Sicherheitsphilosophie gegenüber der 4. Auflage vom Grundsatz her nicht geändert hat.
Wesentlich überarbeitet wurde dagegen Kapitel 10 „Baugruben im Wasser“. Der Planer muss zukünftig ausführlicher als bisher z. B. auf Risiken aus Erosionsvorgängen, Anisotropie in der Durchlässigkeit und hydraulischem Grundbruch eingehen. Aufgrund der fortgeschrittenen Entwicklung in der Messtechnik und den gestiegenen Anforderungen wurde Kapitel 14 „Messtechnische Überprüfung und Überwachung von Baugrubenkonstruktionen“ völlig neu formuliert.
Ziel des Arbeitskreises „Baugruben“ ist es weiterhin, durch Bearbeitung vorliegender und durch Herausgabe weiterer Empfehlungen
a) Entwurf und Berechnung von Baugrubenumschließungen zu erleichtern,
b) Lastansätze und Berechnungsverfahren zu vereinheitlichen,
c) die Standsicherheit der Baugrubenkonstruktionen und ihrer Einzelteile sicherzustellen und
d) die Wirtschaftlichkeit der Baugrubenkonstruktionen zu verbessern.
Der Arbeitskreis „Baugruben“ dankt allen, die in der Vergangenheit durch Zuschriften oder auf andere Weise die Ausschussarbeit gefördert haben, und bittet auch für die Zukunft um diese Unterstützung.
A. Hettler
Benutzerhinweise
1. Die Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ sind Regeln der Technik. Sie sind als Ergebnis ehrenamtlicher technisch-wissenschaftlicher Gemeinschaftsarbeit aufgrund ihres Zustandekommens nach hierfür geltenden Grundsätzen fachgerecht und haben sich als „Allgemein anerkannte Regeln der Technik“ bewährt.
2. Die Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ stehen jedermann zur Anwendung frei. Sie bilden einen Maßstab für einwandfreies technisches Verhalten; dieser Maßstab ist auch im Rahmen der Rechtsordnung von Bedeutung. Eine Anwendungspflicht kann sich aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Verträgen oder aus sonstigen Rechtsgrundlagen ergeben.
3. Die Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ sind in aller Regel eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechtes Verhalten im Normalfall. Sie können nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende Maßnahmen geboten sein können. Es ist auch zu berücksichtigen, dass sie nur den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden Stand der Technik wiedergeben können.
4. Abweichungen von den vorgeschlagenen Berechnungsansätzen können im Einzelfall zweckmäßig sein, sofern sie durch entsprechende Nachweise, Messungen oder Erfahrungen begründet werden.
5. Durch das Anwenden der Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“ entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.
1
Allgemeines
1.1 Bautechnische Voraussetzungen für die Anwendung der Empfehlungen (EB 1)
Soweit in den einzelnen Empfehlungen nicht ausdrücklich andere Festlegungen getroffen werden, gelten sie unter folgenden bautechnischen Voraussetzungen:
1. Die Baugrubenwände sind auf ganzer Höhe verkleidet.
2. Die Bohlträger von Trägerbohlwänden sind so in den Boden eingebracht, dass ein dichter Anschluss an das Erdreich sichergestellt ist. Die Verkleidung bzw. Ausfachung kann aus Holz, Beton, Stahl, erhärteter Zement- Bentonit-Suspension oder verfestigtem Boden bestehen. Sie ist so eingebaut, dass ein möglichst gleichmäßiges Anliegen am Erdreich sichergestellt ist. Der Bodenaushub darf dem Einbohlen nicht in unzuträglichem Maße vorauseilen. Hierzu siehe DIN 4124.
3. Spundwände und Kanaldielen sind so in den Boden eingebracht, dass ein dichter Anschluss an das Erdreich sichergestellt ist. Eine Fußverstärkung der Bohlen ist zulässig.
4. Ortbetonwände sind als Schlitzwände oder als Bohrpfahlwände hergestellt. Ein unbeabsichtigter oder planmäßiger Abstand zwischen den Pfählen ist im Allgemeinen entsprechend Absatz 2 ausgefacht.
5. Steifen bzw. Anker sind im Grundriss rechtwinklig zur Baugrubenwand angeordnet. Sie sind so verkeilt oder vorgespannt, dass eine kraftschlüssige Verbindung mit der Baugrubenwand sichergestellt ist.
6. Ausgesteifte Baugruben sind auf beiden Seiten in gleicher Weise mit senkrechten Trägerbohlwänden, Spundwänden oder Ortbetonwänden verkleidet. Die Steifen sind waagerecht angeordnet. Das Gelände auf den beiden gegenüberliegenden Seiten einer ausgesteiften Baugrube weist etwa die gleiche Höhe, eine ähnliche Oberflächengestaltung und ähnliche Untergrundverhältnisse auf.
Treffen diese oder die in einzelnen Empfehlungen genannten Voraussetzungen nicht zu und liegen für solche Sonderfälle keine Empfehlungen vor, so schließt dies die Anwendung der übrigen Empfehlungen nicht aus. Es sind jedoch in diesen Fällen die sich aus den Abweichungen ergebenden Folgerungen zu untersuchen und zu berücksichtigen.
1.2 Maßgebende Vorschriften (EB 76)
1. Mit der bauaufsichtlichen Einführung von DIN EN 1997-1: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln (EC 7-1) wird in Deutschland die Berechnung und Bemessung in der Geotechnik in Verbindung mit dem zugehörigen Nationalen Anhang
– DIN EN 1997-1/NA: Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln
und
– DIN 1054: Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-1
geregelt. Diese drei aufeinander abgestimmten Normen sind textlich zusammengefasst im Handbuch Eurocode 7, Band 1.
Dabei ist der Nationale Anhang ein formales Bindeglied zwischen dem Eurocode EC 7-1 und dem nationalen Normenwerk. In diesem Nationalen Anhang wird angegeben, welches der zur Auswahl gestellten Nachweisverfahren und welche Teilsicherheitsbeiwerte im nationalen Bereich maßgebend sind. Nicht zulässig sind Anmerkungen, Erklärungen oder Ergänzungen zum Eurocode EC 7-1. Es darf aber angegeben werden, welche nationalen Regelwerke ergänzend anzuwenden sind. Die ergänzenden nationalen Regelungen dürfen dem Eurocode EC 7-1 nicht widersprechen. Darüber hinaus soll der Nationale Anhang keine Angaben wiederholen, die bereits im Eurocode EC 7-1 enthalten sind.
2. Darüber hinaus sind für Baugrubenkonstruktionen folgende Normen des Eurocode-Programms maßgebend:
DIN EN 1990 Eurocode 0:
Grundlagen der Tragwerksplanung
DIN EN 1991 Eurocode 1:
Einwirkung auf Tragwerke
DIN EN 1992 Eurocode 2:
Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbetonbauten
DIN EN 1993 Eurocode 3:
Entwurf, Berechnung und Bemessung von Stahlbauten
DIN EN 1995 Eurocode 5:
Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauten
DIN EN 1998: Eurocode 8:
Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben
3. Das Handbuch Eurocode 7, Band 1 regelt nur grundsätzliche Fragen der Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau. Es wird ergänzt durch die Berechnungsnormen, die, soweit erforderlich, auf das Teilsicherheitskonzept umgestellt worden sind. Für Baugrubenkonstruktionen sind insbesondere auch folgende Normen maßgebend:
DIN 4084:
Geländebruchberechnungen
DIN 4085:
Berechnung des Erddrucks
DIN 4126:
Schlitzwände – Nachweis der Standsicherheit
DIN 4093:
Bemessung von Abdichtungs- und Verfestigungskörpern
4. Die Normen für die Erkundung, Untersuchung und Beschreibung des Baugrundes sind von der Umstellung auf das Teilsicherheitskonzept nicht betroffen und somit weiterhin gültig in ihrer jeweils neuesten Fassung bzw. ersetzt durch Eurocode 7 sowie durch EN ISO Normen:
DIN EN 1997-2, Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Untergrunds
DIN EN 1997-2/NA: Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter – Eurocode 7 Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds
DIN 4020: Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke – Ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2
DIN 4023: Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen Aufschlüssen
DIN EN ISO 22475-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen – Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung, ersetzt DIN 4021 und DIN 4022
DIN EN ISO 14688-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden – Teil 1: Benennung und Beschreibung, ersetzt DIN 4022-1
DIN EN ISO 14688-2: Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden – Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen, ersetzt DIN 4022-1
DIN EN ISO 14689-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung – Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels – Teil 1: Benennung und Beschreibung, ersetzt DIN 4022-1
DIN EN ISO 22476-2: Rammsondierungen
DIN EN ISO 22476-3: Standard Penetration Test
DIN 4094-2: Baugrund – Felduntersuchungen – Teil 2: Bohrlochrammsondierung
DIN 18121 bis DIN 18137: Untersuchung von Bodenproben
DIN 18196: Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke
DIN 1055-2: Bodenkenngrößen
5. Das Handbuch Eurocode 7, Band 1 ersetzt nur den Berechnungsteil der bisherigen Normen DIN 4014 „Bohrpfähle“, DIN 4026 „Rammpfähle“, DIN 4125 „Verpressanker, Kurzzeitanker und Daueranker“ und DIN 4128 „Verpresspfähle (Ortbeton- und Verbundpfähle) mit kleinem Durchmesser“. An die Stelle des Ausführungsteils dieser Normen treten die neuen europäischen Normen der Reihe „Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten“:
DIN EN 1536:
Bohrpfähle
DIN EN 1537:
Verpressanker
DIN EN 1538:
Schlitzwände
DIN EN 12063:
Spundwandkonstruktionen
DIN EN 12699:
Verdrängungspfähle
DIN EN 12715:
Injektionen
DIN EN 12716:
Düsenstrahlverfahren
DIN EN 12794:
Betonfertigteile – Gründungspfähle
DIN EN 14199:
Mikropfähle
6. Nicht betroffen von der Umstellung auf europäische Normen und somit weiterhin für Baugrubenkonstruktionen maßgebend sind die Ausführungsnormen:
DIN 4095:
Dränung zum Schutz baulicher Anlagen
DIN 4123:
Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude
DIN 4124:
Baugruben und Gräben
1.3 Sicherheitskonzept (EB 77)
1. Abweichend vom ursprünglichen probabilistischen Sicherheitskonzept beruht das Sicherheitskonzept, dem sowohl die neue europäische Normengeneration als auch die neue nationale Normengeneration zugrundeliegt, nicht mehr auf Untersuchungen anhand der Wahrscheinlichkeitstheorie, z. B. dem Beta-Verfahren, sondern auf einer pragmatischen Aufspaltung der bisher gebräuchlichen Globalsicherheiten in Teilsicherheitsbeiwerte für Einwirkungen bzw. Beanspruchungen und Teilsicherheitsbeiwerte für Widerstände.
2. Grundlage für Standsicherheitsberechnungen sind die charakteristischen bzw. repräsentativen Werte für Einwirkungen und Widerstände. Der charakteristische Wert ist ein Wert, von dem angenommen wird, dass er mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit im Bezugszeitraum unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer des Bauwerkes oder der entsprechenden Bemessungssituation nicht über- oder unterschritten wird, gekennzeichnet durch den Index „k“. In der Regel werden charakteristische Werte aufgrund von Versuchen, Messungen, Rechnungen oder Erfahrungen festgelegt.
Veränderliche Einwirkungen können auch als repräsentative Werte angegeben werden, die berücksichtigen, dass nicht alle veränderlichen ungünstigen Einwirkungen gleichzeitig mit ihrem Maximalwert auftreten.
3. Wenn die Tragfähigkeit in einem bestimmten Querschnitt der Baugrubenwand oder in einer Berührungsfläche zwischen der Baugrubenwand und dem Baugrund nachgewiesen werden muss, dann werden die Beanspruchungen in diesen Schnitten benötigt:
– als Schnittgrößen, z. B. Normalkraft, Querkraft, Biegemoment,
– als Spannungen, z. B. Druck-, Zug-, Biegespannung, Schub- oder Vergleichsspannung.
Darüber hinaus können weitere Auswirkungen von Einwirkungen auftreten:
– als Schwingungsbeanspruchungen oder Erschütterungen,
– als Veränderungen am Bauteil, z. B. Dehnung, Verformung oder Rissbreite,
– als Lageveränderungen der Baugrubenwand, z. B. Verschiebung, Setzung, Verdrehung.
4. Beim Baugrund wird zwischen zwei Arten von Widerständen unterschieden:
a) Als Basiskenngröße des Widerstandes ist die charakteristische Scherfestigkeit des Bodens maßgebend. Bei konsolidierten bzw. im Versuch dränierten Böden sind dies die Scherparameter φ′k und c′k, bei nicht konsolidierten bzw. im Versuch undränierten Böden die Scherparameter φu,k und cu,k. Diese Größen werden als vorsichtige Schätzwerte des Mittelwertes definiert, weil nicht die Scherfestigkeit in einem Punkt der Gleitfläche maßgebend ist, sondern die durchschnittliche Scherfestigkeit in der Gleitfläche.
b) Aus der Scherfestigkeit leiten sich die Widerstände des Bodens ab, und zwar unmittelbar
– der Gleitwiderstand,
– der Grundbruchwiderstand,
– der Erdwiderstand,
und mittelbar über Probebelastungen oder über Erfahrungswerte
– der Fußwiderstand von Bohlträgern, Spundwänden und Ortbetonwänden,
– der Mantelwiderstand von Bohlträgern, Spundwänden, Ortbetonwänden sowie von Verpressankern, Boden- und Felsnägeln.
Der Begriff „Widerstand“ wird nur für den Bruchzustand des Bodens benutzt. Solange durch die Beanspruchung des Bodens der Bruchzustand des Bodens nicht erreicht wird, wird der Begriff „Bodenreaktion“ verwendet.
5. Bei der Bemessung von Einzelteilen sind der Querschnitt und der innere Widerstand des Materials maßgebend. Dafür sind wie bisher die einzelnen Bauartnormen zuständig.
6. Die charakteristischen Werte der Beanspruchungen werden mit Teilsicherheitsbeiwerten multipliziert, die charakteristischen Werte der Widerstände durch Teilsicherheitsbeiwerte dividiert. Gegebenenfalls sind repräsentative Werte unter Berücksichtigung von Kombinationsbeiwerten zu berücksichtigen. Die so erhaltenen Größen werden als Bemessungswerte der Beanspruchungen bzw. der Widerstände bezeichnet und durch den Index „d“ gekennzeichnet. Beim Nachweis der Standsicherheit werden nach EB 78 (Abschnitt 1.4) fünf Grenzzustände unterschieden.
7. Im Hinblick auf die Nachweise der Sicherheit im Grenzzustand GEO-2 und STR nach EB 78, Absatz 4 (Abschnitt 1.4) bietet der Eurocode EC 7-1 drei Möglichkeiten an. Die DIN 1054 stützt sich auf das Nachweisverfahren 2 in der Form, dass die Teilsicherheitsbeiwerte auf die Beanspruchungen und auf die Widerstände angewendet werden. Zur Unterscheidung zu der ebenfalls zugelassenen Variante, bei der die Teilsicherheitsbeiwerte nicht auf die Beanspruchungen, sondern auf die Einwirkungen angewendet werden, wird dieses Verfahren im Kommentar zum Eurocode EC 7-1 [134] als Nachweisverfahren 2* bezeichnet.
8. Neben den Einwirkungen sind für die Nachweise die Bemessungssituationen zu berücksichtigen. Dazu sind die bekannten Lastfälle LF 1, LF 2 und LF 3 für die Nachweise nach DIN 1054:2005-01 für die Nachweise nach Handbuch Eurocode 7, Teil 1 bzw. DIN EN 1990 durch die Bemessungssituationen
BS-P (Persistent situation),
BS-T (Transient situation) und
BS-A (Accidental situation)
ersetzt worden. Der frühere Lastfall LF 2/3 entspricht der Bemessungssituation BS-T/A. Zusätzlich gibt es die Bemessungssituation infolge Erdbeben BS-E. Weitergehende Hinweise finden sich im Handbuch Eurocode 7, Teil 1.
1.4 Grenzzustände (EB 78)
1. Der Begriff „Grenzzustand“ wird in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet:
a) Als „Grenzzustand des plastischen Fließens“ wird in der Bodenmechanik der Zustand im Boden bezeichnet, in dem in einer ganzen Bodenmasse oder zumindest im Bereich einer Bruchfuge die Verschiebungen der einzelnen Bodenteilchen gegeneinander so groß sind, dass die mögliche Scherfestigkeit ihren Größtwert erreicht, der auch bei einer weiteren Bewegung nicht mehr größer, gegebenenfalls aber kleiner werden kann. Der Grenzzustand des plastischen Fließens kennzeichnet den aktiven Erddruck, den Erdwiderstand, den Grundbruch sowie den Böschungs- und den Geländebruch.
b) Ein Grenzzustand im Sinne des neuen Sicherheitskonzeptes ist ein Zustand des Tragwerkes, bei dessen Überschreitung die der Tragwerksplanung zugrunde gelegten Anforderungen nicht mehr erfüllt sind.
2. In Verbindung mit dem Teilsicherheitskonzept werden folgende Grenzzustände unterschieden:
a) Der Grenzzustand der Tragfähigkeit ist ein Zustand des Tragwerkes, dessen Überschreitung unmittelbar zu einem rechnerischen Einsturz oder anderen Formen des Versagens führt. Er wird im Handbuch Eurocode 7, Band 1 als ULS (Ultimate Limit State) bezeichnet. Beim Grenzzustand ULS werden fünf Fälle unterschieden, siehe Absätze 3, 4 und 5.
b) Der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist ein Zustand des Tragwerkes, bei dessen Überschreitung die für die Nutzung festgelegten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Er wird im Handbuch Eurocode 7, Band 1 als SLS (Serviceability Limit State) bezeichnet.
3. Eurocode 7-1 definiert folgende Grenzzustände:
a) EQU: Gleichgewichtsverlust des als starrer Körper angesehenen Tragwerkes ohne Mitwirkung von Bodenwiderständen. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „equilibrium“.
b) STR: Inneres Versagen oder sehr große Verformung des Tragwerkes oder seiner Bauteile, wobei die Festigkeit der Baustoffe für den Widerstand entscheidend ist. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „structure“.
c) GEO: Versagen oder sehr große Verformung des Baugrundes, wobei die Festigkeit des Bodens oder des Felses für den Widerstand entscheidend ist. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „geotechnics“.
d) UPL: Gleichgewichtsverlust des Bauwerkes oder Baugrundes infolge von Auftrieb oder Wasserdruck. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „uplift“.
e) HYD: Hydraulischer Grundbruch, innere Erosion oder Piping im Boden, verursacht durch Strömungsgradienten. Die Bezeichnung ist abgeleitet von „hydraulic“.
4. Für die Übertragung auf die Vorgaben der DIN 1054 muss der Grenzzustand GEO aufgeteilt werden in GEO-2 und GEO-3:
a) GEO-2: Versagen oder sehr große Verformung des Baugrundes im Zusammenhang mit der Ermittlung der Schnittgrößen und der Abmessungen, d. h. bei der Inanspruchnahme der Scherfestigkeit beim Erdwiderstand, beim Gleitwiderstand, beim Grundbruchwiderstand und beim Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge.
b) GEO-3: Versagen oder sehr große Verformung des Baugrundes im Zusammenhang mit dem Nachweis der Gesamtstandfestigkeit, d. h. bei der Inanspruchnahme der Scherfestigkeit beim Nachweis der Sicherheit gegen Böschungsbruch und Geländebruch sowie, in der Regel, beim Nachweis der Standsicherheit von konstruktiven Böschungssicherungen.
5. Die bisherigen Grenzzustände werden wie folgt ersetzt:
a) Dem bisherigen Grenzzustand GZ 1A entsprechen ohne Einschränkung die Grenzzustände EQU, UPL und HYD.
b) Dem bisherigen Grenzzustand GZ 1B entspricht ohne Einschränkung der Grenzzustand STR. Hinzu kommt der Grenzzustand GEO-2 im Zusammenhang mit der äußeren Bemessung, d. h. bei Inanspruchnahme der Scherfestigkeit beim Erdwiderstand, beim Gleitwiderstand, beim Grundbruchwiderstand und beim Nachweis der Standsicherheit in der tiefen Gleitfuge.
c) Dem bisherigen Grenzzustand GZ 1C entspricht der Grenzzustand GEO-3 im Zusammenhang mit dem Nachweis der Gesamtstandsicherheit, d. h. bei Inanspruchnahme der Scherfestigkeit beim Nachweis der Sicherheit gegen Böschungsbruch und Geländebruch.
Der Nachweis der Standsicherheit von konstruktiven Böschungssicherungen ist in jedem Fall dem Grenzzustand GEO zugeordnet. Je nach konstruktiver Ausbildung und Funktion können sie
– entweder im Sinne des bisherigen Grenzzustandes GZ 1B nach den Regeln des Grenzzustandes GEO-2
– oder im Sinne des bisherigen Grenzzustandes GZ 1C nach den Regeln des Grenzzustandes GEO-3 behandelt werden.
6. Die Grenzzustände EQU, UPL und HYD beschreiben den Verlust der Lagesicherheit:
– Nachweis der Sicherheit gegen Kippen EQU,
– Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwimmen UPL,
– Nachweis der Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch HYD.
Bei diesen Grenzzuständen gibt es nur Einwirkungen, keine Widerstände. Maßgebend ist die Grenzzustandsbedingung
d. h. die destabilisierende Einwirkung Fk, multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert γdst ≥ 1, darf höchstens so groß werden wie die stabilisierende Einwirkung Gk, multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert γstb < 1.
7. Die Grenzzustände STR und GEO-2 beschreiben das Versagen von Bauwerken und Bauteilen bzw. das Versagen des Baugrundes. Dazu gehören:
– der Nachweis der Tragfähigkeit von Bauwerken und Bauteilen, die durch den Baugrund belastet bzw. durch den Baugrund gestützt werden,
– der Nachweis, dass die Tragfähigkeit des Baugrundes, z. B. in Form von Erdwiderstand, Grundbruchwiderstand oder Gleitwiderstand, nicht überschritten wird.
Dabei wird der Nachweis, dass die Tragfähigkeit des Baugrundes nicht überschritten wird, genauso geführt wie bei jedem anderen Baumaterial. Maßgebend ist immer die Grenzzustandsbedingung
d. h. die charakteristische Schnittgröße Ek, multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert γF für Einwirkungen bzw. γE für Beanspruchungen, darf höchstens so groß werden wie der charakteristische Widerstand Rk, dividiert durch den Teilsicherheitsbeiwert γR.
8. Der Grenzzustand GEO-3 ist eine Besonderheit des Erd- und Grundbaus. Er beschreibt den Verlust der Gesamtstandsicherheit. Dazu gehören:
– der Nachweis der Sicherheit gegen Böschungsbruch,
– der Nachweis der Sicherheit gegen Geländebruch.
Maßgebend ist immer die Grenzzustandsbedingung
d. h. der Bemessungswert Ed der Beanspruchungen darf höchstens so groß werden wie der Bemessungswert Rd des Widerstandes. Hierbei werden die geotechnischen Einwirkungen und Widerstände mit den Bemessungswerten
der Scherfestigkeiten ermittelt, d. h. der Tangens des Winkels der inneren Reibung φ und die Kohäsion c werden mit den Teilsicherheitsbeiwerten γφ′ und γc′ abgemindert.
9. Der Grenzzustand SLS beschreibt den Zustand des Bauwerkes, bei dem die für die Nutzung festgelegten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, ohne dass seine Tragfähigkeit verloren geht. Er liegt dem Nachweis zugrunde, dass die zu erwartenden Verschiebungen und Verformungen mit dem Zweck des Bauwerkes vereinbar sind. Bei Baugruben schließt der Grenzzustand SLS auch die Gebrauchstauglichkeit benachbarter Bauwerke und baulicher Anlagen mit ein.
1.5 Stützung von Baugrubenwänden (EB 67)
1. Als nicht gestützt werden Baugrubenwände bezeichnet, die weder ausgesteift noch verankert sind und deren Standsicherheit nur auf ihrer Einspannung im Boden beruht.
2. Als nachgiebig gestützt werden Baugrubenwände bezeichnet, wenn die Auflagerpunkte der Wand stark nachgeben können, z. B. bei stark geneigter Abstützung zur Baugrubensohle hin und bei nicht oder nur gering vorgespannten Ankern.
3. Als wenig nachgiebig gestützt werden Baugrubenwände in folgenden Fällen bezeichnet:
a) Die Steifen werden zumindest kraftschlüssig verkeilt.
b) Verpressanker werden auf mindestens 80 % der für den nächsten Bauzustand errechneten charakteristischen Beanspruchung vorgespannt und festgelegt, siehe Kapitel 7.
c) Es wird eine kraftschlüssige Verbindung mit Pfählen hergestellt, die nachweislich unter Belastung nur eine geringe Kopfbewegung erleiden.
4. Als annähernd unnachgiebig gestützt werden Baugrubenwände bezeichnet, wenn der Bemessung entsprechend EB 22, Absatz 1 (Abschnitt 9.5) ein erhöhter aktiver Erddruck zugrunde gelegt wird und die Steifen bzw. Anker entsprechend EB 22, Absatz 10 vorgespannt und festgelegt werden.
5. Als unnachgiebig gestützt werden Baugrubenwände nur dann bezeichnet, wenn sie nach EB 23 (Abschnitt 9.6) für einen abgeminderten oder für den vollen Erdruhedruck bemessen und die Stützungen entsprechend vorgespannt werden. Bei verankerten Baugrubenwänden müssen die Anker darüber hinaus in einer unnachgiebigen Felsschicht verankert oder wesentlich länger sein als rechnerisch erforderlich.
Wenn die Anforderungen nach Absatz 4 oder Absatz 5 erfüllt werden und darüber hinaus
– eine biegesteife Baugrubenwand angeordnet wird und
– unzuträgliche Fußverschiebungen verhindert werden,
dann darf eine Baugrubenkonstruktion als verschiebungs- und verformungsarm angesehen werden.
1.6 Planung und Prüfung von Baugruben (EB 106)
1. Wenn der Planverfasser nicht die erforderliche Sachkunde und Erfahrung hat, ist für die geotechnische Bemessung der Baugruben ein geeigneter Fachplaner gemäß Handbuch Eurocode 7, Band 1, Absatz 1.3, A 3 einzuschalten.
2. Der in den Empfehlungen verwendete Begriff „Sachverständiger für Geotechnik“ ist in Anlehnung an das Handbuch Eurocode 7, Band 2, Absatz A 2.2.2 zu verstehen.
3. Baugruben sind in eine geotechnische Kategorie GK 1, GK 2 oder GK 3 einzustufen. In Anhang A5 sind Kriterien in Anlehnung an das Handbuch Eurocode 7, Band 1, Absatz A 2.1.2 für die Einstufung von Baugruben aufgeführt.
4. Für Baugruben ist ein Geotechnischer Entwurfsbericht gem. Handbuch Eurocode 7, Band 1, Absatz 2.8 zu verfassen.
Der Geotechnische Entwurfsbericht für die Baugrube sollte bei einer Einstufung in die geotechnischen Kategorien GK 2 und GK 3 folgende Punkte enthalten:
– Beschreibung des Grundstückes und seiner Umgebung insbesondere Nachbarbebauung,
– Beschreibung der Baugrundverhältnisse mit Bezug auf den Geotechnischen Bericht gemäß Handbuch Eurocode, Band 2, Absatz A 7,
– Beschreibung der vorgesehenen Baugrubenkonstruktion,
– Beschreibung der Einwirkungen aus benachbarten Bauwerken,
– Beschreibung der Auswirkungen auf benachbarte Bereiche und Bauwerke,
– charakteristische Werte für Boden- und Felseigenschaften sowie für die Wasserstände und Strömungen,
– Vorschlag der Baugrubenkonstruktion und Feststellung der möglichen Risiken,
– Bemessungssituation und Teilsicherheitsbeiwerte,
– gegebenenfalls Begründung der Notwendigkeit, Angemessenheit und Hinlänglichkeit der Beobachtungsmethode,
– Berechnungen einschl. Angabe des Berechnungsverfahrens und Pläne,
– Vorgaben für die Kontrollen zur Herstellung, z. B. Probebelastungen,
– Vorgaben für messtechnische Überprüfungen und Überwachungen.
5. Bei Baugruben, die in die geotechnische Kategorie GK 3 eingestuft sind, wird empfohlen, einen Sachverständigen für Geotechnik im Zuge der bautechnischen Prüfung des Geotechnischen Entwurfsberichtes und des Geotechnischen Berichtes hinzuzuziehen.
6. Bei der Ausführung von Baugruben, die in die geotechnische Kategorie GK 2 oder GK 3 eingestuft sind, wird empfohlen, einen geeigneten Bauüberwacher, der über entsprechende Erfahrungen und Sachkunde mit Baugruben verfügt, einzuschalten. Bei Baugruben der geotechnischen Kategorie GK 3 wird empfohlen, den in Abschnitt 5 genannten Sachverständigen für Geotechnik auch zur Prüfung der Ausführungsplanung und zur Beurteilung der Ergebnisse der messtechnischen Überwachungen und Überprüfungen hinzuziehen.
2
Grundlagen für die Berechnung
2.1.Einwirkungen (EB 24)
2.2 Bodenkenngrößen (EB 2)
1. Die für Standsicherheitsnachweise benötigten Bodenkenngrößen sind im Grundsatz in Anlehnung an DIN EN 1997-2 einschließlich DIN EN 1997-2/NA sowie DIN 4020 „Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke“ unmittelbar aufgrund geotechnischer Untersuchungen festzulegen. Zur Berücksichtigung der Heterogenität des Untergrundes und der Ungenauigkeiten bei Probenahme und Versuchsdurchführung sind die in Versuchen ermittelten Werte mit angemessenen Zu- bzw. Abschlägen zu versehen, bevor sie als charakteristische Werte in die Berechnung eingehen. Dies gilt insbesondere für die Scherfestigkeit. Hierzu siehe Absatz 3.
2. Bei der Festlegung von charakteristischen Werten für die Wichte ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden:
a) Für Nachweise der Standsicherheit in den Grenzzuständen GEO-2, STR sowie GEO-3, insbesondere also beim Nachweis der Einbindetiefe, bei der Ermittlung der Schnittgrößen und beim Nachweis der Sicherheit gegen Geländebruch, darf der Mittelwert als charakteristischer Wert gewählt werden.
b) Beim Nachweis der Sicherheit gegen Aufschwimmen UPL, der Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch HYD und der Sicherheit gegen Abheben EQU sind die unteren charakteristischen Werte maßgebend.
3. Charakteristische Werte der Scherfestigkeit sind als vorsichtige Schätzwerte des Mittelwertes auf der sicheren Seite vom statistischen Mittelwert zu wählen. Der Abstand vom Mittelwert kann gering sein, sofern die vorliegenden Proben für den Boden im Bereich der nachzuweisenden Baugrubenkonstruktion ausreichend repräsentativ sind. Bei geringer Datenbasis und ungleichmäßigem Baugrund muss der Abstand groß angenommen werden.
4. Die Kapillarkohäsion von nichtbindigen Böden, insbesondere von Sand, darf berücksichtigt werden, sofern sie nicht durch Austrocknen oder durch Überfluten des Baugrundes, infolge Ansteigens des Grundwassers oder infolge Wasserzulaufs von oben während der Bauzeit verloren gehen kann.
5. Die Kohäsion eines bindigen Bodens darf nur dann voll berücksichtigt werden, wenn der Boden beim Durchkneten nicht breiig wird und wenn gewährleistet ist, dass er seine Zustandsform, z. B. beim Auftauen nach einer Frostperiode, gegenüber dem ursprünglichen Zustand nicht ungünstig verändert.
6. Bei der Übertragung der im Versuch an Bodenproben ermittelten Scherfestigkeit auf das Verhalten der gesamten Bodenmasse sind folgende Einschränkungen zu berücksichtigen:
a) Die Scherfestigkeit bindiger oder felsartiger Böden kann durch Haarrisse, Harnische oder Klüfte sowie durch Einlagerungen schwach bindiger oder nichtbindiger Böden stark herabgesetzt sein.
b) Durch Verwerfungen und geneigte Schichtfugen können bestimmte Gleitflächen vorgegeben sein. Als besonders leicht zu Rutschungen neigend gelten z. B. Opalinuston, Knollenmergel und Tarras.
c) Bei feinkörnigen Böden, z. B. bei Kaolinton, und bei Böden mit maßgeblichem Anteil an Montmorillonit, kann die Restscherfestigkeit maßgebend sein.
7. Liegen keine entsprechenden bodenmechanischen Laborversuche vor, dann dürfen die charakteristischen Bodenkenngrößen wie folgt festgelegt werden:
a) Soweit aus örtlicher Erfahrung ausreichend bekannt ist, dass gleichartige Untergrundverhältnisse vorliegen, dürfen die Bodenkenngrößen von früheren Bodenuntersuchungen aus der unmittelbaren Nachbarschaft übernommen werden. Hierzu ist Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet der Geotechnik erforderlich.
b) Sofern die anstehenden Böden aufgrund von Bohrungen oder Sondierungen und weiteren Labor- und Handversuchen nach ihrer Art und Beschaffenheit in die Bodengruppen der DIN 18196 eingeordnet werden können, darf unter Beachtung der jeweils angegebenen Einschränkungen mit den in den Anhängen A 3 und A 4 angegebenen Bodenkenngrößen gerechnet werden.
8. Bei nichtbindigen Böden dürfen die Erfahrungswerte
– der Tabelle 3.1 für die Wichte nach Anhang A 3 bzw.
– der Tabelle 3.2 für die Scherfestigkeit nach Anhang A 3
angewendet werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Die Böden müssen im Hinblick auf Korngrößenverteilung, Ungleichförmigkeitszahl und Lagerungsdichte in die Tabellen eingeordnet werden können. Zur Einstufung der Böden im Hinblick auf ihre Lagerungsdichte siehe Anhang A 1
b) Die angegebenen Erfahrungswerte gelten sowohl für gewachsene als auch für geschüttete nichtbindige Böden. Die Lagerung des Bodens darf in beiden Fällen durch Verdichtung verbessert sein.
Die Tabellenwerte dürfen nicht angewendet werden auf Böden mit porösem Korn, z. B. bei Bimskies und Tuffsand.
9. Bei bindigen Böden dürfen die Erfahrungswerte
– der Tabelle 4.1 für die Wichte nach Anhang A 4 bzw.
– der Tabelle 4.2 für die Scherfestigkeit nach Anhang A 4
angewendet werden, sofern die Böden im Hinblick auf ihre Plastizität in die Bodengruppen nach DIN 18196 eingeordnet und nach ihrer Zustands-form (Konsistenz) unterschieden werden können. Zur Einstufung im Hinblick auf die Zustandsform (Konsistenz) siehe Anhang A 2.
Die Tabellenwerte dürfen nicht angewendet werden, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt:
a) Sie dürfen nicht angewendet werden auf gemischtkörnige Böden, bei denen einerseits die Art des Feinkorns und andererseits der große Anteil an Korn > 0,4 mm es nicht zulassen, den Grad der Plastizität bzw. die Zustandsform zuverlässig zu beschreiben, z. B. auf sandige Geschiebemergel.
b) Sie dürfen nicht auf Böden angewendet werden, die im Absatz 6 beschrieben sind.
c) Sie dürfen nicht angewendet werden, wenn ein plötzlicher Zusammenbruch des Korngerüstes möglich ist, z. B. bei Lössboden.
2.3 Erddruckneigungswinkel (EB 89)
1. Die rechnerischen Neigungswinkel δa,k und δp,k zwischen der Richtung der Erddruckkraft bzw. der Erdwiderstandskraft und der Normalen auf der Wandrückseite hängen ab
– vom charakteristischen Wandreibungswinkel δk,
– von der Relativbewegung zwischen Wand und Boden,
– von der Wahl der Gleitflächenform,
– vom Mobilisierungsgrad.
2. Der charakteristische Wandreibungswinkel δk ist das Maß für die physikalisch größtmögliche Reibung zwischen der Wand und dem anstehenden Boden. Er ist im Wesentlichen abhängig
– von der Scherfestigkeit des Bodens und
– von der Oberflächenrauigkeit der Wand.
3. Im Hinblick auf die Rauigkeit der Wand werden folgende Fälle unterschieden:
a) Als „verzahnt“ wird eine Wandrückseite bezeichnet, wenn sie durch ihre Form eine so große Oberfläche aufweist, dass nicht die unmittelbar zwischen Boden und Wandbaustoff wirkende Wandreibung maßgebend ist, sondern die Reibung in einer ebenen, die Wand nur stellenweise berührenden Bruchfläche im Boden. Dies ist bei Pfahlwänden der Fall. Auch Dichtwände aus erhärtender Zement-Bentonit-Suspension mit eingehängten Spundwänden oder Bohlträgern dürfen als verzahnt eingestuft werden [123]. Näherungsweise gilt dies auch für eingerammte, eingerüttelte oder eingepresste Spundwände.
b) Als „rau“ können im Allgemeinen die unbehandelten Oberflächen von Stahl, Beton und Holz angesehen werden, insbesondere die Oberflächen von Bohlträgern und von Ausfachungen.
c) Als „weniger rau“ darf die Oberfläche einer Schlitzwand eingestuft werden, sofern die Filterkuchenbildung gering ist, z. B. bei Schlitzwänden in bindigem Boden. Erfahrungsgemäß gilt dies auch bei Schlitzwänden in nichtbindigem Boden. Sofern aber bei der Schlitzwandherstellung durch geeignete Maßnahmen die Ausbildung eines Filterkuchens vermieden werden kann oder eine stark unebene Wandoberfläche erreicht wird, darf auch ein betragsmäßig höherer Erddruckneigungswinkel als angesetzt werden [148, 149].
d) Als „glatt“ sind alle Wandrückseiten einzustufen, wenn der anstehende Boden infolge seines Tongehaltes und seiner Konsistenz schmierige Eigenschaften aufweist.
4. Nur dann, wenn
– der Berechnung des Erddruckes oder des Erdwiderstandes eine gekrümmte oder gebrochene Gleitfläche zugrunde gelegt wird und
– nach EB 9, Absatz 1 (Abschnitt 4.8) nachgewiesen wird, dass die Summe der von oben nach unten gerichteten charakteristischen Einwirkungen mindestens so groß ist wie die von unten nach oben gerichtete Vertikalkomponente Bv,k der charakteristischen Auflagerkraft Bk,
darf die physikalisch mögliche Wandreibung nach Absatz 5 a) in Rechnung gestellt werden.
Falls ebene Gleitflächen als Näherung verwendet werden, ist zum Ausgleich des durch Überschätzung des Erdwiderstandsbeiwertes Kp bzw. Unterschätzung des Erddruckbeiwertes Ka entstehenden Fehlers der Erddruckneigungswinkel entsprechend Absatz 5 b) herabzusetzen.
5. Maßgebend sind in Abhängigkeit vom Reibungswinkel φ′k folgende Wandreibungs- bzw. maximale Erddruckneigungswinkel:
a) Die Werte der mittleren Spalte sind Wandreibungswinkel, die bei gekrümmten oder gebrochenen Gleitflächen als maximale rechnerische Neigungswinkel für den aktiven und den passiven Erddruck angesetzt werden dürfen.
b) Die Angaben der rechten Spalte dienen zum Ausgleich des Modellfehlers bei Verwendung von ebenen Gleitflächen. Beim aktiven Erddruck dürfen ebene Gleitflächen unabhängig vom Reibungswinkel φ′k angesetzt werden, beim Erdwiderstand nur bei φ′k ≤ 35°.
c) Soll beim Nachweis der Vertikalkomponente des mobilisierten Erdwiderstandes die Korrektur des Erddruckneigungswinkels nach EB 9, Absatz 2 d) (Abschnitt 4.7) entfallen, dürfen bei der Ermittlung des Erdwiderstandes nur gekrümmte Gleitflächen zugrunde gelegt werden.
6. Das Vorzeichen des Erddruckneigungswinkels richtet sich nach der Relativverschiebung zwischen Wand und Boden:
a) Der Erddruckneigungswinkel ist beim aktiven Erddruck als positiv definiert, wenn entsprechend Bild EB 89-1 a) der Erdkeil sich stärker nach unten bewegt als die Wand.
b) Der Erddruckneigungswinkel ist beim aktiven Erddruck als negativ definiert, wenn sich entsprechend Bild EB 89-1 b) die Wand stärker nach unten bewegt als der Boden.
Bild EB 89-1. Neigungswinkel bei aktivem Erddruck
Für die Ermittlung des Erdwiderstandes gilt sinngemäß das Gleiche. Hierzu siehe Bild EB 19-1 (Abschnitt 6.3).
2.4 Teilsicherheitsbeiwerte (EB 79)
2.5 Allgemeine Festlegungen für den Ansatz von Nutzlasten (EB 3)
1. Als Nutzlasten werden folgende veränderliche Einwirkungen bezeichnet:
– Lasten aus Straßen- und Schienenverkehr nach EB 55 (Abschnitt 2.6),
– Lasten aus Baustellenverkehr und Baubetrieb nach EB 56 (Abschnitt 2.7),
– Lasten aus Baggern und Hebezeugen nach EB 57 (Abschnitt 2.8).
Zur Einteilung dieser Lasten in Regellasten und Sonderlasten siehe EB 24 (Abschnitt 2.1).