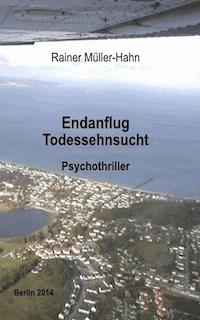
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Markus Schwarz ist Fluglehrer mit Leib und Seele. Er hat sich gerade aus einer lieblosen Ehe befreit und eine Partnerin gefunden, die sein Leben und sein Wesen für alle sichtbar ins Positive verändert hat. Der Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem sie zu Tode kommt, löst bei ihm ein wahnhaftes Erleben aus. Seine Freundin existiert weiterhin für ihn und drängt auf Genugtuung und ein weiteres Zusammenleben. Nachforschungen verstärken seinen Verdacht, dass es sich bei dem Täter um einen seiner Flugschüler handelt. Fortschreitender Wahn, Realitätsverlust und Rückzug in Isolation sowie seine Aktionen zeigen erhebliche Wirkungen. Sie verändern Beziehungen bei den Betroffenen seiner Umgebung, decken Verborgenes auf und lassen Probleme entstehen, die sich bis in den politischen Raum auswirken. Als für Markus Gewissheit besteht, wer für den Tod seiner Freundin verantwortlich ist, kommt es zu einer schrecklichen Tat. Nun gibt es nur noch Täter, die gleiches Leid erzeugt haben, es ertragen müssen und die gemeinsam auf dasselbe Schicksal zustreben. Neben dem dramatischen Geschehen liefert das Buch auch Einblicke in die Praxis der Privatfliegerei. Vielleicht können sie etwas von der Faszination des Fliegens vermitteln. Die Geschichte spielt in Braunschweig und Umgebung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Müller-Hahn
Endanflug-Todessehnsucht
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1.Kapitel
2.Kapitel
3.Kapitel
4.Kapitel
5.Kapitel
6.Kapitel
7.Kapitel
8.Kapitel
9.Kapitel
10.Kapitel
11.Kapitel
12.Kapitel
13.Kapitel
14.Kapitel
15.Kapitel
16.Kapitel
17.Kapitel
18.Kapitel
19.Kapitel
20.Kapitel
21.Kapitel
22.Kapitel
23.Kapitel
24.Kapitel
25.Kapitel
26.Kapitel
27.Kapitel
28.Kapitel
29.Kapitel
30.Kapitel
31.Kapitel
32.Kapitel
33.Kapitel
34.Kapitel
35.Kapitel
36.Kapitel
37.Kapitel
38.Kapitel
39.Kapitel
40.Kapitel
41.Kapitel
42.Kapitel
43.Kapitel
44.Kapitel
45.Kapitel
46.Kapitel
47.Kapitel
48.Kapitel
49.Kapitel
50.Kapitel
51.Kapitel
52.Kapitel
53.Kapitel
54.Kapitel
55.Kapitel
56.Kapitel
57.Kapitel
58.Kapitel
59.Kapitel
60.Kapitel
61.Kapitel
62.Kapitel
63.Kapitel
64.Kapitel
65.Kapitel
66.Kapitel
67.Kapitel
68.Kapitel
69.Kapitel
70.Kapitel
71.Kapitel
72.Kapitel
73.Kapitel
74.Kapitel
75.Kapitel
76.Kapitel
77.Kapitel
78.Kapitel
79.Kapitel
80.Kapitel
81.Kapitel
82.Kapitel
83.Kapitel
84.Kapitel
85.Kapitel
86.Kapitel
87.Kapitel
88.Kapitel
89.Kapitel
90.Kapitel
91.Kapitel
92.Kapitel
93.Kapitel
94.Kapitel
95.Kapitel
96.Kapitel
97.Kapitel
98.Kapitel
99.Kapitel
100.Kapitel
101.Kapitel
102.Kapitel
103.Kapitel
104.Kapitel
105.Kapitel
106.Kapitel
107.Kapitel
108.Kapitel
109.Kapitel
110.Kapitel
111.Kapitel
112.Kapitel
113.Kapitel
114.Kapitel
115.Kapitel
116.Kapitel
117.Kapitel
118.Kapitel
119.Kapitel
120.Kapitel
121.Kapitel
122.Kapitel
123.Kapitel
124.Kapitel
125.Kapitel
126.Kapitel
127.Kapitel
128.Kapitel
129.Kapitel
130.Kapitel
131.Kapitel
132.Kapitel
133.Kapitel
134.Kapitel
135.Kapitel
136.Kapitel
137.Kapitel
138.Kapitel
139.Kapitel
140.Kapitel
141.Kapitel
142.Kapitel
143.Kapitel
144.Kapitel
145.Kapitel
146.Kapitel
147.Kapitel
148.Kapitel
149.Kapitel
150.Kapitel
151.Kapitel
152.Kapitel
153.Kapitel
154.Kapitel
155.Kapitel
156.Kapitel
157.Kapitel
158.Kapitel
159.Kapitel
160.Kapitel
161.Kapitel
162.Kapitel
163.Kapitel
164.Kapitel
165.Epilog
166.Widmung
Impressum neobooks
1.Kapitel
Es ist Donnerstag, der elfte März, fünf Uhr am Morgen. Draußen ist es noch dunkel. Wieder ein unfreundlicher Märztag, trüb und nass wie schon seine Vorgänger der letzten beiden Wochen.
Christine Schumann steht im Badezimmer vor dem Spiegel und wischt das beschlagene Glas mit einem Handtuch ab. Die ausgiebige Dusche hat sie nicht besonders munter gemacht, aber den Raum in ein Dampfbad verwandelt. Sie fühlt sich immer noch wie zerschlagen. Seit den letzten beiden Wochen steht sie unter einer besonderen Spannung, die sie auch nachts nicht gut schlafen lässt.
Das Bild, das nun unter der leise quietschenden Wischbewegung im Spiegel sichtbar wird, verbessert ihre Laune ganz und gar nicht. Sie sieht ein rundliches Gesicht, große braune Augen mit langen Wimpern, die jetzt vom Duschwasser zusammenkleben, eine kleine Stupsnase und einen schön geformten Mund mit vollen Lippen. Nasse Haarsträhnen umrahmen das Gesicht und lassen es traurig wirken. Sie weiß natürlich, dass sie eine sehr ansehnliche Frau ist.
Mit ihren ausgeprägten weiblichen Attributen, der herzlichen und unverfälschten Natürlichkeit vermag sie die Menschen ihrer Umgebung für sich einzunehmen. Aber in der gegenwärtigen Stimmung kommt sie sich äußerst unattraktiv vor.
Ihr Alter von achtunddreißig Jahren macht ihr Kummer. Mehr und mehr beschleicht sie die Angst vor dem Altern. Sie meint, wieder ein paar neue Fältchen um die Augenpartie entdeckt zu haben. Um sich darüber Gewissheit zu verschaffen, führt sie ihr Gesicht dicht an den Spiegel heran und betrachtet sich kritisch. Mit Beruhigung stellt sie aber fest, dass ihre Sorge unbegründet ist
Sie ist überzeugt, dass der Alterungsprozess durch ihre gegenwärtige Arbeit beschleunigt wird. Seit sie vor einem Jahr aus Salzgitter in die Umgebung von Braunschweig gezogen ist, verschlechterte sich ihre Arbeitssituation in dem Maße, wie sich ihr privates Leben verbesserte. Als Krankenschwester hat sie in der Braunschweiger Klinik das Gegenteil dessen vorgefunden, was sie vom Krankenhaus in Salzgitter gewohnt war. Anstelle eines dort gut funktionierenden Teams herrscht hier über sie und ihre unleidlichen Kolleginnen eine fürchterliche Oberschwester. Dazu kommen überforderte Ärzte und unzufriedene, quengelige Patienten sowie unvorhersehbare plötzliche Abweichungen vom Dienstplan. Beim Gedanken an diese Leute möchte sie sich gleich wieder im Bett verkriechen.
Sie fährt mit der Hand durch das nasse Haar, um es etwas aufzulockern, wendet sich von ihrem Spiegelbild ab und beginnt nun das Haar zu föhnen. Der warme Luftstrahl tut ihr gut. Ihre Gedanken kreisen weiter um die Arbeit im Krankenhaus.
„Wieder haben sie mir einen Wochenenddienst reingewürgt. Schon das dritte Mal in den letzten fünf Wochen“.
Sie fühlt sich benachteiligt und ausgenutzt. Für eine jüngere Kollegin werden ständig Extrawürste gebraten. Warum das so ist, das weiß der Himmel! Man sagt dieser Kollegin ein intimes Verhältnis mit dem Oberarzt nach.
Christine stellt sich diesen schlaffen Koloss beim Sex mit Emilie vor und lacht plötzlich laut auf.
„Dieser riesige, phlegmatische Oberarzt mit dem zu kleinen Kopf auf dem massigen Körper, den ständig feuchten Lippen und Händen, der beim Gehen - oder besser beim Schreiten - seinen gewaltigen Bauch wie einen Karren vor sich her schiebt, der Sexpartner von Emilie? Nein, unmöglich!“
Sie schüttelt sich. Immer wenn sie ihm die Hand gibt, hat sie das Gefühl eine Qualle anzufassen und verspürt danach den Drang, sich sofort die Hände waschen zu müssen. Und dann diese Fistelstimme! Sein Spitzname im Krankenhaus ist wohl deshalb auch „Dr. Gallus“. Man hat ihr erklärt, dass in der griechischen Mythologie der Gallus ein kastrierter Priester der Zaubergöttin Hekate war. Und wer die Rolle der Zaubergöttin auf der Station spielt, ist nicht schwer zu erraten.
„Nee, die beiden haben nichts miteinander“, denkt sie, „aber selbst wenn es so wäre, hätte das mit der Bevorzugung von Emilie nichts zu tun.Er hat auf der Station nichts zu sagen - jedenfalls nichts zu den Dienstplänen. Er ist auch sonst der Oberschwester nicht gewachsen.“
Die kleine drahtige, allgegenwärtige Frau mit dem spitzen verhärmten Gesicht und der schier unerschöpflichen Energie bildet das Gegenstück zum dicken, phlegmatischen Arzt. Alle fürchten ihre spitzen Bemerkungen und bissigen Kommentare. Sie trifft damit zielgenau den wunden Punkt des Gegenübers, ähnlich wie das Chamäleon seine Beute mit dem Zungenschuss.
Christine ruft sich nun selbst zur Ordnung, möchte diese unerfreulichen Gedanken über ihre Arbeit abschütteln. Vergeblich! Diese begleiten sie während des Dienstes auf der Station, am Feierabend und überfallen sie wie jetzt, gleich nach dem Aufstehen. Im Grunde ärgert sie sich über sich selbst, weil sie nicht den Mut hat, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen oder den Arbeitsplatz zu wechseln.
„Wie oft hat mir das Markus schon vorgehalten“, und dann mit leichter Empörung, „aber der hat es gerade nötig! Arbeitet fast jedes Wochenende in der Flugschule. Allerdings liebt er seine Arbeit und sein Chef schubst ihn nicht herum.“
Das Haar ist nun trocken, und es kommt ihr vor, als hätte der Fön die düstere Stimmung weggeblasen.
„Ja, Markus! Markus Schwarz, meine große Liebe“, denkt sie und lächelt in den Spiegel, als würde er ihr dort gegenüberstehen.
„Durch dich wird vieles leichter und erträglicher. Leider haben wir keine Zeit füreinander, nicht wahr?“
Ihr Gesicht zeigt nun einen leicht wehmütigen Zug um den Mund. Sie nickt betrübt. Und als hätte der imaginäre Markus gegen ihre Behauptung protestiert, spitzt sie die Lippen, sendet ihm einen Kuss in den Spiegel und räumt in Gedanken ein:
„Ja, ich weiß, so ganz stimmt das nicht, wir haben eben nur nicht genug Zeit für uns.“
Denn wenn sie am Wochenende keinen Dienst hat, besucht sie ihn oft am Flughafen und schaut zu, wie er mit den Flugschülern arbeitet. Gelegentlich sitzt sie auch mal bei Schulungsflügen hinten in der Maschine oder hört beim theoretischen Unterricht zu.
Sie spürt, dass Markus mit ganzem Herzen bei der Sache ist. Solche Freude am Beruf und Hingabe, ähnlich wie sie es selbst von früher her kannte, wünscht sie sich auch wieder. Christine seufzt leise.
Nun noch etwas Make-up. Dann überprüft sie ihr Werk noch einmal sorgfältig. Das, was ihr nun im Spiegel entgegenschaut, stimmt sie sehr viel versöhnlicher.
2.Kapitel
Sie stehen schon eine Weile im Flur der Wohnung. Die beiden attraktiven Frauen sind etwa dreißig Jahre alt. Jede trägt einen offenen Morgenmantel. Der groß gewachsene, schlanke Mann mit grau meliertem Haar ist ziemlich angetrunken und nachlässig angezogen. Das Hemd ist nicht vollständig zugeknöpft und steckt nur teilweise in der Hose. Darüber ein zerknittertes dunkles Jackett, die Schnürbänder der Schuhe nur locker verknotet. Ein Teil seiner Krawatte schaut aus der Jacketttasche hervor. „Mensch Hänschen, nun komm schon, rück’ endlich die Autoschlüssel raus! Wir rufen dir ’ne Taxe, schließlich wollen wir auch mal schlafen.“ Vera ist ärgerlich. Sie schiebt seine Hand beiseite, mit der er an ihrer Brust spielt.
„Dass dieser Kerl nie ein Ende finden kann“, denkt sie ärgerlich und wendet sich Hilfe suchend an ihre Kollegin.
„Nun sag’ du doch auch mal was, wir können ihn doch so nicht gehen lassen.“
Petra zieht resigniert die Schultern hoch und wehrt geduldig seine Attacke auf ihren Po ab. Nun spricht sie zum ihm behutsam wie zu einem Kind:
„Los Doktor, mach’ endlich Schluss, geh’ nach Hause, deine Frau wird sich Sorgen machen.“
„Die macht sich keine Sorgen, hä, hä, die is’ …, die is’ doch gar nicht zu Hause …, is’ in Frankfurt …, bei ’ner Kunstausstellung …, die kommt erst morgen Mittag …, wir können also ruhig noch weiter feiern“, erwidert er triumphierend mit schwerer Zunge und macht er sich weiter an Veras üppigem Busen zu schaffen. Die wehrt ihn erneut ab, schließt nachdrücklich ihren Morgenmantel und sagt nun schon in schärferem Ton.
„Nee, nu’ lass mal, übertreib ’s nicht, jetzt is’ Schluss.“
Sie nimmt seinen Mantel von der Garderobe und drängt ihn, diesen überzuziehen.
Dieser Ankleidevorgang erweist sich als recht schwierig und langwierig, erfordert Petras Hilfe und seine ganze Aufmerksamkeit, die ihm aber immer wieder entgleitet. Damit verschafft er den Frauen eine Verschnaufpause, die Belagerung abzuwehren. Schließlich ist es vollbracht. Es folgt noch ein zähes Abschiedsritual, eher ein Gerangel, wobei er wieder beginnt, beide Damen zu tätscheln und zu küssen. Die versuchen jetzt schon recht misslaunig, sich seinen beharrlichen und plumpen Zärtlichkeiten zu entziehen.
„Wenn du unbedingt willst, dann fahr doch, is’ ja deine Karriere und dein Führerschein“, sagt Petra resolut. Er brummt unwillig, möchte noch etwas einwenden, aber da haben sie bereits die Wohnungstür geöffnet und ihn sanft zur Tür hinaus geschoben. Er wankt schwerfällig den Flur entlang, winkt und flüstert beim Verlassen des Hauses: „Bis bald, ihr Schönen!“ Dann ist er verschwunden. Beide Frauen atmen tief auf und schließen die Wohnungstür.
3.Kapitel
Christine schreckt auf.
„Mein Gott, es ist schon spät! Ich darf keinesfalls unpünktlich zum Dienst kommen“, schießt es ihr durch den Kopf, und sie beendet abrupt die Musterung im Spiegel.
Hastig zieht sie die Kleidungsstücke an, die sie am Vorabend im Bad bereitgelegt hat. Ein letzter prüfender Blick in den Spiegel, noch einmal kurz das Haar nach hinten gebürstet, dann kehrt sie auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer zurück. Die kleine Leselampe auf ihrem Nachttisch erhellt den Raum nur schwach. Markus hat sich tief ins Bettzeug eingegraben. Er liegt auf dem Bauch, nur ein Teil seines Gesichts und etwas von seinem dunklen Schopf schauen hervor. Er schläft tief und atmet gleichmäßig. Christine tritt ans Bett, streicht vorsichtig über sein Haar. Sie lächelt bei dem Gedanken, ihn bald zum Friseur scheuchen zu müssen. Dann beugt sie sich zu ihm herab und küsst ihn liebevoll auf die Wange. Markus reagiert mit einem kurzen Grunzen, ohne wach zu werden. Wie gerne würde sie jetzt neben ihm in seinen Armen liegen. Seufzend löst sie sich von dieser verlockenden Vorstellung und verlässt leise das Schlafzimmer. Später wird sie ihn vom Krankenhaus anrufen und ihm einen guten Morgen wünschen.
4.Kapitel
Es ist kurz nach fünf Uhr, als Dr. Hans Bellier oder Hänschen, wie ihn die beiden Damen nennen, die Haustür hinter sich geschlossen hat. Er steht zunächst noch einen Augenblick an die Hauswand gelehnt. Die frische Luft löst in ihm den Drang aus, sich übergeben zu müssen. Er kämpft dagegen an, atmet mehrmals tief durch, und es gelingt, das Würgegefühl langsam abzuschwächen.
Um zu seinem Wagen zu gelangen, muss er noch ein gutes Stück laufen. Er parkt stets in einiger Entfernung von seinem Privatbordell. Mit einem solchen Etablissement in Verbindung gebracht zu werden, könnte für ihn unangenehme Folgen haben. Langsam macht er sich auf den Weg. Nun wird ein Mechanismus wirksam, der da lautet: Haltung annehmen! Obwohl die Straßen der kleinen Ortschaft noch menschenleer sind, bemüht er sich, beim Laufen nicht zu schwanken. Er konzentriert sich mit aller Kraft auf seinen Gang, zählt die Schritte und herrscht sich mehrmals innerlich an: „Mann, geh’ gerade!“ Sein anfängliches Schwanken geht tatsächlich über in eine steife, roboterhaft eckige Bewegung. Dieser Laufstil würde jedem Betrachter verraten, dass sich hier ein Betrunkener bemüht, nicht betrunken zu wirken. Wie vergeblich seine Mühe ist, bemerkt Hans Bellier jedoch nicht. Er ist sogar ein bisschen stolz darauf, sich so gut im Griff zu haben. Dieses Empfinden von Stolz führt ihn zurück zu den vergangenen Stunden.
Das Zusammensein mit den Damen war auch heute wieder anstrengend, aber gleichermaßen erregend und befriedigend. Er hatte keinen Ausfall und ist über seine Potenz sehr erfreut. Allerdings sind beide auch Meisterinnen ihres Faches. Sie verstehen es, ihn immer wieder aufs Neue herauszufordern und in Schwung zu halten.
Dieser Rückblick schwächt seine Konzentration, und er beginnt, erneut zu schwanken.
„Mensch, reiß dich zusammen!“, herrscht er sich wieder an. Sofort verbessert sich die Bewegungskoordination und beansprucht all seine Aufmerksamkeit.
Der Weg zum Auto scheint kein Ende zu nehmen. Schließlich jedoch hat er den Landrover erreicht. Er zieht den Mantel nahezu so umständlich aus, wie er ihn angezogen hat, wirft ihn auf den Rücksitz, setzt sich dann erschöpft auf den Fahrersitz und schließt die Augen. Nun kommt zur Wirkung des Alkohols noch die Müdigkeit hinzu. Als er einzuschlafen droht, rafft er sich auf, nimmt aus dem Handschuhfach ein Erfrischungstuch und fährt sich damit übers Gesicht. Es tut gut und macht etwas munter. Dann kramt er aus dem Handschuhfach eine Schachtel mit starken Mentholpastillen hervor. Zwei dieser Pillen steckt er in den Mund. Auch sie haben eine belebende Wirkung, vertreiben seinen üblen Geschmack im Mund und überlagern etwas die Alkoholfahne. Schließlich startet er den Wagen, fährt langsam und unsicher durch die Wohnsiedlung in südliche Richtung. Sein Weg führt entlang der Eisenbahnlinie, bis er die Bundesstraße eins erreicht. Von dort durchquert er den Ort in Richtung Braunschweig. Die Risiken dieser Fahrt sind ihm voll bewusst. Aber er ist davon überzeugt, dass er hier in keine Polizeikontrolle geraten wird. Wenn überhaupt, dann in Braunschweig. Aber auch dort dürften Kontrollen zu Beginn des Berufsverkehrs nicht sehr wahrscheinlich sein. Zweifel an seiner Fahrtüchtigkeit regen sich bei ihm nicht. Er glaubt, sich und seinen Wagen fest im Griff zu haben.
5.Kapitel
„Heute werde ich den Anorak anziehen, es könnte regnen“, denkt Christine. Das Wetter ist launisch. Sie schiebt das Fahrrad aus der Garage, schnallt ihren Rucksack um und fährt los. Der Fahrtwind erfrischt. Gleich nachdem sie hierher in das kleine niedersächsische Dorf Lamme gezogen war, hatte sie beschlossen, die sechs Kilometer zum Krankenhaus mit dem Fahrrad zurückzulegen und das möglichst bei jedem Wetter. Nur in Ausnahmefällen hat Markus sie mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Die kurzen Radstrecken helfen, den Kopf klar zu bekommen. Dabei bildet die Hinfahrt, wie bei einem Sportler, eine Art geistig-körperliche Vorbereitung auf die kommenden Herausforderungen. Die Rückfahrt schafft Gelegenheit, das Erlebte zu sortieren und zu bewerten.
Im Osten zeigt sich ein schmaler heller Streifen am Horizont. In etwa einer halben Stunde wird die Sonne aufgehen. Die aber wird hinter dicken, niedrig hängenden Wolken verborgen bleiben. Christine radelt langsam durch das verschlafene Nest.
Hier in Lamme ist Markus aufgewachsen. Das Haus gehörte seinen verstorbenen Eltern und stand eine geraume Zeit leer. Nachdem sie Markus kennengelernt hatte, dauerte es nicht lange, bis beide dort eingezogen sind. Er hatte bis dahin bei seiner Frau in Braunschweig gelebt. Christine selbst wohnte zu dieser Zeit in einem Schwesternheim, in dem sie sich wie eine Gefangene fühlte.
Gemeinsam haben sie das Haus von Grund auf renoviert und Einiges umgebaut. Obwohl das alles mit wenigen Geldmitteln, großem körperlichem Einsatz und oftmals unter Zeitdruck durchgeführt werden musste, denkt sie gern an diese Zeit zurück. Die gemeinsame Arbeit hatte zwischen ihnen zusätzliche Nähe geschaffen und ihre Beziehung weiter gefestigt.
Noch ist der ‚Nestbau’ nicht abgeschlossen, aber er war nie so notwendig wie im Augenblick. Bei diesem Gedanken durchflutet sie ein warmes Gefühl.
6.Kapitel
Dr. Hans Bellier ist dreiundfünfzig Jahre alt, promovierter Agraringenieur, einen Meter und neunzig groß - eine stattliche Erscheinung. Die schlanke Gestalt, ein von grauen Strähnen durchzogener dunkles Haar und das scharf geschnittene, markante Gesicht mit wachen intelligenten braunen Augen geben ihm das Aussehen eines Mitglieds des Diplomatischen Korps. Er befährt jetzt in mäßigem Tempo die Bundesstraße, fühlt sich mittlerweile einigermaßen nüchtern und ist mit sich und der Welt zufrieden, körperlich, finanziell und sozial.
Seine Wahl zum Abgeordneten in den Niedersächsischen Landtag vor einem Jahr erfüllt ihn noch immer mit Freude und Genugtuung. Und was war das für ein merkwürdiges Gefühl, an Wahlplakaten vorbeizufahren, auf denen das eigene, überlebens-große Gesicht abgebildet war. Am Anfang hatte er sich noch regelmäßig erschrocken und sich bewusst machen müssen, dass er das ja war, der ihn da so weltmännisch sicher und optimistisch anschaute.
Früher hätte er sich nicht einmal im Traum vorstellen können, eine solche Funktion zu bekleiden. Er, Hans Bellier, in den Niederungen politischer Rangeleien? Undenkbar!
Aber es kam anders.
Vor zwanzig Jahren hat er vom Vater den maroden Landwirtschaftsbetrieb übernommen. Mit großem persönlichem Engagement und hohen finanziellen Risiken hat er den Betrieb zu einem modernen und florierenden Milch verarbeitenden Unternehmen umgestaltet. Nun, nach dem Verkauf des Unternehmens, ist er finanziell mehr als gut gestellt. Das geschah vor drei Jahren, zwei Monaten und neun Tagen. Wenn er an seinen Vater zurückdenkt, mischen sich Gefühle von Furcht, Respekt, aber auch Mitleid. Letzteres ist heute vorherrschend. Der autoritäre Vater hatte sich letztendlich zu Tode geschuftet. Dessen ausgeprägter Starrsinn machte ihn unzugänglich für neue Gedanken. Unbeeindruckt hielt er an dem fest, was und wie er es bisher getan hatte. Er war nicht bereit oder in der Lage wahrzunehmen, dass sich der Markt und die Methoden modernen Wirtschaftens verändert hatten.
Die Mutter, weitsichtig genug zu erkennen, dass der Betrieb ohne einschneidende Veränderungen nicht bestehen würde, setzte alles daran, ihm, dem Sohn, eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Gegen den anfänglichen Widerstand des Vaters konnte Bellier das Gymnasium besuchen und nach dem Abitur ein Studium aufnehmen.
Diese ruhige, besonnene Frau, die es nie gewagt hätte, dem Ehemann in Gegenwart anderer Personen zu widersprechen, war seine verlässlichste Verbündete. Sie brachte ihm Liebe und Verständnis entgegen und nahm ihn gegen manche Willkür des Vaters in Schutz. Hans Bellier ist erst viel später klar geworden, dass die Mutter alle Weichen im privaten Leben gestellt hatte. Mit ihrer sanften, ruhigen, aber unbeirrten Art konnte sie sich in diesen Fragen dem Ehemann gegenüber durchsetzen. Nur die Firma war für sie exterritoriales Gebiet, der einzige Bereich, in dem sie ihren Einfluss nie hatte geltend machen können. Möglicherweise ein Grund dafür, dass es dort beständig bergab ging. Der Vater hielt ein Studium für unsinnig.
„Nichts als vergeudete Zeit, nur die Praxis ist entscheidend“, war sein Kommentar dazu. Widerspruch gegen diese Behauptung ließ er nicht zu. Und die verächtliche Art, wie er das sagte, ließ erkennen, dass er im Studienwunsch des Sohnes eine nur schlecht getarnte Form der Drückebergerei vor „richtiger“ Arbeit sah.
Bellier hegte damals schon den Verdacht, dass die heftige Ablehnung akademischer Bildungen etwas damit zu tun hatte, dass dem Vater eine solche Möglichkeit versagt geblieben war.
Kurz nach Abschluss des Studiums der Agrarwissenschaften in Göttingen erkrankte seine Mutter an Krebs und verstarb ein halbes Jahr später. Der Tod der Mutter hatte ihn seelisch und körperlich schwer getroffen und eine Lähmung der Beine ausgelöst. Eine Zeit lang konnte er sich nur mit Gehhilfen fortbewegen. Damals pflegte ihn Franziska, seine um vier Jahre ältere Verlobte, eine überaus kluge, gut aussehende Frau, selbstständig im Denken und Handeln. Er hatte sie an der Universität kennengelernt, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am kunstgeschichtlichen Seminar arbeitete. Beide verliebten sich ineinander. Franziska ist die Tochter einer alten Braunschweiger Bankiersfamilie. Die Eltern kamen durch einen Verkehrsunfall in Spanien ums Leben. Das geerbte Vermögen hat sie materiell unabhängig gemacht. Diese Unabhängigkeit, zusammen mit ihrer geistigen Eigenständigkeit faszinierte ihn, zeigte es ihm doch, dass sie ihn nur um seinetwillen liebte. Nach seiner Genesung stand sie ihm bei den häufigen Auseinandersetzungen mit dem Vater auf eine bemerkenswerte Weise zur Seite. Ihre Unterstützung entsprang nicht einem Anspruch auf besseres Wissen, und sie wollte ihn auch nicht zu bestimmten Handlungen oder Unterlassungen drängen.
Sie vertrat die Überzeugung, dass Ratschläge auch immer Schläge bedeuteten. Dieser Maxime folgte die konsequent. So bestand ihre Unterstützung in einer respektvollen und liebevollen Art der Begleitung. Ihre Fragen führten ihn oftmals zu neuer Nachdenklichkeit und zu einer veränderten Sicht der Dinge. Bald nach seiner Promotion heirateten sie.
Die Plackerei seines Vaters und dessen genussfeindliche Einstellung waren es dann auch, die ihn schon im Studium einen wichtigen Entschluss fassen ließen: Sollte er geschäftlich erfolgreich sein, würde er nur bis zu seinem fünfzigsten Lebensjahr arbeiten und dann sein Leben ändern. Als er vor drei Jahren seinen fünfzigsten Geburtstag feierte, löste er dieses Versprechen sich selbst gegenüber ein. Er gab bekannt, sich aus dem Geschäftsleben zurückzuziehen.
Franziska kannte seinen Schwur. Wenn er ihr vorschwärmte, was er und sie beide gemeinsam alles tun würden, nachdem er der Tretmühle - genannt Firma - entronnen wäre, hatte sie immer ein wenig mitleidig geschmunzelt. Sie glaubte nicht, dass er seinen Vorsatz wirklich ernst meinte. Sie sah darin ein lustvolles Gedankenspiel über eine imaginäre Flucht aus der Tageswirklichkeit, wie es auch Leute entwickeln, wenn sie vom großen Gewinn in einer Lotterie träumen. Umso erstaunter war sie, als er einige Wochen vor seinem Geburtstag seinen Entschluss verkündete.
Sie akzeptierte seine Entscheidung, hatte allerdings noch gefragt, ob er sich nicht durch einen fähigen Geschäftsführer entlasten könnte, anstatt alles zu verkaufen. Diese Option war für ihn keine akzeptable Lösung. Er kannte sich zu gut, um zu wissen, dass er immer wieder in die Führung der Firma eingreifen würde. Deshalb kamen nur ein Verkauf und damit die vollständige Trennung vom Unternehmen in Frage. Nach zähen Verkaufsverhandlungen war es endlich so weit.
Nun verfügte er über ein ansehnliches Vermögen und eine nahezu unbeherrschbare Menge an Zeit - einen Zustand, den er so bisher nicht kannte. Die hohen Erwartungen an die neue Lebenssituation verstellten ihm den Blick auf die Kehrseite der gewonnenen Freiheit. Er war auf ein Dasein als Privatier nicht ausreichend vorbereitet, hatte gemeint, dass er die Zeit mit seinen vielfältigen brachliegenden Interessen ausfüllen könnte. Dies erwies sich als Trugschluss. Viele seiner Freizeitinteressen, für die vorher nie ausreichend Zeit zur Verfügung stand, verloren unerwartet ihren Reiz. Es fehlten die Einschränkungen, die sie vorher so wertvoll gemacht hatten. Reisen, Angeln, Golfspielen, Skilaufen, ein Fußballspiel besuchen, all das war nun möglich, wann immer er es wollte und sich dafür Gelegenheiten boten. Ohne auf den Preis schauen zu müssen, konnte er kaufen, was er wollte. Das tat er zunächst auch, aber es befriedigte nicht. Dieses Übermaß an Möglichkeiten verunsicherte und lähmte, anstatt zu befreien und Aktivitäten zu beflügeln. Da entstand nur Leerlauf, Lethargie und Unzufriedenheit.
So war die Umstellung auf den neuen Lebensabschnitt viel schwieriger als erwartet. Im Stillen hatte er bald den Verkauf des Unternehmens mehr als einmal verflucht.
Am Tiefpunkt dieser Entwicklung angelangt, raffte er sich auf, systematisch aufzulisten, was in seinem bisherigen Leben zu kurz gekommen war und was er sich nicht zugetraut oder zu tun gewagt hatte. Diese Inhalte sollten nun in seinem neuen Lebens-abschnitt einen breiten Raum einnehmen. Ergebnis dieser Bilanz
stellte das „PSF - Programm“ dar.
7.Kapitel
Christine befindet sich kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße eins, nach Braunschweig. Nieselregen hat eingesetzt. Sie zieht die Kapuze weit über den Kopf und tritt etwas kräftiger in die Pedale. Hin und wieder nimmt sie die Hand vom Lenker, um sich die Nässe aus den Augen zu wischen.
Ihre Gedanken sind bei Markus. Sie ist gespannt auf sein Gesicht, wenn sie ihm eröffnet, dass sie schwanger ist. So lange hatte ihre Periode noch nie auf sich warten lassen. Der Schwangerschaftstest lieferte nun eine erste Bestätigung. Für morgen ist sie bei ihrer Frauenärztin angemeldet.
„Ein Baby! Unser Traum vom gemeinsamen Kind wird nun wahr. Ich werde es ihm aber erst nach dem Arzttermin sagen, wenn ich endgültig sicher bin.“ Immer wieder gehen ihr diese Gedanken durch den Kopf. Dann überlegt sie weiter:
„Vielleicht führt die Schwangerschaft auch zum Einlenken von Britta. Bisher verweigert sie beharrlich, unsere Beziehung ernst zunehmen und der Scheidung zuzustimmen. Also, weitere zehn Monate Wartezeit, dann erst kann die Ehe auch ohne Brittas Einwilligung geschieden werden. Ob sie noch hofft, Markus zurückzugewinnen, oder ist alles nur Schikane aus verletztem Stolz?“
Christine ärgert sich oftmals darüber, dass Markus der Auseinandersetzung mit Britta aus dem Wege geht, zu wenig Kampfgeist und Entschlossenheit zeigt. Hält sie ihm das vor, entgegnet er, dass Auseinandersetzungen mit Britta sinnlos seien. Britta wäre keinesfalls zum Einlenken zu bewegen. Es ginge ihr gar nicht um Klärung. Denn für sie ist alles klar. Sie will ihn, solange sie mit ihm verheiratet ist, festhalten und erzwingt auf diese Weise den Kontakt. Mit ihr zu diskutieren heißt, Kontakt herzustellen, was wiederum bedeutete, Brittas Spiel zu spielen. Dazu ist er nicht bereit.
Christine ist von dieser Strategie nicht überzeugt. Es bleibt dabei, sie hält ihn für zu nachgiebig. Auch kann sie immer noch nicht begreifen, wie dieser ruhige und nachdenkliche, manchmal merkwürdig verschlossene Mann es so lange mit einer anmaßenden und herrischen Frau wie Britta ausgehalten hat. Ihr gegenüber zeigt Britta offene Feindschaft. In angetrunkenem Zustand, vollkommen außer sich, hatte sie gedroht, Christine umzubringen. Und das traut Christine ihr zu und denkt:
„Britta ist zu allem fähig!Diese Frau ist fanatisch und kommt mit der Kränkung nicht klar, dass Markus sie verlassen hat.“
8.Kapitel
Belliers Fahrt durch den kleinen Ort verläuft problemlos. Ähnlich wie beim Gehen, will er mit einer betont korrekten Fahrweise den Eindruck vermitteln, dass mit dem Fahrer alles in Ordnung ist. Aber genau dadurch müsste er auffallen, wenn die wenigen Menschen auf den Straßen ihn beachteten oder er der Polizei begegnen würde.
Er denkt an die einzelnen Schritte, die er unternommen hat, um sein privates PSF-Programm zu realisieren und muss schmunzeln. Dabei steht das „P“ für Politik, das „S“ für Sex und das „F“ für Fliegen. Bis vor drei Jahren hatte er mit Politik nichts im Sinn. Er stand ihr verständnislos, oftmals mit Verachtung gegenüber und schaute herablassend auf die Kaste der Politiker. Die politische Willensbildung hielt er für zu umständlich und langwierig, die daraus gewonnenen Entscheidungen für faule Kompromisse. Sich anderen anzubiedern, um gewählt zu werden, und auf diesem Wege Veränderungen herbeizuführen, entsprach nicht seiner Wesensart. Als Unternehmer besaß er keinen Mangel an Gestaltungsmöglichkeiten. Als er dann in seiner Bilanz feststellte, dass da nichts mehr zu gestalten war, begann er sich mit politischen Problemen auseinander zu setzten, vor allem mit denen, in seiner Region.
Es folgte ein weitere Schritt: Er trat in die Partei ein, die seinem konservativen Weltbild und seinen Wertvorstellungen am nächsten kam. Er wollte sich dort lediglich orientieren und Erfahrungen sammeln, wie es früher Praktikanten in seiner Firma taten.
Dabei erkannte er schnell den Reiz politischen Wirkens und sah darin eine neue Herausforderung: Sich durchzusetzen, nur gestützt auf persönliche Überzeugungskraft, eigene Wertvorstellungen, Analysen und Lösungskonzepte. Das kannte er in dieser Form bisher nicht. Als Firmenchef hatte er diese Kunst des „‚Kämpfens ohne Waffen“ nur beim Kunden einsetzen müssen. Dabei halfen ihm aber Fakten, technisches Know-how und Produktkenntnisse, die es für politisches Entscheiden und Handeln in dieser Form nicht gibt. Die regionale Parteiorganisation erkannte schnell seine organisatorischen und rhetorischen Qualitäten. Besonders beeindruckt war man, wie es ihm in Diskussionen gelang, ohne Pathos und Weitschweifigkeit, Probleme zu analysieren und Lösungen zu entwickeln. Diese Lösungsansätze verbanden wertkonservative Positionen mit innovativen Vorgehensweisen. Seine Beiträge überzeugten, wohl auch deshalb, weil er als erfolgreicher Unternehmer nach gleichen Grundsätzen gehandelt hatte. Man nahm ihn mit Freude auf. Damit brachte er frischen Wind in die erstarrte und angestaubte Parteimannschaft. Man förderte ihn, obwohl er ein unerfahrener Quereinsteiger war. Damit begann ein steiler, parteiinterner Aufstieg, dessen vorläufiger Abschluss das Direktmandat zum Landtagsabgeordneten darstellt. Auguren haben ihm bereits eine Karriere auf Bundesebene vorhergesagt.
So verwirklichte er das ‚P’ in seinem Programm.
9.Kapitel
Der Regen ist stärker geworden. Christine befindet sich jetzt auf der Bundesstraße. Sie hat bereits die drei Teiche zu ihrer Rechten hinter sich gelassen und die leichte Steigung überwunden. Jetzt geht es ohne zu treten in flotter Fahrt bergab. Sie ärgert sich darüber, dass hier der Fahrradweg noch immer nicht freigegeben wurde. Seit Wochen werden an der Straße Schachtarbeiten durchgeführt und Röhren verlegt. Zwischen Straßenrand und dem Fahrradweg ist ein tiefer und breiter Graben ausgehoben worden. Kleine Hügel von bräunlich-roter Erde türmen sich auf dem Fahrradweg.
Ein rot-weißes Plastikband, befestigt an spillerigen und schiefen, in den Boden gerammten Eisenstangen, dient als straßenseitige Baustellenabsperrung. Das Band ist an vielen Stellen zerrissen, flattert in der Luft oder hängt schlaff in weiten Bögen bis hinunter zum Straßenbelag. An manchen Abschnitten fehlt es vollständig. In größeren Abständen zwischen den Eisenpflöcken blinken rhythmisch gelbe Warnlampen. Ein Fahrzeug fährt mit hohem Tempo dicht an ihr vorbei. Sie hat es wegen der Kapuze ihres Anoraks nicht herannahen hören. Ein Schreck durchfährt sie, wie ein elektrischer Schlag. Mit Schaudern erinnert sie sich daran, wie Britta im Spätherbst ein Jahr zuvor sie auf diese Weise beinahe von der Straße gefegt hätte.
Damals war sie wie mit dem Rad von der Arbeit gekommen. Plötzlich ein heranrasendes Auto. Dann spürte sie eine Druckwelle, die sie fast umriss. Nur mit Mühe konnte sich auf dem Rad halten. Wenige Zentimeter fehlten und der Wagen hätte sie getroffen.
Langsam kommt sie wieder zur Ruhe indem sie sich auf das Radfahren konzentriert.
10.Kapitel
Bellier schreckt auf und bemerkt, dass er noch immer an der Kreuzung steht, obwohl die Ampel längst grünes Licht zeigt. Er fährt ruckartig an und schimpft laut mit sich selbst.
„Mensch reiß dich zusammen, eine Polizeikontrolle würde gerade noch fehlen.“
Dann setzt er die Fahrt konzentriert fort. Er denkt an seine beiden Damen, die das ‚S’ seines Programms im wahrsten Sinne des Wortes „verkörpern“. Im Bett geschieht zwischen Franziska und ihm seit vielen Jahren nichts mehr. Dennoch liebt er sie hingebungsvoll und erfährt auch ihre tiefe Zuneigung auf vielerlei Weise. Die Beziehung hat sich zu einem innigen Bruder-Schwester-Verhältnis entwickelt. Es besteht zwischen ihnen eine unausgesprochene Übereinkunft, dass Sexualität kein Bestand-teil ihrer Beziehung ist.
Er ist davon überzeugt, dass Franziskas Interesselosigkeit am Sex in einem Ereignis begründet liegt, das viele Jahre zurückliegt.
Ein Jahr nach dem Tod seines Vaters wurde Franziska schwanger. Beide waren überglücklich. Dann im fünften Monat der Schwangerschaft hatte Franziska eine Fehlgeburt und musste erfahren, dass sie von nun an keine Kinder mehr bekommen wird - für beide ein schwerer Schlag.
In ihrem Schmerz klammerten sie sich ganz eng aneinander. Ihm kam es so vor, als würde diese Nähe von ihr ausgehen und manchmal beschlich ihn der Gedanke, dass sie an ihm etwas gut machen wollte. Mit dieser Nähe aber verschwanden Franziskas sexuelle Bedürfnisse vollständig. Er fühlte sich zurückgewiesen. Die wenigen Male, in denen er sie gedrängt hatte, mit ihm zu schlafen, empfand er als verkrampfte, mühevolle Pflichtübungen, bei denen er selbst nur wenig Lust verspürte. Schließlich verzichtete er ganz auf Sex mit ihr. Mit diesem Verzicht wuchs Franziskas liebevolle Zuwendung. Wollte sie sich bedanken oder entschädigen, dass er sie in dieser Hinsicht in Ruhe ließ?
Auch sein sexuelles Interesse nahm rapide ab, nicht nur Franziska, sondern auch anderen Frauen gegenüber. Er erklärte es sich mit der aufreibenden Arbeit im Betrieb. Trotz der unausgesprochenen, aber einvernehmlichen Aufkündigung, nicht miteinander zu schlafen, weiß er bis heute nicht, wie Franziska auf einen Seitensprung reagieren würde. Würde sie sich von ihm trennen, oder würde sie es ihm nachsehen? Die Angst, sie zu verlieren, sitzt tief.
Seine sexuelle Abstinenz bereitete ihm über all die Jahre kein Problem. Das änderte sich, als er die Firma verkauft hatte. Wie beim Öffnen einer Sprudelflasche nach kräftigem Schütteln schäumte nun sein sexuelles Bedürfnis drangvoll auf.
Er mochte sich seiner Frau nicht nähern, um den Bestand des harmonischen Verhältnisses nicht zu gefährden. Eine Geliebte zu finden, wäre ihm ohne Schwierigkeiten möglich gewesen. Es gab einige ehemalige Mitarbeiterinnen im Betrieb und weitläufige Bekannte, die an einer Liebesbeziehung mit ihm Interesse hatten. Was ihn von solchen Abenteuern zurückschrecken ließ, war die Gefahr von gefühlsmäßigen Verwicklungen, die er weder bei sich noch bei der Partnerin ausschließen konnte. Eine solche Affäre dürfte sich - über den gemeinsamen Spaß am Sex hinaus - auf keinen Fall zu einer Bedrohung der Beziehung zu Franziska entwickeln. So verwarf er diese Möglichkeit.
Dann nahm all seinen Mut zusammen und besuchte das erste Mal in seinem Leben ein Bordell. Hier fand er genau das, was er suchte: Das professionelle Sexangebot schloss emotionale Bindungen aus, war diskret, hinterließ keinerlei Verpflichtungen, stand zu jeder Zeit zur Verfügung, bot Möglichkeiten zu experimentieren, ermöglichte problemlos einen Wechsel der Partnerinnen oder mit mehreren Damen gleichzeitig zusammen zu sein. Diese Vielfalt an Möglichkeiten, zusammen mit der Heimlichkeit, in der er das Angebot nur wahrnehmen konnte, übte einen zusätzlichen Reiz aus. Als er seine moralischen Skrupel und die gewisse Peinlichkeit, „es nötig zu haben“, überwunden hatte, war er in den Bordellen der Region ein oft und gern gesehener, großzügiger Gast. Was ihn allerdings störte, war einmal die Tatsache, ein Kunde unter vielen zu sein, zum anderen die Gefahr, erkannt und dann, vielleicht sogar erpresst zu werden. Durch seine politische Arbeit geriet er mehr und mehr ins Licht der Öffentlichkeit, womit seine Besuche solcher Etablissements immer risikoreicher wurden. Über eine Anzeige fand er die beiden jungen, sehr professionellen Damen, die von sich behaupteten, Studentinnen zu sein. Er war von den beiden in jeder Hinsicht angetan. Im Gegenzug zu seiner Finanzierung einer Wohnung, eines Autos und des Lebensunterhalts, verpflichteten sich die Frauen ihrerseits, ausschließlich ihm und zu jeder Zeit zur Verfügung zu stehen. Das war zwar sehr kostspielig, bot aber die besten Voraussetzungen, dass dieser zweiter Bestandteil seines Lebensprogramms, das „S“, im Geheimen blieb. Er wollte keinesfalls das Risiko eingehen, seine Frau und seinen guten Ruf zu verlieren.
11.Kapitel
Christine tritt gleichmäßig in die Pedalen und bewegt sich in einem konstanten Tempo entlang der Baustelle. Ihre Gedanken sind noch bei dem Beinahezusammenstoß im vorigen Jahr. Es war Britta. Durch die Heckscheibe des Wagens erkannte sie deren blonden Pferdeschwanz. Britta hatte sich auch noch kurz umgewandt und ihr mit höhnischem Grinsen den Mittelfinger gezeigt.
Als sich Christine vom Schreck erholt hatte, wurde ihr klar, dass es Britta auf einen Unfall hatte ankommen lassen. Nur eine leichte Berührung, und sie wäre schwer gestürzt.
Am Abend berichtet sie Markus den Vorfall. Markus wurde sehr zornig, sprang auf und lief zum Telefon. Noch ehe sie ihn davon abhalten konnte, hatte er Britta bereits am Apparat und stellte sie zur Rede. Was sie sich bei ihren morgendlichen Eskapaden mit dem Auto gedacht habe, hatte Markus aufgebracht gefragt. Britta erwidert kühl darauf:
„Mann, reg’ dich nicht so auf, die Dame will sich doch nur aufspielen, es ist doch völliger Quatsch, den sie dir da erzählt.“
„Du hast sie heute also nicht mit deinem Wagen überholt?“
„Ja natürlich, aber ich hab’ sie nicht bedrängt.“
„Du bist also nicht extrem dicht an ihr vorbeigefahren?“
„Blödsinn! Warum sollte ich das tun? Dazu ist sie mir nicht wichtig genug. Im Gegenteil, ich hab ihr sogar noch freundlich zugewinkt. Das ist alles.“
Christine, die über den Lautsprecher mitgehört hatte, schüttelte empört den Kopf, daraufhin hatte Markus wütend in den Hörer schrie:
„Du lügst doch wie gedruckt! Das bleibt nicht ohne Konsequenzen, darauf kannst Du Dich verlassen!“
„Na, wenn du alles weißt, warum fragst du dann? Besser wäre es, die Dame würde dir erklären, warum sie solchen Scheiß erzählt. Darüber solltest du dir mal Gedanken machen, anstatt mich anzubrüllen, grundlos zu beschuldigen und zu bedrohen. Vielen Dank auch und noch einen schönen Abend.“
Dann hatte sie aufgelegt. Wieder einmal war es Britta gelungen, Zweifel in Markus einzupflanzen, denn er zog resigniert die Schultern hoch und ging nicht weiter auf das Thema ein.
Auch Christine beließ es dabei, sonst hätten sie sich vermutlich wieder über Britta gestritten. Im Stillen aber schimpfte sie:
„Es ist zum Verzweifeln! Immer wieder gelingt es dieser schrecklichen Frau, Gift in unsere Beziehung zu spritzen.“
Damit war die Stimmung an diesem Abend im Eimer.
12.Kapitel
Mittlerweile hat Hans Bellier das Städtchen verlassen und befindet sich auf der schnurgeraden Bundesstraße in Richtung Braunschweig. Es herrscht kaum Verkehr. Er fährt nun etwas flotter. Die wenigen Fahrzeuge, die vor ihm fahren, kann er nur an der grauen Spritzwasserschleppe erkennen, die sie hinter sich herziehen.
Die Sicht ist schlecht. Es ist zwar heller geworden, aber die dicken Wolken und der Vorhang aus Nieselregen schirmen das Licht der gerade aufgehenden Sonne ab.
Das monotone Motorgeräusch und die gleichförmige Bewegung der Scheibenwischer ermüden ihn. Seine Lider werden schwer, und für Bruchteile von Sekunden fallen ihm die Augen zu. Er erschrickt, nimm das Gas weg und lässt die Scheibe an der Fahrertür herab. Kühle, feuchte Luft strömt ins Wageninnere, sie erfrischt und macht ihn etwas munterer. Bellier denkt an das dritte Symbol seines Programms, an das „F“, das für Fliegen steht. Obwohl er einiges über Aerodynamik und Funknavigation gelesen hatte, war ihm diese Art der Fortbewegung zutiefst unheimlich. Für ihn stellte es ein Mysterium da, dass sich ein so schweres Gerät wie ein Flugzeug in der Luft halten kann und dazu noch die kleinen Betonpisten - genannt Landebahnen - irgendwo in der Landschaft findet. Der erste Flug war eine einzige Tortur. Die Angst abzustürzen, hatte ihn die ganze Zeit über fest im Griff. Er horchte den ganzen Flug auf das Dröhnen der Triebwerke. Jede Veränderung der Tonlage erschreckte ihn und es schien, dass er dabei Schläge in die Magengrube erhielt. Turbulenzen nahmen ihm den Atem. Er presste sich in den Sitz und krallte sich ins Polster der Armlehne. Wie ein Gebet zählte er die Zahlenreihe aufwärts, bis das Flugzeug wieder ruhig in der Luft lag. Wenn die Landeklappen und das Fahrwerk kurz vor der Landung geräuschvoll ausgefahren wurden, schlug sein Herz bis zum Hals. Er orientierte sich an den Gesichtern der Stewardessen und beruhigte sich mit dem nicht ganz abwegigen Gedanken, dass, solange diese keine Panik zeigten, es um den Flug nicht allzu schlecht bestellt sein konnte.
Auch später konnte er die Flugangst nicht eindämmen. Er vermied soweit es ging private und geschäftliche Flüge. Wenn ein solcher Flug jedoch unvermeidlich, dann kletterte er jedes Mal erschöpft und schweißnass aus einem Flieger.
Dass er nun ausgerechnet das Fliegen in sein neues Lebensprogramm aufgenommen hat, geht auf eine sehr prägende Begebenheit zurück.
Vor etwa drei Jahren hatte er Geschäftsfreunde zum Flughafen begleitet. Nach ihrer Verabschiedung sprach ihn jemand an mit den Worten: „Hallo, Tag Chef.“ Er benötigte eine Weile, ehe er in dem Mann einen seiner Lagerarbeiter erkannte. An den Namen konnte er sich nicht erinnern. Das merkte der junge Mann und half ihm.
„Ich bin der Moll, Peter Moll, Gabelstaplerfahrer im Lager.“ Sie wechselten ein paar Worte. Moll gab sich geheimnisvoll und bat ihn in vertraulichem Ton, ihm etwas zeigen zu dürfen. Das machte ihn neugierig, und er folgte seinem Mitarbeiter etwas unsicher. Sie passierten die Kontrolle zum Flughafenbereich, erreichten das Vorfeld und gingen auf ein kleines, einmotoriges Flugzeug zu.
„Der Vogel da, der gehört ein paar Kumpel und mir“, erklärte Moll sichtlich stolz, „kommen Sie Chef, ich lade Sie zu ’ner kleinen Runde ein.“ Als Moll das besorgte Gesicht und sein Zögern bemerkte, fügte er hastig hinzu, „keine Sorge Herr Doktor, hab’ schon ziemlich lange den Pilotenschein und ’ne Menge Stunden heruntergeschrubbt, steigen Sie einfach ein.“ Was sollte er tun? Einen Vorwand suchen, um das freundliche Angebot abzulehnen, Zeitmangel vorschieben, seine Angst zugeben? Nein, als Chef wollte er sich keine Blöße geben. Also biss er die Zähne zusammen und kletterte umständlich und mit sehr gemischten Gefühlen in den engen, etwas wackligen Zweisitzer. Derweil führte Moll den Außencheck durch, prüfte den Ölstand des Motors, umrundete anschließend das Flugzeug, schaute sich die Tragflächen an, wackelte an den Rudern und dem Fahrwerk. Schließlich bestieg auch er die Maschine.
„So, das war der Außencheck“, erklärte er, „wegen der Sicherheit, wissen Sie.“
Dann half er ihm, sich anzuschnallen, reichte ihm Kopfhörer, eine Checkliste und bat ihn, Punkt für Punkt langsam daraus vorzulesen. Moll führte die in der Liste geforderten Prüfungen nacheinander aus und bestätigte jede. Im Wesentlichen bestand die Prüfung darin, Knöpfe zu drehen, Anzeigegeräte einzustellen und Sicherungen auf ihren festen Sitz zu kontrollieren. Dann ließ er das Triebwerk an. Aus den Kopfhörern ertönte ein babylonisches Sprachgewirr, teils Deutsch teils Englisch. Moll sprach etwas ins Mikrofon, sogleich antwortetet eine freundliche Stimme und sagte etwas über den Weg zur Startbahn, die Windstärke, die Startrichtung und den Luftdruck. Moll wiederholte die Meldung, und die Maschine rumpelte dann zur Startbahn. Nun gab es kein Entrinnen mehr. Gottergeben beugte er sich in das Unvermeidliche, und es gelang ihm sogar, sich ein wenig zu entkrampfen. Er tröstete sich damit, dass sein Mitarbeiter auch wieder heil herunterkommen wollte.
Noch ein letzter Check vor dem Start. Moll drehte nacheinander den Zündschlüssel, wobei er den Drehzahlmesser genau beobachtete. Jedes Mal wurde das Motorengeräusch etwas schwächer, und die Motordrehzahl fiel ab. Moll erklärte, dass man auf diese Weise feststellt, ob beide Magnetzündungen funktionieren. Schließlich zog er einen Hebel heraus. Auch dadurch verringerte sich die Drehzahl des Motors, ging aber wieder höher, als er ihn zurück in die Ausgangsstellung brachte.
„Das war die Prüfung der Vergaservorwärmung“, und fügte hinzu, dass er später erklären würde, was es damit auf sich hat. Das, was Moll tat, empfand er ebenso spannend wie verwirrend. Umso mehr war er für dessen Erklärungen dankbar. Seine Neugier schien Aufregung und Besorgnis zu verdrängen. Er war darüber verwundert, dass er die sonst übliche Angst nicht spürte. Dann meldete sich Moll wieder beim Turm und erhielt die Startfreigabe. Das Flugzeug rollte los, bog in die Startbahn ein, richtete sich an der Mittellinie aus. Dann gab Moll langsam Gas, bis der Motor auf vollen Touren lief. Das Maschinchen schüttelte und rüttelte sich. Als die Bremsen gelöst wurden, schoss es befreit nach vorn, wurde schneller und schneller und unversehens befanden sie sich in der Luft.
Nun geschah etwas Unglaubliches. Es passierte nichts, gar nichts. Das erwartete Angstgefühl blieb aus, als hätte er die Angst am Boden gelassen.
Moll wirkte ruhig und besonnen, flog die Maschine entspannt, ganz selbstverständlich. Er hatte den Vogel offensichtlich voll im Griff.
„Ist das nicht irre, Chef?“, fragte er voller Begeisterung und tatsächlich, er empfand das ebenso. Alles war ganz unmittelbar und übersichtlich, nicht undurchschaubar, wie in den großen Jets.
Sie stiegen und stiegen. Er starrte gebannt aus dem Seitenfenster. Unter ihnen das Flughafengelände, das sie langsam hinter sich ließen, dann zogen Dörfer, Felder und Waldstücke unter ihnen hinweg, alles im Miniaturformat. Sie überflogen die Autobahn und den Stichkanal, der in der Nachmittagssonne wie ein silbriges Band leuchtete. Zweimal bekam er einen Schrecken, als das Flugzeug im Steigflug von einer Bö geschüttelt wurde. Das aber war auch alles.
Als der Steigflug beendet, und das Flugzeug waagerecht und ruhig in der Luft lag, begann er den Flug und den Ausblick zu genießen. Etwas unwohl fühlte er sich anfänglich in den Kurven. Es erschien ihm, als würde er seitlich abrutschen und hielt sich deshalb verkrampft am Haltegriff fest. Aber bereits nach den ersten Kurven empfand er diese Bewegung eher erregend als unangenehm. Moll erläuterte ihm während des Fluges die wichtigsten Bestandteile der technischen Ausstattung der Maschine. Er beschrieb die Funktionen einzelner Anzeigegeräte und erklärte den Sinn seiner Aktionen. Dabei kam er zurück auf die Vergaservorwärmung und erklärte, dass im Landeanflug bei gedrosseltem Triebwerk durch die anströmende Luft eine starke Abkühlung des Motors erzeugt wird. Diese Verdunstungskälte bewirkt schnell eine Vereisung des Vergasers, damit eine Unterbrechung der Treibstoffzufuhr und führt zu einer extrem gefährlichen Situation. Deshalb wird mit dem Ziehen des Hebels warme Verbrennungsabluft direkt an den Vergaser geführt, was die Motorleistung zwar etwas vermindert, aber eine Vereisung verhindert. Molls Kenntnisse und dessen ruhige und verständliche Erläuterungen beeindruckten ihn stark.
„Mann, das ist nun einer meiner Gabelstaplerfahrer, unglaublich!“ Den Höhepunkt des Fluges bildete der Moment, als Peter Moll ihn freundlich und bestimmt aufforderte, das Steuerhorn zu übernehmen. Der Schreck war schnell überwunden. Noch ein paar Erklärungen, worauf zu achten wäre, und das Flugzeug befand sich jetzt in seiner Hand. Es war ganz leicht zu steuern. Die Maschine reagierte sensibel auf jede Ruderbewegung.
Schließlich lernte er, eine Kurve ein- und auszuleiten und dabei das Steuerhorn behutsam zu ziehen, um nicht an Höhe im Kurvenflug zu verlieren. Das war unglaublich spannend. Nach ein paar Übungen klappte es schon recht gut und Moll lobte: „Donnerwetter! Chef, das bekommen Sie ja schon so hin, wie ein Profi. Alle Achtung, Sie haben ein gutes Fluggefühl!“
Nach etwa zehn Minuten - er hatte keine Ahnung, über welchem Gebiet sie sich gerade befanden - dirigierte ihn Moll in die Platzrunde. Beim Endanflug übernahm dieser wieder das Steuer, ließ ihn die Vorwärmung ziehen und die Bewegungen am zweiten Steuerhorn mit vollziehen. Die Landung verlief ruhig und sanft. Er war überwältigt. So unmittelbar und vollkommen angstfrei hatte er das Fliegen noch nie erlebt. Das zu lernen, was Peter Moll beherrschte, stand nun ganz oben auf der Hobbyliste. Nur damals hatte er keine Zeit. Heute aber liegen die ersten Theoriestunden und einige Starts und Landungen bereits hinter ihm. Der erste Alleinflug wird in naher Zukunft stattfinden.
13.Kapitel
Im Moment ist es sehr still. Das Vogelgezwitscher und die heiseren Rufe der Krähen hat scheinbar der Regen verschluckt. Christine hört nur das Fahrgeräusch von Reifen auf feuchtem Pflaster, gleich einem leisen Zischen. Ab und zu knarrt der Sattel und manchmal entsteht ein Knacken beim Treten der Pedale. Jetzt vernimmt sie Motorgeräusch, das sich schnell nähert.
Christine will nach hinten schauen, als sie plötzlich, wie von einer unsichtbaren Hand emporgehoben, durch die Luft gewirbelt wird. Sie spürt einen harten Schlag. Dann ist nur noch schwarze Nacht um sie.
14.Kapitel
Bellier sind erneut die Augen zugefallen. Während des Sekundenschlafs driftet er im Baustellenbereich weit nach rechts. Als er erschrocken aufwacht, ist der Radfahrer plötzlich dicht vor ihm. Geistesgegenwärtig reißt er das Lenkrad nach links, und es gelingt ihm gerade noch, dem Radfahrer auszuweichen. Als er aber in den Rückspiegel schaut, ist der Radfahrer verschwunden.
Bellier ist erschrocken und fühlt sich augenblicklich nüchtern. Er ist beunruhigt. Aber da war kein Geräusch oder eine Bewegung, die auf einen Zusammenstoß hingedeutet hätten. Aber etwas stimmt nicht. Wo ist der Radfahrer?
Bellier tritt auf die Bremse, legt den Rückwärtsgang ein und fährt zu der Stelle, wo er den Radfahrer zuletzt gesehen hat. Er schaltet das Warnblinklicht ein und steigt aus dem Wagen. Zögernd nähert er sich dem Straßenrand und erkennt nun eine bewegungslose, auf dem Rücken liegende Gestalt im Graben, auf ihr das Fahrrad. Der Kopf ruht seitlich auf den weißen Mauersteinen der inneren Randmauer des Grabens. Das Gesicht ist von der Straßenseite abgewandt und von der Kapuze verdeckt. Blut verteilt sich langsam auf den weißen Steinen und nimmt, vom Regen verdünnt, einen helleren Farbton an.
Hans Bellier klettert in den Graben, hebt das verbogene Fahrrad auf, lehnt es an eine Seite. Dann beugt sich über den Verunglückten. Bellier dreht den Kopf behutsam zur Seite, um in das Gesicht sehen zu können und erkennt jetzt, dass es sich bei dem Unfallopfer um eine junge Frau handelt. Ihre Lippen sind aufgeschlagen. Ein dünner Blutfaden rinnt aus Mund und Nase.
„Hallo, können sie mich hören, verstehen sie mich, hallo, können Sie mich hören?“, ruft Bellier erregt:
Er prüft den Puls an der Schlagader der Frau, kann zunächst in seiner Aufregung nichts feststellen. Dann aber bemerkt er ein schwaches Pochen und ist erleichtert.
Plötzlich öffnet die Frau die Augen, starrt zu ihm hoch und röchelt ein paar Worte, aus denen er so etwas herauszuhören glaubt, wie: „Wo bin ich?“, Sie starrt noch einen Moment Bellier an, bewegt die Lippen, ohne einen Ton herauszubringen. Sann schließt sie die Augen und scheint wieder weggetreten zu sein. Bellier überlegt, was er tun kann. Glücklicherweise musste er vor Beginn der Privatpilotenausbildung an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen. Daher weiß er, wie Verletzte in eine stabile Seitenlage zu bringen sind. Das tut er, so gut er sich an die Übungen im Kurs erinnern kann. Er zieht zunächst ihren linken Arm durch den Rucksackgurt und bringt die Frau vorsichtig in die vorgeschriebene stabile Seitenlage. Die Frau reagiert nicht, aber Bellier nimmt erleichtert ein flaches Atmen bei ihr wahr.
15.Kapitel
Langsam kommt Christine wieder zu sich. Das Erste, was sie spürt, ist der Geschmack von Blut. Sie öffnet die Augen, will den Kopf heben und sich aufrichten, aber ein heftiger Schmerz durchfährt sie vom Kopf zur Schulter und bringt die Bewegung zum Stillstand. Sie begreift nicht, was geschehen ist und wo sie sich befindet. Jemand beugt sich über sie. Das Gesicht ist verschwommen, es ist das eines Mannes. Sie sieht, dass sich seine Lippen bewegen, kann aber nichts hören; es ist, als wäre wie beim Fernseher der Ton abgeschaltet. Über ihr schwingt eine Art Pendel, eine kleine, runde goldene Scheibe an einer ebensolchen Kette. Sie erkennt darauf gestochen scharf ein Sternkreiszeichen.
„Das ist ein Widder, mein Sternzeichen, was hat das zu bedeuten, was mache ich hier? Ich muss doch zur Arbeit?“, denkt sie verwirrt. Sie will etwas sagen, es kostet sie aber zu viel Kraft, Worte zu finden. Ihre Sprache gehorcht ihr nicht mehr. Sie ist
müde und will einfach nur schlafen.
16.Kapitel
Wenige Autos rauschen auf der regennassen Straße an der Unfallstelle vorbei. Bellier überlegt, ob er eines anhalten soll, damit der Fahrer Hilfe anfordern kann. Sogleich verwirft er den Gedanken. Panik kommt auf. Er hat ja einiges getrunken, man würde ihn vielleicht erkennen, er müsste erklären, woher er gekommen ist, und was er dort getan hat. Das könnte sich zu einem Skandal ausweiten, alles wäre ruiniert.
So entschließt er sich, selbst Hilfe zu holen. Sein Handy wagt er nicht zu benutzen, man könnte ihn darüber ausfindig machen. Aber er erinnert sich, dass in den Haltebuchten der Straße Notrufsäulen stehen. Hastig klettert er aus dem Graben, läuft zum Wagen und fährt mit hoher Geschwindigkeit los. Minuten später hält er neben der orangefarbenen Notrufsäule. Er steigt eilig aus, drückt den Hebel nach unten und wartet. Eine blecherne Stimme meldet sich. Er gibt den Ort und die Zeit des Unfalls genau an. Beim Sprechen hält er sich ein Taschentuch vor den Mund, so wie es Anrufer in Kriminalfilmen tun, deren Stimme nicht identifiziert werden soll. Nach seiner Meldung unterbricht er abrupt das Gespräch.
Er sitzt nun wieder im Wagen und überlegt angestrengt: Zurück zum Unfallort fahren und auf den Notarztwagen und die Polizei warten? Er könnte behaupten, die verunglückte Frau dort entdeckt und Hilfe angefordert zu haben. Aber wie sollte er erklären, im Vorbeifahren die Frau im Graben entdeckt zu haben. Das könnte er vielleicht noch mit einer Pinkelpause notdürftig erklären. Aber mit Sicherheit würde man eine Blutprobe veranlassen, die ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer und möglicherweise auch Verkehrsgefährdung mit Körperverletzung nach sich ziehen würde. Seine Ehe und politische Karriere würden die zu erwartenden schweren Turbulenzen nicht überstehen. Andererseits, wenn er jetzt nach Hause führe, erfüllte das mindestens den Tatbestand der Verkehrsunfallflucht. Das wäre weitaus schlimmer, hätte aber nur dann Konsequenzen, wenn man ihn als Fahrer ermittelte. Wie stehen dafür die Chancen? Er zwingt sich zur Ruhe und überlegt. Es ist unwahrscheinlich, dass die verunglückte Frau ihn überhaupt bewusst gesehen und sich an
ihn erinnern kann, wenn sie wieder zu sich kommt. Andere Fahrzeuge haben sicherlich seinen am Straßenrand geparkten Wagen mit den Warnlichtern gesehen. Bei der Dämmerung und dem Regen wird man das Fahrzeug bei der hier üblichen Geschwindigkeit - wenn überhaupt - nur sehr kurz wahrgenommen haben. Dass sich jemand die Zulassungsnummer gemerkt hat, hält er für ausgeschlossen. Schlimmstenfalls wurden Fahrzeugtyp und Farbe erkannt. Dunkle Landrover oder ähnliche Fahrzeuge gibt es in Braunschweig und Umgebung sehr viele. Außerdem war der Verkehr noch sehr schwach. Erst jetzt beginnt sich der Straßenverkehr zu beleben. Hans Bellier trifft eine Entscheidung. Er fährt weiter in Richtung Braunschweig. Unterwegs versucht er sein Gewissen zu beruhigen. Auch wenn er zum Unfallort zurückgekehrt wäre, um dort auf die Rettungskräfte zu warten, das hätte der Frau auch nicht helfen können. Besonders behaglich fühlt er sich bei diesen Gedanken allerdings nicht. Kurz bevor er die Autobahnunterführung erreicht, kommen ihm auf der Gegenfahrbahn ein Polizeifahrzeug und ein Krankenwagen mit hoher Geschwindigkeit entgegen.
Er ist erleichtert, denn er weiß nun, dass in wenigen Minuten die junge Frau fachgerechte Hilfe erhalten wird.
Zu Hause in der mondänen Zuckerbergsiedlung angekommen, fährt er den Wagen in die Garage, geht in sein Schlafzimmer und legt in sich bekleidet aufs Bett. Er ist vollkommen erschöpft. Seine Gedanken kreisen um das Geschehen. Wie schwer war die Frau wirklich verletzt? Hätte er ihr nicht doch helfen, sie wenigstens bei Bewusstsein halten können? Immer wieder erwägt er die verschiedenen Möglichkeiten seiner Entdeckung. Schließlich erbarmt sich der Schlaf.
17.Kapitel
Christine hört Stimmengemurmel. Es kommt von weit her. Sie kann nichts verstehen und versucht, die Augen zu öffnen. Das gelingt nicht sofort. Erst langsam heben sich die Augenlider wie schwere Vorhänge. Grelles Licht trifft sie. Es schmerzt. Sofort schließt sie die Augen wieder. Eine der Stimmen sagt: „Sie kommt zu sich!“ Der Kopf schmerzt, der Mund ist trocken, sie kann sich nicht bewegen. Vertrauter Geruch des Krankenhauses umgibt sie.
„Bin ich unpünktlich zur Arbeit gekommen?Aber was tue ich hier?“, fragt sie sich verwirrt. Dann verschwimmt der Gedanke, und sie hört eine andere, tiefere Stimme, die knappe Anweisungen erteilt, die sie aber nicht versteht. Nun spürt sie, wie ihr Oberkörper ein Stück aufgerichtet wird. Stechender Schmerz. Sie möchte etwas sagen, will schreien, bringt aber keinen Ton hervor.
Wieder hört sie die Stimme etwas sagen. Gleich darauf macht sich jemand an ihrem Kopf zu schaffen. Dann wird es dunkel um sie. Der Oberarzt erteilt den Schwestern noch ein paar Anweisungen, ehe er die Intensivstation verlässt. Er ist unzufrieden. Noch hat er kein klares Bild von der Verletzung der Patientin. Sicher ein Schädelhirntrauma, aber wie schwer?
18.Kapitel
Markus Schwarz hastet durch eine schmale Straße. Rechts und links hohe Gebäude ohne Fenster. Ganz am Ende der Straßenschlucht ein einsames Telefonhäuschen. Das Telefon darin läutet unangenehm schrill. Er weiß, es ist ein Gespräch für ihn, das er unbedingt annehmen muss. Trotz aller Laufanstrengungen gelingt es ihm nicht, der Telefonzelle näher zu kommen. Sie scheint sich immer weiter von ihm zu entfernen. Das Klingeln dagegen wird lauter. Dann ist er wach.
Sein Blick fällt auf den Wecker. Es ist sechs Uhr zwanzig.
„Du meine Güte, wer ruft um diese Zeit denn an?“, denkt er ärgerlich. Seine Hand tastet nach dem Telefon auf dem Nachttisch. Erst hält er den Hörer falsch herum, dann meldet er sich mit verschlafener Stimme.
„Ja, bitte?“
„Polizeikommissariat, Steinberg. Spreche ich mit Herrn Markus Schwarz?“ Die Stimme ist kräftig, klingt unpersönlich und kalt. Markus ist alarmiert.
„Ja, was ist denn los, ist was passiert?“
„Sagen sie Herr Schwarz, ist Frau Christine Schumann ihre Lebensgefährtin?“
„Ja, klar, worum geht’s?“, fragt er unwirsch. Es entsteht eine Pause.
„Ich muss Ihnen mitteilen, dass Frau Schumann auf der Bundesstraße mit dem Fahrrad verunglückt ist, es tut mir leid“, antwortet die Stimme vom anderen Ende der Leitung. Markus durchfährt es siedend heiß, er ist nun hellwach, meint sich verhört zu haben und fragt heiser:
„Sie hatte einen Unfall?“, er wird panisch, „mein Gott, was ist passiert, ist sie tot? Mann, so reden Sie schon!“
„Nein, sie ist verletzt ins Klinikum Freisestraße gebracht worden“, antwortet die Stimme jetzt wärmer und behutsamer und nach einer Pause, „wir möchten Sie bitten, zu uns ...“ Markus hört die letzten Worte nicht mehr. Er hat den Hörer auf die Telefonstation geknallt, springt auf, läuft ins Bad, absolviert das Minimalprogramm einer Morgentoilette. Gleich darauf ist er in den Kleidern, rennt in die Garage und startet seinen roten Golf. In Rekordzeit erreicht er das Krankenhaus.
19.Kapitel
Markus findet sofort den Intensivbereich des Krankenhauses. Dort angekommen erklärt er etwas außer Atem der Krankenschwester, wer er ist und wen er besuchen will. Sie reagiert zunächst abweisend, möchte wohl vermeiden, dass er die Patientin direkt am Krankenbett besucht. Er könne Frau Schumann aber kurz durch eine Glasscheibe sehen. Markus ist empört, er drängt energisch darauf, Christine direkt zu besuchen. Daraufhin wendet sich die Schwester an den Stationsarzt, berichtet kurz, worauf dieser zustimmend nickt. Zusammen mit der Schwester betritt er den Schleusenbereich. Er erhält einen grünen Kittel, eine Kopfbedeckung und Plastiküberzieher für die Schule. So betreten sie die Intensivstation. Ihn empfängt zunächst ein vielstimmiges Konzert von Kontrollsignalen medizinischer Geräte - ein beunruhigender akustischer Wirrwarr. Mehrere Betten stehen in einer Reihe an der Wand, durch Stellwände als Abteile voneinander abgetrennt. Neben den Betten befinden sich Geräte mit Monitoren, Kontrolllampen und Tastaturen, Versorgungsleitungen und Kabel. Tropfflaschen an Ständern und viele dünne, durchsichtige Schläuche führen direkt zu den Patienten. Die Menschen in den Betten tragen Verbände, sind zum Teil nur spärlich bekleidet und wirken inmitten dieses technischen Dschungels nahezu verloren. Markus erschaudert, blickt wie magisch angezogen in diese Kabinen in der Hoffnung, Christine zu entdecken. An einem Bett steht medizinisches Personal. Eine Ärztin oder Schwester dreht sich um, betrachtet ihn flüchtig, runzelt die Stirn und nickt der Kollegin, die ihn begleitet, kurz zu. Markus übersetzt diesen Gruß als Frage:
„Was bringst du denn da für einen Gaffer mit?“ Er empfindet einen Anflug von Scham, richtet nun den Blick nach unten und trottet hinter der Krankenschwester her, die wie er meint, provozierend langsam läuft.
Schließlich führt sie ihn zum letzten Bett der Reihe und ermahnt ihn, sich ruhig zu verhalten und nur einen kurzen Moment zu bleiben. Jede Aufregung sei Gift für die Patientin, diese brauche viel Ruhe. „Mein Gott“, entfährt es ihm, als er die leblos wirkende Gestalt vor sich im Bett sieht, der Oberkörper hoch gebettet, die Augen geschlossen, das eingefallene, blass-gelbliche Gesicht von Verbänden fast verdeckt. Verschorfte Hautabschürfungen befinden sich auf der rechten Gesichtshälfte, die Lippen sind aufgesprungen. Überall verteilt sind Reste eines bräunlichen Desinfektionsmittels. Eine breite blaue Manschette liegt um ihren Hals. Schläuche führen von der Armbeuge und dem Handrücken zu Tropfflaschen oder verschwinden in technischen Geräten. Einen Moment lang kommt in Markus so etwas wie Erleichterung auf, denn diese Person dort kann unmöglich Christine sein. Sein Verstand aber ist unbestechlich und zerstört brutal die rettende Hoffnung auf eine Verwechslung. Widerwillig wird ihm klar, dass sie es ist. Verzweiflung und Hilflosigkeit packen ihn.
Einfach wegrennen, abhauen fordert sein erster innerer Impuls. Tränen stehen ihm in den Augen. Dann versucht er sich vorzugaukeln, dass das, was er hier sieht, nicht wirklich, alles ein inszenierter Albtraum ist, deshalb sagt ganz leise und beschwörend:
„Komm Christine, steh’ auf und lass uns nach Hause gehen. Das ist hier nichts für dich!“ Nichts geschieht.
Die gleichmäßigen Pieptöne aus dem Überwachungsgerät erreichen sein Bewusstsein dröhnend wie Hämmerschläge. Mühevoll kämpft er sich tapfer in die Wirklichkeit zurück und stellt sich der Tatsache, dass hier seine lebenslustige, starke Christine schwer verletzt liegt, deren Lebenszeichen nun stellvertretend von technischen Apparaturen in Form gezackter Kurven, Zahlen und akustischer Signale gesendet werden. Er ist voller Angst, sie könnten unregelmäßig werden oder ganz aufhören. Instinktiv spürt er Christines ernsten Zustand, dass sie nicht nur verletzt ist, sondern dass sie mit dem Tode ringt. Etwas in ihm lässt ihn ahnen, dass er sie verlieren wird.
„Was ist, wenn sie stirbt?“ Dieser Gedanke schnürt ihm fast die Kehle zu. Ein Weinanfall schüttelt ihn, er kann ihn nicht unterdrücken, Tränen fließen nun ungehemmt die Wangen herab.
Markus zwingt sich zur Ruhe, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht, tritt gefasst an das Bett und streichelt sanft Christines linke Hand, in der keine Kanüle steckt. Die Haut wirkt fahl und durchsichtig wie Pergamentpapier. Mit seiner Berührung wird auch die Folge der Kontrolltöne schneller. Hat sie seine Anwesenheit bemerkt? Markus ist besorgt, etwas falsch gemacht zu haben und wendet sich mit fragendem Blick an die Schwester, die sich bisher still im Hintergrund gehalten hat. Sie nickt ihm ermutigend zu und deutet auf einen Hocker. Markus setzt sich, ohne Christines Hand loszulassen. Das tut gut.
Als würde sie ihre Freude über seine Anwesenheit durch die Verbindung der Hände leiten. Markus wird ruhiger und kann seine Ängste für einen Moment hinter sich lassen.





























