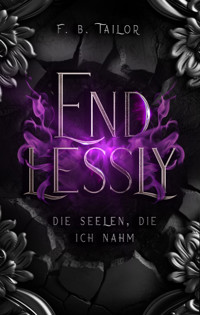
3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ellen van Deflames ganzes Leben verändert sich innerhalb einer einzigen Nacht. Sie wird plötzlich mit dunklen Mächten konfrontiert, die ihr zuvor undenkbar schienen: Ellen gerät in die Fänge eines Schwarzmagiers, der sie als willenlose Waffe – mit Kräften eines Feuerdämons ausgestattet – auf seine Feinde entfesseln will. Jedoch trifft Ellen auf Raphael Kiayn, der mit ihr um die halbe Welt reist, um dem Schwarzmagier zu entkommen, sie vom Dämon zu befreien und damit die Welt vor Tod und Verderben zu bewahren. Doch er hütet selbst ein dunkles Geheimnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
F. B. Tailor
ENDLESSLY
Die Seelen, die ich nahm
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
Danksagung
Impressum
"Nun bist du viel zu weit gegangen.
Du entstelltes, finstres Maskenspiegelbild
alt und kalt.
In den Händen Klingen, Zangen,
mit denen es dich nun von mir zu trennen gilt
mit Gewalt.
…
Ich weiß nicht mehr, wie oft
ich sie in tausend kleine Stücke brach!
Vergeblich habe ich gehofft,
Denn sie wuchs einfach immer wieder nach."
ASP - Reflexionen
PROLOG
"Wie heißt du? Woher kommst du? Was hast du bisher so gemacht?"1 Derartige Fragen hast du sicherlich genauso oft gestellt bekommen, wie ich – auf Partys, im neuen Semester an der Uni oder bei offiziellen Verhören, auch "Vorstellungsgespräche" genannt.
Mein Name?
Ellen van Deflame – wobei man Deflame spricht, wie man es schreibt. Das "van" hat leider nichts mit "blauem Blut" zu tun. Es entwickelte sich aus "Vandefflamer", dem Namen meiner Vorfahren, die sich vor hunderten Jahren in Skandinavien ansiedelten. Ich habe dagegen gar nichts Nordisches an mir. Meine hellgrünen Augen, dunkelbraunen Haare und helle Hautfarbe sind eher sehr durchschnittlich mitteleuropäisch.
Woher ich komme?
Ich bin in Hamburg geboren und in Thüringen aufgewachsen. Warum sich meine Eltern entschieden haben, aus einer angesagten Großstadt in ein Hundert-Seelen-Dorf zu ziehen, bleibt mir bis heute ein Rätsel.
Bei der letzten Frage – was ich bisher mit meinem Leben angefangen habe – weiche ich geflissentlich von der Wahrheit ab. Anfänglich fiel es mir schwer, doch irgendwann ging mir die Unwahrheit immer leichter über die Lippen. Das Lügenkonstrukt aufrecht zu erhalten, wird erst dann richtig anstrengend, wenn man versucht, dieses in einer Beziehung weiterzuführen. Früher oder später verstrickt man sich in der eigens erdachten Vergangenheit.
Wenn ich bei der Wahrheit bliebe, würde die Mehrheit meiner Gegenüber wahrscheinlich anfangen zu lachen und mir zu meiner vorzüglichen Fantasie gratulieren. Der Rest würde empört mit dem Kopf schütteln und sich von mir entfernen. Sie würden es als Masche meinerseits abtun, sich nervige Leute vom Hals zu halten.
Insgeheim liefe ihnen jedoch ein Schauer den Rücken hinunter – aufgrund der Art, wie ich es ihnen erzählt hätte: völlig aufrichtig, mit diesem Blitzen in den Augen, das man schlecht deuten konnte. Wahnsinn? Trauer? Und sie würden sich immer wieder fragen, ob es stimmte.
Ja, es ist alles wahr. Die ganze Geschichte. Von Anfang bis Ende.
Ich bin eine Mörderin.
Diese Tatsache ungeschehen zu machen, wäre mein Wunsch, doch, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es Folgendes: Das Leben hält oft Überraschungen bereit, auf die man getrost hätte verzichten können. Vielleicht existiert ja wirklich eine höhere Macht, die unser Leben bestimmt und einen verdammt makabren Sinn für Humor hat.
Ich vertraue dir nun meine Geschichte an. Letztendlich musst du für dich entscheiden, zu welcher Kategorie du gehörst: zu den Personen, die leugnen oder zu jenen, die anfangen, zu zweifeln und die Welt plötzlich mit anderen Augen sehen.
Soundtrack: Thomas-Adam Habuda – Shape Of Lies↩
KAPITEL 1
Mein Name ist Ellen van Deflame. Aber das wisst ihr ja bereits.
Ich hatte in meinem Leben kaum etwas auszustehen gehabt – weder große Verluste, noch Krankheiten und selbst meine Kindheit war erfüllt und voller Zuneigung. Ich war gleichermaßen beliebt bei Mädchen und Jungs und immer für irgendeinen Quatsch zu haben.
In der Schule stellte ich mich auch nie ganz blöd an – klar, ich war überall eher mittelmäßig, aber das machte mir nichts aus.
Und daraus entwickelte sich die achtundzwanzig Jahre junge Frau, die ich damals war – lebenslustig, tolerant, aufgeschlossen und ein bisschen verrückt. Wenn man mich reizte, konnte ich auch die Krallen ausfahren, aber im Großen und Ganzen riefen nur wenige Menschen diese Seite in mir hervor.
Zugegeben – mein Lebenslauf gestaltete sich sehr übersichtlich: Grundschule, Gymnasium, Studium, Eintritt in die Arbeitswelt. Langweilig, aber ich war wirklich zufrieden mit dem, was ich hatte. Ja, sogar glücklich.
Seit 8 Jahren quälte ich mich jeden Morgen um viertel sechs aus dem Bett, um auf Arbeit fast acht Stunden vor dem PC zu sitzen und zu kontrollieren, ob Entscheidungen des öffentlichen Auftraggebers rechtlich korrekt waren. Doch so einschläfernd es sich anhörte – die Vorteile lagen auf der Hand: die gleichmäßigen Arbeitszeiten erlaubten mir, allen meinen Hobbies nachgehen zu können. Sogar das Wochenende hatte ich – im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen – ganz zu meiner Verfügung. Das hieß in meinem Fall zum Fotografieren, Joggen, Rennradfahren, Fitness-Studio und Freunde treffen.
Ich war dankbar darüber, jeden Tag die Augen aufzuschlagen und weder Schmerzen zu spüren, noch von Existenzängsten geplagt zu werden.
Hätte man mir erzählt, dass sich dieses Leben innerhalb kürzester Zeit in ein einziges Chaos wandeln und völlig aus den Fugen geraten würde – hätte ich ihm einen Vogel gezeigt und gesagt, dass so etwas nur in Filmen oder Spekulanten passierte.
~ ~ ~
Wir schrieben das Jahr 2019, genauer gesagt das erste Juni-Wochenende. Am Freitag, hatte ich traditionell meinen Kollegen Eis für meinen bevorstehenden Urlaub ausgegeben und freute mich nun auf drei Wochen Ausschlafen, Sport, Reisen und hoffentlich schönes Wetter.
Jedenfalls hatte ich die ersten Tage bereits verplant: ich würde nach Potsdam fahren und Denise, eine meiner besten Freundinnen, besuchen, die ich leider seit ihrem Umzug viel zu wenig sah. Aline und Sandra – die den Kreis meiner besten Freundinnen komplettierten – konnten in dieser Zeit leider keinen Urlaub nehmen, hatten jedoch versprochen, sich ein Wochenende freizuschaufeln.
Unsere illustre Runde war der Beweis dafür, dass die Verhaltensweisen und Gesprächsthemen, die bei TV-Serien wie "Sex and the City" aufgegriffen wurden, keineswegs übertrieben dargestellt wurden.
Die Mädels waren für mich nicht nur Freundinnen, sie waren Familie.
Der einzige Unterschied zu den meisten Soaps bestand darin, dass es in unserer Clique keine Rothaarige gab, dafür drei extrem scharfe Blondinen und mich, als einzige Brünette. Wenn wir uns zum Quatschen in einem Café trafen, amüsierten wir nur allzu oft die anderen Gäste mit unserem lauten Gekicher.
Sicherlich wurden wir oft als junge, eingebildete Weiber abgetan, die sich nur für ihr Aussehen interessierten und nichts auf dem Kasten hatten. Aber natürlich trügt der Schein. Aber gewaltig. Wobei Aline jetzt noch ein "Üüüübelst!" draufsetzen würde.
Aline, mit den großen, karamellfarbenen Augen, war die Künstlerin unter uns – sie arbeitete als Psychologin, griff jedoch in ihrer Freizeit zur Tattoo Nadel und tätowierte eigens kreierte Meisterwerke auf die Haut der Willigen.
Sandra, die früher permanent vom Fernweh geplagt worden war, hatte sich irgendwann selbstständig gemacht und finanzierte mittlerweile die Weltreisen mit Hilfe von Sponsoren und über ihre etwas "anderen" Reiseführer. Sandras Wohnung in München war daher zu einem Zweitwohnsitz verkommen, den sie kaum nutzte.
Denise – ebenso Typ "blonder Engel" mit himmelblauen Augen und wunderschöner "Wallemähne" – hatte erst vor Kurzem einen Job beim Verwaltungsgericht als Staatsanwältin angetreten und beschäftigte sich nun größtenteils mit Rauschmittel- und Körperverletzungsdelikten. Wenn sie nicht gerade böse Buben hinter Gitter brachte, voltigierte sie in einem exklusiven Pferdeclub. Sie liebte das Meer, hasste Kochen, kannte sich dafür jedoch bestens mit der Reparatur und dem "Pimpen" von Autos aus.
Meine Mädels waren so wunderbar – warmherzig und ehrlich, sie schafften es immer, mich aufzuheitern und mir Mut zu machen, egal, wie schlecht es mir ging. Ich konnte mich immer auf sie verlassen.
Wir vier Mädels lernten uns damals an der Uni kennen und lieben, danach verschlug es jede in eine andere Richtung. Nun waren wir quasi die "Capitol Girls": Denise lebte in Potsdam, Sandra übernachtete zumindest hin und wieder in München, Aline hatte sich in Dresden niedergelassen und ich in Erfurt. Und dies würde sich aufgrund der allgemeinen Arbeitssituation auch nicht so schnell ändern. Darum verabredeten wir uns, so oft es die übervollen Terminkalender zuließen.
Da wir jedoch trotz unserer Bemühungen nicht immer alle unter einen Hut bekamen, freute ich mich wie ein Schnitzel, dass ich sogar mehrere Tage mit Denise verbringen konnte.
Den Samstag verplemperte ich größtenteils mit Packen, als sich jedoch die Sonne durch die Wolken gequält hatte, zog es mich und meine Laufschuhe nach draußen.
Die Wohnung, die ich mir in Erfurt in der Löbervorstadt gemietet hatte, war eine absolut genial geschnittene, gemütliche Dachgeschosswohnung mit offener Küche zum Wohnzimmer, Terrasse, großem Schlafzimmer und Bad mit Badewanne. Ich gebe zu, sie hätte durch ein paar Farbtupfer noch gemütlicher wirken können – aber von Deko und Farbgestaltung hatte ich einfach keine Ahnung. Ich war dafür vielleicht einfach zu pragmatisch: "Warum Kram hinstellen – da hat man beim Putzen viel mehr Arbeit! Warum Farbe – es geht doch auch so." Gleiches galt für Pflanzen – ich hatte weder Lust, überall welche stehen zu haben, noch das Geschick, sie zu pflegen. Wer mir Grünzeug schenkte, verurteilte es in jenem Moment zum Tode.
Jedenfalls befand sich mein sechzig Quadratmeter großes Domizil nur einen Katzensprung vom Steigerwald entfernt, was ideal für meine Ausflüge per pedes war.
Aufgrund meiner guten Gene hätte ich wahrscheinlich nicht so viel Sport treiben müssen, um meine schlanke Figur – dreiundfünfzig Kilo bei einer Größe von eins achtundsechzig – zu halten. Doch zum einen machte es mir Spaß und zum anderen half es mir, den Kopf frei zu bekommen, wenn ich Stress auf Arbeit hatte. Ich konzentrierte mich dann auf die gleichmäßigen Bewegungen, den Wald und die klare Luft oder auf die Musik, die mir von meinem Mp3-Player entgegenhämmerte. Oder ich genoss den Anblick der leckeren, joggenden Typen. So vergaß man schon mal alle Probleme.
An diesem Abend nahm ich ein ausgiebiges Bad, bevor ich mich mit einem Buch ins Bett kuschelte. Ein wirklich guter Einstieg in den Urlaub.
Sonntagmorgen weckten mich die ersten Sonnenstrahlen schon gegen sechs Uhr und ich war zu aufgeregt, um wieder einschlafen zu können. Also zog ich mir schnell etwas über, versuchte meine strubbeligen, bis über die Schulter reichenden Haare, mit einer Spange zu bändigen und tapste zu meinem Lieblingsbäcker, der zum Glück auch sonntags seinen Laden öffnete.
Eine halbe Stunde und einen Plausch mit dem sympathischen Bäcker später war ich wieder zurück. Ich erweckte meinen Kaffeevollautomaten zum Leben und kredenzte einen aromatischen Espresso. Ich schlenderte gut gelaunt mit Brötchen, Croissants, koffeinhaltigem Heißgetränk und flauschiger Kuscheldecke auf meine Dachterrasse, die sich der Küche anschloss. Da ich ganz oben wohnte, konnte ich über die Häuserdächer weit in die langsam erwachende Stadt blicken.
Ich machte es mir auf meinem Rattan-Sessel bequem und biss genüsslich in ein noch warmes Croissant. Es war herrlich, die Sonne auf dem Gesicht zu spüren, auch, wenn der kühle Wind noch keine Lust auf das Ablegen der warmen Kleidung machte.
Gestärkt und aufgeputscht hüpfte ich ins Schlafzimmer und zog die Sachen an, die ich gestern bereitgelegt hatte. Als Letztes überprüfte ich noch schnell, ob meine Kamera eingepackt, alle Fenster geschlossen und alle Geräte ausgeschalten waren. Es gab nichts Nervigeres, als auf halber Strecke überlegen zu müssen, ob man das Glätteisen abgestellt hatte, nur um dann zurückzufahren und festzustellen, dass es ordnungsgemäß auf einer hitzebeständigen Unterlage verstaut und sogar abgesteckt war. Nicht, dass mir das jemals passiert wäre!
Mit dem prall gefüllten Rucksack auf dem Rücken und meinem Verpflegungsbeutel in der Hand – meine Freunde waren es gewohnt, dass ich ständig aß und zogen mich dementsprechend auch andauernd auf: "Mensch Ellen, dein letzter Müsliriegel ist schon über eine halbe Stunde her – willst du nicht langsam was essen? Nicht, dass dein Zuckerspiegel sinkt!" – quetschte ich meine Füße irgendwie in die schwarzen Turnschuhe, um mich nicht bücken zu müssen. Ein letzter Blick in die Wohnung, dann schloss ich zweimal ab und stürmte die Treppe hinunter. Meinen Polo Classic, den ich in weiser Voraussicht genau vor der Haustür geparkt hatte, schloss ich hastig auf und verstaute das Gepäck – den Rucksack und die Verpflegung griffbereit auf den Beifahrersitz. Dann ließ ich mich in den Fahrersitz fallen, stöpselte meinen USB-Stick an das Radio, wählte den Ordner "Mix" und zündete den Motor. Freudig röhrte dieser auf, als hätte er schon darauf gewartet, mal wieder aus dem Stadtverkehr herauszukommen. Die Lautsprecher gaben die ersten Klänge von Muse "Panic Station" wieder und ich wippte in freudiger Erwartung auf und nieder, das Grinsen in meinem Gesicht konnte kaum breiter werden.
Um diese Uhrzeit hielt sich der Verkehr in Grenzen und so war ich bald auf der Autobahn in Richtung Potsdam. Beim Hermsdorfer Kreuz staute es sich kurz, aber schon kurz vor zwölf Uhr betätigte ich die Klingel am Hauseingang mit der Aufschrift "D. Himber". Sofort schallte mir Denise überschwängliches "Hola Chica!" über die Gegensprechanlage mit dem gleichzeitigen Summen des Türöffners entgegen.
Sie hatte sich eine atemberaubende Maisonette-Wohnung in der Bornstedter-Straße gekauft, ein luxussanierter Altbau, bei dem einem der Mund offen stehen blieb: große, helle Räume, die durch die dunklen Steinfliesen dennoch Gemütlichkeit und Wärme ausstrahlten, moderner Kamin, riesige Terrasse plus Garten. Es war ein Traum.
Denise erwartete mich an ihrer Eingangstür und wir begrüßten uns stürmisch mit lautem Gekreische und Gekicher, wie das eben bei uns so üblich war.1
Mein Gepäck ließen wir im Flur fallen, um uns auf der gemütlichen Terrassenmuschel niederzulassen und ein Glas Hugo zu genehmigen – das gerade angesagte Saisongetränk. Ich war nicht immer up-to-date was das betraf, da ich eher die eingefleischte Kräutertee-Tante und nicht unbedingt die fanatische Sekt-Schlürferin war.
Wir brachten uns gegenseitig auf den neuesten Stand, was Arbeit und Privatleben betraf – Denise war gerade auf Männersuche und beichtete, dass sie sich für den nächsten Abend verabredet hatte. Für mich war das völlig in Ordnung. Die Partnersuche stand definitiv weiter oben in der Prioritätenliste, als die Bespaßung von Freundinnen auf Besuch.
Da sie jedoch schon stundenlang in ihrem Kleiderschrank gewühlt und nichts Passendes gefunden hatte, war glasklar, was unser Tagesziel sein würde: shoppen, shoppen, shoppen, bis die Kreditkarte glühte. Der heutige verkaufsoffene Sonntag war quasi wie für uns gemacht.
In Sachen Liebe herrschte bei mir die reinste Ebbe, meine letzte Beziehung hatte ich vor einem Jahr beendet. Ich genoss mein Leben auch ohne Mann darin und war derzeit nicht unbedingt scharf darauf, jemand Neues kennenzulernen. Als Single musste man sich nach niemandem richten, nicht rechtfertigen und keine faulen Kompromisse eingehen. Die Freiheit tat mir ganz gut.
Drei Stunden und mehrere Cocktails später machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt, genauer gesagt ins Holländische Viertel. Wir klapperten alle Boutiquen in Richtung des Brandenburger Tores ab und ich saß vor gefühlt hundert Umkleidekabinen, doch am Ende hatten wir einige coole Sachen erstanden. Erschöpft kehrten wir im Lieblings-Café von Denise ein. Wir redeten und beobachteten die vorbeiströmenden Touristen bei Latte macchiato und Schokoeis mit Schokosoße, wobei wir ausgiebig über deren Klamotten und Ticks lästerten – wundervoll. Wie sehr ich Denise doch vermisst hatte – inklusive ihrer Grimassen und Witze.
Nachdem wir unser Eis gegessen hatten, zeigte sie mir endlich ein paar Fotos von Maximilian, ihr Date für morgen Abend. Natürlich hatte er Tattoos, ein wirklich attraktives, markantes Gesicht und einen perfekt trainierten Körper – er passte also vollkommen in ihr Beuteschema.
Gegen zwanzig Uhr statteten wir der Sushi-Bar nahe ihrer Wohnung einen Besuch ab, damit uns später nur ein kurzer Rückweg bevorstehen würde. Immerhin war unser Alkoholpegel im Begriff stark zu steigen.
Denise wurde herzlichst begrüßt und der erste Drink ging sogar aufs Haus. Ich nickte beeindruckt – sie hatte zwar gesagt, dass sie hier oft Sushi aß, aber anscheinend war sie Stammgast. Es fehlte nur noch, dass ich in der Karte ein Gericht fand, dass man nach ihr benannt hatte.
Das All-you-can-eat-Angebot nahmen wir wörtlich und so stapelten sich die Schüsseln auf unserem Tisch. Dazu bestellten wir reichlich Sake und Cocktails. Wir rollten folglich am Ende des Abends wohlgenährt und lauthals lachend aus dem Restaurant und torkelten durch die gutbetuchte Wohngegend. In der Wohnung angekommen, putzten wir noch zusammen Zähne – obwohl das Putzen aufgrund des ununterbrochenen Kicherns eher hintenanstand – und fielen dann erschöpft in die Federn.
Den nächsten Tag begannen wir mit einem ausgiebigen Frühstück. Denise hatte nach wie vor eine Schwäche für Nutella – es war wunderbar, dass sich manches nie ändern würde.
Danach folgte stundenlanges An- und Umziehen, Schminken und Abschminken, bis wir den perfekten Look gefunden hatten – nicht zu sexy, aber auch nicht zu brav. Das Date musste ihr wirklich wichtig sein, da sie sonst nie so aufgeregt war. Ich verabschiedete sie gegen siebzehn Uhr mit den besten Wünschen und packte daraufhin in Ruhe meine Kamera aus, zog mir Jeans und Langarmshirt an und verließ die Wohnung. Denise hatte mir einen ihrer Schlüssel überlassen, damit ich unabhängig von ihr kommen und gehen konnte.
Es zog mich nicht in den Park Sanssouci, dort hatte ich bei den früheren Besuchen bereits so viele Fotos geschossen, dass ich neues Territorium erkunden wollte. Ich lief eine Weile umher, bis ich an einem vielversprechenden Park vorbeikam. Eine Bank mit einem alten Ehepaar unter einer Weide, Schwäne auf einem kleinen See und die Mauerreste eines historischen Gebäudes wurden in dem, als Remisenpark ausgewiesenen, Idyll Opfer meiner Linse. Die Ruine ließ sich wirklich gut in Szene setzen und so wurde es bereits dunkel, als ich die letzten Bilder schoss. Ich setzte mich kurz auf eine Parkbank, um die kühler werdende Brise zu genießen, die nach frisch gemähtem Gras und Tau roch. Derweil schaute ich mir die Bilder auf dem Display der Kamera an und löschte alle, die unscharf waren oder bei denen mir der Winkel im Nachhinein nicht gefiel. Nur noch wenige Spaziergänger verirrten sich hierher und so entschied ich mich, langsam aufzubrechen. Außerdem hörte ich, wie sich eine Gruppe grölender Männer näherte und wollte ihnen nur ungern begegnen. Ich verstaute meine Kamera in der Tasche und lief in Richtung des Schleichweges, den ich zuvor beim Fotografieren entdeckt hatte. Leider entpuppte sich dieser mehr als "Schleich" denn als Weg – ich bahnte mich durch Gestrüpp, Brennnesseln und Spinnweben, während ich leise fluchte. Plötzlich trat ich auf blechernen Untergrund, der besorgniserregend ächzte. Ich versuchte schnell, mein Gewicht nach hinten zu verlagern, als es laut knackte.
Der Boden unter mir gab nach und plötzlich war alles schwarz um mich herum.2 Es ging so schnell, dass ich überhaupt nicht reagieren konnte, sondern wie ein nasser Sack in die Tiefe stürzte. Ich schrammte an scharfen Kanten vorbei, Dreck fiel in meine Augen, in den Mund. Ich versuchte, mein Gesicht mit den Armen zu schützen. Es machte mich wahnsinnig, nicht zu sehen, wie weit es noch nach unten ging oder ob mich vorher irgendetwas aufspießen könnte. Doch diese Gedanken gingen mir nicht bewusst durch den Kopf – ich dachte nur "Fuck!".
Und da schlug ich auch schon, mit einem lauten, berstenden Geräusch, auf – mit dem Bauch voran. Es trieb alle Luft aus meinen Lungen, mein Körper explodierte förmlich vor Schmerz, etwas hatte mich am Oberschenkel durchbohrt. Es dauerte nur Sekunden, dann spürte ich nichts mehr.
So musste es sich anfühlen, einen Sturz aus dem dritten Stock zu überleben.
Derartige Schmerzen hatte ich noch nie zuvor gespürt, ich krümmte mich und stieß einen krächzenden Laut aus, als es in jeder Faser meines Körpers nur noch mehr stach. Plötzlich hingen meine Füße im Freien und zogen den geschundenen Rest über die Kante des kalten Untergrundes, auf dem ich lag. Ich war völlig reaktionsunfähig und klatschte mit Bauch und Gesicht voraus auf den steinharten Boden. Ich riss meinen Mund im stummen Schrei auf, die Tränen brannten auf Nase und Lippen. Ich rang hektisch nach Luft, doch meine Kehle war wie zugeschnürt. Panik breitete sich in mir aus. Ich … krieg … keine … Luft! Ich stand kurz vorm Hyperventilieren und, dem Schwindelgefühl nach zu urteilen, auch vorm nächsten Blackout.
Ich zwang mich mit aller Macht, ruhiger zu atmen, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Leider war ich noch nie ein Mensch gewesen, der in Ausnahmesituationen einen kühlen Kopf bewahren konnte. Zum einen lähmten mich die Schmerzen, zum anderen die Fragen, die unbeantwortet in meinem Kopf tobten: Zur Hölle, wo bin ich! Warum kann ich nichts sehen! Wenn ich laut schreie, ob mich dann jemand hört und mir hilft?
Dann schien alles plötzlich so einfach: Ich rufe Denise mit dem Handy an und …
Mir fiel ein, dass ich es bei Denise liegen gelassen hatte – nicht, dass ich ihr genaue Instruktionen hätte geben können! Mein Magen drohte, sich umzudrehen. So eine Situation hatte ich noch nie erleben müssen! Ich war schon immer ein Angsthase gewesen und wollte noch nicht einmal Ski fahren, da ich Panik vor Lawinen hatte! Und jetzt das!
Ich hätte am liebsten angefangen zu heulen, aber ich musste der Tatsache ins Auge blicken – das würde mich definitiv nicht hier rausbringen. Okay, okay. Ruhig Brauner. Auch, wenn in mir alles schrie, ich sollte so schnell wie möglich weg, weg, weg, konnte ich nicht Hals über Kopf losstürzen: einmal aufgrund meiner offensichtlich mehr als bescheidenen Verfassung und, weil es stockdunkel war und ich womöglich gleich mit der nächsten Wand kollidiert wäre. Und wenn es gar nicht dunkel ist, sondern ich blind bin?
Bevor mich die nächste Panikwelle erreichte, verdrängte ich alle Horrorgedanken und konzentrierte mich wieder auf meine Atmung und mein konkretes Ziel: wieder ans Tageslicht kommen.
Einatmen ... Ausatmen ... Einatmen ...
Erstens: Nach dem Ausgang tasten und versuchen, sich so wenig wie möglich anzustrengen. Hey! Klingt doch super einfach! Positive Gedanken!
Einatmen ... Ausatmen ... Einatmen ...
Ich hielt die Luft an, schluckte die reißenden Schmerzen hinunter und stützte mich auf meine Unterarme. Alter Schwede, tut das weeeeeh! Ich biss die Zähne so fest zusammen, wie ich konnte und kroch los. Der rechte Arm fühlte sich merkwürdig verdreht an. Ich wimmerte und schluchzte, als ich mich vorwärts zog, die Schmerzen übermannten mich fast. Bitte, bitte, bitte lass mich einen Ausgang finden!
Kurz darauf stieß ich mit der Stirn an etwas Hartes – es war glatt, verlief vertikal nach oben und hatte weder Anfang noch Ende. Eine Wand im besten Fall. Ich schob mich unter Ächzen seitlich daran hoch, bis ich saß und ertastete so weiter die Umgebung.
Direkt über meinem Kopf griff ich an eine metallene Stange, die gut eine Klinke sein konnte. Bitte, bitte, bitte, bitte! Die Arme nach oben zu bringen war die reinste Qual. Ich klammerte mich an das Metall, wie an einen Rettungsring und zog mit aller Kraft, bis es unangenehm quietschte und leise klickte. Links neben mir erschien ein winziger, heller Lichtschein auf dem Boden. Danke, oh danke, danke! Ich bin NICHT blind! Und es ist eine Tür!
Ich hievte mich zur Seite, damit ich die Tür ganz öffnen konnte.
Es war ein großer Fehler, dem Schein mit den Augen zu folgen – ich hätte mich einfach in den Gang schleppen sollen, der sich hinter der Stahltür auftat und einen Weg in die Freiheit versprach, aber nein!
Als die Umgebung aufgehört hatte, sich zu drehen, wurde mir wieder speiübel. Und das lag dieses Mal nicht nur an den Nachwehen des Sturzes.
Im schummrigen Licht offenbarte sich ein, selbst an den Wänden, gefliester Raum, der jedoch nichts Steriles an sich hatte, sondern rohe Gewalt ausstrahlte – es gab mehrere Metallbahren mit Abflüssen und einige Werkzeugbänke; an den Wänden hingen schmutzige Skalpelle, Zangen und Beile, eine verdreckte Handkreissäge lag neben einer der Liegen auf dem Boden. Unzählige herabgebrannte Kerzen waren im ganzen Raum verteilt – auf Arbeitsplatten, Fässern und Schränken. In den Gläsern, die weiter hinten in hohen offenen Regalen standen, schwammen Objekte, die aussahen wie abgetrennte Körperteile.
Schnell wandte ich mich ab, bevor ich noch andere blutige Details erhaschen konnte, doch allein dieser Anblick würde genug Stoff für zukünftige Alpträume bieten.
Verdammt, wo bin ich nur gelandet? In Frankensteins Labor?
Wieder hielt ich die Luft an, als ich mich an der Wand neben der Tür hinaufdrückte. Jedenfalls versuche ich es, doch mein linkes Bein verweigerte seinen Dienst. Es nützte nichts, ich musste sitzen bleiben und mit Hilfe des linken Arms Stück für Stück weiterrutschen. Und das tat ich. Mein Wille war eisern. Auch, wenn die Tränen die Wangen herunterströmten und brannten und ich nicht die Nase hochziehen konnte, da es mir dabei fast die Schädeldecke sprengte.
Ich kam nicht umhin, den dunklen Film zu entdecken, der sich hinter mir gebildet hatte. Shit! Blut! Viel Blut! Schnappatmung setzte ein und ich robbte ein bisschen schneller. Ich hatte wirklich nicht vor, in diesen Katakomben zu verbluten!
Vermutlich gab es diese Anlage schon ein paar hundert Jahre – heutzutage baute beinahe keiner mehr mit groben Natursteinen. Es hingen nur ein paar stümperhaft angebrachte Glühbirnen an einer Seite der Wand – doch das Einzige was zählte, war, dass sie Licht spendeten. Der Tunnel führte ein ganzes Stück geradeaus, bis er scharf nach rechts abbog. Als das Licht flackerte und kurz ausging, quiekte ich vor Entsetzen. Doch im nächsten Augenblick wurde es wieder heller. Der Angstschweiß feuerte zusätzlich in den Wunden. Ich sehnte mich nach einem Vollbad in Panthenol und Aloe Vera. Das war nur eines der Dinge auf meiner brandaktuellen Wunschliste, aber man musste ja bescheiden bleiben.
Schwindel und Übelkeit nahmen von der Anstrengung zu, bis ich mich übergab.
Ich musste mich kurz hinlegen, es nützte nichts. Mein Herz klopfte so laut, dass ich das Gefühl hatte, mein Trommelfell platzte gleich.
Die Müdigkeit, die sich auf meine Glieder legte, war fast nicht zu bezwingen, ich wollte am liebsten liegen bleiben. Doch mein Verstand brüllte: Krieg deinen Arsch hoch van Deflame! Wir sind doch hier nicht im Häkelkreis, du Lusche! Und jetzt ab, sonst kriegst du vier Monate keine Schokolade, du Handtuchbügler! Die Drill-Sergeants wären stolz auf mich. Wahrscheinlich zog das Schokoladenverbot, denn ich riss mich zusammen und rutschte weiter.
Ich hatte keine Erinnerung daran, wie ich den ganzen Weg zurückgelegt hatte, doch irgendwann tauchte vor mir eine verrostete Stiege auf. Ich blickte nach oben, wo sich eine hölzerne Klappe abzeichnete. Ich fasste mit dem linken Arm an das rostige Geländer und schob mich mit dem rechten Bein Stufe für Stufe nach oben. In Zeitlupentempo.
Ich biss die Zähne so fest zusammen, dass diese unter dem Druck knirschten. Oben angekommen, versuchte ich einen Arm zu heben, aber es gelang mir nicht, so sehr ich es auch versuchte. Ich stemmte meine Schädeldecke gegen das massive Holz und half mit einem Arm nach, indem ich ihn gegen das Geländer stützte. Doch nichts geschah, das verflixte Ding ließ sich kein Stück bewegen.
Die Verzweiflung stieg wie heißes Magma in mir auf und drohte mich von innen heraus zu vernichten. Wenn ich hier nicht rauskam, würde ich in diesem Loch verrecken. Ich atmete tief ein, schwang vor Schmerzen schreiend beide Arme, bis ich sie an die Klappe legen konnte und drückte zusammen mit dem Kopf um mein Leben. Es gab einen Ruck und schon spürte ich einen Luftzug. Ich konnte durch einen Spalt Licht und viele dünne Seile sehen. Ich rutschte eine weitere Stufe nach oben und bekam die Tür mit einem weiteren, gequälten Schrei ganz aufgedrückt. Dem Geruch nach rieselte ein Schwall Erde auf mich nieder. Anscheinend war der Zugang in Vergessenheit geraten und die Natur hatte sich den Flecken zurückerobert. Als ich mich hinausgewuchtet hatte, heulte ich los. Mein Körper begann vor Anspannung wild zu zittern und ich wollte auf der Stelle zusammenbrechen, um dem grausamen Hämmern und Stechen und Ziehen zu entkommen. Doch etwas in mir war stärker und befahl, meine schweren und verletzten Glieder zu Denise zu bewegen.
Wie in Trance schleppte ich mich zu ihrem Haus und suchte verzweifelt nach ihrem Schlüssel. Ich erinnerte mich schließlich, dass ich diesen in meine Hosentasche gesteckt hatte – wo er sich glücklicherweise noch immer befand.
In ihrem Flur sackte ich endgültig zusammen.
Nur dumpf hörte ich das Klicken des Schlosses und fühlte Hände an mir – ich schlug um mich und schrie um Hilfe, bis Denise Stimme zu mir durchdrang.
"What the fuck! Ist gut, ist gut! Ich bin's! Scheiße! Was ist denn mit dir passiert?", fragte sie völlig aufgelöst und tätschelte vorsichtig meine Schulter. Ich weinte los und stammelte nur Unverständliches – ich war ein Häufchen Elend, das einfach nur in den Arm genommen werden wollte. Was war da gerade nur passiert? Der lichtdurchflutete, moderne Flur schien einer ganz anderen Welt anzugehören, als diese Hölle. Doch ich wusste es besser. Mein geschundener Körper war Beweis genug.
"Okay, Schluss damit, ich bring dich jetzt sofort in die Notaufnahme! Kann man dich denn keine Minute alleine lassen!", zeterte sie, während sie ins Wohnzimmer stürmte, um meinen Rucksack zu holen.
Der Weg zum Auto gestaltete sich qualvoll. Ich hatte einen Arm um Denise Schulter gelegt, damit sie mich beim Gehen stützen konnte, doch die Schmerzen ließen mich zunehmend winseln und keuchen.
Es tat mir wahnsinnig leid, dass sie mich so sehen musste. Wäre ich an ihrer Stelle gewesen, hätte es mir das Herz gebrochen.
Sie half mir in ihr Auto – ein schwarzer Opel GT 2.0 Turbo – knallte die Tür zu und rannte auf die Fahrerseite. In ihrer Aufregung brauchte sie mehrere Anläufe das Zündschloss zu finden und fluchte unaufhörlich. Dann donnerte sie los. Au. Die Beschleunigung des zweihundertvierundsechzig PS-Monstrums raubte mir die Luft, als Denise das Gas durchdrückte und es mich in den Sitz presste. Die Schlaglöcher wurden aufgrund des harten Fahrwerkes kaum abgefedert und direkt über die Sportsitze weitergegeben. Ich schaute hoch zum Verdeck des Cabrios und biss mir fest auf die Unterlippe, um nicht aufzuschreien. Es kam mir vor, als würden sich Knochensplitter aufgrund der Erschütterungen in Bewegung setzen und durch meine Organe bohren.
Denise fuhr wie eine Henkerin, driftete über Kreuzungen ohne Rücksicht auf Vorfahrtsstraßen oder Stoppschilder. Wir konnten nur froh sein, dass sich um diese Uhrzeit – die beleuchtete Anzeige verriet 01:25 Uhr – der Verkehr in Grenzen hielt.
Ich krallte mich am Türgriff fest und versuchte, meine Stimme möglichst entspannt klingen zu lassen: "Wie war eigentlich dein Date?" Ich versagte auf ganzer Linie. Dies spiegelte auch der Blick wider, den Denise mir zuwarf. "Du bist doch nicht ganz dicht! Wie kannst du jetzt an sowas denken!", warf sie mir hysterisch vor.
"Komm schon, ich kann ein bisschen Ablenkung gut gebrauchen…", sagte ich atemlos.
Denise schüttelte ungläubig den Kopf, erzählte dann jedoch von ihrem Treffen – nicht ohne Funkeln in den Augen. Je länger sie die Einzelheiten des Abends auswertete, desto verträumter wurde ihr Blick. Sie war fasziniert von seinem Modegeschmack und der Art, wie er sich artikulierte. Sie schilderte, wie sie sich beinahe am Wein verschluckt hätte, als er eine Augenbraue nach oben gezogen hatte. "Boar, sah das sexy aus!" Das darauffolgende Stöhnen klang fast schon ein bisschen verknallt. "Der Ess-Stil ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber das krieg ich schon hin", lächelte sie schelmisch.
Ich machte ein entschuldigendes Gesicht: "Stell dir einfach vor, wie ich dir um den Hals falle und mich riesig mit dir freue, ja?"
Sie wollte mir einen Klaps auf den Oberschenkel geben, aber mein ängstliches Gesicht erinnerte sie daran, dass dies keine gute Idee war. "Das holen wir auf jeden Fall nach – wenn du wieder heil bist! Hoffentlich haben die auch ein paar leckere Ärzte in dem Laden!", grinste sie.
Ich versuchte, zu schmunzeln, aber das verursachte ein Pochen in meinem Schädel, also ließ ich es gleich wieder sein.
Kurz darauf hielten wir mit einer Vollbremsung vor dem Eingang der Notaufnahme des St. Josefs-Krankenhauses. Denise flitzte hinein, um einen Arzt zu holen. Sie hatte mir verboten, mich in irgendeiner Weise zu rühren, da ich vor ein paar Minuten wieder ohnmächtig geworden war. Es dauerte nicht lange, bis meine Tür geöffnet wurde und ein Mann in weißem Kittel inklusive eines Rollstuhls neben mir stand. Seinem genervten Ausdruck nach zu urteilen, hatten wir ihn in einer ruhigen Schicht gestört.
Denise stand an seiner Seite und sah mich bestürzt an. Sie hatte die Arme um den Körper geschlungen, als würde sie frieren.
Der Mann gab fachmännische Anweisungen, wie ich mich aus dem Auto schälen sollte und bald saß ich sicher im Rollstuhl.
Die ersten drei Meter nahm ich noch wahr, dann kehrte der Schwindel zurück und alles wurde schwarz.
Als ich wieder zu mir kam, fiel nicht nur das Denken schwer, sondern auch meine Wahrnehmung war extrem getrübt. Ich sah nur verschwommen, dass Kanülen in meinen Arm gestochen worden waren und man an mir herumzerrte. Geräusche waren nicht klar zu definieren, sie verbanden sich zu einem einzigen Raunen. Alles schien so geschäftig. Soviele fleißige Ameisen …
Ich meinte, Denise in der Ferne reden zu hören, war mir aber nicht sicher. Ich driftete wieder ab.
Als ich erneut zur Besinnung kam, stand ein hochgewachsener, grauhaariger Weißkittel vor meinem Bett und schrieb in eine dieser Klemmakten. Er war so um die fünfzig und hatte auffällig dunkle Ringe unter den Augen.
Ich bemühte mich, meine – höchstwahrscheinlich durch die Schmerzmittel – getrübte Sicht scharf zu stellen. Er bemerkte, dass ich mich regte und schaute mich merkwürdig streng an.
Er stellte sich als Professor Doktor Köhler vor und begann mich mit Fragen zu bombardieren: wie mein vollständiger Name war, mein Alter, Name der Eltern und Telefonnummer. Ich gab vor, die Nummer meiner Eltern vergessen zu haben – was er mir nicht wirklich abkaufte. Ich wollte einfach vermeiden, dass meine Eltern alles auf den Kopf stellten und sofort herkamen. Danach fragte er direkt, ob ich verprügelt worden wäre.
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte und schwieg.
"Verstehen Sie mich nicht falsch. Falls Sie keinem Fight-Club oder ähnlichem angehören und sich in ihrer Freizeit nicht freiwillig so zurichten lassen, rate ich Ihnen dringend, die Polizei einzuschalten."
Fight-Club? Aber sicher! Elender Schlaumeier. Ich brauch keinen Sozialarbeiter, sondern einen Arzt! Idiot! Wo bin ich hier bloß gelandet?
In meiner Wut über die dämlichen Fragen, packte ich trotz des brennenden Ziehens in meiner Schulter die Schläuche und wollte sie herausreißen, um von hier verschwinden zu können. Doch als ich schließlich an mir herunterblickte – im grellen Licht der Leuchtstofflampen nahm alles einen absurden Grünstich an – entdeckte ich die unzähligen, dunkelblauen Flecke, die alle sichtbaren Körperteile übersäten und vergaß mein Vorhaben. Die Jeans und mein Oberteil – jedenfalls das, was davon übrig war – hatten die Ärzte am Bauch zerschnitten, um mich besser untersuchen und die Schürfwunden reinigen zu können. An meiner Kleidung konnte ich erkennen, dass ich viel Blut verloren haben musste. Aus diesem Grund baumelte wohl auch zu meiner Rechten die halbvolle Blutkonserve. Mein Kopf fing an, mörderisch zu hämmern. Das war alles eine Spur zu viel für mich.
Der Doktor setzte sich auf einen der Stühle und rieb sich seine müden Augen. "Es wäre ungemein hilfreich, wenn Sie mir erzählen würden, was passiert ist. Dann könnten wir unsere Untersuchungen und Tests eventuell eingrenzen. Skifahren waren Sie ja wohl nicht."
Ich überlegte angespannt. "Sie werden meiner Freundin nichts davon erzählen, oder?"
"Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht." Ein Satz den er anscheinend sehr oft herunterbetete.
Ich nickte zaghaft. "Ich hatte eine Abkürzung durch den Remisenpark genommen und bin in eine Art Keller gestürzt. Dann muss ich die Besinnung verloren haben und wachte irgendwann so auf. Dann habe ich mich durch einen unterirdischen Tunnel wieder nach draußen geschleppt." Ich hatte keine Ambitionen ihm die Saw-I-horrormäßigen Details zu offenbaren, die ich selbst noch zu verdrängen versuchte.
Der Blick des Arztes verriet, dass er an meiner Geschichte zweifelte. Wahrscheinlich würde er mich sogar heimlich einem Drogentest unterziehen. Was soll's, da findet er sowieso nix … hoffe ich zumindest!
Doktor Köhler räusperte sich, da ich gedankenversunken vor mich hin zu stieren schien. "Also gut. Wir werden als erstes Ultraschall- und Röntgenaufnahmen machen, Blut abnehmen – die ganze Palette. Dann warten wir auf die Laborbefunde."
Ich hatte schon immer ein ausgeprägtes Apell-Ohr, welches mir – trotz meiner schlimmen körperlichen Verfassung – den Befehl weiterleitete: Auf geht's zu den Untersuchungen! Beweg deinen Hintern! Ich griff mir also den Infusionsständer und glitt vom Krankenhausbett.
"Was machen Sie denn!", fragte der Arzt erschrocken.
Bevor ich meine Handlung als Fehlentscheidung einstufen und rückgängig machen konnte, knickten meine Beine bereits kraftlos weg und der Boden schoss mir entgegen.
Im letzten Moment fing mich der eben zu uns gestoßene Arzt auf.
Ich würgte und kämpfte mit einer erneuten Ohnmacht. Das Stechen, welches der eiserne Griff des Arztes hervorrief, hielt mich bei Bewusstsein. Ich war mir nicht sicher, was angenehmer gewesen wäre: der Sturz auf das Linoleum oder diese Schraubzwingen von Händen, die mich langsam hochzogen. Plötzlich hörte ich, wie jemand scharf einatmete.
Mit einiger Mühe hob ich meinen Kopf und schaute in ein atemberaubend schönes Gesicht – es war wie im Film, wenn plötzlich Slow Motion einsetzte und nur die verträumten Gesichter der beiden Hauptcharaktere auf der Leinwand festgehalten wurden.
Zum ersten Mal in diesem Schlamassel war ich froh darüber, das geschändete Opfer zu sein. So nahm es mir niemand übel, wenn ich keine intelligente Konversation zustande brachte. Ich hätte definitiv nur Stuss gefaselt.
Ich schätzte ihn auf Mitte, vielleicht auch Ende dreißig. Sein Gesicht war zwar kantig maskulin, hatte jedoch nichts Grobes an sich, es wirkte ästhetisch. Makellos … noch nicht einmal Leberflecke oder Sommersprossen. Er hatte eine gerade Nase, markante Wangenknochen und seine Lippen mussten voll und verlockend aussehen, wenn sie nicht gerade so angespannt waren wie jetzt. Selbst der Dreitagebart stand ihm gut.
Trotz, dass er mich nicht direkt ansah, fiel mir die außergewöhnliche Augenfarbe auf, die durch die dunkel gerandete Brille – es war eine dieser modernen, vollgerahmten Kunststofffassungen in dunkelgrau – besonders hervorgehoben wurde. Um die Pupille schlang sich ein sternförmiger, hellbrauner Ring, der nach außen hin in ein Grün-Grau-Blau verlief. Der äußere Rand der Iris war ein dunkleres Grau. Woooow.
Ich wollte alles um mich herum vergessen und nur noch in diesen Augen versinken. Sie erinnerten mich an klares Meerwasser, durch das man auf ein farbenfrohes Riff blicken konnte.
Die müssen mir echt krasses Zeug gespritzt haben, dachte ich verwundert. Solche emotionalen Höhenflüge hatte ich eher selten.
Seine Wimpern waren ebenso dunkel wie seine Haare und Augenbrauen, ein tiefes, warmes Braun, fast Schwarz. Seine Haare waren an den Seiten und im Nacken kurz geschnitten, wurden zum Deckhaar immer länger und fielen in leichten Wellen locker nach hinten.
Er sieht aus wie ein fucking Model … ein Goncalo-Teixeira-Doppelgänger.
Seiner hellbraunen Hautfarbe nach zu urteilen, stammte zumindest ein Teil seiner Eltern aus Brasilien oder Spanien. Ja, er hatte so etwas Heißblütiges an sich, seine fast arroganten Züge waren die eines temperamentvollen Machos. Das war ein Mann, der wusste, was er wollte – ein harter Bursche, keiner von den Zartbesaiteten. Mmmm.
Nicht nur seine Gesichtszüge waren angespannt, sogar die Muskelstränge am Hals traten ein wenig hervor. Er hielt mich eine Armlänge auf Abstand und starrte meine linke Körperhälfte an, als wäre mir ein dritter Arm gewachsen.
Der Chefarzt musste nun auch seinem bestürzten Blick gefolgt sein, denn er hatte schon ein Telefon in der Hand.
Der junge Arzt zischte ein paar Worte in einer Sprache, die ich nicht verstand und seine Hände erhöhten beängstigend den Druck auf meine Arme. Bevor ich mich beschweren konnte, wurde ich bereits wieder auf das Bett gehoben, mein linker Arm im Griff der beiden Männer. Als ich zwischen ihren Händen hindurchsah, erkannte ich dunkle Konturen, ähnlich einer Hennabemalung. Wer abkackt wird angemalt oder was, dachte ich wütend.
Wieder kamen Schwestern herein, die Tupfer und allerlei Gefäße brachten. Die beiden Ärzte riefen sich gegenseitig kurze Anweisungen zu. So, wie die zwei agierten – keiner kam dem anderen in die Quere, beide wussten genau, was der Kollege als nächstes benötigte – arbeiteten sie schon eine ganze Weile zusammen.
Ich sah, wie Spritzen aufgezogen wurden und vermutlich Desinfektionsmittel in großen Mengen auf meine Haut gesprüht wurde. Die beiden Männer diskutierten indes. Es fielen so viele Fachbegriffe, mit denen ich nichts anfangen konnte, dass ich bald abschaltete und nur aufschreckte, als Doktor Köhler sich lautstark über die Vorwürfe seines Kollegen echauffierte, mich nicht gründlich genug untersucht zu haben. Er verteidigte seinen Standpunkt, dass Verletzungen dieser Art zuvor nicht dort gewesen waren! Sonst hätte er sie doch sofort behandelt!
Während die beiden neue Instruktionen an das Personal weitergaben, konnte ich endlich meinen Arm näher inspizieren. Es dauerte eine Weile, ehe die Information, die meine Augen aufnahmen, in meinem Gehirn verarbeitet wurde. Und selbst, als dieser Vorgang abgeschlossen war, konnte ich es nicht fassen. Die Verletzungen am Arm zeugten nicht von meinem Sturz in die Tiefe. Es sah aus, als hätte ein Tätowierer anstatt der Nadel ein Cuttermesser benutzt. Welches verdammte Schwein macht sowas!
An meiner Schulter beginnend zogen sich, gleichmäßig in die Haut geschnittene, Zeichnungen bis zur Unterseite meines Unterarms. Es war ein Zusammenspiel aus in sich verschlungenen Kringeln, mir unbekannten Schriftzeichen, geschwungenen Linien und immer kleiner werdenden Kreisen.
Ich wollte die rechte Hand auf meine Augen legen, um die Tränen zurückzuhalten, doch die verweigerte ihren Dienst. Ich beließ es dabei, schaute nach oben in die Lampe und schniefte vor mich hin.
Nach ein paar Minuten hatte ich mich wieder einigermaßen im Griff und schenkte meiner Umgebung wieder Beachtung. Der ältere Arzt war ins Nebenzimmer verschwunden, ich hörte ihn telefonieren. Der jüngere Arzt saß auf einem der grauen Plastikstühle, den Ellenbogen hatte er auf dem kleinen Tisch neben ihm abgelegt, seine Finger stützten seine Stirn in nachdenklicher Pose. Die Krankenhausbekleidung konnte seine sportliche Figur nicht verbergen: seine Rücken- und Armmuskulatur zeichnete sich stark ab, einen Tick massig, aber vorwiegend athletisch.
Trotz, dass er in seine Notizen vertieft war, wirkte er aufgewühlt. Seine Stirn lag in Falten, sein Blick flog angestrengt über die Werte. Als er Bemerkungen hinzufügen wollte und der Stift seinen Dienst versagte, schleuderte er ihn mit einer energischen Bewegung auf den Tisch. Der Kugelschreiber schlidderte über die Oberfläche und landete unter dem Bett zu meiner Linken.
Sein Blick wanderte in meine Richtung. In ihm lagen Frustration und Hilflosigkeit. Er schaute eine Weile auf meinen Arm, wurde jedoch abgelenkt, als Doktor Köhler ins Zimmer zurückkehrte.
Irgendwie jagte mir sein merkwürdiges Verhalten Angst ein.
Eine kurze Information seines Kollegen über die weiteren Verfahrensweisen genügte und der junge Arzt war auf den Beinen, um mich und mein Bett aus dem Zimmer zu schieben.
Die nächsten Stunden verbrachte ich auf kalten Untersuchungstischen, vor piependen Maschinen und auf – dem Schildchen seines Kittels zufolge – Doktor Kiayns Armen, der mich immer wieder in das rollbare Bett zurückhievte.
Ich zerbrach mir den Kopf, ob ich durch den Sturz irgendwelche bleibenden Schäden davontragen würde und, wie ich die Narben auf Arbeit verdecken sollte. Wer weiß, wie lange ich keinen Sport mehr machen kann! Ich hoffte inständig, dass mir die Ärzte mehr sagen konnten, wenn die Ergebnisse und Röntgenbilder vorlagen.
Irgendwann legten sie eine Pause ein und stellten mich mit meinem Bett in den Gang. Prompt fielen mir die Augen zu.
Ich wurde schlagartig wach, als die Tür neben mir aufschwang und beide Ärzte sich vor mir aufbauten. Doktor Köhler schaute in seine Akte und verkündete mir seine Neuigkeiten. "Nun, es gibt eine gute Nachricht und ein paar Schlechte. Die Gute ist, dass wir Sie nicht operieren müssen. Es sind keine lebenswichtigen Organe verletzt, die Frakturen, die Sie sich zugezogen haben, sind ohne Dislokation – also ohne Verschiebungen und ohne Anzeichen auf eine Splitterung der Knochen. Dennoch kommen – und das sind die Schlechten – einige Verletzungen zusammen. Ich fange am besten von oben an: Gehirnerschütterung, Platzwunde an der Stirn, Nasenfraktur, angebrochenes Schlüsselbein, drei gebrochene Rippen, Fraktur des rechten Oberarms, Riss des musculus rectus femoris am linken Bein, Fraktur des linken oberen Sprunggelenkes. Prellungen und Quetschungen verteilen sich über den gesamten Körper."
Ich schaute auf meine Hände und versuchte, mir nicht vorzustellen, wie es gerade in meinem Körper aussehen musste.
Doktor Köhler kreuzte seine Hände samt der Akte vor seinem kleinen Bauch, bevor er mir eröffnete: "Die Schwestern werden sich gleich um Sie kümmern und dann in Ihr Zimmer begleiten. Ich werde in den nächsten Tagen wieder nach Ihnen sehen. Bitte empfangen Sie vorerst keinen Besuch. Ihr Körper braucht dringend Ruhe. Gute Besserung fürs Erste."
Ich nickte traurig und er verschwand wieder in seinem Büro. Der gutaussehende Arzt – Doktor Kiayn – lehnte am Ende meines Bettes und regte sich nicht. Sein Blick ging ins Leere, als würde er über die Worte seines Kollegen nachdenken.
"Geht es Ihnen gut?" Erst nachdem der Satz über meine Lippen gekommen war, registrierte ich, wie deplatziert die Frage war. Ich hoffe, er schiebt es auf die Medikamente.
Er schaute auf, aus seinen Gedanken herausgerissen, und schien zu überlegen, wie er höflich formulieren konnte, dass ich eingewiesen gehörte. "Nun ja, in Anbetracht Ihrer derzeitigen Verfassung ist mein Gemütszustand wohl eher nebensächlich." Als er mich nun direkt ansah, lag in seinem Blick weder Belustigung oder Freundlichkeit – er wirkte unterkühlt.
Ich wendete mich ab und schluckte meinen Kommentar hinunter.
Mich beschlich das ungute Gefühl, dass all dies erst der Anfang von etwas viel Schlimmerem war.
Wortlos ging er ans Kopfende des Bettes und schob mich in den Aufzug, um mich im "concrete room", wie ihn die Schwestern später nannten, abzuliefern und sogleich das Weite zu suchen. Die Schwestern klammerten meine Stirn, mein Oberschenkel – jetzt wusste ich auch, was Doktor Köhler mit "rectus dingens" gemeint hatte – wurde genäht, der rechte Arm eingegipst und der linke Fuß geschient. Danach brachte mich die flippige Blondine mit den kurzen, stacheligen Haaren in eines der vielen Patientenzimmer und zeigte mir, wie ich den Notrufknopf betätigen konnte, falls ich etwas benötigte. Zum Schluss verkabelte sie meinen Arm mit dem Tropf, der eine durchsichtige Flüssigkeit enthielt. Ich bedankte mich, bevor sie verschwand und das Licht löschte.
Ein Einzelzimmer wäre für jeden ein Segen gewesen: keiner der einem vorheult, wie schlecht es ihm ging und kein Geschnarche. Ich dagegen hätte nichts über eine weitere Person im Zimmer einzuwenden gehabt. Ich hatte Angst. Keine Ahnung, vor was oder wem genau, es war nur so ein Gefühl.
Die Digitalanzeige am Fernseher informierte mich, dass es bereits "Dienstag, 05:24" Uhr war.
Ich schloss die Augen und hoffte, die Schmerzmittel würden das Stechen und Pochen lange genug unterdrücken, um ein paar Stunden schlafen zu können.
Ich wünschte, die Medikamente hätten den gleichen betäubenden Effekt auf mein Unterbewusstsein gehabt. Doch dieses pflanzte mir die düstersten Bilder in den Kopf.
Der Himmel in dieser bizarren Welt leuchtete in aggressivem, beängstigendem Rot. Wo ich auch hinsah waren Menschen in schwarz gekleidet. Sie strömten an mir vorbei, ihre Gesichter vor Trauer versteinert. Ihnen folgten Kuttenträger, die hunderte von Särgen auf Holzkarren hinter sich herzogen. Es mussten tausende Tote sein! Hatte es eine Epidemie gegeben? Das Schluchzen und die Schreie erhoben sich immer lauter. Sie schienen allen Sauerstoff in sich aufzusaugen und plötzlich bekam ich keine Luft mehr, drohte gar zu ersticken. Ich versuchte, zu husten und um Hilfe zu rufen, aber im nächsten Augenblick war das beklemmende Gefühl verschwunden und damit auch die trauernden Massen.
Ich blickte um mich und spürte, wie meine Füße von einer Flüssigkeit umspült wurden. Die zähflüssige Masse stieg bis hinauf zu meinen Knien – es roch nach Eisen. Erst jetzt bemerkte ich, dass meine Hand etwas umklammerte. Als meine Augen erfassten, was sich dort zwischen meinen Fingern befand, wollte ich es fortschleudern, doch ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Es waren blutige Haare, die ich umklammerte und daran hing der Kopf eines Mannes. Seine Züge verzerrt und angsterfüllt. Ich spürte sein Gewicht, als sich das Traum-Ich in Bewegung setzte und durch die Straßen watete, die überschwemmt waren von Leichen, Blut und Gedärmen. Und ich konnte mich nicht wehren, als sich meine Lippen vor Erregung zu einem Grinsen verzogen.
Als ich in der Nacht aus diesem Alptraum erwachte, war ich schweißgebadet. Ob dies dem Traum oder den einsetzenden, immensen Schmerzen geschuldet war, konnte ich nicht sagen. In jedem Fall überstiegen diese Schmerzen das Pochen und Stechen beim Aufwachen im Horrorkeller um ein Vielfaches.
Es begann, fürchterlich in meinem linken Arm zu brennen. Dieses Gefühl steigerte sich, bis ich glaubte, alle Muskeln würden sich in Säure auflösen. Ich krümmte mich, trat mit den Füßen an das Bettgestell, wollte mir am liebsten die Adern abdrücken oder den Arm abhacken, da das Brennen weiter zur Schulter wanderte und in meinem Kopf widerhallte. Ich schrie auf, krümmte mich verzweifelt auf dem Bett und fasste an meinen Kopf, der gefühlt kurz vorm Explodieren stand. Immer weiter, immer tiefer fraß es sich in mein Fleisch. Der Herzfrequenzmesser neben mir piepte immer schneller und gab beunruhigende Warntöne von sich. Ich tastete mit einer Hand nach dem Notknopf, doch in diesem Moment wurde die Tür zu meinem Zimmer aufgerissen und wieder verschlossen. Trotz der Dunkelheit wurde der Lichtschalter nicht betätigt.
Ich hörte, wie jemand durch das Zimmer rannte und die Kabel des Frequenzmessers aus der Dose riss – das wilde Piepen endete abrupt. Eiserne Arme drückten mich auf das Bett, fixierten mich.
Die seltsame Vorgehensweise ließen mich daran zweifeln, dass ich es mit einem normalen Arzt zu tun hatte – und da schoss es mir durch den Kopf: Fuck! Das ist der Tattoo Freak! Er will mich ausschalten! Trotz der Qualen hatte ich das dringende Bedürfnis, um mein Leben zu kämpfen oder wenigstens zu flehen. "Neiiiin! Lass mich los, du blöder Wichser! Hiiiilfe!" Ich schlug – soweit ich mich noch bewegen konnte – um mich und versuchte, wieder zu schreien.
Der Griff lockerte sich und ich hoffte, er hätte aufgrund meines Gekreisches Angst bekommen, erwischt zu werden. Doch im nächsten Augenblick wirbelte der Angreifer mich herum, als wäre ich leicht, wie eine Feder und setzte sich hinter mich. Eine Hand hielt meinen Oberarm fest, die andere meinen Mund zu und seine Unterschenkel legte er auf meine Beine.
Ich hyperventilierte vor Panik, Tränen flossen die Wangen hinunter. Ich biss in seine Hand, doch sie verharrte, wo sie war.
"Verdammt! Hören Sie auf damit! Sie müssen sich aufs Atmen konzentrieren! Los! Einatmen! Ausatmen!" Tatsächlich hörte ich bei diesen Worten auf, mich wie eine Furie zu wehren. Der junge Arzt? Leider konnte ich die Schmerzen nicht so einfach weg atmen!
Die Hand vor meinem Mund verschwand, die Umklammerung blieb.
"Kann … nicht …", röchelte ich.
"Doch. Sie. Können!", sagte er mit Nachdruck.
"Verbrenne … innerlich …" Ich konzentrierte mich auf seinen kühlen Atem, den ich im Nacken fühlte.
"Ich kann Ihnen nichts geben, was es erträglicher macht. Wehren Sie sich nicht dagegen, das macht es nur schlimmer …" Seine Stimme klang wehmütig.
Was? Was zur Hölle faselt der da? Feuer in meinem Kopf und überall! Beschissen heiß! Mach, dass es aufhört! Ich schluchzte vor mich hin. Ich wollte ihn so gern anschreien, er sollte mir sofort was dagegen spritzen! Irgendwas!
Erzog mich noch enger an sich, als würde er denselben Schmerz fühlen und legte seine kühle Wange an mein Ohr. Für mich existierte nur noch seine kühle Wange, sie war mein Rettungsboot.
Alles zehrte und schmorte in mir. Mein Blut würde gefühlt bald den Siedepunkt erreichen.
"Was passiert mit mir?", presste ich durch die zusammengebissenen Zähne. Die Stille erdrückte mich.
Nur verschwommen kann ich mich an das erinnern, was dann geschah. Wäre der Herzfrequenzapparat angeschlossen gewesen, hätte sich das Piepen um ein Vielfaches beschleunigt – mein Herz flatterte merklich, Schweiß brach aus allen Poren.
Das Brennen zog sich urplötzlich in mir zusammen, um mich Sekunden später innerlich zu zerreißen.
Mein Körper bäumte sich so stark auf, dass selbst der Arzt mich nicht mehr halten konnte. Es brannte in Ohren, Rachen und Nase, als das Blut aus meinem Körper gepresst wurde und ich Unmengen der dunklen Flüssigkeit erbrach.
Mein Körper sackte in sich zusammen.
Soundtrack: Pharrell Williams – Happy↩
Soundtrack: Trivium – Chaos Reigns↩
KAPITEL 2
Bummbumm. Bummbumm. Bummbumm.
Ich konnte mich nicht mehr spüren, fühlte mich wie ein Geist, der keine Hülle besaß und im luftleeren Raum schwebte. Ich versuchte zurückzufinden, die Augen zu öffnen, aber nichts geschah. Vielleicht musste ich meine frühere Vorstellung vom Sterben revidieren? Doch als ich wieder dieses gleichmäßige Schlagen hörte, wusste ich, dass es mein Herz war. Es hatte Gevatter Tod getrotzt und schlug unaufhörlich weiter.
Langsam drangen Geräusche an mein Ohr. Nach und nach fühlte ich den Druck an meinem Rücken, als würden sich die Nervenenden Stück für Stück regenerieren und mir meine Sinne wiederschenken.
Wie viel Zeit war vergangen? Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit bis ich im Stande war, meine Augen aufzuschlagen.
Es war helllichter Tag, der Himmel war blau, die Sonne schien. Die weißen Gardinen bewegten sich sanft vor dem offenen Fenster. Nichts schloss auf die Geschehnisse der letzten Nacht, alles war in bester Ordnung. Der Pulsapparat piepte leise und gleichmäßig.
Habe ich wieder nur schlecht geträumt? Zuzutrauen wäre es mir …
Ich schaute unwillig an mir herunter und erwartete ein blutüberströmtes Bettlaken.
Das Laken war nicht nur unbefleckt, sondern auch beinahe knitterfrei.
Aber ich fühlte mich nicht so, als wäre alles nur in meinem Kopf passiert – ich fühlte mich schlechter. So, als hätte ich eine ganze Woche nicht geschlafen und nichts gegessen. Das Heben und Senken meiner Brust schmerzte, mein Hals brannte extrem.
Ich erschrak, als die Tür aufgestoßen wurde und eine hektische, schwarzhaarige Schwester mit einem Tablett und einer Thermoskanne hereineilte.
"Ah! Endlich sind Sie wach! Sie haben gestern den ganzen Tag verschlafen! Wir wollten Sie wecken, damit Sie was essen, aber keine Chance. Neben Ihnen hätte eine Bombe einschlagen können und Sie hätten es nicht gehört." Sie zwinkerte mir zu, als ich mich bemühte, zu lächeln.
Ich überlegte, welcher Tag dann heute sein musste. Mittwoch, wenn ich mich nicht irrte.
Sie stellte Tablett und Kanne ab, befreite mich von Kabeln und Schläuchen und wechselte die Verbände am linken Arm, Bauch und Bein.
"Sie haben das Schmerzmittel in sich aufgesaugt, wie nix", sagte Sie und nickte zu dem leeren Beutel auf dem Besuchertisch. "Das ist mir so auch noch nie untergekommen. Ich dachte schon, es sei ausgelaufen. Aber irgendwie scheint ihr Körper es einfach verbrannt zu haben." Sie schrieb ihre Notizen in den am Fußende des Bettes befestigten Klemmblock, wünschte guten Appetit und verschwand so zügig, wie sie gekommen war.
Das ist jetzt wirklich nicht gerade hilfreich … Ob ich den Arzt suche und ihn einfach frage? Er wird mir schon sagen, ob ich noch alle Latten am Zaun habe.
Der Geschmack in meinem Mund war fürchterlich. Als hätte ich mir auf die Zunge gebissen.
Ich goss mir eine Tasse Tee ein und trank sie in einem Zug leer. Diesen Vorgang wiederholte ich vier Mal, bis mir schlecht war. Der eklige Geschmack verschwand leider dadurch nicht.
Ich quälte mich aus dem Bett und suchte mir ein paar meiner weitesten Sachen aus dem Rucksack, die ich eigentlich für faule Nachmittage auf der Couch vorgesehen hatte. Bei meiner Suche fand ich einen Kaugummi, den ich mir gleich einverleibte, da Zähneputzen in diesem eingeschränkten Zustand nicht wirklich möglich war. Es dauerte ewig, bis ich den Pulli über den Gips gezerrt hatte, danach war ich schon völlig geschafft und wollte mich am liebsten wieder hinlegen. Es hatte sich aber trotzdem gelohnt, sich umzuziehen. In den eigenen Sachen fühlte ich mich definitiv wohler, als in diesem zugigen Krankenhaus-Hemdchen.
Beim Blick in den Spiegel erschrak ich zugegebenermaßen: er zeigte mir eine bleiche Gestalt, deren lange schokobraune Haare schlaff herunterhingen. Mein Gesicht war entstellt durch die dunklen, fast schwarzen Blutergüsse unter den Augen und der geschwollenen Nase. Zumindest konnte ich die Hämatome und die geklammerte Platzwunde auf der Stirn mit meinem Pony verdecken. Die von den dichten Wimpern umrandeten, sonst so strahlenden Augen blickten matt und ausdruckslos drein. Ein paar Äderchen waren geplatzt. Mein sportlicher und aufrechter Gang hatte sich in ein gebücktes, durch die Schiene unterstütztes Humpeln gewandelt – so alterte man zwanzig Jahre über Nacht.1
Ich schleppte mich hinaus in den Gang, in dem reges Treiben herrschte und fragte eine Schwester, ob Doktor Kiayn gerade arbeitete. Sie war nur sehr kurz angebunden und sagte sarkastisch, dass sie unglücklicherweise nicht von jedem Arzt den Dienstplan im Kopf hatte. Als ich fragte, wer mir darüber Auskunft geben könnte, schnaubte sie und wollte das Gespräch abbrechen. Ich hatte schon Tränen in den Augen – der ganze Stress schien mich echt mürbe zu machen – und meinte schniefend, es wäre wirklich sehr wichtig.
"Das sagen sie alle … also gut, also gut. Er ist im Grunde kein festangestellter Arzt, er hilft oft aus, wenn es personelle Engpässe gibt. Er taucht immer mal auf und ist dann auch schon wieder verschwunden. Der Oberarzt, der den Plan erstellt, ist erst später wieder im Haus. Tut mir leid Kleine, aber mehr weiß ich nicht."
Niedergeschlagen trottete ich durch die Krankenhausgänge und fand mich schließlich im Außenbereich wieder, wo ich mich auf eine der Bänke setzte. Ich schaute den Goldfischen zu, die in einem großen, künstlich angelegten Teich ihre Runden drehten. Sie funkelten so hübsch in der Sonne.
Es wäre schön gewesen, Aline und Denise hier zu haben, um einfach ein bisschen zu quatschen. Ich vermisste ihre Herzlichkeit und ihren Humor. Die Ärzte hatten mir jedoch jeglichen Besuch untersagt, da ich mich schonen sollte und in meinem Zustand Aufregung nicht förderlich wäre. Die können mich mal! Ich zückte mein Smartphone und wählte den Kontakt von Denise. Da ich es aufgrund der Verbände und des Gipses schlecht ans Ohr halten konnte, stellte ich auf Lautsprecher.
Sie freute sich riesig, von mir zu hören, war jedoch erschrocken, wie schlecht ich mich anhörte. Wie immer konnte sie mich zum Lachen bringen, was leider ein Ziehen in meinem Brustkorb auslöste: "Mensch Bunny! Wenn du dich vor meinen Kochkünsten fürchtest, hättest du das nur sagen brauchen, dann hätten wir was bestellen können! Du musst dich nicht extra so doll verletzen, um an Krankenhausessen zu kommen – so geil ist das auch wieder nicht. Gibt es denn wenigstens scharfe Ärzte?", scherzte sie.
Ich unterdrückte mein Prusten. "Du bist so genial. Ja, einen gibt es sogar. Aber ich denke mal, der hat sehr viel hübschere Patientinnen, die ihm den Kopf verdrehen – und ich bin nur Matschgesicht aus Zimmer drei. Also Zonk, beeeeböööp."
"Ach Mausi, das tut mir alles so leid. Hoffentlich geht es dir bald wieder besser. Aber ich muss dir noch was echt Schlimmes mitteilen: deine Nasenmodelkarriere kannst du jetzt voll vergessen." Ich liebte ihren Sarkasmus.
"Oh Maaaann! Du raubst mir echt all meine Träume, was soll ich jetzt nur tun!" Es war schön, mit ihr zu lachen. Bevor sie sich verabschiedete, ließ sie eine ihrer legendären, ausdrucksstarken Schimpftiraden auf die Stadtverwaltung los, die den "beschissenen Keller" nicht ausfindig machen konnte und ihrer "Kack Verkehrssicherungspflicht" nicht nachkam. Sie übermittelte noch liebe Grüße von Aline und Sandra, dann verabschiedeten wir uns auf bald.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich ihr jemals die Verletzungen am Arm erklären sollte – sie würde tierisch ausrasten.
Ich döste vor mich hin und versuchte, nicht allzu sehr über die Rolle des Arztes in diesem Wahnsinn nachzudenken. Vorausgesetzt, ich habe mir das gestern nicht nur eingebildet, wusste er irgendwas über die Symptome – er sagte, kein Mittel würde helfen. Ist doch Scheiße, wenn er dann einfach abhaut!
Mein Kopf fing an, Achterbahn zu fahren und ich entschied mich, wieder nach drinnen zu hinken. Der kleine Ausflug hatte mich ziemlich entkräftet.
In meinem Zimmer angekommen, warf ich den Kaugummi in den Müll, legte mich zurück ins Bett und zog die Decke über meinen Kopf.
Nach wenigen Minuten war ich eingeschlafen.
Die Straßenlaternen vor dem Zimmerfenster warfen orangefarbenes Licht auf die weißen Wände, der Blick zum Fernseher verriet: "Mittwoch, 23:14" Uhr.
Ich fühlte mich, soweit man davon sprechen konnte, ganz gut. Die Mittelchen, die sie mir verabreichten, mussten ordentlich "Bumms" haben. Ich erschrak zu Tode, als mein Blick weiter durch das Zimmer schweifte und die reglose, dunkle Gestalt erfasste, die an meinem Bettende verharrte. Ich tastete hektisch nach dem Notknopf. Bevor ich diesen erreichen konnte, sprach die Schattengestalt mich an: "In ihrem Tropf befindet sich ein spezielles Medikament, welches wir ansonsten nur bei Herzpatienten einsetzen. Ich habe die Hoffnung, dass Ihnen dadurch bestimmte Schmerzen erspart bleiben."
Ich entspannte mich für einen Moment, als ich die Stimme des jungen Arztes erkannte – aber nur für einen Moment.
"Sagen Sie mal, können Sie nicht wie normale Menschen das Licht anschalten, wenn Sie sich irgendwo hinsetzen? Ich krieg wegen Ihnen noch einen Herzinfarkt!", fuhr ich ihn an. Etwas ruhiger, aber dafür mit einem skeptischen, fast schnippischen Unterton, setzte ich hinterher: "Sie sagten doch, es gibt nichts, was mir hilft?"
"Korrekt. Dies ist auch nur ein Versuch, die Schmerzen einzudämmen, nichts weiter."
Aufgrund seines arroganten Tonfalls verlor er augenblicklich so manche Punkte auf meiner Attraktivitätsskala. Wahrscheinlich fiel mein nächster Satz auch deswegen noch kühler aus. "Ich dachte schon, die haben Sie gefeuert."
Das brachte ihn etwas aus dem Konzept. "Warum sollten sie?"
Hallo?





























