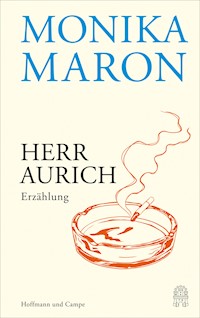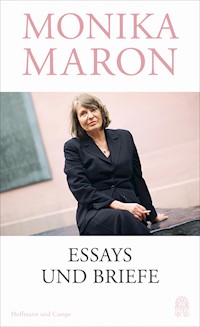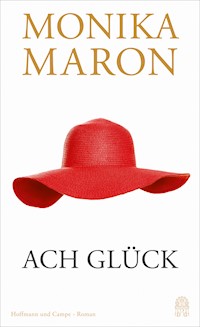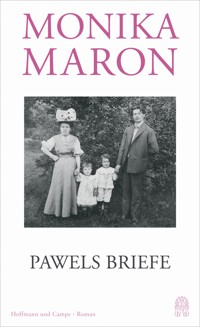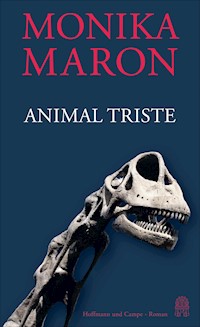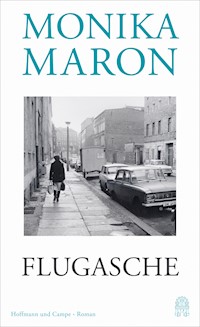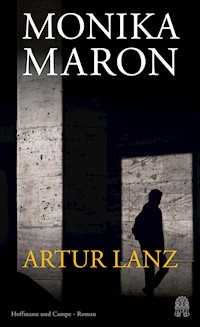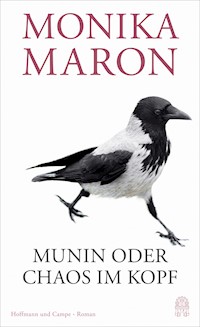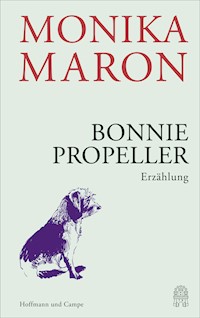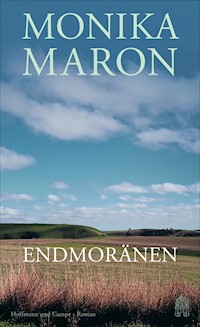
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Herz altert nicht I n einer nordöstlichen Endmoränenlandschaft versucht Johanna, ihren biographischen Standort zu bestimmen – und stellt sich der Frage, wie der Rest des Lebens noch genutzt werden könnte. Johannas entschlossene und lebenskluge Freundin Elli benutzt das Wort Glück seit langem nur in seinen trivialen Zusammenhängen. Die erfolgreiche Malerin und Erbin eines Verwalterhauses Karoline Winter, vor jeder Flugreise in Todesangst, verzweifelt am Verfassen ihres Testaments, weil sie keine Erben hat. Christian, der alte Freund aus München, Lektor in einem Wissenschaftsverlag, erlebt den Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Die Lebensentwürfe aller scheinen erschöpft, und die Zeit vor ihnen ist noch lang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Monika Maron
Endmoränen
Roman
Hoffmann und Campe
Vor drei Jahren habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass ich erleichtert war, als der Herbst kam. Vielleicht war es im Jahr davor auch schon so gewesen und im Jahr davor auch, und es war mir nur nicht bewusst geworden, dass sich etwas verändert hatte, dass offenbar ich mich verändert hatte, schleichend und undeutlich, sonst hätte ich den Wandel nicht erst bemerkt, nachdem er ganz und gar vollzogen war und ich nicht mehr sagen konnte, wann er begonnen hatte. Nur dass die Zeit, in der ich den Abschied vom Sommer als eindeutigen Verlust, als Zumutung, sogar als Schmerz empfunden habe, länger als drei Jahre zurückliegen muss, weiß ich genau. Der letzte Sommer, dessen ich mich nachträglich als ganz und gar frei von jenem Missbehagen erinnere, das ihn mir später fast verleidete, war unser erster Sommer in Basekow. Und das war schon vor dreizehn Jahren. Das war auch der Sommer, in dem Irene starb. Ihre Familie hatte mich nicht finden können, als Irene vor ihrem Tod mich, nur mich noch einmal sehen wollte. Wären diese beiden Ereignisse nicht zusammengefallen, Irenes Tod und der Erwerb eines Landhauses, wäre Irene für mich wohl eine jener Schulfreundschaften geblieben, die sich, eine freundliche Erinnerung hinterlassend, im Leben langsam verlieren und die im Falle eines frühen Todes des einen ein kleines aufrichtiges Bedauern im Überlebenden entfachen, vor allem aber, sofern der Tod nicht durch einen Unfall, sondern durch Krankheit verursacht wurde, das Erschrecken über einen Jahrgangstoten. So aber gehört Irene für immer zur Geschichte des Hauses und meines ersten Sommers in Basekow, der zugleich der letzte war, den ich nachträglich meiner, wenn auch späteren, Jugend zurechne.
In den Jahren vor ihrem Tod habe ich Irene höchstens zwei- oder dreimal im Jahr und dann auch nur zufällig getroffen, zum letzten Mal an einem warmen Abend in der Buchhandlung am Rathaus. Sie kam mit zu mir, und wir tranken Wein auf dem Balkon. Irene und ich waren zusammen zur Schule gegangen, zuerst in die Grundschule, dann in die Oberschule. Irene studierte Slawistik, ich Germanistik, manchmal trafen wir uns in Vorlesungen bei den Philosophen. Während der Grundschulzeit waren wir Freundinnen. Wir haben uns auch später gemocht, sahen uns aber kaum noch. Irene war, was meine Tante Ida verwachsen nannte. Ihre Beine standen stockdünn auf langen Füßen in orthopädischen Schuhen, die mageren, behaarten Arme reichten fast bis zu den Knien, weil Irenes Wirbelsäule zwischen den Schulterblättern verkrümmt war und ihren Oberkörper um zehn oder zwölf Zentimeter verkürzte. Später spendete die ganze Verwandtschaft Geld, und Irene konnte im West-Berliner Oskar-Helene-Heim operiert werden. Die Wirbelsäule wurde begradigt, konnte nun aber nicht mehr wachsen. Und auch das Korsett aus Stahl und Leder musste Irene noch tragen.
Als wir uns zum letzten Mal sahen, waren wir beide fast vierzig, und Irene wohnte immer noch bei ihrer Mutter. Ich weiß nicht mehr, worüber wir uns unterhalten haben. Aber seit einem anderen Abend, der einige Jahre zurücklag, sprachen wir in einem vertrauten, fast intimen Ton miteinander, als hätten wir seit unserer Kinderfreundschaft nie aufgehört, einander in unsere Geheimnisse einzuweihen und an unserem Leben teilhaben zu lassen.
Auch an diesem früheren Tag muss ich, weil wir uns nie verabredet hatten, Irene auf der Straße getroffen und in meine Wohnung eingeladen haben. Wir saßen in den Sesseln am Fenster zum Hof, die Sonne stand tief und tauchte das Zimmer in rosa Licht wie der Widerschein eines Feuers. Wir tranken Glühwein, der sich schnell als ein entspanntes Wohlgefühl in Körper und Kopf ausbreitete. Irene sprach über ihre Mutter, die, seit sie Witwe war, ihr Sorge- und Kontrollsystem auf ihre unverheiratete Tochter übertragen hatte und sich in ehelicher Routine beklagte, wenn diese es ihr nicht durch ihre Anwesenheit dankte. Die Frage, warum Irene mit vierzig Jahren noch bei ihrer Mutter wohnte, hing, ohne dass ich sie gestellt hätte, zwischen uns; die Antwort darauf auch. Irenes große hervorstehende Augen mit den dünnen langen Wimpern an den immer leicht entzündeten Lidern schwammen farblos im Dämmerlicht. Wenn sie sich bewegte, verbreitete sie einen süßlichen, an Krankheit erinnernden Geruch, der sie schon in der Kindheit begleitet hatte.
Wie lebst du so?, fragte ich, ich meine, wie lebst du so in deinem Körper?
Ich hatte mir nie vorstellen können, ihr diese Frage zu stellen, obwohl ich immer gespürt hatte, dass es unfair war, gerade danach, nur danach nicht zu fragen. Ich wusste nicht, ob es je einen Mann gegeben hatte, der über Irenes Sanftmut und Liebenswürdigkeit ihren verunstalteten Körper hatte vergessen können, die knochigen Schultern, auf denen ein kurzer dünner Hals den großen Kopf trug, den gewaltigen, auf das Becken gestauchten Brustkorb, sodass der Eindruck entstand, die Beine wüchsen direkt aus dem Oberkörper.
Irene sah mir für eine Sekunde in die Augen, so direkt, dass ich mich an das Gefühl, durchschaut zu werden, heute noch erinnere. Damals hielt ich diesen Blick für einen Ausdruck von Tapferkeit, von stiller Selbstbehauptung, und ich befürchtete, die Grenze zum Unaussprechlichen überschritten zu haben.
Es ist nicht leicht, sagte Irene, es ist schwer, aber es geht. Schließlich sei es nicht plötzlich über sie gekommen wie bei einem Unfall, sondern sie sei reingewachsen in diesen Körper und habe rechtzeitig verstanden, dass sie von dem Glück, das die menschliche Natur für Männer und Frauen bereithält, ausgeschlossen war. Damals in der Oberschule, als wir anderen uns von den ersten Küssen und Rendezvous erzählten und sie einfach nicht mehr beachteten, weil wir voraussetzten, dass sie niemals zum Kreis der Eingeweihten gehören würde, damals, sagte Irene, sei ihr klar geworden, dass sie sich auf ein anderes Leben vorbereiten musste als wir. Sie fühlte kein besonderes Talent in sich, keine Neigung, die sie von anderen unterschieden hätte, sie hielt sich auch für durchschnittlich intelligent, und so schien es ihr das Beste, einen Beruf zu ergreifen, in dem vermehrter Fleiß fehlendes Genie ausgleichen und überdurchschnittliche Leistungen ermöglichen könnte. Sie entschied sich für ein philologisches Fach, und damit sie ihre noch zu erwerbenden Kenntnisse durch Reisen und Anschauung würde vervollkommnen können, wählte sie die Slawistik, weil die den slawischen Sprachen zugehörigen Länder als einzige nicht dem staatlichen Reiseverbot unterlagen.
Irene sprach leidenschaftslos, als hätte sie all diese Sätze schon einmal aufgeschrieben und zitiere sie jetzt nur. Ein ebenso verzeihender wie um Verzeihung bittender, einem Lächeln ähnlicher Zug um den Mund und ein verlegener Glanz in den Augen wirkten beschwichtigend; es ist alles nicht so schlimm, sollte das wohl heißen, oder: So ist das Leben. Einmal, sagte Irene, sie sei siebzehn oder achtzehn gewesen, habe sie sich nackt vor den Spiegel gestellt und sich mit Hilfe eines zweiten Spiegels lange und genau von allen Seiten betrachtet, einmal nur. Danach habe sie ihre Nacktheit nicht mehr ertragen können. Sie dusche niemals, sondern bade immer in einem Berg von Schaum, um ihre ungefügen Gliedmaßen, durch deren wächserne Haut der Tod hervorscheine wie in einem Röntgenbild, nicht ansehen zu müssen. Jeden Morgen und jeden Abend, vollziehe sie den Wechsel der Kleidung hastig und atemlos vor Angst, ihren nackten Körper wahrnehmen zu müssen, als ließe er sich zum Verschwinden bringen, wenn niemand, nicht einmal sie selbst, ihn zur Kenntnis nähme.
Es war fast dunkel geworden, nur der äußerste Rand der Sonne glühte noch über den Dächern. Ich zündete die Kerzen an. Auf Irenes Oberlippe glänzten jetzt winzige Schweißperlen. Sie hatte ihre Kostümjacke geöffnet, unter dem dünnen Pullover formte sich eine kleine, mädchenhafte Brust. Seit der Studienzeit kannte ich Irene in immer ähnlich unauffälligen, nur in Stoffart, Kragenform und Farbe differierenden Kostümen, wobei die Farben sich auf ein Spektrum von Beige bis Hellgrün beschränkten. Der Anblick von Irenes kleiner weiblicher Brust überraschte mich. Nicht einmal, als ich ihr die indiskrete Frage nach ihrem Leben in diesem Körper stellte, hatte ich an ihre Geschlechtlichkeit gedacht, sondern an etwas Abstrakteres, eher Soziales, an Geborgenheit oder auch nur Erwünschtsein.
Hat es so etwas gegeben, fragte ich und deutete mit Augen, Händen und Stimme an, dass ich nicht aussprechen wollte, wonach ich fragte.
Nein, sagte Irene, niemals, ich hätte es sicher auch nicht gewollt, aber wer weiß. Nein, ich glaube, ich hätte es nicht gewollt, nicht so. Früher wäre jemand wie ich vielleicht in ein Kloster gegangen. Mein Kloster ist die Bohemistik, das ist mein sicherer Ort. In der vorigen Woche hatten wir eine Feier im Institut, wir haben getanzt, ich auch, jeder Mann hat einmal auch mit mir getanzt.
Dieser Abend ist außer einigen Szenen aus unserer Kindheit meine deutlichste Erinnerung an Irene. Als wir uns zum letzten Mal begegneten, erzählte sie von einer Zyste in der Brust, die am nächsten Tag entfernt werden sollte, die dritte oder vierte während der letzten zwei Jahre; lästig, aber harmlos, sagte Irene mit einer fahrigen, resignierten Handbewegung, als wollte sie die eben gesprochenen Sätze wieder wegwischen. Sie stand schon in der Tür.
Das ist mein letztes Bild von ihr, jedenfalls das letzte, das ich wirklich gesehen habe. Ein Jahr danach, ich war gerade in eine neue Wohnung gezogen, traf ich Irenes Schwester in der Straßenbahn. Sie war noch dicker geworden und trug eine Elfenbeinrose an einem schwarzen Samtband um den Hals. Ich versuchte, mich an ihren Namen zu erinnern, aber mir fiel nur ein, dass ich Irene lange nicht gesehen hatte.
Wie geht es deiner Schwester, fragte ich, auch weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte fragen sollen.
Die Straßenbahn schlingerte durch eine Kurve, Irenes Schwester und ich fielen gegeneinander, sodass mich der mir zugedachte Blick nur streifte, aber auch in ihrer Stimme vibrierte eine angestaute Wut: Das weißt du nicht, zischte sie, Irene ist tot.
Ich dachte an die Zyste, aber was konnte ich für die Zyste in Irenes Brust. Warum schrie die Frau mich an. Sie schrie nicht, niemand drehte sich nach uns um, aber ich hörte sie schreien, weil ich ihr ansah, dass sie am liebsten geschrien hätte.
Sie wollte dich unbedingt sprechen, schrie sie, nur dich, wir haben dich gesucht, aber du warst weggezogen, niemand wusste, wohin. Wir dachten, du wärst in den Westen gegangen. Wir waren sogar bei der Polizei, aber die wussten auch nichts. Nur dich wollte sie sehen.
Ich habe mich noch nicht umgemeldet, ich wohne nur ein paar Straßen weiter. Die Nachbarn hätten es euch sagen können.
Wir haben dich nicht gefunden. Immer wieder hat sie gesagt, dass sie dich sprechen will; wo ist Johanna, sucht doch Johanna.
Warum habt ihr nicht die Nachbarn gefragt?
Niemand wusste was. Wir haben ihr gesagt, du bist im Westen. Du warst doch ihre beste Freundin, sagte sie.
Es klang, als hätte sie gesagt: Du bist doch ihre Mörderin. Dann malte sie mir unauslöschbar das letzte Bild von Irene: skelettdünn, kahlköpfig, die großen Zähne zwischen den erschlafften Lippen, die halbrund aus den Höhlen quellenden Augäpfel mit mattfarbener Iris. Ein Pfleger hält sie wie ein Bündel Wäsche im Arm und trägt sie zum letzten Mal die Treppe hinunter in den Krankenwagen.
Ich weiß nicht, wie viele Bilder von Halbtoten, Siechen, an Aids oder Krebs Sterbenden ich in meinem Leben schon gesehen habe; Hunderte, Tausende, die alle zu der einen prophetischen Metapher von unserer, meiner, gesichtslosen Sterblichkeit verschmolzen sind. Nicht Irenes jämmerlicher Tod hat mich dieses letzte Bild von ihr nicht vergessen lassen. Es gab längst ein gültiges Bild von diesem Tod in meinem Kopf, dem ich Irenes Elend hätte zuordnen können. Ich hätte sie nicht vermisst, es war mir ja nicht einmal aufgefallen, dass ich sie fast ein Jahr nicht getroffen hatte. Bis eine mir fast fremde Frau mit einer Elfenbeinrose um den Hals mir ins Gesicht schrie, ich sei Irenes beste Freundin gewesen.
Ich weiß nicht mehr, ob ich so herzlos war, Irenes posthume Umarmung zurückzuweisen. Es ist möglich, dass ich gefragt habe, warum, warum war ich ihre beste Freundin? Oder ich habe, weil ich mich schuldig fühlte, gesagt, davon hätte ich nichts gewusst, was nichts anderes bedeutet hätte als eine Zurückweisung; schlimmer, ich hätte Irenes Zuneigung, von der ich gerade erfahren hatte, verraten, denn ihre Behauptung, ich sei ihre beste Freundin gewesen, kann nur gemeint haben, dass sie meine Freundin war, heimlich und anspruchslos, unbemerkt.
Wie immer ich die Eröffnung der Schwester auslegte, ob ich Irene einen Grund für ihre Liebe zugestand oder ob ich mich nachträglich von ihr bedrängt fühlte, am Ende jeder Aufrechnung blieb etwas, das nur als Schuld zu bezeichnen war. Ich war Irene etwas schuldig geblieben, ohne ihr etwas versprochen oder von ihr geliehen zu haben; eine Schuld, an der ich nicht schuld war, die ich nicht zu verantworten hatte, die ich aber, weil Irene tot war, auch nicht zurückweisen konnte.
Ein paar Wochen lang dachte ich an Irene jeden Tag. Es genügte, dass ich eine kleingewachsene Frau auf der Straße sah oder jemand ein hellgrünes Kostüm trug oder dass ich mit der Straßenbahn fuhr oder an der Buchhandlung am Rathaus vorbeikam, um an Irene zu denken und gleich darauf ein schreckhaftes Ziehen in der Magengrube zu verspüren. Eines Morgens fand ich sie in meinem Bett. Aus der Höhlung des Kissens lugte ein Hinterkopf mit kahlen Stellen im stoppligen stumpfen Haar und wiegte sich kaum merklich im Rhythmus eines rauen Stöhnens, das klang, als käme es von einem Tier. Es dauerte ein paar Sekunden, ehe ich den Kopf als Schatten erkannte und in dem Stöhnen das ferne Geräusch eines elektrischen Werkzeugs.
Vielleicht hätte Irenes Geist von meinem Gewissen gar nicht so verstörend Besitz ergreifen können, wäre ich nicht zugleich auch geschmeichelt gewesen von meiner Wichtigkeit in Irenes Leben, ohne mich auch nur im geringsten darum bemüht zu haben. Der Gedanke, dass sie mich allen anderen Menschen, die sie kannte, vorgezogen hatte, verführte mich, mir auszumalen, was Irene an mir als liebenswert, vielleicht sogar als bewunderungswürdig empfunden haben könnte, und für eine Weile gelang es mir sogar, mich selbst mit einem uneingeschränkten Gefühl des Einverständnisses zu betrachten. Im warmen Licht der Eigenliebe aber wog meine Schuld umso schwerer und mein Versagen glich einem Selbstverrat, weil es bewies, dass ich nicht die Person war, die Irene in mir vermutlich gesehen hat. So erkläre ich mir jedenfalls heute, warum Irenes Geist mir damals unerwünscht in jedem Tabaksqualm oder in jedem Stoffmuster erscheinen konnte, obwohl ich meine Gewissensnot angesichts der losen, eher unverbindlichen Beziehung zwischen Irene und mir selbst übertrieben fand.
Ich kann mich nicht erinnern, ob ich Achim damals von Irenes Tod erzählt habe. Vielleicht war er verreist, oder wir sprachen gerade wenig miteinander, oder wir haben zwar darüber gesprochen, aber Achim hat etwas gesagt, das mir missfiel. Vielleicht hat er mich ja damals schon durchschaut und gesagt, dass ich weniger um Irene als um meine verpatzte Heiligkeit trauere; jedenfalls tritt Achim, wenn ich an Irene denke, nicht einmal als stummer Mitspieler auf, als hätte ich ebenso allein gelebt wie Irene. Laura war zu jung, als dass ich mich ihr hätte anvertrauen wollen. Sie war neun oder zehn Jahre alt und hat Irene bei einem ihrer Besuche in unserer Wohnung gesehen. Sie musterte sie ungeniert und neugierig, lehnte sich dabei eng an mich, blieb stumm, auch als Irene sie etwas fragte, und war offensichtlich erleichtert, als ich ihr einen Vorwand bot, uns zu verlassen. Daran kann ich mich erinnern, weil mir die unverhohlene Ratlosigkeit meiner Tochter angesichts der unglücklichen Erscheinung unserer Besucherin peinlich war, obwohl Irene gar nicht wissen konnte, dass Laura für gewöhnlich ein eher schwatzhaftes Kind mit einem angeborenen Empfinden für Takt und Höflichkeit war.
Es war Herbst, als ich von Irenes Tod erfuhr, und hinter mir lag der erste Sommer in Basekow, wo wir im Jahr davor das Haus gekauft hatten, eine halbe Ruine mit einem Flickendach und beängstigend federnden Dielen. Die Öfen lagen als Trümmerhaufen in den Zimmerecken, in der Räucherkammer auf dem Dachboden hing ein dreckiger verfilzter Pferdeschwanz, von einem Balken baumelte ein Strick mit fachkundig geschürztem Knoten, als hätte hier jemand für den äußersten Notfall vorgesorgt. Die letzten Mieter waren drei Jahre zuvor in den nächstgelegenen Ort gezogen, wo sie von einem Verwandten ein zwar kleineres, aber eigenes Häuschen geerbt hatten, wogegen sie im Basekower Haus, das der Gemeinde gehörte, nur zur Miete wohnten. Ein neuer Mieter hatte sich nicht finden lassen für das Haus in dem Sechsunddreißigseelenort, in den ein ausgefahrener, nach Regen nur noch an den Rändern passierbarer Sandweg hineinführte und eine im Acker verendende Traktorenspur wieder hinaus.
Den Entschluss, das Haus zu kaufen, fassten wir innerhalb von Minuten. Wir hatten einen ehemaligen Kommilitonen von Achim in seinem gerade ausgebauten alten Forsthaus besucht und, weil die Besitzer solcher Anwesen es von ihren Besuchern so erwarten, das Haus, die Einrichtung, den Garten und die Landschaft überschwänglich gepriesen. Der Gastgeber muss in unseren Lobreden wohl unseren geheimen Wunsch vermutet haben, selbst Besitzer eines derartigen Refugiums zu sein, oder er sehnte sich nach befreundeter Nachbarschaft, jedenfalls fuhr er mit uns nach Basekow, wo das Haus, von abgeernteten Feldern umgeben und in ein unglaubliches Herbstlicht getaucht, uns alle Bedenken vergessen ließ, die in vernünftigen und handwerklich unbegabten Menschen wie uns angesichts des ruinösen Zustandes dieser Kate jeden Gedanken an einen Kauf hätten ersticken müssen. Die vierzehn Häuser von Basekow entlang des ansteigenden und auf der Höhe nach rechts abbiegenden Sandweges waren von keinem Punkt der Straße aus gleichzeitig zu sehen, sodass der Ort noch weniger wie ein wirklicher Ort, sondern wie eine zufällige Ansammlung einiger Häuser wirkte, wie gar nicht zugehörig der realen Welt, sondern übrig geblieben, zurückgelassen von der Zeit wie die als sanfte Hügel sich breitenden Endmoränen, die ihn umschlossen. Und auf allem lag dieses ungeheure Licht, von dem wir später, als unser ganzes Leben sich geändert hatte und auch wir in die Toskana fahren durften, sagten, in Basekow gebe es ein Licht wie in der Toskana.
In der Kneipe des Hauptdorfes, von dem Basekow ein Ortsteil ist, fanden wir den Bürgermeister, der dort, wie unser Gastgeber wusste, an jedem Sonntag zwischen drei und fünf Skat spielte. Er wollte dreitausendfünfhundert Mark für das Haus. Als Achim versuchte, mit ihm zu handeln, sagte er, dass schließlich ein Farbfernseher schon sechstausend Mark koste, und immerhin hätte das Haus sogar einen Keller.
Der Vertrag wurde mit einem Handschlag auf der Dorfstraße geschlossen. Bei uns gilt ein Handschlag noch was, sagte der Bürgermeister, und wir waren, was wir noch am Morgen auf keinen Fall hatten werden wollen: Besitzer eines Wochenendhauses. Es blieb uns nichts übrig, als uns fortan selbst in unseren Spott über diese Kleinodien familiären Glücks einzubeziehen, zumal uns eigentlich nur unsere Vorliebe für Improvisationen von anderen Hausbesitzern unterschied. Wir zeigten ungebeten Fotos, auf denen die verschiedenen Stadien unseres Aufbauwerkes dokumentiert waren, wir fragten jeden, ob er uns bei der Beschaffung einer Badewanne oder eines Klobeckens oder gar von Fliesen behilflich sein könne, wir schlugen Einladungen aus, wenn sie auf den Sonnabend fielen; über Nacht hatten wir uns in Objekte unseres eigenen Gespötts verwandelt, was uns das Glück, diesen jenseitigen Ort erobert zu haben, nicht nur nicht verdarb, sondern unseren unvorhersehbaren Sinneswandel vor uns selbst legitimierte.
Für den Sommer nahm ich keine Aufträge an, obwohl wir das Geld dringend gebraucht hätten, und zog mit Laura nach Basekow. Fast täglich fuhren wir über die Dörfer, um hier einen Sack Weißkalk, dort einen Sack Zement zu erbeuten. Der Briefträger des Dorfes, der nach dem Krieg in der Stadt als Maurer gearbeitet hatte, verputzte abends und an den Wochenenden unser Haus, der Nachbar besorgte einen kleinen Kran und hob eine Sickergrube aus. Sein Vetter, ein Tischler, baute eine Haustür, sodass wir die Tür, die wir bis dahin irgendwie mit einer Kette gesichert hatten, nachts endlich verschließen konnten. Nach der Mahd steckten wir uns vom genossenschaftseigenen Feld, das fast bis an unser Haus reichte, einen Garten ab. Nehmt, wat ihr braucht, sagten die Treckerfahrer, Acker jibt et hier jenug.
Den ganzen Sommer war ich damit beschäftigt, Baumaterial zu besorgen. Ich genoss es, Wörter auszusprechen, von deren Existenz ich bis dahin nichts geahnt hatte: Blaukalk, Weißkalk, Brunnenringe, gespundete Bretter. Ich genoss es überhaupt, jenseits aller Gewohnheiten zu leben. Morgens lief ich im Nachthemd durch den Garten, der, außer einigen Pflanzen dicht am Haus, nur ein von Unkraut begrünter Acker war. Statt zu duschen, badeten wir im See. Jeden Tag zog ich dieselben, von Kalk und Sand verschmutzten kurzen Hosen an, nur die Hemden wechselte ich. Das einzige Telefon im Ort verwaltete der Nachbar, dessen privater Anschluss zugleich als öffentliche Telefonzelle diente. Nach jedem Sturm oder Gewitter musste er die Chaussee zum Nachbarort ablaufen, um die Leitung aus einem Baumgeäst zu befreien. Bei Gewitter setzte ich mich auf einem Schemel in die offene Haustür und sah zu, wie die Blitze aus dem unsichtbaren grollenden Himmel in die Felder schossen und der Regen tosend auf die Erde stürzte. Zwischen Himmel und Erde nichts als schwarzer Raum, keine Häuser, Bäume, Sträucher.
Ich war ein Stadtkind, und mein Verhältnis zur Natur beschränkte sich auf ihre Nutzbarkeit, ohne dass ich mir dessen bewusst gewesen wäre. Ich dachte einfach nicht darüber nach. Selbst als ich in Basekow den Gewittern zusah oder dem Sturm, der in gewaltigen Wellen das Korn peitschte, empfand ich vor allem eine tiefe Genugtuung, weil diese Macht keine Menschenmacht war, weil sie keinem Gesetz gehorchte und keiner Regierung, weil sie die Garantie war für einen größeren, der Lächerlichkeit unseres eigenen Lebens entzogenen Zusammenhang. Der Gedanke, eine Kreatur dieser undurchschaubaren, endlosen Welt zu sein, stattete mich gegenüber der Tatsache, dass ich den idiotischen Gesetzen einer ebenso idiotischen Menschenmacht unterlag, mit unbestreitbaren Rechten aus. Ob ich das damals schon so formuliert habe, weiß ich nicht, aber an die Beruhigung und eine keinem genauen Gedanken zugeordnete Gewissheit, die mich während des ersten Sommers in Basekow überkam, kann ich mich erinnern. Auf einem Foto, das Laura damals aufgenommen hat, stehe ich barfuß und in kalkbefleckter Kleidung auf der Straße vor unserem Haus. Ich breite die Arme aus, als wollte ich jemanden begrüßen oder auffangen. Das Haar hängt in nassen Strähnen um den Kopf und ins Gesicht. Später hat Laura das Bild über ihren Schreibtisch gehängt. Weil du darauf aussiehst wie ein Mädchen, sagte sie. Als sie auszog, nahm sie es nicht mit. Ich war dem Foto von mir wohl nicht mehr ähnlich.
Im September begann die Schule, und wir zogen wieder nach Berlin. Mir waren alle Schuhe zu eng geworden, weil meine Füße vom ständigen Barfußlaufen breiter geworden waren. Im Herbst fuhren wir nur noch über die Wochenenden nach Basekow. Achim pflanzte Bäume, verkümmerte Birken und Lärchen, die wir an Waldrändern aus dem Schatten größerer Bäume befreiten. Angesichts der entlaubten, vor der weiten erdfarbenen Landschaft kaum sichtbaren Bäumchen rechnete ich aus, wann sie den Dachfirst unseres Hauses erreicht haben würden, und musste an meinen Tod denken, der, gemessen an der erwünschten Baumhöhe, plötzlich sehr nahe schien. Inzwischen sind die Bäume groß, so groß und breit, dass ihre Äste ineinandergreifen, und Achim behauptet, er habe damals schon gesehen, dass sie zu wenig Abstand haben, aber ich hätte in meiner ewigen Ungeduld darauf bestanden.
In den letzten Jahren habe ich kaum noch an Irene gedacht, nicht mehr als ein flüchtiges Achja, wenn ich zufällig an ihrem Haus vorbeifuhr, ohne die Attacken des Gewissens, die mich damals, im ersten Jahr nach ihrem Tod, heimgesucht hatten. Ich wusste um meine Schuld, aber ich empfand sie nicht mehr. Erst seit zwei oder drei Wochen, seit Achim und Laura abgereist waren und auch die Gäste ausblieben, schlich sich mit dem Verschwinden des Sommers Irene wieder in meine Gedanken. Vielleicht erinnerte mich ja dieser in toskanische Sonne getauchte Herbst an unser erstes Jahr in Basekow. Vielleicht war es auch meine Erleichterung am Morgen, wenn ich, ohne nach dem Grund zu fragen, alle nackte Haut wieder verhüllen durfte, sodass kein zufälliger Blick, weder mein eigener noch der eines anderen, die in grellem Sonnenlicht schon sichtbare Gravur der Greisenhaftigkeit auf meiner Haut entdecken konnte. Vor allem aber meine Unlust, wieder in die Stadt zu übersiedeln. Ich hätte am Morgen überlegen müssen, welches Kleidungsstück sowohl dem bevorstehenden Anlass als auch meinem äußeren Befinden angemessen wäre, ich hätte, um mich zu schminken, in den Spiegel sehen und dabei feststellen müssen, dass mir schon wieder ein melierter Scheitel gewachsen war und dass ich es leid war, diesen aussichtslosen Kampf zu führen gegen die Haare, die Haut und das Fleisch. Ich duschte nicht mehr, sondern badete unter einer Decke aus Schaum, wie Irene. Ich hasste die unvermeidlichen Augenblicke meiner Nacktheit am Abend und am Morgen. Ich kannte längst das Gefühl, wenn die Blicke der Männer mich neutralisierten; ich hatte seit wenigstens sieben oder sechs Jahren nicht mehr getanzt.
Als Elli und ich vor zwanzig Jahren im Morgenlicht eines schönen Sommertages nach einer durchfeierten Nacht einander die Köpfe nach grauen Haaren absuchten wie Affen ihr Fell nach Ungeziefer und Elli erschrocken flüsterte: Mensch, Johannachen, da sind wirklich welche, damals waren wir uns einig, dass wir nicht demütig abwarten sollten, bis uns das Alter hässlich, hilflos und lächerlich macht, sondern dass wir ihm zuvorkommen müssten, indem wir uns sein Brauchbares aneigneten, solange wir noch kräftig genug waren, es zu nutzen. Verlockend am Alter war eigentlich nur, dass alte Menschen, sofern gesund und bei Verstand, unabhängig sind. Sie müssen sich nicht ständig um ihre Zukunft sorgen, weil sie nicht mehr so viel davon haben. Vor allem aber, sagte Elli, könnten alte Menschen, besonders natürlich alte Frauen, im Schutze ihrer gebrechlichen Erscheinung hundsgemeine und verbotene Dinge tun, die ihnen, meistens leider zu Recht, niemand mehr zutraut. Eigentlich, sagte Elli, müssten wir, wenn wir von unserem Alter etwas haben wollen, bald, am besten gleich damit anfangen. Wir müssten uns die Haare grau färben und lernen, uns Falten und eine fahle Haut ins Gesicht zu schminken, wir müssten uns gepunktete oder schwarze Kleider mit weißen Pikeekragen oder Smokstickerei besorgen.
Und kleine Schnürstiefelchen, sagte ich.
Schnürstiefelchen auch, sagte Elli, und Stöcke. Spazierstöcke und Krücken, die sind wichtig. Wir könnten zum Beispiel so einen Stock mit einer Abschussvorrichtung für Knallfrösche ausstatten und sie dann bei der Demonstration am Ersten Mai direkt vor der Tribüne abschießen.
Wir könnten auch einen Nagel in die Spitze schlagen und damit in der U-Bahn unsympathische Leute piken, sagte ich, oder nachts Parolen an die Häuserwände malen, Reise- und Gedankenfreiheit für alle! oder so was, und dann schnell wegrennen.
Für solche Albernheiten lohnt es sich nicht, alt zu werden, sagte Elli.