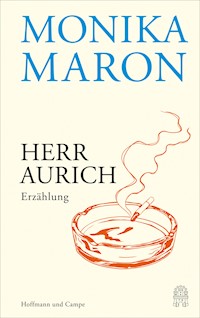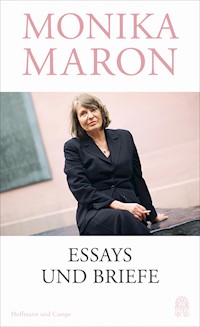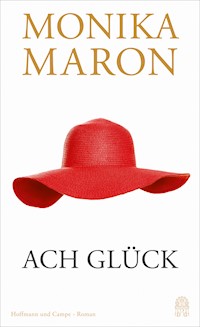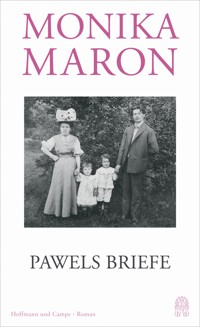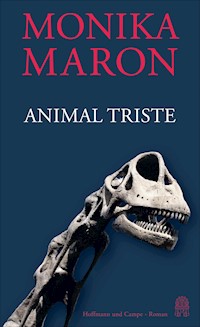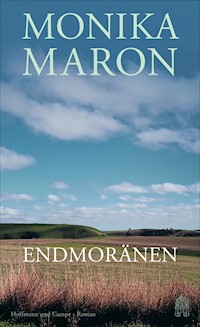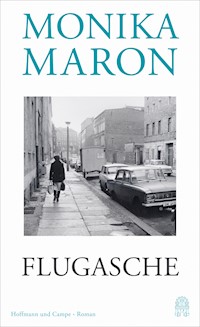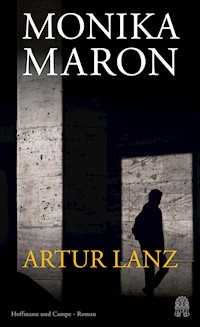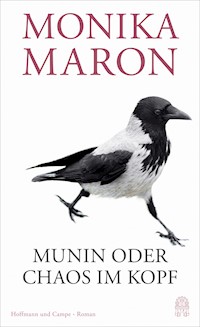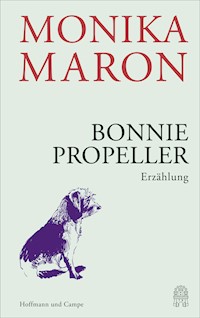10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Muss der Handelnde schuldig werden, immer und immer wieder? Die DDR, Mitte der achtziger Jahre: Nachdem die 42-jährige Historikerin Rosalind Pokowski beschlossen hat, ihre intellektuellen Fähigkeiten nur noch für die eigenen Interessen und nicht mehr im beruflichen Kontext zu benutzen, kommt ihr Herbert Beerenbaum gerade recht: Der ehemalige einflussreiche Funktionär bietet ihr an, seine gelähmte rechte Hand zu ersetzen und seine Memoiren aufzuschreiben. Wenngleich sich Rosalind fest vornimmt für diese Arbeit nur ihre Hand, nicht aber ihren Kopf einzusetzen, wird sie unentrinnbar in Beerenbaums Leben hineingezogen – und bekommt eine Ahnung von den eigenen Abgründen und davon, wie Menschen zu Tätern werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Monika Maron
Stille Zeile Sechs
Roman
Hoffmann und Campe
für Jonas
Beerenbaum wurde auf dem Pankower Friedhof beigesetzt, in jenem Teil, der Ehrenhain genannt wurde und in dessen Erde begraben zu werden der Asche so bedeutender Personen wie Beerenbaum vorbehalten war. Ich entschloss mich, trotz der Kälte nicht mit dem Bus zu fahren, sondern die zwei, höchstens drei Kilometer, die zwischen meiner Wohnung und Beerenbaums künftigem Grab lagen, zu Fuß zu gehen. Ich nahm die Blumen, die ich gekauft hatte, aus dem Wasser – ein dürres Sträußchen Freesien, andere hatte ich nicht auftreiben können –, trocknete ihre Stiele ab und wickelte sie zum Schutz gegen den Frost in mehrere Lagen Zeitungspapier. Ich mag Freesien, ob Beerenbaum sie gemocht hat, weiß ich nicht. Ich entschied mich für den Weg, der mich bis auf zwanzig Meter an Beerenbaums Haus vorbeiführte, ein kleiner Umweg, aber eben der Weg, den ich im letzten halben Jahr zweimal in der Woche gegangen war.
Das Haus, in dem Beerenbaum gewohnt hatte, stand in einem Pankower Villenviertel, vom Volk »Städtchen« genannt, was liebevoller klang, als es gemeint war. In dem Rondell, von dem einige kleine Straßen und Wege abzweigten, hatte bis zum Ende der fünfziger Jahre, hinter Zäunen und Barrieren, beschützt von Armee und Polizei, die Regierung gewohnt, bis sie, aus Gründen, über die viel gemunkelt wurde, hinter die Stadtgrenze von Berlin gezogen war. Nur einige Witwen ehemaliger Regierungsmitglieder und einstmals mächtige Männer wie Beerenbaum waren hier, gleich neben dem Niederschönhausener Schloss, wohnen geblieben. An manchen Häusern verwiesen Tafeln auf ihre früheren, inzwischen verstorbenen Bewohner: den ersten Präsidenten des Staates, den ersten Ministerpräsidenten, den ersten Kulturminister. Das Haus des Ersten Generalsekretärs hatte man nach dessen Tod, obwohl es sich in gutem Zustand befand, bis auf das Fundament abgetragen und an seiner Stelle ein neues, keineswegs schöneres gebaut, was ebenfalls Anlass zu Gerüchten bot. Unter anderem wurde erzählt, es seien mit der Zeit so viele Abhöreinrichtungen in das Gemäuer eingebaut worden, dass niemand sie sicher zu entfernen vermocht habe und das Haus deshalb für jeden neuen Mieter unzumutbar geworden sei. Die meisten der großen Häuser im »Städtchen« hatte man als Gästehäuser der Regierung eingerichtet, die kleineren Häuser wurden von den Hausmeistern bewohnt, die die großen Häuser instand zu halten hatten.
An manchen Tagen ging ich, seit das »Städtchen« für die Öffentlichkeit zugänglich war, dort spazieren. Eine jenseitige Stille lagerte zwischen den Villen, deren ständigen oder wechselnden Bewohnern eine amtliche Regelung die Belästigung durch den städtischen Autoverkehr ersparte. Aber nicht nur die Stille war es, die mich anzog. Eine irritierende Unwirklichkeit ging aus von den alten und neuen Häusern, von den sterilen, gleichförmigen Blumenrabatten in den Vorgärten, von den nackten Fahnenmasten neben den Eingangstüren. Die wenigen Spaziergänger sprachen mit gedämpften Stimmen. Die Bewohner blieben unsichtbar, nur selten traf man einen, der mit dem Auto gerade aus der Garage fuhr oder nach Hause kam; niemals sah man in den Gärten ein spielendes Kind. Wer hier wohnte, blieb für den Außenstehenden namenlos; die Namen der Toten auf den Bronzetafeln waren die einzigen, die an den Häusern zu finden waren. Nur ein paar satte, zutrauliche Katzen suchten hin und wieder die Bekanntschaft eines flanierenden Fremdlings. Auf einem der Steinsockel zwischen den Zäunen erwarteten sie ihn gelassen oder gelangweilt, ließen sich von ihm streicheln oder begleiteten ihn sogar ein Stück seines Weges. Ein Ort, öde wie eine Goldgräberstadt, deren Schätze nun erschöpft waren. Nur klapperte hier nirgends eine Tür oder ein Fensterflügel im Wind. Wie von Geisterhand wurde Ordnung gehalten, als wären die, die fort waren, noch da.
Als ich die Stille Zeile überquerte, sah ich vor Beerenbaums Haus zwei Autos stehen, ein großes schwarzes, dessen Schofför neben dem Wagen stand und eine Zigarette rauchte, und das karmesinrote, das Beerenbaums Sohn gehörte. Michael Beerenbaum mit dem blassen asketischen Gesicht, in dem mich immer die grauen Augen beunruhigten, mit denen er seine Gesprächspartner gerade und niemals aus den Augenwinkeln ansah und die mich jedes Mal, wenn er seinen unbewegten Blick auf mich richtete, an blinde oder künstliche Augen denken ließen. Ich hatte ihn nicht öfter als vier- oder fünfmal bei Beerenbaum getroffen und wusste nicht viel mehr über ihn, als dass er ein hoher Offizier der Armee war, dass er von seinem Vater Mischa genannt wurde und dass er selbst einen ihm sehr ähnlichen, schweigsamen Sohn hatte, der Stefan hieß. Ich hatte Michael Beerenbaum nie in Uniform gesehen und hätte ihn, wäre er mir auf der Straße begegnet, eher für einen Pathologen oder für einen Pfarrer gehalten als für einen Militär.
Ich ging langsam weiter, den Kopf nach rechts gewandt, wo Beerenbaums Haus stand, das nun nicht mehr sein Haus war, Stille Zeile Nummer sechs. Ich fühlte nichts. Ich konnte denken, dass Beerenbaums Tod mich erleichterte; dass eine einfache und lebendige Gerechtigkeit lag in seinem Sterben und meinem Überleben, das konnte ich denken und nicht fühlen. Ich fror an den Händen, weil ich meine Handschuhe vergessen hatte und weil die Stiele der Freesien doch noch feucht waren. Vielleicht hat er Freesien gar nicht gemocht. Er hat Rosen gezüchtet. Alle alten Männer züchten Rosen, wenn sie einen Garten haben. Warum, dachte ich, warum züchten und warum Rosen.
Den Rosenzüchter Beerenbaum hatte ich im Café kennengelernt, wo ich an warmen Tagen oft auf der Terrasse saß, am liebsten während der späten Nachmittagsstunden, wenn die Leute von den Bussen und Straßenbahnen aus den Büros und Fabriken zurückgebracht wurden. Das Café lag in der Nähe mehrerer Haltestellen, und die Wege vieler Heimkehrer führten direkt über den Streifen Pflaster vor der Terrasse. Einige von ihnen waren mir im Laufe der Jahre so vertraut geworden, dass ich sie schon aus der Ferne an ihrem Gang oder an der Art ihrer Kleidung erkannte. In jedem Frühling suchte ich neugierig nach Veränderungen, die sich an meinen heimlichen Bekannten entdecken ließen: Frauen waren inzwischen schwanger, andere promenierten am Arm eines neuen Mannes; Familien hatten sich über den Winter Hunde angeschafft. Manche Leute sah ich nie wieder, sie waren umgezogen oder gestorben, vielleicht im Gefängnis.
Auch Beerenbaum hatte ich schon einige Male gesehen, ohne zu wissen, wer er war. Er war mir wegen seines kurzen, aus den Kniegelenken geworfenen und auf der ganzen Sohle landenden Schritts aufgefallen, eine Art der Fortbewegung, die ich häufig an alten Männern beobachtet habe, von denen ich annahm, dass sie es aus ihren jüngeren Jahren gewohnt waren, sicher und, wie meine Mutter sagen würde, forsch aufzutreten; Männer, die anderer Menschen Chefs gewesen waren, Chefärzte oder Chefkassierer oder Chefingenieure, Chefs überhaupt, die von ihren Untergebenen oder selbst von ihren Familien auch so genannt worden waren. Männer, die es sich auch im Alter, wenn das Gehen ihnen bereits schwerfiel, versagten, mit den Füßen über das Pflaster zu schlurfen, sondern sie mit der letzten Kraft ihrer steifen Knochen aus den Kniegelenken anhoben, um sie ein paar Zentimeter weiter wieder auf die Erde fallen zu lassen.
Mit diesem, zu Mutmaßungen über seine Vergangenheit anregenden Schritt näherte sich Beerenbaum, eine Zeitung unter dem Arm, langsam dem Café, als ich im Spätsommer des vergangenen Jahres dort saß, einen Tee mit Zitrone trank und unkonzentriert in einem Buch las. Im Eingang blieb er stehen, schaute sich um und kam dann, obwohl in der rechten Ecke ein Tisch frei war, zu mir und fragte, ob er sich setzen dürfe. Ich hatte einige Male zuvor beobachtet, wie er das Gespräch mit Fremden gesucht hatte. Offensichtlich ging er nur in das Café, um sich mit Fremden zu unterhalten, wobei mir aufgefallen war, dass er seine zumeist jugendlichen Gesprächspartner innerhalb weniger Minuten in Zuhörer verwandelte, die mit dem hilflosen Lächeln von Übertölpelten seinen eindringlichen, von heftigen Gesten begleiteten Reden folgten.
Ich war gespannt, auf welche Weise er versuchen würde, die Unterhaltung mit mir zu eröffnen, und widmete mich, um ihm die Aufgabe zu erschweren, demonstrativ meiner Lektüre, bewegte die Augäpfel, als ließe ich sie den Zeilen folgen, blätterte hin und wieder eine Seite um, ohne mehr wahrzunehmen als das Geflimmer der Buchstaben. Alle meine Sinne, außer den Augen, richtete ich auf den Mann neben mir, der mich fest in seinem Blick hielt, um mich, sobald ich die Augen von der Buchseite lösen würde, damit zu packen.
Er bestellte beim Kellner ein Stück gedeckte Apfeltorte mit Schlagsahne, seine Zeitung lag ungeöffnet auf dem Tisch. Je länger das Schweigen zwischen uns dauerte, umso drängender fühlte ich mich von ihm befragt, warum ich ihm das Gespräch verweigerte, bis ich schließlich selbst nicht mehr wusste, weshalb ich es dem alten Mann so schwer machte, obwohl ich doch neugierig auf ihn war. Ich fand ihn nicht sympathisch mit seinen scharfen, abwärts zeigenden Mundwinkeln, durch die seine Lippen wie durch Kommata begrenzt wurden, mit den borstigen Brauen über den Augen, deren Ausdruck mir immer gleich, unbeeindruckbar, erschienen war, sooft ich den Mann gesehen hatte.
Dem Umstand, dass der Mann mir nicht gefiel, maß ich wenig Bedeutung bei. Alte Männer waren mir fast immer unsympathisch, und von den wenigen liebenswürdigen, die ich in meinem Leben getroffen hatte, erinnerte ich jeden einzelnen. Meine Abneigung wurde durch bestimmte optische und akustische Signale aktiviert, zu denen dieser tappende, auf ehemalige Bedeutung verweisende Gang gehörte, eine lärmende Jovialität im Umgang mit dienenden Berufsgruppen wie Verkäuferinnen oder Kellnern, denen, wie dem Hofhund ein Knochen, mit falscher Stimme ein peinlicher Witz zugeworfen wurde, über die eigene Ehefrau und das viele Geld, das sie in ihrer Verschwendungssucht ihn, den nun schon wieder gutlaunig Zahlenden, ein Leben lang gekostet habe; die lässige Vertraulichkeit, zu der die Stimme sich neigte, wenn sie »Stimmt so« sagte und ihr Besitzer, den Blick schon abgewandt, einen größeren Geldschein an die Tischkante schob. Mein Widerwille gegen solche und ähnliche Symptome männlichen Alters steigerte sich zur Feindseligkeit, wenn mein Ohr von einem bestimmten knarrigen und nörgelnden Ton getroffen wurde, einem Ton, in dem sich das uneinsichtige Quengeln eines Kindes mit rechthaberischer Gereiztheit mischte. Unbezähmbare Hassgefühle konnte ein solcher Ton in mir auslösen. Selbst wenn sein Verursacher mir fremd war und der Ton nicht mir galt, musste ich mich beherrschen, um ihn nicht in kindischer Manier nachzuäffen. Einmal war es mir trotzdem passiert. In einer vollen Straßenbahn zeterte ein alter Mann mit seiner alten Frau, die er für die strapaziöse Fahrt verantwortlich machte. Unablässig schimpfte er mit seiner knarrigen gepressten Stimme vor sich hin, während die Frau stumm neben ihm stand und unter den niedergeschlagenen Lidern hervor mit hastigen kleinen Blicken nach links und rechts prüfte, ob die Mitfahrenden das Gezänk verfolgten. Der Mann wiederholte immerfort die gleichen Sätze, zwischen denen er gerade so viel Zeit ließ, dass die Frau ihre Widerrede hätte führen können, wären die beiden zu Hause in ihrer Küche gewesen und hätte der Frau die Peinlichkeit nicht den Mund verschlossen. Aber der Mann schien zu wissen, was die Frau ihm unter anderen Bedingungen geantwortet hätte, und so nahm er den verschwiegenen Widerspruch für gesprochen, wodurch er seine Wut ständig aufs Neue belebte.
Ich stand hinter dem Mann und spürte deutlich, wie sein vor Wut vibrierender Körper die Luft zwischen uns in Schwingungen versetzte, die zuerst meine Haut, dann mein Fleisch durchdrangen, bis sie mein Herz erreichten, das in plötzlicher Empörung die Anzahl seiner Schläge verdoppelte, das Blut aufschäumte und durch die Adern jagte, sodass ich hören konnte, wie es hinter meinem Trommelfell brodelte. Und wie die fremde Wut in mich eingedrungen war, drängte sie nun als die fremde quengelige Stimme des Mannes aus mir hinaus. Hab’s doch gleich gewusst, hab’s doch gleich gewusst, wiederholte ich papageienhaft seinen letzten Satz, erschrak über die eigene fremde Stimme und versteckte, als der Mann und die Frau sich ungläubig nach mir umsahen, die eben gesprochenen Worte hinter einem krächzenden Husten.
Der Kellner brachte die Apfeltorte und den Kaffee. Ich zündete mir eine Zigarette an, wobei ich scheinbar zufällig dem Alten meine Augen freigab. Wie ich erwartet hatte, genügte ihm dieser flüchtige Blick, um mich am Weiterlesen zu hindern.
Er erkundigte sich, ob das Buch, das ich gerade las, interessant sei, und als ich die Frage verneinte, wollte er wissen, warum ich mich ihm dann so aufmerksam widmete. Ich sagte, ich möge diesen Autor nicht, und so entschädige mich die Feststellung, dass dem Mann wieder einmal etwas misslungen war, für den ausbleibenden ästhetischen Genuss.
Ohne dass ich an seiner Miene erkennen konnte, ob er meine Einschätzung des Autors teilte, begann er genüsslich seine Apfeltorte zu verspeisen, wobei mir auffiel, dass er dafür nur seine linke Hand benutzte, während er den rechten Arm gerade herabhängen ließ, sodass die Hand vom Tischtuch verborgen wurde.
Ob ich beruflich mit Literatur zu tun habe, fragte er.
Nein, sagte ich.
Ob er fragen dürfe, womit ich denn beruflich zu tun habe.
Er dürfe fragen, sagte ich, und ich wolle ihm auch antworten, nur werde ihm meine Antwort wenig Aufschluss geben. Ich hätte in diesem Sinne keinen Beruf mehr, sondern lebte von Schreibarbeiten und anderen Dienstleistungen, die ich ausführen könnte, ohne von meinem Kopf eine spezielle Denkarbeit zu verlangen. Das schien ihn zu interessieren. Oder es weckte sein Misstrauen. Er schluckte an seiner Apfeltorte und beobachtete mich dabei. Ich erwartete, dass er mich etwas fragen würde, und da er schwieg, begann ich, ohne es wirklich zu wollen, zu erklären, was es mit meinem Vorsatz auf sich hatte. Bestimmte Ereignisse in meinem Leben, sagte ich, haben mich davon überzeugt, dass es eine Schande ist, für Geld zu denken, und in einem höheren Sinne ist es sogar verboten.
Vor einem halben Jahr war mir tatsächlich über Nacht eine Erkenntnis aufgegangen und stand am Morgen unübersehbar wie die Sonne am Himmel meiner banalen Existenz, sodass ich mich fragte, wo sie sich vorher hatte verstecken können; die Einsicht, dass ich mein einziges Leben tagtäglich in die Barabassche Forschungsstätte trug wie den Küchenabfall zur Mülltonne. Am Abend hatte ich eine der Katzen getroffen, die in dem Gartengeviert unseres Häuserblocks lebten, sechs oder sieben schwarz-weiß gefleckte Katzen, deren Verwahrlosung in dem Maße zunahm, wie die schwarzen Flecken in ihrem Gesicht eine Maske des Bösen assoziierten. Eine von ihnen trug den Fleck über einem Auge und sah aus wie ein Straßenräuber. Sie war mager und scheu, ihr Fell gelb verstaubt von der Asche in den Mülltonnen, wo sie ihr Futter suchte. Eine andere hatte schwarze Flecke um beide Augen und erinnerte an einen Pandabären. Sie war der Liebling der Straße und verbrachte die meiste Zeit vor dem offenen Küchenfenster der Eckkneipe, durch das der Koch ihr ab und zu ein Stück Fleisch oder Fisch zuwarf. Der pandabärähnlichen Katze begegnete ich auf dem Heimweg von der Barabasschen Forschungsstätte. Die Kneipe hatte Ruhetag, und die Katze, offenbar hungrig, folgte mir bis in meine Wohnung. Ich schnitt ein Paar Würstchen in kleine Stücke, goss Milch in eine Schale und stellte ihr beides in die Küche. Sie fraß ruhig, trank die Milch, strich mir zum Zeichen des Dankes einige Male um die Füße und setzte sich dann vor die Wohnungstür, den Blick unverwandt auf die Klinke gerichtet, bis ich ihr die Tür öffnete.
Die Würstchen hätten mein Abendessen sein sollen. Im Kühlschrank lagen nur noch zwei Zitronen und ein Zipfel Leberwurst. Das Brot war verschimmelt, und die Geschäfte hatten geschlossen. Ich fand einen Brühwürfel und Fadennudeln, woraus ich mir eine Suppe rührte. Eher aus leichtfertiger Gewohnheit als ernsthaft dachte ich, man müsste eine Katze sein. Beim Suppekochen so dahingedacht: eine Katze sein, statt dieses Hundeleben zu führen, irgendwo seine Nahrung holen, sich höflich bedanken und dann zu seinesgleichen ziehen und tun, wozu man Lust hat. Ich sah aus dem Küchenfenster. Sechs schwarz-weiße Katzen saßen im Kreis auf dem Rasen und sahen einander an. Darin schien Sinn für sie zu liegen.
Sie saßen da für nichts. Wenn ich in meinem acht Quadratmeter großen Zimmer in der Barabasschen Forschungsstätte saß und mir einredete, ich interessierte mich für die zweite Parteikonferenz der sächsischen Kommunisten im Jahr 1919, saß ich da für Geld. Die Parteikonferenz hatte mich zu interessieren für Geld, das ich für Würstchen ausgab, die ich an Katzen verfütterte, damit diese am Abend auf dem Rasen sitzen konnten für nichts als für das Dasitzen, während ich allein hinter dem Küchenfenster saß, die salzige Brühe löffelte und morgen früh, pünktlich fünf Minuten nach sieben, wieder das Haus verlassen würde, um von sieben Uhr fünfundvierzig bis siebzehn Uhr in der Barabasschen Forschungsstätte unter der Bewachung von Barabas und seinen Knechten nachzudenken für Geld. Was ich anfangs nur achtlos und missmutig vor mich hin gedacht hatte – man müsste eine Katze sein –, erwies sich, sobald ich mich dem Sog dieser Vorstellung überließ, als eine Wahrheit von empörender Absurdität. Jeden Tag sperrte ich mich freiwillig in einen Raum, der seiner Größe nach eher eine Gefängniszelle war und den man mir ebenso zugeteilt hatte wie das Sachgebiet, dem ich acht Stunden am Tag meine Hirntätigkeit widmen musste. Sie, Kollegin Polkowski, haben wir für die Entwicklung der proletarischen Bewegungen in Sachsen und Thüringen vorgesehen, hatte Barabas gesagt, als ich ihm vor fünfzehn Jahren zum ersten Mal an seinem Schreibtisch gegenübersaß. So war es: Nicht mir wurde das Sachgebiet zugeteilt, sondern ich dem Sachgebiet und auch dem Zimmer. Stürbe ich, würde es das Sachgebiet und das Zimmer immer noch geben, so wie es sie vor mir gegeben hatte; ein anderer würde ihnen zugeteilt werden, der, wie ich, die einzige Fähigkeit, die ihn von einer Katze unterschied, die Gabe des abstrakten Denkens, an einem kleinen Sachgebiet verschleißen würde, um von dem Geld, das er dafür bekäme, sein kreatürliches, von einem Katzendasein wenig unterschiedenes Überleben zu sichern.
Wenn ich nicht zu jenen gehören durfte, denen es der Herr im Schlafe gab, wollte ich, was mich von diesen unterschied, wenigstens für mich behalten. Wie kam ich, ein frei geborener Mensch, dazu, mich ein Leben lang ausgerechnet Barabas zu unterwerfen, einem gewöhnlichen, grau melierten Familienvater, den nur sein unentwickelter Widerspruchsgeist, verbunden mit despotischer Pedanterie, zur Beförderung empfohlen hatte. Ich sah mir gleichzeitig zwei Filme im Fernsehen an, einen Western und einen Serienkrimi im gerechten Wechsel, und immer wieder, besonders, wenn ein Tier durchs Bild lief, dachte ich an die Katze und daran, welche Vorteile ihr Leben im Vergleich zu meinem bot. Alles sprach für die Katze.
Die Nacht umgab mich wie ein schalldichter Bunker. Niemand würde mich ansprechen wollen bis zum Morgen, und niemand würde sich ansprechen lassen. Auf mich warteten mein Zimmer und mein Sachgebiet im Dunkel der Barabasschen Forschungsstätte. Nichts an meinem Leben erschien mir noch vernünftig.
Am Morgen stand ich nicht auf. Ich blieb liegen, sah zu, wie die Sonne über unserer Straße aufstieg und sich durch das Laub der Bäume vor meinem Fenster drängte, bis auf mein Kissen. Ich schob meinen Kopf in den Sonnenfleck und schloss die Augen. Ich sah mein Blut in meinen Augenlidern, so rot wie Katzenblut. Langsam, wie zufällig, ordnete sich ein Satz in meinem Kopf: Ich werde nicht mehr für Geld denken. Den Rest des Tages verbrachte ich im Bett.
Der alte Mann verschloss sich den Mund mit einem Stück Apfeltorte, was mich verwunderte, da ich ihn ja nur als den Redenden, nie als den Zuhörenden erlebt hatte. Ich ärgerte mich, weil ich meine überlegene Position so schnell verloren hatte, obwohl ich die Gefahr kannte, die von alten Männern wie diesem für mich ausging. Ich lieferte ihnen ab, was sie von mir erwarteten, ehe sie Zeit gehabt hätten, es von mir zu verlangen. Das war einer der Gründe, vielleicht der wichtigste, warum ich sie verabscheute. Er lehnte sich zurück und schloss die Lider, als wollte er sich sonnen. Es war die Haltung, in der er nachdachte, das wusste ich erst später. Ich griff nach meinem Buch.
Warten Sie, sagte er und wandte sich mir wieder zu, ich habe schon mit vielen jungen Leuten gesprochen, aber etwas so Abartiges hat mir noch niemand erzählt.
Ich bin nicht jung, sagte ich.
Mag sein, sagte er, aber im Verhältnis zu mir sind Sie jung.
Das stimmte, und angesichts seines Alters, fand ich, hätte er meine uneitle Selbsteinschätzung entschiedener zurückweisen können.
Sie denken also nicht für Geld, aber Sie denken. Und davor haben Sie Ihr Geld durch Denken verdient, fragte er und konnte, obwohl er sich um Beiläufigkeit in der Stimme bemühte, nicht verbergen, dass er plötzlich gezielt fragte.
Ich nickte, und ehe er weitersprechen konnte, fragte ich ihn, womit er sein Geld verdient habe. Oder noch verdiene, fügte ich aus Höflichkeit hinzu.
Seit vierzig Jahren nur durch seine Arbeit, sagte er und begleitete die letzten beiden Worte durch mehrmaliges starkes Klopfen gegen seinen Stirnknochen.
Ich traute meiner Fähigkeit, in den Gesichtszügen und Gesten der Menschen zu lesen, einiges zu. Bezüglich dieses Mannes hegte ich seit langem einen Verdacht, zunächst nur genährt durch seinen auffälligen Gang und seine Sucht, auf junge Leute einzureden. Seine Hände – ich setzte voraus, dass die rechte der sichtbaren linken nicht unähnlich war – bestärkten mich in meiner Vermutung: große, ausgeprägte Hände, die annehmen ließen, sie hätten schon in ihrer Wachstumsphase Steine greifen und Axthiebe austeilen müssen, denen nun aber schon lange keine grobe Verrichtung mehr zugemutet wurde, sodass ihre kräftige Anatomie zu der zarten, wenn auch welken Haut einen auffälligen, meine Phantasie provozierenden Kontrast bildeten. Vor allem inspirierte mich sein Gesicht, ein mir vertrauter und ebenso verdächtiger Ausdruck darin, der, wollte man dem Träger des Gesichts wohl, als stolz, selbstbewusst und willensstark gelten konnte, anderenfalls als anmaßend und borniert. Dazu eine Müdigkeit zwischen Augen und Kinn, die weniger vom Alter gezeichnet schien als von Ekel und Abwehr.
Männer mit diesem Ausdruck im Gesicht waren mir in jeder meiner Lebensphasen begegnet. Es war auch das letzte Gesicht meines Vaters. Ich war mir meiner Sache fast sicher. Zudem trieb es mich, den Alten durch mein heimliches Wissen um ihn zu verunsichern und ihm so die Vormacht in unserem Gespräch, die ihm, begünstigt durch meine Verhaltensstörung gegenüber alten Männern, kampflos zugefallen war, wieder streitig zu machen. Darf ich Ihre Biographie raten, fragte ich. Er tat erstaunt. Aber bitte, wenn Sie sich das zutrauen.
Aus kleinen Verhältnissen, sagte ich, wahrscheinlich Kind eines Arbeiters, Mutter Hausfrau. Volksschule. Erlernter Beruf Dreher oder Maurer, vielleicht Zimmermann. Mit achtzehn oder neunzehn in die Kommunistische Partei eingetreten. Nach 33 Emigration oder KZ. Nein, KZ nicht, dachte ich, seinem Gesicht fehlte die endgültige Irritation, die ich an anderen Überlebenden gefunden hatte. Wahrscheinlich Emigration, sagte ich. Er schien mir nicht zu denen zu gehören, die sich in Frankreich oder Amerika durchgeschlagen hatten, die sahen anders aus. Entweder hatten sie schon vorher anders ausgesehen oder infolge ihres Aufenthalts. Den Mann an meinem Tisch siedelte ich in Moskau an, vielleicht sogar in dem berüchtigten Hotel Lux, der Moskauer Herberge für Kommunisten aus aller Welt und für viele von ihnen die Todesfalle. Emigration in die Sowjetunion, sagte ich, zeitweilig untergebracht im Hotel Lux. 1945 Rückkehr. Danach wichtige Funktionen, wo immer die Partei Sie brauchte.
Als ich das Hotel Lux erwähnte, lächelte er, als hätte er mich bei einer Mogelei ertappt. Sie wissen, wer ich bin, sagte er eitel oder enttäuscht. Ich beteuerte, nicht mehr über ihn zu wissen, als er selbst durch seine Erscheinung mitteilte, konnte aber, da er an so viel Hellsichtigkeit nicht glauben wollte, seine Zweifel nicht tilgen. Übrigens hätte ich mich in einem Punkt geirrt, sagte er, nicht mit achtzehn oder neunzehn sei er Kommunist geworden, sondern mit siebzehn.