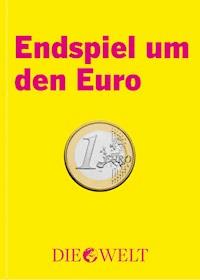
Endspiel um den Euro E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zwischen Eurostaat und Exit: Szenarien für die weitere Entwicklung der Währungszone. Wie Sie Ihr Geld am besten anlegen und vor einem Euro-Crash sichern. Nach Griechenland droht nun auch in Spanien der Finanz-Kollaps. Weltweit ziehen Anleger ihre Gelder aus der Eurozone ab. Bis auf Deutschland gilt kaum ein Land mehr als sicher. Doch auch hierzulande mehren sich die Krisenzeichen. Mit einem Geheimplan wollen die europäischen Regierungschefs nun den Befreiungsschlag wagen. Doch was taugt er wirklich? Erfahrene Wirtschaftsreporter aus der "WELT"-Redaktion beschreiben den Masterplan und bewerten ihn. Sie zeigen Szenarien für einen Austritts Griechenlands aus dem Euro auf und analysieren die Risiken für den deutschen Steuerzahler. Sie geben Tipps, wie Sie Ihr Geld am besten anlegen und vor einem Euro-Crash sichern. Und sie haben die besten Experten befragt, wie es nun weitergeht: Interviews mit Bundesbankchef Jens Weidmann, seinem Vorgänger Helmut Schlesinger und dem Chef des Institutes für Wirtschaftsforschung, Michael Hüther, runden das Ebook ab. Und als Bonus erklärt Ihnen Finanzminister Wolfgang Schäuble beim Mittagessen mit dem Herbert Seckler, dem Wirt der Kult-Kneipe "Sansibar" auf Sylt, warum es doch noch ein gutes Ende mit der Euro-Krise nehmen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Endspiel um den Euro
Zwischen Eurostaat und Exit: Szenarien für die weitere Entwicklung der Währungszone. Wie Sie Ihr Geld am besten anlegen und vor einem Euro-Crash sichern
WELT GRUPPE, Axel Springer AG
published by: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
© Axel Springer AG 2012. Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-8442-2382-8
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Geheimplan für ein neues Europa
Der Masterplan …
und was er taugt
Kapitel 2
Was kommt, falls Griechenland geht: Wie der Austritt ablaufen könnte
Grexit – Geheimoperation am Freitag
Drei Szenarien für Europa nach dem Griechen-Austritt
Was uns Athens Euro-Aus kosten wird
Bleibt Deutschland auf den Griechen-Schulden sitzen?
Kapitel 3
Wie Sie Ihr Geld am besten anlegen und vor einem Euro-Crash sichern
Zinsen, Dispo, Sparkonto und Lebensversicherungen
Gewappnet für den Fall der Fälle: Wie sich Urlauber und Sparer absichern
Kapitel 4
Vier entscheidende Fragen:
Bekommt Europa einen Wachstumspakt?
Kommen jetzt Euro-Bonds?
Verändert die EZB ihr Mandat?
Droht Frankreich der Abstieg?
Kapitel 5
Was die Experten empfehlen
Bundesbankchef Jens Weidmann über die Inflation, ob er noch gut schläft und ob seine Tochter in drei Jahren ihre Abiturfahrt noch mit dem Euro bezahlen wird
Ex-Bundesbankchef Helmut Schlesinger über die Sehnsucht nach der D-Mark und wie er sein Geld schützt
IW-Chef Michael Hüther über Teufelszeug im Kampf gegen die Euro-Krise und warum gezielte Hilfe für Spanien so nötig ist
Und als Bonus:
Finanzminister Wolfgang Schäuble erklärt dem Sylter Sansibar-Wirt Herbert Seckler beim Mittagessen, warum es mit der Euro-Schuldenkrise ein gutes Ende nehmen wird
Kapitel 1 - Geheimplan für ein neues Europa
Im Auftrag der Regierungschefs entwickeln die Spitzen der europäischen Institutionen hinter den Kulissen einen Masterplan für ein stabileres Europa. Der Preis könnte eine Spaltung der EU sein
Eine erste Andeutung wagte Angela Merkel schon. "Es ist natürlich möglich, darüber nachzudenken, wie wir uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickeln", sagte die Bundeskanzlerin Anfang Juni 2012 mit Blick auf Europa. "Wenn wir uns unentwegt Denkverbote auferlegen, wird das nicht klappen." Das war ein Testballon. Er stieg unbemerkt auf. Noch ahnt kaum jemand, dass Merkels Worten schon bald sehr weitreichende Beschlüsse folgen könnten.
Nach den zwei Horrorwochen Ende Mai steht für die Regierungschefs und das EU-Spitzenpersonal fest, dass man allein mit kurzfristiger Krisenbekämpfung nicht weiterkommt. Der Euro stürzte tagelang ab, notierte Ende Mai 2012 zwischenzeitlich nur knapp über 1,23 Dollar, so niedrig wie seit zwei Jahren nicht. Gleichzeitig klettern die Risikoaufschläge für die Staatsanleihen von Spanien und Italien auf Rekordwerte. Die Krise ist mit voller Wucht zurück.
Ein "Weiter so" kann es bei der Euro-Rettung nicht geben. Nun soll eine deutliche Reaktion folgen. Nach Recherchen der "Welt am Sonntag" wollen die Regierungschefs schon auf dem EU-Gipfel Ende Juni über einen Masterplan für Europa beraten.
Es geht dabei nicht um akute Krisenbewältigung. Eine Vision für den Kontinent soll es sein, vor allem aber für die gebeutelte Euro-Zone. "Überall auf der Welt, in Amerika oder Asien, werden wir gefragt: Wo wollt ihr eigentlich hin?", sagt ein hoher EU-Vertreter. "Darauf müssen wir nach zwei Jahren Krise endlich eine Antwort liefern." Er erwartet für das Treffen in vier Wochen "einen großen Wurf". Das sieht auch ein Vertreter der Währungsunion so: "In der Euro-Zone besteht Einhelligkeit darüber, dass es weitere integrative Schritte geben muss." Und ein Notenbanker wird staatstragend: "Wir müssen das Fenster aufstoßen zu der Frage, was die Bürger von Europa wollen."
Auf ihrem informellen Treffen am 23. Mai hatten die Staats- und Regierungschefs einen Arbeitsauftrag erteilt an EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy, Kommissionschef José Manuel Barroso, an den Eurogruppen-Vorsitzenden Jean-Claude Juncker und den Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi. Die vier sollen einen Fahrplan entwerfen, wie "die EU auf eine neue Ebene" gehoben werden kann. "Drei bis vier Unterredungen" habe diese Präsidentenrunde in den kommenden Wochen geplant, die Institutionen stünden in engem Kontakt.
Van Rompuy wird Eckpunkte des Plans beim Gipfel Ende Juni präsentieren. Sie sollen in die Schlusserklärung aufgenommen werden. Bis spätestens Ende des Jahres sollen die Staats- und Regierungschefs diese Roadmap dann offiziell und schwarz auf weiß beschließen. Es könnte ein revolutionäres Schriftstück werden.
Van Rompuy, Barroso, Juncker und Draghi arbeiten an Vorschlägen für vier Felder: Strukturreformen, eine Bankenunion, eine Fiskalunion und eine politische Union. Bisher läuft die Arbeit an dem Masterplan nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit. Dabei haben es die Vorschläge, die in den Hinterzimmern der EU-Institutionen zusammengetragen werden, in sich. Am Ende entstünde ein ganz neues Europa - wenn sich die 27 EU-Länder einigen können.
Weil das schwer vorherzusagen ist, operieren die Beteiligten noch im Geheimen: Sie haben wenig Interesse daran, dass ihre Arbeit bekannt wird, "weil der Prozess sehr schwierig ist". Zunächst müssen sich die vier Institutionen auf einen gemeinsamen Bericht einigen, der anschließend noch die Zustimmung der Regierungschefs finden muss. Schon wird gewarnt. Man dürfe "keine unrealistischen Erwartungen wecken", heißt es in Berlin. Es wird betont, dass es beim Gipfel Ende Juni zunächst um einen Fahrplan für die nächsten Schritte gehe, die in den Folgemonaten abgearbeitet werden müssten. Schließlich gehe es um weitreichende Änderungen, die man nicht auf einem einzigen Gipfel abschließend beraten und beschließen könne.
Daher ist es auch möglich, dass viele Vorschläge im Laufe des Prozesses wieder entschärft werden. Bisher allerdings sind die vier EU-Lenker wild entschlossen, eine weitreichende Roadmap zu erarbeiten. Am harmlosesten ist noch der Punkt Strukturreformen: Die Sozialsysteme sollen reformiert, der Binnenmarkt soll weiter gestärkt werden. Beides ist im Grundsatz weitgehend unumstritten. Es wird vor allem darauf ankommen, diese Maßnahmen als wachstumsfreundlich zu verkaufen und nicht als Sparkurs.
Der zweite Bestandteil des Plans, die Bankenunion, ist kniffliger. Die EZB fordert sie als Konsequenz aus der Krise offensiv ein: "Die Lehre ist eine weitere Zentralisierung der Bankenüberwachung", sagte Draghi Anfang Juni und fordert eine gemeinsame Finanzaufsicht in der Euro-Zone. Zudem plädiert die EZB für einen europäischen Banken-Rettungsfonds, der über eine Abgabe der Finanzinstitute gefüllt werden könnte. Bei der Bundesregierung stießen solche Überlegungen lange auf Ablehnung, schließlich würden deutsche Banken für südeuropäische Konkurrenten mithaften. Andererseits ist auch in Berlin heute vielen klar, dass eine Währungsunion ohne integrierten Bankenmarkt nicht sinnvoll ist. "Ich glaube, der Bankenunion werden die Deutschen letztlich zustimmen", sagt jemand, der den Fahrplan mitentwirft.
Eine Fiskalunion ist für die Bundesregierung der mit Abstand heikelste Vorschlag. In Berlin würde man darunter gerne nur eine strengere Haushaltsaufsicht verstanden wissen, also eine Weiterentwicklung des Fiskalpakts.
Aber im Gegensatz zur Bundesregierung verstehen die vier beteiligten EU-Institutionen unter einer Fiskalunion auch eine gemeinsame Haftung für Staatsschulden, also Euro-Bonds, die Deutschland heute vehement ablehnt. Den Architekten des neuen Europa ist klar, dass Gemeinschaftsanleihen ein Langfristprojekt sind. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass EU-Vertragsänderungen nötig sind. Und die werden langwierig.
Bei dem Masterplan handelt es sich um eine Euro-Agenda für die kommenden fünf bis zehn Jahre. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass man dafür einen hohen Preis zahlen könnte: eine weitere Spaltung zwischen den 17 Euro-Ländern und den übrigen zehn, mit Kroatien ab dem kommenden Jahr elf EU-Staaten.
Schon als Merkel den Fiskalpakt durchdrückte, nahm sie in Kauf, dass sich mit Großbritannien und Tschechien zwei EU-Partner verweigerten. Diese Entwicklung dürfte sich mit dem Visionsbericht fortsetzen. Europa nimmt das Risiko der Spaltung in Kauf. "Wir müssen die Euro-Zone vertiefen, um sie zu stabilisieren", sagt einer der Vordenker. "Die Euro-Zone muss eine Vorreiterrolle spielen", fügt ein anderer hinzu. Lediglich Kommissionspräsident Barroso dringt noch darauf, eine Architektur für alle 27 EU-Staaten zu entwerfen, nicht nur für die Währungsunion.
In Berlin, in Frankfurt und Luxemburg hält man zwei Geschwindigkeiten für möglich: Was immer geht, soll mit allen Ländern in Angriff genommen werden, alles andere nur mit den 17 Euro-Staaten. Das ist ein Strategiewechsel für die europäische Einigung. "Aber dieser Strategiewechsel muss kommen", sagt ein Zentralbanker. "Das gemeinsame Geld ist Europas prägendes Element." Das gilt für die Krise wie auch für den Versuch, ihr zu entkommen. Florian Eder; Sebastian Jost; Jan Hildebrand; Anja Ettel
Bankenunion, neue Institutionen, gemeinsame Politik, Reformen: Das sind die Elemente des Masterplans. Wie realistisch sind sie?
Bankenunion
Die konkretesten Pläne gibt es bislang für das Zusammenwachsen des Bankenmarktes. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die EU-Kommission machen sich dafür stark.
Die Bankenunion soll drei Elemente umfassen: eine europäische Bankenaufsicht, eine gemeinsame Einlagensicherung und einen zentralen Rettungsfonds für Not leidende Institute. Vor allem Letzteres wäre eine unmittelbare Antwort auf eines der größten Probleme der Euro-Krise: Geraten große Banken in Schieflage, werden sie schnell zur Existenzbedrohung für ihr Heimatland.
Dieses Dilemma trieb bereits Irland unter den Rettungsschirm und bedroht nun Spanien. Auch Einlagensicherungssysteme haben sich nur als vertrauenswürdig erwiesen, wenn ein zahlungskräftiger Staat dahinter steht - deshalb käme es Krisenländern entgegen, wenn auch die Einlagensicherungen zusammengelegt würden. Im Gegenzug dürften dann freilich auch nicht länger nur nationale Aufseher über ihre Banken wachen.
Dass sich multinationale Banken nicht national bändigen lassen, ist weitgehend Konsens. Doch im Detail hagelt es Kritik. Sie kommt vor allem aus Ländern, deren Banken gut durch die Krise gekommen sind oder aber bereits mit eigenen Steuergeldern stabilisiert wurden.
So lehnen die deutschen Branchenverbände eine gemeinsame Einlagensicherung ab, weil diese "zu einer Vergemeinschaftung von Risiken insbesondere zu Lasten der deutschen Kreditinstitute" führe. Ähnliche Vorbehalte gibt es gegenüber einem europäischen Rettungsfonds. "Gerade in Deutschland kann man diese Idee nur verkaufen, wenn dieser Fonds von der Finanzbranche selbst finanziert wird, etwa über eine Bankenabgabe oder eine Transaktionssteuer", heißt es in EZB-Kreisen.
Nur: Ein solcher Fonds bräuchte viele Jahre, bis er handlungsfähig wäre. Kurzfristige Hilfe gäbe es nur mit Steuergeldern - was eine Art Fiskalunion durch die Hintertür bedeuten würde.





























