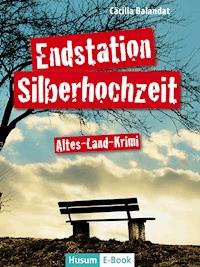
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was als fröhliches Fest ihres Chefs gedacht war, endet für die Oberstufenleiterin der Gesamtschule Buxtehude tödlich. Der vierte Fall im Alten Land, am Deich, vor den Toren Hamburgs, entwickelt sich für Thorsten Brandt jedoch nicht nur wegen der ungewöhnlichen Todesursache zu einem Albtraum an Ermittlungsarbeit. Konnte er sich bislang in allen vorherigen Fällen auf seine erfahrene Vorgesetzte Celia Dörfer verlassen, muss er diesmal alleine auf sich gestellt ermitteln, während sie den größten persönlichen Kampf ihres Lebens kämpft. Menschliche Abgründe, Schicksale und Intrigen bringen beide Kripobeamte an ihre Grenzen. Und am Ende wird nichts mehr sein, wie es vorher war. „Endstation Silberhochzeit“ ist der vierte Krimi der in Hamburg lebenden Autorin Cäcilia Balandat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN 978-3-89876-710-1 (Vollständige E-Book-Version des 2013 im Husum Verlag erschienenen Originalwerkes mit der ISBN 978-3-89876-679-1) Umschlagabbildung: Einsame Winterbank © Petair/Fotolia.com © 2013 by Husum Druck- und Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG, Husum Gesamtherstellung: Husum Druck- und Verlagsgesellschaft Postfach 1480, D-25804 Husum –
1. Kapitel
Der Deich an der Elbe zeigte sich in einem kräftigen Grün. Die Sonnenstrahlen glänzten auf den Tautropfen, die sich in der Nacht an den Grashalmen gebildet hatten. Noch waren die Strahlen nicht stark genug, um die Halme zu trocknen. Deutliches Zeichen des herannahenden Herbstes. Der Parkplatz des Lüheanlegers im Alten Land, vor den Toren Hamburgs, lag noch ruhig und einsam. Es war noch früh. Aber die Touristen und auch die Einheimischen würden bald kommen. Die letzten schönen Tage vor dem langen, meist trüben Herbst und Winter lockten viele an diesen Platz.
Die Geschäftemacher hatten dies schon vor Jahren erkannt und seitdem tummelten sich etliche Fritten- und Fischwagen, Eis- und Kuchenverkäufer, um an den Touristen zu verdienen. Doch noch waren die Verkaufswagen geschlossen.
Bis ungefähr 9 Uhr hatte Schäfer Hubert den Platz für sich. Der schmächtige, bärtige Mann genoss den Blick auf die Elbe ebenso wie die Ruhe. Er war ein Eigenbrötler. Immer schon. Wenn er die Wahl hatte, verbrachte er die Zeit lieber mit seinen Tieren als mit den Menschen. Sie verfügten vielleicht nicht über die Intelligenz der Menschen, dafür aber waren sie ehrlich. Unverfälscht.
Zufrieden beobachtete der Schäfer den Schiffsverkehr, der ebenfalls, so schien es, noch vor sich hindöste. Lediglich eine kleine Schute zeigte sich in der Ferne. Aber keines der großen Containerschiffe, die Tag für Tag Hamburgs Hafen anliefen oder ihn verließen, war in Sicht.
Hubert griff nach den leichten, mobilen Weidezäunen auf der Ladefläche seines Jeeps. Die Weidefläche für seine Schafe musste abgezäunt werden. Sie sollten in den nächsten Wochen diesen Abschnitt des Deiches entlang der Elbe abgrasen.
Die Touristen reagierten darauf durchaus unterschiedlich. Manche mokierten sich über die Belästigung durch den Gestank und die Beeinträchtigung durch die Zäune.
Es hatte Jahre gegeben, in denen Touristen die Zäune einfach niedergetrampelt hatten, die Schafe davongelaufen waren. Dabei war den Besuchern des Alten Landes nicht bewusst, dass die Schafe einen wichtigen Beitrag zur Deichsicherheit leisteten. Sie hielten nicht nur das Gras kurz, sodass ein Befahren mit elektrischen Geräten überflüssig war, sie traten auch den Boden fest, verdichteten den Untergrund und verhinderten so ein schnelles Durchweichen bei Hochwasser.
Seit die Gemeinde Jork dazu übergegangen war, Infotafeln aufzustellen, die die Touristen über Sinn und Zweck informierten, blieb es in der Regel bei mürrischen Kommentaren. Allerdings gab es auch Besucher, die den Anblick der Schafe als Ausdruck der Romantik empfanden.
Ein Blick auf die Uhr zeigte Schäfer Hubert, dass es Zeit wurde. Bis die Zäune errichtet waren und die Schafe von ihrem jetzigen Weideplatz hierher getrieben sein würden, dauerte es. Und er wollte mit beidem fertig sein, bevor die Touristen den Platz stürmten. Entschlossen machte er sich an die Arbeit. Er ließ sich auch von dem Paar nicht stören, das kurz darauf an ihm vorbei Richtung Partyzelt ging, das in einiger Entfernung aufgebaut stand.
Es war Hubert ohnedies ein Dorn im Auge, dass die Leute meinten, sie müssten immer mehr Natur für sich in Anspruch nehmen. Nicht um sie zu genießen, sondern um sie zu zerstören. In der einen oder anderen Form. Es wollte sich ihm nicht erschließen, warum man eine Party auf einer Wiese feierte, des Nachts, wenn niemand etwas von der Natur hatte. Warum feierte man Feste in Zelten, in die die Kälte eindrang, die dann mit Heizstrahlern vertrieben werden musste, statt gleich, wie man das früher tat, einen Raum in einer Gaststätte anzumieten, wenn man zu Hause nicht über die entsprechenden Möglichkeiten verfügte.
Er gab ein unwilliges Grunzen von sich. Was wusste er schon? Er feierte selten. Gezwungenermaßen, wenn sein Bruder zu Familienfesten einlud.
Bis vor ein paar Jahren konnte Hubert ihnen sogar noch etwas abgewinnen. Die Nichten und Neffen, Kinder seines Bruders, waren in einem Alter, in dem sie noch niedlich waren und an allem interessiert. Sie liebten die Geschichten des verschrobenen Onkels über die Schafe. Aber nach und nach waren die Kinder größer geworden. Inzwischen interessierten sie sich nur noch für Playstation, Handy und Co. Die Natur hatte in ihrem Leben keinen Platz mehr.
Grübelnd setzte der Bärtige seine Arbeit fort. Bis die Schreie an sein Ohr drangen. Sie kamen von der Frau, die eben in Richtung des Zeltes an ihm vorbeigegangen war. Hilfe suchend kam sie auf ihn zugelaufen. Verstehen konnte er die Worte nicht. Um zu wissen, dass etwas passiert war, brauchte er das auch nicht. Der Ausdruck auf dem Gesicht der Frau war beredt genug. Ihr Begleiter war nicht zu sehen. Also nahm er an, ihm wäre etwas zugestoßen.
„Jaron, bitte wach auf!“ Celia Dörfer rüttelte an der Schulter ihres Lebensgefährten. Ihre Stimme klang aufgeregt und verängstigt zugleich. Es passte nicht zu ihrer sonstigen Art.
Als Hauptkommissarin der Kripo des Landkreises Stade war sie eher mutig und unerschrocken. Jaron Karloff, Lebensgefährte und als Staatsanwalt Vorgesetzter der Beamtin in einer Person, fuhr mit einem Ruck aus dem Tiefschlaf.
„Celia?“ Zu mehr kam er nicht.
„Ich spür Julien nicht mehr!“ Celias Stimme war nur ein ängstliches Flüstern. Es flößte Jaron mehr Angst ein, als ein lauter Ausruf es getan hätte. Ihm wurde kalt. Celia neigte nicht zu übertriebenen Panikattacken. Während der bisherigen Schwangerschaft war er es eher, der alle mit seiner Fürsorge und Ängstlichkeit genervt hatte.
„Seit wann? Was ist denn passiert?“, versuchte er äußerlich ruhiger zu scheinen, als er sich in Wirklichkeit fühlte. Gleichzeitig war er mit den Beinen schon aus dem Bett und auf dem Weg zu seiner Hose.
Celia brach in Tränen aus.
„Ich weiß es nicht. Ich bin vor einer halben Stunde wach geworden, weil ich das Gefühl hatte, es stimmt was nicht. Normalerweise tritt und boxt der Kleine mich die ganze Nacht. Aber ich fühle nichts mehr. Gar nichts mehr!“
Jaron ließ die Hose auf den Boden fallen, von dem er sie gerade aufgehoben hatte, und eilte auf die Bettseite zu seiner Freundin.
„Pscht. Ganz ruhig. Das muss doch nichts heißen. Vielleicht hat sich der Kleine schon an deinen Rhythmus gewöhnt und schläft auch. Aber wir fahren einfach in die Klinik und lassen es überprüfen. Einverstanden?“
Obwohl er nicht damit gerechnet hatte, schien der Versuch Celia zu beruhigen zu funktionieren. So froh er einerseits darüber war, zeigte es ihm gleichzeitig, wie schlimm es um Celia und ihre Nerven bestellt war. Sie ließ sich sonst nicht von ihm beruhigen. Häufig war es umgekehrt.
Schniefend und die letzten Tränen hinunterschluckend befreite sie sich aus seiner Umarmung. Celia hatte es eilig. Nur kurze Zeit später saßen sie im Auto auf dem Weg nach Stade.
Auch wenn Buxtehude, genau wie Stade, über eine Geburtsstation verfügte, war Stade in Jarons Augen die bessere Wahl. Die Klinik hatte eine Säuglingsstation. Unausgesprochen nahmen sie den etwas längeren Weg von Jork nach Stade in Kauf, waren sie sich einig, dass sie dort besser aufgehoben waren, falls mit dem Kind tatsächlich etwas nicht in Ordnung wäre.
Während der Fahrt herrschte zwischen beiden, die sonst nie um ein Thema verlegen waren, angespanntes Schweigen. Jaron hätte gerne ein unverfängliches Thema angesprochen. Ein aktueller Fall Celias wäre hilfreich gewesen. Aber es gab keinen. Und alle anderen Themen erschienen ihm zu nahe an der Bedrohung, die im Raum stand. Also schwieg er. Hätte er geahnt, mit welchen Gedanken sich seine Lebensgefährtin quälte, hätte er vielleicht doch gesprochen. Aber er wusste es nicht. Und so blieb Celia alleine mit ihren Schuldgefühlen.
Jaron hatte sie immer und immer wieder gebeten, geradezu bekniet, kürzerzutreten. Rücksicht auf die Schwangerschaft, auf ihr Kind zu nehmen. Obwohl sie wusste, warum er es tat, oder vielleicht gerade deshalb, ließ sie sich nicht darauf ein. Sie wollte nicht ausbaden, was ihre Vorgängerin in Jarons Leben verbockt hatte. Zwar beteiligte sie ihn an allen Untersuchungen und Entscheidungen, die das Kind, die Entbindung, die Namensgebung und Planung der Zeit nach der Entbindung betrafen. Aber über ihre Arbeit ließ sie nicht mit sich verhandeln. Sie arbeitete weiter wie bisher.
Erst in der kommenden Woche, wenn der offizielle Mutterschutz begann, wollte sie zu Hause bleiben. Celia schossen erneut Tränen in die Augen bei dem Gedanken, es übertrieben zu haben. Sie fühlte sich schuldig, ohne zu wissen, ob mit dem Kind tatsächlich etwas nicht in Ordnung war.
Erneut tastete sie über ihren Bauch. Die Hand unter der Jacke. Sie wollte es Jaron nicht sehen lassen. War da nicht doch eine leichte Bewegung? Sie ließ die Hand an der Stelle ruhen. Nur um erneut zu bemerken, dass sie sich getäuscht hatte.
Der Weg zog sich endlos dahin, so schien es zumindest. Trotz der frühen Morgenstunde, ohne jeden Verkehr. Unisono erklang ein Aufseufzen aus den Kehlen der beiden Beamten, als sie endlich die Anhöhe zur Klinik in Stade erreichten. Alle Vorschriften ignorierend, fuhr Jaron den Wagen vor die breite gläserne Eingangstür der Klinik und stellte das Auto dort ab. In Windeseile war er um das Auto herumgelaufen und öffnete Celia die Tür.
So lange es gedauert hatte, bis man ihr die Schwangerschaft überhaupt ein wenig ansehen konnte, in den letzten Wochen hatte sich das Bild dann doch gewandelt. Zwar war Celia der Umstand von hinten immer noch nicht anzusehen, von der Seite jedoch und von vorne war die Kugel deutlich gewachsen und erkennbar. Nicht verwunderlich. Schließlich waren es nur noch sieben Wochen bis zum errechneten Geburtstermin.
„Komm, ich helfe dir!“, griff Jaron unterstützend unter ihren Arm und führte sie in die Klinik. Hilflos blickte er sich um. Aber es war noch früh. In der Klinik herrschte die berühmte Ruhe vor dem morgendlichen Sturm des Tagesgeschäfts.
Die Rezeption war noch nicht besetzt. Jaron führte Celia geradewegs zu den Aufzügen. Nur kurz dachte er daran, in die Notaufnahme zu fahren, dann entschied er, gleich den Weg auf die Geburtsstation zu nehmen.
„Kann ich Ihnen helfen?“ Man sah der jungen Frau an, dass sie von der Nachtschicht übrig geblieben war. Sie hatte Ränder unter den Augen, die, ausgeschlafen, sicher einen faszinierenden Ausdruck hatten.
Sie waren strahlend blau, wie Jaron überrascht feststellte, obwohl sie dunkles, fast schwarzes Haar hatte. Jetzt blickten sie müde, mit einem fast flehenden Ausdruck, so kurz vor Schichtende nicht noch mit einem Problem beschäftigt zu werden. Jaron ignorierte den Ausdruck.
„Celia, meine Lebensgefährtin …“, er stotterte, was ihm sonst selten passierte. Dabei bemerkte er, dass sich in ihm alles gegen den Ausdruck Lebensgefährtin sträubte. Er hätte ihn gerne durch die Formulierung „meine Frau“ ersetzt. Bisher war er immer der Meinung, er wäre Celia so nah, wie man einem Menschen nur sein konnte. Dafür benötigte er keinen Trauschein. Jetzt, in diesem Moment fühlte es sich so an, als reiche es nicht. Er riss sich zusammen.
„Sie spürt das Kind nicht mehr!“
Die Schwester zog kurz scharf die Luft ein. Dann wandte sie sich betont gelassen an Celia, ein beruhigendes Lächeln auf das müde Gesicht zaubernd. „Seit wann haben Sie Ihr Kind nicht gespürt?“
Die Krankenpflegerin berührte leicht Celias Arm. Als wäre es enorm wichtig, prägte Celia sich deren Namen ein, der gut sichtbar auf ihrem Namensschild am Kittel zu lesen war. Pflegerin Lydia. Ohne Celias Antwort abzuwarten, führte die Pflegekraft Celia zu einem Stuhl neben dem Schwesternzimmer.
„Setzen Sie sich einen kleinen Moment hin. Ich funke den Bereitschaftsarzt an. Er ist dann gleich hier und schaut nach dem Rechten.“
Celia sträubte sich gegen den Sitzplatz. Sie wollte nicht warten. Es sollte endlich was passieren.
Jaron, der spürte, dass Celia gleich explodieren würde, nahm sie sanft zur Seite. „Komm, die Frau kümmert sich. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Beruhig dich!“
Celia entzog sich der Umarmung. Sie konnte die Enge, die sie verursachte, nicht ertragen. Sie konnte Jarons Trost nicht entgegennehmen. Er fühlte es. Die Kränkung, die ihre Reaktion in ihm hervorrief, schob er zur Seite.
Schnell war Schwester Lydia wieder bei ihnen. „Der Gynäkologe ist auf dem Weg. Wir gehen schon mal in den Untersuchungsraum. Hier entlang!“, übernahm sie die Führung.
Sie erschien Jaron sehr unerfahren. Wahrscheinlich, so mutmaßte er, hatte sie noch nicht viele solcher Situationen zu meistern gehabt. Als dann der angekündigte Gynäkologe zu ihnen trat, noch bevor sie das Untersuchungszimmer erreichten, wirkte sie so erleichtert, wie Jaron es vorausgesehen hatte.
„Gerber, Dr. Gerber!“, stellte sich der Facharzt vor. Auch er wirkte ein wenig übernächtigt, jedoch souverän. Seine Hand hatte er zuerst Celia gereicht, dann Jaron. Celia reagierte lediglich mit einem Nicken. Jaron übernahm die Vorstellung.
„Frau Dörfer, was ist passiert?“ Während er versuchte, Celia Informationen zu entlocken, öffnete er die Tür zum Behandlungszimmer, schaltete das Licht ein und führte Celia zu einem Stuhl.
Unwillig entzog Celia dem Arzt ihren Arm, schüttelte ihn ab.
„Ich will mich nicht hinsetzen. Ich will, dass Sie einen Ultraschall von unserem Kind machen. Es bewegt sich nicht mehr. Es hat sich immer bewegt. Die ganze Nacht. Es hat mich nie schlafen lassen. Aber heute Nacht macht er gar nichts mehr.“
Gerber nickte und änderte die Richtung.
„Kommen Sie!“ Er wies auf die Liege im Raum. Das Ultraschallgerät direkt daneben. „Wollen mal sehen. Wahrscheinlich ist gar nichts. Wann ist der errechnete Termin?“
Er drehte sich zu Jaron. Celia war jedoch schneller. „In sieben Wochen! Nur noch sieben Wochen. Jetzt kann dem Kleinen doch eigentlich gar nichts mehr passieren, oder? Ich meine …?“
Sie brach ab. Die Tränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, liefen ihr übers Gesicht. Unwillig wischte sie sie mit dem Handrücken weg.
Gerber wechselte einen Blick mit Jaron, den dieser nicht deuten konnte. Normalerweise war er gut darin, Worte und Gesten von Menschen zu verstehen. Als Staatsanwalt ein unbestreitbarer Vorteil im Umgang mit Angeklagten bei Gericht. Aber Gerbers Blick hätte viel bedeuten können. Jarons Gefühl der Verunsicherung verstärkte sich.
Celia, die inzwischen auf der Liege lag, zog ihr Hemd über den Bauch hoch. Auf das kalte Gel, das der Gynäkologe auf dem Bauch verteilte, reagierte sie nicht. Sie hatte den Blick starr auf den Monitor des Ultraschalls gerichtet. Als der Mediziner den Monitor wegdrehen wollte, fuhr sie ihn an.
„Lassen Sie das. Ich will sehen, wie es Julien geht!“
„Es wird ein Junge?“, versuchte Gerber zu plaudern.
„Es ist ein Junge. Er ist schon. Julien!“
Neue Tränen traten ihr in die Augen. Diesmal wischte sie sie nicht weg. Sie ließ sie laufen.
Gerber sagte nichts mehr, begann mit der Untersuchung. Behutsam fuhr er mit der Ultraschallsonde über Celias gewölbten Bauch. Zunächst mit schnellen Bewegungen, um das Gel zu verteilen. Dann setzte er es gezielt auf die Bauchdecke. Wie er erkannte auch Celia den Kopf des Kindes, Arme, Rücken und Po waren gut zu erkennen. Celia spürte Erleichterung, als hätte sie erwartet, das Kind hätte sich in Luft aufgelöst.
Jaron dagegen hatte das Zögern des Arztes bemerkt. Jetzt, als er das Stethoskop, das bisher unbenutzt um seinen Hals gehangen hatte, griff, und es ebenfalls auf die Bauchdecke drückte, fühlte Celia Panik in sich hochsteigen. Das gleiche Gefühl konnte sie in Jarons Augen erkennen. Es gab ihr den Rest.
Das gellende „Nein“, das Celia ausstieß, würde Jaron nicht wieder vergessen können.
2. Kapitel
Widerwillig ließ der Schäfer den Weidezaun sinken. Kurz schoss es Leah Brake durch den Kopf, dass der Mann eher nach Bayern passen würde. Sein Äußeres hatte etwas von einem verschrobenen Almbauern. Schnell wurde der Gedanke von dem aktuellen Gedanken verdrängt. Atemlos rüttelte sie am Arm des Schäfers.
„Nun kommen Sie, schnell. Wir brauchen Hilfe. Frau Welsch bekommt keine Luft mehr.“
Sie zerrte Hubert zum Partyzelt. Mit einem Blick erfasste er die Situation. Auch wenn er noch so weltfremd erschien, er war nicht begriffsstutzig. Not erkannte er.
Auch der modernen Zivilisation hatte er sich nicht gänzlich verweigert. Er besaß ein Handy, das er nun aus der Hosentasche zog. Weder die Frau noch der mit Herzmassage beschäftigte Mann schienen bisher auf die Idee gekommen zu sein, einen Rettungsdienst zu informieren.
Kurz und knapp informierte er die Leitstelle über die wichtigsten Fakten. Während er das Handy in die Hosentasche zurückgleiten ließ, nahm er die Einzelheiten auf.
Dabei stach ihm das leuchtend rote Haar der Frau im Gras besonders ins Auge. Es stand in einem überdeutlichen Kontrast zur bläulichen Färbung ihres Gesichts.
Erst nach einigen Sekunden wurde ihm die Bedeutung der Gesichtsfarbe bewusst. Dann reagierte er. Er schubste den anderen Mann zur Seite und begann mit der Beatmung der Frau, die röchelte und offensichtlich nicht genug Luft in die Lungen zu bekommen schien. Doch es brachte ihr keine Erleichterung, ihr Zustand verschlechterte sich.
Zunächst begann sie unter seinen Händen zu krampfen. Dann bog sich der Körper ins Hohlkreuz durch. Gegen sie ankämpfend versuchte Hubert abwechselnd das Herz zu massieren und sie dann erneut zu beatmen. Nur am Rand nahm er wahr, dass der Rettungswagen eintraf.
Bevor die Rettungssanitäter bei ihnen waren, spürte er, wie die Frau unter seinen Händen entspannte. Die Krämpfe hörten auf. Im ersten Moment beschlich ihn die Hoffnung, es würde ihr besser gehen. Aber nur für einen kurzen Moment. Dann bemerkte er das Fehlen jeden Lebenszeichens. Ein Blick in die weit aufgerissenen, starren Augen bestätigte seine Befürchtungen. Als hätte er sich verbrannt, zog er ruckartig die Hände vom Brustkorb der schönen Frau.
Er befand sich noch im Zustand des Halbschlafes, als er mit dem rechten Arm auf die andere Seite des Bettes griff. Ins Leere. Thorsten Brandt schreckte hoch. Er brauchte einige Sekunden, um sich zu erinnern, warum seine Freundin Seyda nicht neben ihm im Bett lag.
Ihr Fehlen hatte ihm eine Mordsangst eingejagt und sein Herzschlag beruhigte sich nur langsam. Dann erinnerte er sich.
Allerdings gab es an der Erklärung genug Aspekte, um sein Unwohlsein erneut zu entfachen. Seyda war mit ihrer Freundin Büsra abgetaucht, wie er es für sich bezeichnete. Aus heiterem Himmel hatte Seyda für sich beschlossen, eine Auszeit zu brauchen.
Ihre Beziehung hätte sich zu schnell entwickelt. Sie fühle sich überrollt und brauche ein wenig Distanz, um sich darüber klar zu werden, ob sie genau das wollte, was sie zurzeit mit ihm lebte. Thorsten war wie vor den Kopf gestoßen. Seyda war es gewesen, die die Beziehung vorangetrieben hatte. Anfänglich waren sie nur Nachbarn, dann hatten sie sich immer öfter getroffen, nicht nur auf dem Gang des Hausflurs. Seyda hatte ihm regelrecht den Kopf verdreht. Sie hatte nach und nach mehr und mehr Raum in seinem Leben eingenommen.
Celia, seine Vorgesetzte und gute Freundin, hatte ihn ein ums andere Mal gewarnt, auch vor möglichen Problemen durch ihre unterschiedliche Herkunft.
Aber Seyda ließ keine Zweifel aufkommen. Sie widersetzte sich allen Anfeindungen in ihrem türkischen Freundeskreis gegen ihre Liebesbeziehung zu einem Nichttürken. Sie bestand darauf, ihn ihren Eltern vorzustellen. Sie nahm teil an seinem beruflichen Leben, schreckte vor keiner Tatbeschreibung zurück. Die Landung nach dem Fall von Wolke Sieben auf der Erde schmerzte ihn umso mehr.
„Ich will doch nur ein paar Tage Abstand!“, hatte Seyda versucht, ihn zu beruhigen.
„Ich laufe nicht weg. Und ich beende doch auch unsere Beziehung nicht. Vertrau mir doch einfach!“
Genau das fiel ihm jedoch schwer. Seydas Vorgängerin hatte einiges daran gesetzt, genau dieses Gefühl in ihm zu zerstören. Gerade als er sich auf dem Weg zur Genesung wähnte, zog Seyda sich zurück. Dennoch hatte er nach außen den Lässigen gemimt.
Als sie mit der Reisetasche durch die Tür verschwand, wäre er am liebsten in Tränen ausgebrochen. Er hätte sie gerne zurückgehalten. Sein nächster Impuls war, Celia anzurufen. Ihn schreckte jedoch die Vorstellung, er könne unterschwellig ein „Hab ich dir doch gesagt!“ aus ihren Worten raushören. Er ließ es. Am Ende landete er dort, wo er auch nach dem Aus mit Eva gelandet war. Im Marktschreier, bei Mona auf dem Kneipensofa.
Bis heute wusste keiner der drei Beamten, was die Düsseldorfer Kneipenwirtin in das kleine Nest Jork verschlagen hatte. All ihre Ermittlerfähigkeiten hatten nicht ausgereicht, ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen.
Jaron hatte einmal scherzhaft erwähnt, sie könnten den Polizeicomputer befragen. Ohne Worte war Jaron, Celia und Thorsten der Blick von Mona Warnung genug, ihre Vergangenheit ruhen zu lassen.
„Es gibt keine Polizeiakte über mich. Das ist alles, was ich euch sage. Alles andere geht euch nichts an“, hatte sie kurz und bündig hinzugefügt und jedem der Beamten ungefragt ein Glas Bier auf den Tresen geknallt. Sie hatten es nie wieder erwähnt.
Mit dem typisch hohlen Gefühl von enttäuschter Liebe, ertränkt in zu viel Alkohol, zog Thorsten sich das Kopfkissen über den Kopf und wünschte, er könnte noch ein wenig weiterschlafen. Dabei wusste er nur zu gut, dass ihm genau das nicht vergönnt war.
Alkohol, der bei vielen anderen zu einem beinahe komatösen Schlaf führte, brachte Thorsten regelmäßig viel zu kurze Nächte ein.
Als sein Handy auf dem Nachttisch zu läuten begann, schoss er hoch. Dabei vergaß er seinen Bereitschaftsdienst. Zu sehr sehnte er einen Anruf von Seyda herbei.
Ein Blick auf das Display seines Handys hätte ihn aufgeklärt. Aber er war zu schnell. Daher brauchte er einige Sekunden, um zu begreifen, dass er an einen Tatort gerufen wurde.
„Ist Frau Dörfer schon informiert?“, konnte er sich doch noch sammeln. Die Antwort ließ ihn seine eigenen Probleme vergessen.
„Scheiße!“ war alles, was ihm noch einfiel. Dann legte er auf. Während er mit der einen Hand das Handy am Ohr hielt, versuchte er, mit der freien Hand nach seiner Hose zu greifen und sie über die Beine zu ziehen. Kurz bevor er drohte, das Gleichgewicht zu verlieren, setzte er sich aufs Bett zurück. Dann fluchte er erneut und schmiss das Handy neben sich auf die Bettdecke.
Er hatte lediglich Jarons Mailbox erreicht. Ihm fehlten jedoch die Worte für die Situation. Also hinterließ er keine Nachricht.
Schnell zog er den Rest der Kleidung über, auch im Badezimmer legte er den Schnellgang ein. Zurück im Schlafzimmer griff er nach dem eben weggeworfenen Handy und wählte. Wenn auch ohne Hoffnung auf ein anderes Ergebnis zunächst Jarons Nummer.
Als er seine Befürchtungen bestätigt sah, wählte er die Richie Saalmanns. Der Mann von der Spurensicherung musste informiert werden. Ebenso wie Thomas Heuser von der Gerichtsmedizin.
Beide waren von der Zentrale bereits auf den Weg geschickt worden. Beide erkundigten sich danach, ob Celia informiert war. Beiden verschlug es die Sprache, als Thorsten sie brüsk informierte, dass Celia im Krankenhaus sei, und dann auflegte.
Er griff nach den Autoschlüsseln im Eingangsbereich seiner Wohnung, nur um dann innezuhalten und festzustellen, dass er von seinem Wohnzimmerfenster fast auf den Tatort blicken konnte. Er kehrte um und warf einen Blick hinaus. Tatsächlich konnte er gerade noch das Blaulicht des Rettungswagens über die Krone des Deichs herausragen sehen.
„Ich wollte immer schon ganz in der Nähe meiner Arbeit wohnen!“, murmelte er ironisch vor sich hin. Es folgte ein weiterer Fluch. Dann wandte er sich von der großen Panoramascheibe seines Wohnzimmers ab.
Als er die Wohnung vor gut einem Jahr gekauft hatte, hatte dieser Blick aus dem Fenster einen entscheidenden Anteil an seinem Entschluss gehabt, sich in die Belastungen einer Eigentumswohnung zu stürzen. Er konnte von ihr aus über den Deich hinweg auf die Elbe blicken. Eine faszinierende Aussicht, wenn die hoch aufragenden Containerschiffe majestätisch vorbeischipperten.
Oder die größer und größer werdenden Kreuzfahrtschiffe. Eins luxuriöser als das andere.
Er besann sich auf die Realität. Er griff nach dem Wohnungsschlüssel, die Autoschlüssel ließ er liegen. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, sprintete er die drei Stockwerke hinunter. Die sonst recht belebte Straße am Deich entlang, nach Stade in die eine Richtung und Hamburg in die andere, lag ruhig da. Die frühe Stunde am Sonntag machte es möglich, sie zu überqueren, ohne die Ampel durch Knopfdruck in Betrieb zu nehmen.
Fast zeitgleich mit ihm fuhr Richie auf den großen Parkplatz am Anleger.
Bis vor wenigen Jahren fuhr von Lühe eine Schnellfähre nach Hamburg zu den Landungsbrücken. Der Betreiber hatte sich gutes Geld ausgerechnet, das ihm die Pendler einbringen sollten, die nach Hamburg zur Arbeit mussten. Sein Plan war nicht aufgegangen. Eine Weile fuhr die Schnellfähre dann noch in den Sommermonaten, um Touristen zum berühmten Fischmarkt in St. Pauli zu bringen.
Aber auch damit ließ sich die Schnellfähre nicht finanzieren.
Nun gab es in den Monaten von März bis Oktober, wenn die Touristen über das Alte Land einbrachen, an den Samstagen, Sonntagen und Feiertagen eine Fähre, die das Alte Land mit der Elbmetropole verband. Schnell fuhr sie jedoch nicht. Und der Parkplatz war nur selten, an sehr heißen Sommertagen, wirklich ausgelastet.
Richie parkte seinen Wagen jedoch nicht auf dem großen, leeren Parkplatz. Er hielt kurz an, bedeutete Thorsten mit einer Geste einzusteigen und fuhr dann den schmalen Weg weiter. Die Richtung wies ihnen der Rettungswagen.
Rechts von diesem parkte bereits das Auto des Gerichtsmediziners. Viel zeitlichen Vorsprung hatte er nicht. Er saß noch im Auto. Thorsten stieg aus und klopfte gegen die Seitenscheibe. Heuser winkte ab. Dabei bemerkte Thorsten das Handy in seiner anderen Hand am Ohr. Ohne auf den Mediziner zu warten, folgte er Richie Saalmann.
„Hoffentlich hat sich nicht mal wieder ein Teenie bei einer Party zu Tode gesoffen“, deutete Richie auf das große Partyzelt.
„Ach du Scheiße. Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht.“ Thorsten schüttelte sich.
Im vergangenen Winter, der sowohl ausgesprochen lang als auch extrem kalt gewesen war, waren gleich drei Jugendliche in der Kälte unter Alkoholeinfluss ums Leben gekommen.
Unabhängig voneinander und doch in kurzen Abständen. Das hatte eine Weile hohe Wellen geschlagen. Aber wie so viele andere Themen auch, egal wie brisant sie waren, sie verloren an Reiz, wenn die Zeit verstrich.
Jetzt, fast ein Dreivierteljahr später, sprach kaum noch jemand darüber. Dabei, das wussten die Männer von der Kripo nur zu gut, war die Gefahr keineswegs geringer geworden.
Das unvernünftige Verhalten der Teenager hatte sich nicht geändert und die Eltern fühlten sich oft machtlos in dem Kampf gegen die unter den Kids so beliebten Komasaufereien.
Ein Blick auf die Tote, nur wenige Sekunden später, zeigte ihnen, dass ihre Befürchtungen umsonst waren.
Bei dem Opfer handelte sich eindeutig um eine erwachsene Frau. Und selbst wenn Alkohol im Spiel war, todesursächlich war er sicher nicht. Um das zu erkennen, brauchten die beiden Beamten nicht mal auf den Gerichtsmediziner zu warten.
Yorek Meinschuh schaute zum wiederholten Mal auf die Uhr an seinem Handgelenk, als bestünde die Hoffnung, dass er sich bei den Malen davor getäuscht hatte. Die Uhrzeit blieb jedoch, wie sie war.
Es war zu spät, so sagte ihm die Uhr, um ungesehen an seiner Frau vorbei ins Haus zu kommen.
Zu spät aber auch, dass die Tatsache unbemerkt blieb, erneut eine Nacht nicht zu Hause verbracht zu haben.
Dabei wusste er immer noch nicht, welches das kleinere Übel für ihn war. Sie weiterhin in dem Glauben zu lassen, er habe eine Affäre mit einer anderen Frau, oder ihr endlich die Wahrheit einzugestehen.
Er entschied sich, wie so oft in den vergangenen Monaten, sich weiterhin für die angebliche Affäre beschimpfen zu lassen. Es fühlte sich besser an. Dann war er wenigstens kein kompletter Versager. Immerhin bedeutete es wenigstens so sehr Mann zu sein, noch Frauen für sich einnehmen zu können. Die Wahrheit war allerdings genau davon meilenweit entfernt.
Leise schloss er die Hautür auf. Immer noch in der sinnlosen Hoffnung, irgendwie ungesehen ins Haus zu gelangen.
Als er die Stimmen seiner Kinder im Essbereich des großen Wohnzimmers vernahm, erkannte er seine realitätsfremden Gedanken. Er hätte es wissen können.
Die Uhrzeit hätte ihm auch das verraten. Er atmete tief ein und wappnete sich für die nächsten Augenblicke. Es fiel ihm immer schwerer, seiner Frau gegenüberzutreten.
Sie hatte nichts verbrochen, das sein Verhalten rechtfertigen würde. Sie hatte ihm nie Anlass für Versteckspiele gegeben.
Gunda war ein Ausbund an Offenheit. Damit hatte sie ihn bezirzt, den Jungen aus dem verklemmten Pastorenhaus.
Es verursachte ihm heute noch, nach all den Jahren, bittere Gefühle, wenn er daran dachte, wie verlogen es bei ihnen zu Hause zugegangen war.
Nie wurde offen geredet, Probleme wurden kategorisch unter den Teppich gekehrt. Zwar wurden sie dadurch nicht vergessen oder gar gelöst, aber man sah sie nicht. Und darauf kam es seiner Mutter, der Pastorin, an.
Es durfte kein Makel auf die erste Pastorin in der Gemeinde Oldesloe fallen. Zu schwer hatte sie sich die Stelle erkämpft. Es war hart genug, wie sie immer betonte, dass ihr Mann, der Vater der Kinder, aus seinem Theologiestudium nicht mehr gemacht hatte, als ein bescheidener Religionslehrer an der Schule zu werden.
Also mussten die Kinder vorzeigbar sein, wenn es der Mann schon nicht war. Sie gaben sich alle Mühe. Alle vier Kinder. Weder seine beiden Schwestern noch sein Bruder leisteten sich irgendwelche Ausrutscher. Nicht in der Schule. Auch nicht privat. Und auch er brauchte zumindest nicht versteckt zu werden.
Yorek Meinschuh glänzte nicht so strahlend wie seine Geschwister. Dennoch wurde aus ihm ein passabler Lehrer. Immerhin angesehener in den Augen seiner Mutter als sein Vater. Yorek brachte es auf eine A-14-Stelle als Staatsbeamter. Er hatte Lehramt für die Sekundarstufe II studiert, konnte damit noch weiter aufsteigen. Gar eine Leitungsstelle. Bei dem Gedanken lachte er höhnisch.
So schnell, wie seine Mutter es sicher von ihm erwartete, würde es damit nichts werden.
Dabei hätte er viel darum gegeben, sie zu bekommen, als die Stelle an der Gesamtschule Buxtehude ausgeschrieben wurde. Die Oberstufenleitung an einer Schule zu übernehmen, hätte den ersten Schritt in die richtige Richtung bedeutet. Und es hätte ihm geholfen, halbwegs glimpflich aus seiner jetzigen Situation rauszukommen.
Er war sich seiner Sache so sicher gewesen. Brake hielt viel von ihm. Sie waren quasi Lehrer der ersten Stunde an der Schule. Hatten sie gemeinsam hochgezogen. Gegen viele Widerstände. Die Schulpolitik Niedersachsens war konservativ. Erst eine massive Elterninitiative hatte die Errichtung der Gesamtschule ermöglicht.
„Papa!“, unterbrach sein Jüngster seine Gedanken. Der Kleine stürzte unbefangen auf ihn zu. Mit seinen drei Jahren schien er die Spannungen zwischen seinen Eltern nicht zu spüren. Oder vielleicht war die Fröhlichkeit des Kleinen dessen Mittel, um mit ihnen fertig zu werden.
Monique, sie war sieben, reagierte deutlicher auf die Anspannung im Elternhaus. Ihre Augen hatten schon seit geraumer Zeit aufgehört zu leuchten, wenn sie ihren Vater erblickte. Dabei war sie bis vor gar nicht langer Zeit mal der Inbegriff des Papakindes gewesen.
Wie heute Esteban hatte sie sich früher in seine Arme gestürzt und sich von ihm rumwirbeln lassen. Heute schaute sie fast mit dem gleichen mitleidigen, manchmal ironischen Blick ihrer Mutter auf ihn. Er ließ sich den Schmerz, den sie in ihm verursachten, nicht anmerken.
Nachdem er seinen Sohn dreimal durch die Luft gewirbelt hatte, setzte er ihn zurück in seinen Hochstuhl und gab seiner Tochter einen liebvollen Kuss auf den Scheitel.
„Wie hübsch du schon am frühen Morgen ausschaust!“, neckte er sie. Sie hatte selbstständig versucht, Schleifen in ihrem Haar zu platzieren. Man sah es. Aber sie hörte den Unterton nicht heraus, nahm es als wahres Lob und fühlte sich, dann doch wie sein kleines Mädchen von früher, geschmeichelt.
Seine Worte und die Reaktion der Tochter stimmten sogar Gunda für einen Augenblick milder. Er konnte es an ihren Augen sehen. Als er den Umstand jedoch ausnutzen wollte, um auch ihr einen Kuss zu geben, verhärteten sich ihre Gesichtszüge.
„Versuch es ja nicht!“, zischte sie ihn durch die Zähne an. Wenn sie sich ihm nicht entzogen hätte, er körperlich noch Zugang zu ihr hätte, entschuldigte Yorek sich häufig vor sich selbst, hätte er vielleicht den Mut aufgebracht, sich ihr anzuvertrauen. Natürlich, in klaren Momenten wusste er es, hätte es nichts geändert.
Müde ließ er sich auf seinen Stuhl am Tisch plumpsen. „Ich wusste gar nicht, dass man Silberhochzeiten so lange feiern kann!“, versuchte er seine ausgedachte Lüge zu platzieren.
„Ach ja?“ Zwei Worte, zur Frage langgezogen, erübrigten jeden weiteren Versuch, an seiner Version festzuhalten. Sie würde sie ihm nicht glauben. Er versuchte es dennoch.
„Lass es Yorek! Brake hat heute früh hier angerufen. Sie waren auf der Suche nach Dana. Ihr Mann war wohl einigermaßen beunruhigt, dass seine Frau immer noch nicht zu Hause eingetroffen war. Komisch, dass Brake hier anruft, um zu fragen, ob du vielleicht weißt, wo sie geblieben ist. Findest du nicht?“
Yoreks Gedanken überschlugen sich. Dana Welsch wäre die letzte Frau, mit der er sich, wenn überhaupt je eine in Betracht käme, auf eine Affäre einlassen würde. Ausgerechnet mit ihr? Wie verbohrt musste seine Frau in dem Gedanken, von ihm betrogen zu werden, schon sein, dass sie eine solche Affäre in Erwägung zog.
Er versuchte Kapital aus dem Offensichtlichen zu ziehen.
„Du weißt noch, wer Dana ist, oder? Es ist die Frau, wegen der ich die Stelle nicht bekommen habe. Du glaubst nicht im Ernst, dass ich ausgerechnet mit dieser Person ins Bett gehen würde!“
„Nicht? Mit wem dann?“ Gunda witterte die Chance, endlich die Wahrheit zu erfahren.
„Oh Gott, kannst du das Thema nicht endlich ruhen lassen. Warum glaubst du mir nicht. Ich habe kein Verhältnis mit einer anderen Frau. Nicht mit Dana und auch mit niemand sonst!“
„Was willst du mir damit sagen?“ Gundas Stimme klang leicht zittrig. Im ersten Moment begriff Yorek nicht aus welchem Grund, dann begann er zu lachen.
„Du hast jetzt nicht wirklich gedacht, ich wäre versteckt schwul? Sag, dass das nicht wahr ist! Wie absurd!“
Er lachte laut auf. Als es nicht mehr zu ändern war, er die Reaktion seiner Frau auf ihrem Gesicht ablas, bemerkte er, wie taktlos seine Reaktion war.
„Tschuldigung, Gunda bitte!“, versuchte er zu retten, was nicht zu retten war.
Gunda griff nach ihrem Sohn in seinem Hochstuhl.
„Monique, wisch dir den Mund ab und dann komm bitte mit nach oben. Wir werden zu Oma und Opa fahren.“
„Echt? Heute?“ Die Begeisterung seiner Tochter war unüberhörbar. Die Besuche bei den Großeltern waren selten genug. Mit gutem Grund. Sie wohnten in Bremen, zu weit, um mal einen kurzen Sonntagsbesuch bei ihnen zu absolvieren.
Yorek brauchte nur Sekunden, um die Bedeutung der angekündigten Reise zu ergründen.
„Du gehst?“, suchte er dennoch die Bestätigung.
„Aber du willst mich nicht verlassen, oder?“ Während seiner Worte hatte er sich von seinem Stuhl erhoben, schwerfällig, seine Glieder waren bleischwer. Und so stand er nun mit hängenden Schultern vor seiner Frau.
Gunda stieß ein Schnauben durch die Nase. Eine abfällige Geste, die bei ihr immer noch würdevoll wirkte. Die nächsten Worte unterstrichen ihren Stolz.
„Du glaubst nicht im Ernst, dass ich abhaue, meine Praxis aufgebe und alles stehen- und liegenlasse?
Du kennst mich wirklich nicht. Ich gebe dir lediglich Zeit, dich zu besinnen. Wenn es nach mir geht, würde ich vorschlagen, wir versuchen eine Eheberatung. Es ist deine Chance.“
Sie zögerte einen Moment, wollte sich schon zum Gehen abwenden. Drehte sich dann jedoch noch einmal zu ihm um: „Wenn du nicht bereit bist, etwas für uns zu tun, dann werde ich mich trennen. Aber Yorek, nur dass das klar ist, dann gehst du und sicher nicht ich!“ Damit ließ sie ihn endgültig stehen.
Yorek Meinschuh tat sich schwer damit herauszufinden, ob sein vorherrschendes Gefühl nun Erleichterung über die Chance, die Gunda ihm gab, war oder Wut über den letzten Satz. Er entschied sich für die Wut. Wer war sie, fauchte er sie an, dass sie für sich beschloss in dem Haus zu bleiben und ihn wegzuschicken.
Dann wurde ihm die Unsinnigkeit seiner Wut bewusst.
Sollte Gunda sich von ihm trennen, würde am Ende keiner von ihnen in diesem Haus wohnen bleiben. Dafür hatte er in den letzten Wochen nachhaltig gesorgt. Gerettet werden konnten sie nur, wenn sie zusammenblieben. Dabei war er sich nach wie vor keineswegs sicher, dass Gunda genau das tun würde, wenn sie die Wahrheit erfuhr.
3. Kapitel
„Ist das schön hier! Das Meer. Was für Farben?“ Büsra konnte sich überhaupt nicht einkriegen, so begeistert war sie. Seyda ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie konzentrierte sich darauf, das Auto sicher durch die schmale Straße von Sierksdorf, dem kleinen Erholungsort an der Ostsee, zu steuern.
Obwohl es bereits Nachsaison war, schien das die Touristen nicht davon abzuhalten, den Ort in Scharen zu bevölkern.
Dabei hatten viele von ihnen vergessen, dass auf Straßen auch Autos fuhren. Und so flanierten sie gelassen und alle Vorsicht vergessend über die Straßen, mitten vor den vorbeifahrenden Autos. Seyda hatte mehrfach schon abrupt bremsen müssen, um einen Unfall zu vermeiden.
Also hob sie sich den Blick aufs Meer für dann auf, wenn sie das Auto auf dem Parkplatz ihres Hotels abgestellt hatte. Ihr Navigationssystem meldete ihr, dass sie das nach wenigen Metern tun konnte.
Erleichtert bog sie auf den großzügigen Parkplatz der Anlage. Aus den Prospekten wusste sie, dass es nicht nur ein Hotel, sondern auch Ferienappartements gab, und nun sah sie, dass sogar ein Campingplatz dazugehörte.
„Ganz schön geschäftstüchtig die Leute, denen der Schuppen gehört!“, ließ sie Büsra an ihren Gedanken teilhaben.
Die nickte, schien aber nicht weiter an dem Thema interessiert. Seyda konnte es ihr nicht verdenken. Büsra hatte zurzeit andere Sorgen. Doch statt sich mit ihnen zu beschäftigen, griff sie das Thema auf, dass Seyda gerne zurückgestellt hätte.
„Da wir jetzt endlich angekommen sind, wirst du den armen Thorsten anrufen und ihm die Wahrheit erzählen. Ich will einfach nicht, dass er wegen mir zu Hause sitzt und umkommt vor Angst, du könntest ihn verlassen. Ich weiß immer noch nicht, welcher Teufel dich geritten hat, ihm eine solche Geschichte aufzutischen.“
Jetzt, mit ein wenig Abstand, wusste Seyda es selbst nicht mehr. In der akuten Situation, als Büsra am ganzen Körper zitternd vor ihr gestanden und um Hilfe gebeten hatte, war ihr nichts anderes eingefallen.
Selim, Büsras Bruder, war Thorsten ein solcher Dorn im Auge, dass er sofort losgezogen wäre und ihn zur Rede gestellt hätte. Dabei hatte er keine Ahnung, wie ernst die Situation für Büsra wirklich war. Reden, das hätte Thorsten nicht verstanden, half da leider nicht. Selim würde nicht diskutieren. Schon gar nicht mit Seyda und ihrem von Selim nicht akzeptierten Freund Thorsten.
„Und was soll ich ihm sagen? Du kennst Thorsten nicht. So süß wie er ist, er wird versuchen uns zu erklären, dass es für alles eine Lösung gibt. Und dass man mit Weglaufen keine Lösung schafft. Du hast ihn doch erlebt. Er ist einfach zu gut für die Welt.“
Büsra musste lachen, auch wenn ihr im Grunde wenig danach zumute war.
„Ja, stimmt. Er ist wirklich zu lieb. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass ausgerechnet er bei den Bullen arbeitet!“
Das Wort Bullen betonte sie überspitzt. Sie hatte keine Abneigung gegen Thorsten oder seinen Berufsstand.
„Trotzdem musst du ihn anrufen. Wenn du es nicht machst, mache ich es. Alles klar? Ich will am Ende nicht auch noch schuld sein, dass eure Beziehung in die Grütze geht!“
Seyda schüttelte innerlich den Kopf. Wie konnte Selim auch nur eine Sekunde mit dem Gedanken spielen, seine Schwester könne in der Türkei, irgendwo in einem abgeschiedenen Kaff, glücklich oder wenigstens zufrieden leben? Ihre ganze Art, ihre Sprache, ihre Einstellung. Sie war so sehr westlich sozialisiert, wie man nur sein konnte.
„Okay, Kompromiss! Ich schalte mein Handy jetzt kurz ein, und wenn ich Thorsten nicht erreiche, spreche ich ihm die wichtigsten Infos auf die Mailbox, aber ohne zu sagen, wo wir sind. Dann schalte ich wieder ab. Ich will einfach nicht, dass Selim uns orten lässt. Ich bin sicher, unsere Handys sind so modern, dass man das mit denen kann. Jedenfalls zeigen sie einem das immer in den Krimis!“
„Hättest Thorsten ja längst mal fragen können!“, ärgerte Büsra ihre Freundin, erleichtert, dass sie zugestimmt hatte, ihren Freund anzurufen.
„Blabla!“, konterte Seyda, während sie schon die Pin in ihr Handy tippte, um es zu aktivieren. Gleich darauf wählte sie Thorstens Nummer.
Dr. Gerber und Jaron hatten alle Hände voll zu tun, die aufgelöste Celia zu beruhigen. Sie brauchten eine ganze Weile, bis die Worte wieder an ihr Ohr drangen.
Dabei schreckte Jaron, um sie in ihrem Kummer zu erreichen, sogar nicht davor zurück, richtig laut zu werden. Es war so ungewöhnlich für sein sonstiges Verhalten, dass es Celia zusammenzucken und endlich aufhorchen ließ.
„Celia, du musst dich jetzt beruhigen“, fügte er ein wenig sanfter hinzu. Dann überließ er Gerber das Reden.
„Frau Dörfer. Ihr Gefühl war nur bedingt richtig. Julien, so heißt er doch, ist ausgesprochen schwach. Aber er lebt. Die Nabelschnur hat sich um seinen Hals gewickelt, als er sich in Vorbereitung auf die Geburt gedreht hat. Wenn er auf herkömmlichem Weg auf die Welt käme, würde er sich erdrosseln. Wir müssen ihn per Kaiserschnitt holen. Und zwar jetzt!“
Er schwieg einen Augenblick, versuchte, in Celias Gesicht zu lesen, ob sie den Inhalt seiner Worte verstanden hatte.
„Haben Sie mich verstanden?“, suchte er nach einer deutlichen Antwort von ihr.
Celia nickte. Zögerlich. „Aber es geht ihm wirklich gut?“
Gerber schüttelte den Kopf.
„Nein, das habe ich Ihnen ja gerade versucht zu erklären. Sein Herz schlägt nur sehr schwach. Deshalb haben wir keine Zeit. Wir müssen jetzt operieren. Ist das in Ordnung?“
Hilfe suchend wandte er sich an Jaron. Der nickte, versuchte krampfhaft, seine Fassung zu bewahren. Schon Celia zuliebe.
„Celia, du musst dein Einverständnis für den Kaiserschnitt geben. Sonst geht es nicht. Hörst du?“
Endlich schien die Bedeutung der Worte des Arztes und ihres Lebensgefährten zu ihr vorzudringen. Ein Ruck ging durch ihren Körper. Sie setzte sich auf und Jaron konnte einen Hauch von der entscheidungsfreudigen und lebhaften Frau in ihr wiedererkennen, die sie sonst im Leben war.
„Okay, worauf warten Sie noch. Wo muss ich unterschreiben und wo ist der OP?“, sie wollte sich selbst auf den Weg machen.
„Ganz ruhig!“, der Arzt drückte sie zurück auf die Liege.
„Wir fahren Sie dort hin. Das Kind sollte so wenig Bewegung wie möglich mitbekommen.“
Ganz gegen ihre sonstige Art ließ Celia sich widerstandslos zurück auf die Liege sinken. Jaron griff nach ihrer Hand. Kraftlos überließ sie sie ihm, ohne jedoch seinen Händedruck zu erwidern.
„Hey, deine Hand ist ganz kalt!“, stellte er fest.
„Mir ist auch kalt!“, murmelte sie.
„Dr. Gerber, Dr. Gerber!“, Jarons Stimme überschlug sich. Celia schien ohnmächtig geworden zu sein.
Der Arzt, der gerade mit der Anästhesistin telefoniert hatte, drehte sich aufgeschreckt um. Er übernahm die Hand, die zuvor Jaron gehalten hatte, und prüfte den Puls.
„Frau Dörfer!“, er tippte ihr leicht mit der Hand gegen die Wange. Sofort öffnete Celia die Augen. „Alles in Ordnung mit Ihnen?“
„Ja, so weit es in Ordnung sein kann.“
Jaron war erleichtert. Eine Bedrohung Celias würde er nicht auch noch verkraften können. Es würde über seine Kräfte gehen.
Dabei hatte er schon einmal die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlte, die eigene Freundin in einer lebensbedrohlichen Situation zu sehen. Ohnmächtig, außer Stande, selber zu handeln, um an dem Zustand etwas ändern zu können.
Nur war damals ein Krimineller Schuld an der Situation und nicht ein Kind, das sie beide voller Freude und Liebe gezeugt hatten.
Mit aller Macht unterdrückte Jaron das immer stärker werdende Gefühl der Panik. Einer von ihnen musste in dieser Situation stark bleiben.
Zu seiner Erleichterung erschien in diesem Augenblick eine Schwester mit einem Bett. Celia wurde umgelagert. Ohne es sich anmerken zu lassen, atmete Jaron innerlich auf. Endlich wurde etwas unternommen. Dabei hatte er sich keine Gedanken darüber gemacht, welche Konsequenzen das für ihn haben würde. Er musste sich von Celia verabschieden. Er konnte sie nicht in den OP begleiten.
Noch nie hatte er ein solch schreckliches Gefühl empfunden wie gerade in diesem Moment, als sich die Tür des OP-Traktes hinter Celia, der Pflegerin und Dr. Gerber schloss.
„Was haben wir denn?“, erschreckte Thomas Heuser Richie und Thorsten, als er fast lautlos an sie herantrat.
Thorsten, ohnehin nicht von bester Laune, raunzte den Mediziner an. Der zuckte gleichgültig die Schultern. Er hatte ein dickes Fell. Er konnte gut austeilen, aber ebenso gut einstecken.
Obwohl man das vielleicht anders erwarten würde bei einem Mann, der vorwiegend mit Toten zu tun hatte.
Über dessen Privatleben wusste Thorsten nichts. Heuser hielt sich bedeckt. Gesprächen über das Leben außerhalb der Mauern der Gerichtsmedizin ging er aus dem Weg. Sowohl über sein eigenes als auch das der anderen.
Was seiner Beliebtheit keinen Abbruch tat. Man konnte über ihn nichts Schlechtes sagen. Fachlich noch viel weniger. Da war er eine Koryphäe.
Lachend hatte Thorsten ihn mal mit dem Gerichtsmediziner der Münsteraner Tatortserie verglichen. Professor Boerne. Heuser hatte es nicht kommentiert. Aber man sah ihm an, dass er sich geschmeichelt fühlte.
„Könntet ihr mal die ganzen Leute hier wegschaffen?“, blieb er seiner abgehackt spröden Art treu.
Richie war ihm allerdings dankbar für die klaren Worte. Für ihn war jeder Einzelne an einem Tatort einer zu viel. Sie versauten zu viele Spuren, die gerade an einem Ort wie diesem ohnedies schwer genug zu finden waren.
Die Streifenbeamten, die schon weit vor den anderen vor Ort gewesen waren, begannen die weiträumige Absperrung rund um den Fundort der Toten. Wie so häufig viel zu spät.
Thorsten wunderte sich immer wieder darüber, dass die Kollegen der Streife scheinbar nie zu begreifen schienen, wie wichtig es war, die Menschen so schnell wie möglich vom Schauplatz einer Tat fernzuhalten.
Erst wenn die Kripo eintraf, schienen sie sich der Bedeutung zu erinnern. Gerade wollte er eine Bemerkung in dieser Richtung machen, als das Läuten seines Handys ihn davon abhielt. Er trat einen Schritt zurück und begann zu reden, bevor er richtig abgenommen hatte.
Seyda unterbrach ihn lachend.
„Komm runter. Ist alles gut. Es tut mir leid, dass ich dir solche Sorgen gemacht habe. Büsra hat mir schon mächtig den Kopf deshalb gewaschen. Und deshalb rufe ich jetzt an.“
Auch als sie ihre Erklärung beendet hatte, schwieg er weiter. Es erschreckte Seyda. Sie hatte sich nicht vorstellen können, dass Büsra recht behalten könnte mit ihren Befürchtungen.
„Sag doch was. Es tut mir doch leid!“, flüsterte sie.
Thorsten hatte sie dennoch verstanden und es schien ihn zu berühren. Er räusperte sich.
„Du bist so dämlich!“, brachte er mühsam hervor. Es kostete ihn unglaublich Kraft, die Tränen der Erleichterung hinunterzuschlucken. Es wäre ihm peinlich vor den Kollegen. Seyda jedoch hörte sie raus.
„Entschuldigung. Bitte, ich mach es auch nie wieder!“, flehte sie, während sie ihre Tränen nicht unterdrückte.
„Heißt das, dass es eine Zukunft gibt?“, wollte Thorsten nach wie vor verunsichert wissen.
„Ja, ganz sicher!“
Thorsten schluckte, ließ die Erleichterung zu.
„Ich muss dir aber auch was sagen.“ Er zögerte einen Moment, bevor er fortfuhr.
„Celia ist in der Klinik. Ich kann aber keinen von beiden erreichen. Ich weiß es nur von der Einsatzleitung, als ich heute zu einem Fall gerufen wurde.“
„Es ist doch noch viel zu früh, oder?“ Seyda mochte Celia gerne. Dabei kannten sie sich noch nicht lange genug, um von Freundschaft zueinander sprechen zu können.
„Vielleicht vorzeitige Wehen. Muss ja nichts Schlimmes sein, was denkst du?“
„Ich weiß es nicht Thorsten! Soll ich zurückkommen?“
„Nein, wir können im Moment ja auch nichts machen. Rufst du mich heute Abend noch mal an?“
„Ja, mache ich!“
Erst jetzt bemerkte er, wie zittrig er die ganze Zeit gewesen war. Nur mit Mühe schaffte er es, sein Handy wegzustecken. Erst dann registrierte er, dass Richie ihn schon eine ganze Weile beobachtet haben musste.
„Celia oder Seyda?“ Saalmann war nicht ohne Grund ein fähiger Mann in seinem Job. Seine Beobachtungsgabe war enorm. Nicht nur in der Umgebung von Opfern.
„Seyda!“, lächelte Thorsten.
„Alles okay?“
„Jetzt wieder, ja!“ Und mit ein wenig Verzögerung. „Wie weit ist Heuser?“, wies er mit dem Kinn zu der unverrückt am Boden liegenden toten Frau.
Erst jetzt nahm er sie richtig wahr. Lebend musste sie eine Schönheit gewesen sein, wie er bemerkte.
Groß und schlank, feuerrotes Haar, in langen Locken. Thorsten vermutete blasse Hautfarbe, mit einem Hang zu Sommersprossen. Aber dieses Detail konnte er nur erahnen. Nicht nur die Entfernung zu ihr, auch die Verfärbung durch den Erstickungstod ließen eine genaue Beschreibung nicht mehr zu.
Heuser beendete seine Arbeit vorläufig. Sein eigentlicher Einsatz würde in den Räumen der Gerichtsmedizin fortgesetzt werden.
Thorsten wagte einen Vorstoß, den alle Gerichtsmediziner verachteten.
„Hast du schon was für uns?“
Heuser schüttelte hämisch den Kopf.
„Wann lernt ihr es? Nein, außer dem Augenscheinlichen, wofür ihr mich nicht gebraucht hättet. Die Frau ist erstickt. Könnte sich um Vergiftung handeln. Sie ist noch nicht lange tot. Aber auch dafür brauchtet ihr mich nicht. Das haben die Leutchen da drüben ja schon ausgesagt. Und alles andere? Wie gehabt!“
Ohne speziellen Gruß verließ er den Tatort und überließ Richies Leuten das Feld. Der verlor auch keine großen Worte mehr. Ab jetzt galt seine ganze Konzentration dem, was hier vielleicht zu finden war. Erst sehr viel später würde sich herausstellen, ob es ihnen helfen konnte. Umso wichtiger war es, möglichst nichts zu übersehen.
„Thorsten Brandt, Kripo Buxtehude. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Geht das?“
Weder der Schäfer noch das Ehepaar hätten es vermutet, aber Thorsten fühlte sich ungelenk und unerfahren ohne Celia an seiner Seite. Dabei hatte er schon genug Jahre auf dem Buckel.
Nicht nur die gemeinsamen Jahre mit Celia. Bevor er ins Alte Land kam, war er bereits in Hamburg tätig.
Ein Pflaster, das einem deutlich mehr abverlangte als die ländliche Umgebung im Alten Land. Aber er hatte viel von Celia gelernt, und sie war, ohne je unangenehm die Chefin rauszukehren, die leitende Ermittlerin im Team.
Seine Unsicherheit wegräuspernd, wartete er auf eine Reaktion der drei. Sie schienen alle noch mit dem Geschehen zu kämpfen. Doch sie nickten einhellig als Zeichen, für eine Befragung bereit zu sein.
„Das ist meine Frau Leah und ich bin Konrad Brake“, wies einer der beiden Männer mit dem Daumen hinter sich, ohne sich umzudrehen. So als wolle er vermeiden, noch einen Blick auf das Opfer werfen zu müssen.
„Das Zelt hier ist von unserer Silberhochzeit. Gestern haben wir sie gefeiert.“
„Und kennen Sie die Tote?“
Leah Brake würgte. Thorsten hoffte inständig, sie würde es einhalten können. Nicht nur, weil es Spuren überdecken könnte.
Wieder ergriff der Mann das Wort.
„Ja, es ist Dana Welsch. Sie arbeitet an meiner Schule. Ich bin dort Schulleiter.“ Er zögerte, ihm war sein Fehler aufgegangen.
„Sie arbeitete!“, setzte er seine Worte in die richtige Zeitform.
„Waren noch andere Kollegen aus der Schule zu Ihrem Fest geladen?“, wunderte sich Thorsten darüber, ein so privates Fest mit Arbeitskollegen zu begehen.
Jetzt hatte sich Leah Brake auch wieder im Griff.
„Mein Mann führt die Schule sehr kollegial. Man duzt sich und man ist einander verbunden. Dazu gehört dann auch, dass man sie zu privaten Veranstaltungen einlädt!“
„Das war Ihnen zu verbunden?“ Thorsten hatte leisen Zynismus aus den Worten gehört.
Konrad Brake ließ seiner Frau keine Gelegenheit, die Frage selber zu beantworten.
„Keineswegs. Meine Frau unterstützt mich in meiner Arbeit in allen Belangen. Und selbstverständlich haben wir die Gästeliste gemeinsam erstellt. Wie sollte es auch anders sein? Es war ja eine Silberhochzeit und nicht mein Geburtstag!“
Seine Ironie war keineswegs versteckt. Sie wurde bewusst von ihm eingesetzt.
Thorsten überging sie.
„Wie kommt es, dass Sie hier sind? Hat die Feier so lange gedauert?“
Obwohl schon die Kleidung des Ehepaars andeutete, dass seine Frage überflüssig war, wollte er sehen, wie sie darauf reagierten und welche Erklärung es für ihre Anwesenheit gab. Die Antwort überraschte ihn.
„Frau Welschs Lebenspartner hat uns heute in der Früh angerufen. Frau Welsch war nicht nach Hause gekommen. Da uns das beunruhigt hat, haben wir versprochen zu sehen, ob sie vielleicht hier versackt ist!“
„Ist das üblich? Ich meine, dass Ihre Kollegen versacken und nicht mehr nach Hause finden?“
Es war ein Bild, das dem Beamten von Lehrern noch nie gekommen war.





























