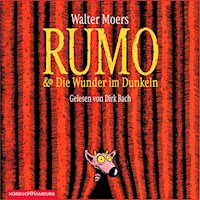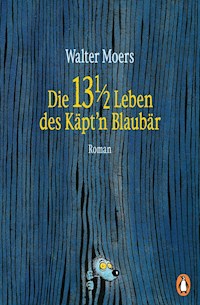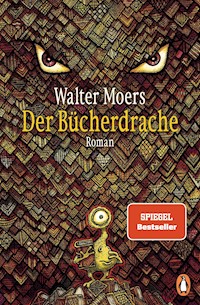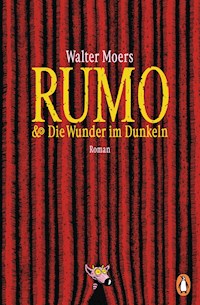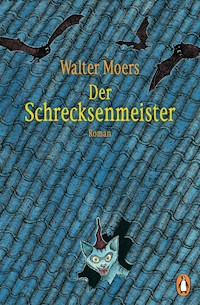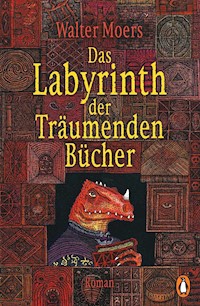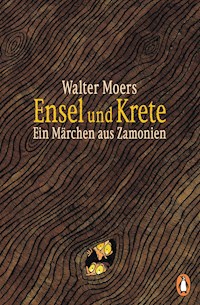
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Moers meets Grimm: ein geniales Match!
Angeln, Imkern, Beeren sammeln – ein aufregender Familienurlaub sieht anders aus. Auf der Suche nach einem handfesten Abenteuer verlässt das Geschwisterpaar Ensel und Krete den zivilisierten Bereich von Bauming. Tiefer und tiefer dringen die zwei jungen Halbzwerge in den Großen Wald vor: zu tanzenden Bäumen, Pflanzen mit Tiergesichtern und Wesen mit Tausend Stimmen. Da treibt sie der Hunger in ein drolliges kleines Haus… Mit dieser hintergründigen Parodie auf das berühmte grimmsche Märchen, erzählt von Großdichter Hildegunst von Mythenmetz, entführt Walter Moers in sein legendäres Zauberreich Zamonien, wo Fantasie und Humor gehörig außer Kontrolle geraten.
Dies ist ein Roman, der im legendären Bücherreich Zamonien spielt. Folgende weitere Zamonienromane sind bislang erschienen:
Die 13 1/2 Leben des Käptn Blaubär
Rumo & die Wunder im Dunkeln
Die Stadt der Träumenden Bücher
Der Schrecksenmeister
Das Labyrinth der Träumenden Bücher
Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr
Weihnachten auf der Lindwurmfeste
Der Bücherdrache
Die Insel der Tausend Leuchttürme
Außerdem: Das Einhörnchen, das rückwärts leben wollte: Zwanzig zamonische Flabeln
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ensel und Krete
Ein Märchen aus Zamonien von
Hildegunst von Mythenmetz
Aus dem Zamonischen übertragen, illustriert und mit einer halben Biographie des Dichters versehen von
Walter Moers
Mit Erläuterungen aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigaller
»Ensel und Krete« erschien erstmals 2000 beim Eichborn Verlag, Frankfurt am Main.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 beim Albrecht Knaus Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Rainer Wieland
Covergestaltung: bürosüd
Satz und Layout: Oliver Schmitt, Mainz
Illustrationen: Walter Moers
ISBN 978-3-641-13962-9V005
www.penguin-verlag.de
www.zamonien.de
Hildegunst von Mythenmetz
Kaum hatt’ mein Leben ich begonnen,Befand ich mich in einem finstren Wald,Da ich vom rechten Wege abgekommen.
Wie quälend, zu beschreiben die GestaltDer hohen, wilden, bösen Waldeshallen,Die, denk ich dran, erneu’n der Furcht Gewalt.
Zu nah war’n mir des Todes Krallen.Des Guten wegen, das er mir erwies,Bericht ich, was im Walde vorgefallen.
Hildegunst von Mythenmetz,
»Der Große Wald«, Erster Gesang
enn man in Zamonien das Bedürfnis nach vollkommener Harmonie hatte, dann machte man Ferien im Großen Wald. Ein Aufenthalt im Großen Wald garantierte Forstnatur in ihrer vielfältigsten Art, nur hier standen Nadel- und Laubbaum einträchtig beisammen, wucherten Zyklopeneichen neben Druidenbirken, streckten sich Hutzenlärchen neben florinthischen Rottannen, hausten Einhörnchen, Schuhu und Kassanderspecht. Dem dort lebenden Buntbärenvolk1 beim Zelebrieren seiner tagtäglichen Eintracht beizuwohnen war nach dem gewöhnlichen zamonischen Chaos so erholsam, daß sich daraus ein ganzer Tourismuszweig entwickelt hatte.
Kurz nach Betreten des Großen Waldes aus östlicher Richtung (aus anderen Richtungen kam kaum jemand; im Norden begrenzte ihn das Meer, im Westen die Finsterberge und im Süden die Wüste) hatte man eines der Waldhüterhäuschen zu passieren, die an jedem der Zugangswege standen. Darin saß immer ein gelber, roter, grüner oder in irgendeiner anderen Farbe bepelzter Buntbär mit einer schmucken Waldhüterkappe auf dem Kopf und begrüßte den Besucher mit einem vielzähnigen Lächeln.
Die vielen Zähne sagten: »Sieh nur, ich bin dir freundlich gesinnt, denn ich lächle! Aber beachte bitte auch, wie viele gesunde, lange und scharfe Zähne ich habe, denn trotz meines freundlichen Lächelns: Ich bin immer noch ein Bär. Und ich bin ein Bär, der einiges mitgemacht hat in seinem Leben, denn unser Volk wurde vor langer Zeit verschleppt und versklavt, und wir Buntbären sind seitdem etwas empfindlich, wenn uns jemand zu nahe tritt.
Also: Wenn du gekommen bist, um hier Ärger zu machen, dann wirf bitte noch einmal einen aufmerksamen Blick auf mein Gebiß und beachte bei dieser Gelegenheit auch meine wohlgeschärften Krallen. Ansonsten: Wenn du gekommen bist, um Ruhe, Zerstreuung und Eintracht zu finden – dann nur hereinspaziert!«
So sprachen die Zähne.
Der Waldhüter aber sagte seinen auswendig gelernten Spruch auf: »Willkommen im Buntbärenwald! Wildes Campieren, Phogarrenrauchen, Jagen, Verlassen der bezeichneten Wanderwege und offenes Feuer jeder Art verboten. Bitte entnehmen Sie dem Holzkasten unter meinem Fenster eine kostenlose Waldkarte. Gut Holz!«
War man ein Blutschink oder ein wilder Laubwolf und suchte Ärger oder hatte Lust auf eine Wirtshausschlägerei, dann sah man sich die Zähne des Buntbären nochmal genauer an und kehrte dann murrend um. War man aber in friedlicher Ferienlaune, dann zupfte man eine Karte aus dem Holzkasten, entfaltete sie und betrat, die informativen Zeichnungen studierend, den kühlen Wald.
Zunächst lernte man, daß die Buntbären für den von ihnen besiedelten Teil des Großen Waldes die Bezeichnung »Bauming« bevorzugten, wahrscheinlich weil das mehr nach einer zivilisierten Gemeinde klang als nach einem düsteren Gehölz. Die Bauminger Gemeinde umfaßte zehn Walddörfer von unterschiedlicher Größe und Sehenswürdigkeit: Im Zentrum lag Tannhausen, wo die Forstverwaltung und das Bürgermeisteramt ihren Sitz hatten, eine kleine adrette und stets wohlgekehrte Stadt vorwiegend aus Fachwerkhäusern, in der sich zahlreiche Handwerksbetriebe und Gemischtwarengeschäfte befanden. Ein ständiges Hämmern, Sägen und Klopfen erfüllte tagsüber das Dorf, erzeugt von emsigen Bären, die sich als Schreiner, Blech- oder Kunstschmiede verdingten.
Die Touristen logierten lieber im benachbarten Quellheim, wo es die meisten Pensionen, Biergärten und mehr Ruhe gab. Hier sprudelten die unterirdischen Quellen von Bauming am zahlreichsten ins Freie. Die Stadt war von einer Vielzahl murmelnder Bäche durchädert, die man teilweise mit kleinen Korkbooten befahren konnte, auf Wunsch mit Kerzenbeleuchtung und jodelndem Fährmann.
War einem Quellheim zu touristisch oder zu idyllisch, konnte man sich im nördlich gelegenen Waldläufers Rast einquartieren, einer Waldkolonie aus primitiv gezimmerten Zelten, die nur mit Blättern gedeckt waren. Hier logierte der robustere Naturfreund, der die direkte Konfrontation mit der Natur bevorzugte. In Waldläufers Rast schlief man auf dem Waldboden, wusch sich im Bach und kochte am offenen Feuer. Man durfte auch nackt und singend durch den Wald laufen, ohne gleich verhaftet zu werden.
Südlich von Quellheim lag Honing, die Imkerstadt. Hier hatten sich sämtliche Bienenzüchter Baumings versammelt, nicht zuletzt um das Herumschwirren von Stechbienen auf einen Ort zu konzentrieren. Honing durfte man nur in einem Schutzanzug betreten, den man sich in Tannhausen mieten konnte. Man konnte die Stadt schon einige hundert Meter entfernt hören, noch bevor die erste Behausung überhaupt zu sehen war: Das Gesumm der Millionen Insekten, die die Bienenkörbe der Imkereien bewohnten, war beeindruckend und ließ jeden Besucher die Verschlüsse seines Schutzanzuges ängstlich überprüfen.
Die meisten Touristen erledigten zügig ihre Geschäfte, kauften ein paar Gläser Honig, eine Flasche Met oder Kerzen aus Bienenwachs und machten sich wieder davon.
Von Honing aus kam man auf dem Weg zum Großwaldstädter See am Fort Palisadentrutz vorbei, der Heimat der Bauminger Waldwart, eine von angespitzten Holzstämmen bewehrte Festungsanlage, die von Touristen nicht betreten werden durfte und aus der zu jeder Tageszeit zackige Befehle und militärische Gesänge in den Wald schallten. Der Großwaldstädter See war besonders im Sommer einer der meistbesuchten Anziehungspunkte der Gemeinde, ein von unterirdischen Quellen gespeister Badesee mit Bootsverleih, mehreren Forellenräuchereien und einem legendären Pilzrestaurant.
Im von dort aus südöstlich gelegenen Akazien blieben die Buntbären gerne unter sich, es gab weder Pensionen noch Speisegaststätten, also ging man lieber gleich ins nördlicher gelegene Blockshütten, wo die Buntbären ihre Gemeinde ursprünglich gegründet und erste, noch sehr einfache Blockhäuser errichtet hatten, die heute als eine Art historische Bildungsstätte dienten. Gegen ein geringes Entgelt konnte man die Blockhütten betreten und bekam dann von den dort schauspielernden Buntbären eine Lektion in Bauminger Frühgeschichte: In rauhes Sackleinen gekleidet, saßen sie am primitiv gezimmerten Kamin, kochten Eichelsuppe und beklagten den harten Winter. Die Bärenkinder spielten tapfer mit nichts anderem als Tannennadeln und beteten die Bauminger Verfassung herunter. Dann trat ein Waldwächter auf, dramatisch stürmte er zur Tür herein, sang die erste Strophe des Brandwächterliedes und verkündete das Herannahen des schrecklichen Finsterberggewitters. Die Bärenfamilie klammerte sich jammernd aneinander, und draußen hinter der Hütte wurden Donnerbleche geschüttelt.
Hatte man sich an Härte und Armut des Pionierlebens genügend delektiert, zog man weiter ins nördlichere Reblausitz und kehrte dort in eine der zahlreichen Blaubeerweinkeltereien ein, um sich einen tüchtigen Schoppen zu genehmigen. Reblausitz bestand vorwiegend aus riesigen ausgedienten Blaubeerweinfässern, in denen sich die ansässigen Winzer eingerichtet hatten, eine weitere touristische Sehenswürdigkeit von Bauming. Hier konnte man den leicht säuerlichen Wein kaufen sowie kitschig bemalte Tonkrüge in Faßform und extrem unpraktische Korkenzieher aus poliertem Wurzelholz.
Milde berauscht wanderte man dann ins nahe Eichendorf, die letzte Bauminger Attraktion auf solch einem Rundgang. Besonders eindrucksvoll war Eichendorf, wenn man es in der Dämmerung erreichte. Es bestand aus mehreren Dutzend toter Eichen, vermutlich Jahrtausende alt, die auf einer leichten Anhöhe dicht beieinander standen und den Eindruck einer Versammlung unheimlicher Holzgespenster machten, die gemeinsam ihr grausames Schicksal beklagten. In den ausgehöhlten Bäumen saßen nach Einbruch der Dämmerung Buntbären, die, für die Touristen unsichtbar, herzzerreißend jammerten und heulten und Laternen schwenkten. Das tanzende Licht und das Geheul, das aus den Astlöchern drang, machte besonders auf Kinder mächtigen Eindruck. Entsprechend begruselt machte man sich auf den Weg zurück zur Unterkunft nach Quellheim oder Waldläufers Rast.
Neben den zehn Dörfern waren auf der Karte alle befestigten Wege Baumings verzeichnet, die niemand verlassen durfte, der kein Buntbär war. Wurde man nur einen Meter neben dem Pfad erwischt, dann zeigten die patrouillierenden Wächter des Forstes dem Übeltäter ihr Lächeln und ihr Gebiß und begleiteten ihn freundlich, aber bestimmt auf den rechten Weg zurück.
Es gab ein dichtes, verzweigtes System von Straßen und Wegen im bewohnten Teil des Waldes, manche schmal und kurvenreich, für Entdeckungsfreudige angelegt, andere breit genug, um von Kutschen befahren zu werden. Sie waren großzügig und kunstvoll beschildert, mit Wegweisern, humorigen Ermahnungstafeln (»Rauchen verboten! Durchatmen erlaubt!«) und Reklameschildern (»Waldgasthof Lindenlaub – gegrillte Forellen – Ameisenfarm für Kinder«), und immer wohlgefegt. Schließlich gab es noch die sogenannten Holzwege: schmale Pfade aus Holzplanken, fachmännisch in das Dickicht des Waldes gepflastert, letzte Vorstoßmöglichkeiten für den wagemutigeren Naturfreund, der dem Großen Wald so nah wie möglich auf die Rinde rücken wollte. Die Holzwege waren zumeist an Stellen des Gehölzes angelegt, wo Pflanzen seltene Wuchsgemeinschaften gegründet hatten oder besonders üppige Beerenbüsche zur Plünderung bereitstanden.
Je näher man aber der Grenze zum unbesiedelten Teil des Großen Waldes kam, desto schmaler und vereinzelter wurden die Wege, und schließlich gab es gar keine mehr, nur noch dunklen, wilden Urwald, umgeben von eindrucksvollen Verbotsschildern: »Weitergehen verboten! Lebensgefahr und gesundheitliche Dauerschäden drohen!« – »Halte ein, Wanderer, wenn Dir Dein Leben lieb ist!« – »Hinter diesem Schild lauert das Ungewisse – Kehre um!« und so weiter.
Den unzivilisierten Teil des Waldes betrat sowieso niemand, nicht einmal die Buntbären, denn dort war damals die große Waldspinnenhexe2 verbrannt worden, und es roch immer noch nach ihrem giftigen Sekret, das einen (angeblich) in den Wahnsinn treiben konnte.
Da durch das Wachhäuschenpersonal geistig instabile oder moralisch zweifelhafte Personen ausgefiltert wurden und sich außer den Buntbären sonst niemand in Bauming herumtrieb, kam keiner auf die Idee, die schönen Wanderwege zu verlassen und sein Leben, seine Gesundheit oder seinen Verstand beim Erkunden des inneren Kreises des Großen Waldes aufs Spiel zu setzen.
Ansonsten waren auf der Karte sämtliche Gasthäuser, Dampfbiergärten und Herbergen von Bauming verzeichnet. Sie trugen alle Namen, die größtmögliche Harmonie, Ruhe und Einklang mit der Natur signalisieren sollten: »Zum Verstopften Waldhorn«, »Einsiedelruh«, »Gasthaus Forstfrieden« oder »Beim Tannenfreund«. Die Karte verzeichnete weiterhin Laufwege für den sportlichen Wanderer, offizielle Pilzsammelplätze und die von Waldhütern organisierten öffentlichen Lagerfeuer, wo unter strenger Aufsicht Würstchen am Stock ins Feuer gehalten werden durften (Würstchen und vorgeschnitzte Stöcke gab es in den Gasthäusern zu kaufen, Stöckeabbrechen und Würstchenmitbringen war im Großen Wald untersagt).
Bei Einbruch der Nacht scheuchten die Wächter die Touristen höflich von den Wegen und zurück in die Gasthöfe, wo man bei einem Glas Honiggrog, Dampfbier oder Blaubeerwein auf der Veranda sitzen und den Geräuschen des Waldes zuhören konnte.
Nur im Großen Wald hatte man die Gelegenheit, den hysterischen Balzschreien des Getupften Keckerlings oder den Duetten des Doppelköpfigen Wollhühnchens zu lauschen. Nur hier morsten die Klopfzeichen des geheimnisumwitterten Kassanderspechts durch die Dämmerung, die angeblich verschlüsselt die Zukunft voraussagten (niemand konnte sie bisher enträtseln, aber viele Freizeit-Ornithologen arbeiteten daran). Ausschließlich in der Bauminger Dämmerung konnte man das rhythmische Knirschen vernehmen, das Erdgnömchen im Waldboden verursachten, wenn sie sich zwischen Birkenwurzeln paarten. Nur sanften Schrecken verursachten die Buhrufe des Dreiäugigen Schuhus.
Einhörnchen weinten aus Liebeskummer in der Nacht (weibliche Einhörnchen sind notorische Fremdgänger), Mooszikaden geigten ein Ständchen, Nachtigallen flöteten aparte Melodien. Und fünfhundertmal rief der Zamonische Glückskuckuck, um jedem ein langes Leben zu verheißen.
Wenn der Wind richtig stand und man ein sehr feines Gehör hatte, konnte man ganz tief im Inneren des Gehölzes die Sternenstauner stöhnen hören, die kein Tourist jemals zu sehen bekommen hatte, weil sie, wie die Buntbären geheimnisvoll raunten, im Waldboden des verbotenen Zentrums festgewachsen waren.
Zeigten sich die Waldgäste endlich schläfrig vom Wandern, vom Wein und der hypnotischen Musik des Forstes, dann wurden die Fackeln und Sturmlichter gelöscht, um weitere Insekten vor dem Verbrennungstod zu bewahren. Ein Waldhorn blies sanft zum Zapfenstreich, und schließlich ging man zu Bett und träumte vom Laub, das von den Bäumen fiel.
agsüber konnten die harmoniebegierigen Touristen an den gesellschaftlichen Aktivitäten der Buntbären teilnehmen. Morgens um sechs wurden sie mit Waldhörnern aus dem Schlaf geblasen, dann gab es Blaubeerpfannkuchen mit Ahornsirup oder Waldblütenhonig und frischen Eichelkaffee, in den besseren Gasthäusern serviert von dressierten Backenhörnchen. Anschließend erkundete man das Gehölz und seine vorbildliche Gemeinde.
Vor ihren schmucken, in vielen Farben gestrichenen Blockhäusern betrieben die Buntbären mit ihren Kindern Frühgymnastik, rotuniformierte Briefträger auf Einrädern verteilten die Post, kleine Buntbärjungs verkauften krakeelend die Tageszeitung, den Bauminger Forstfreund.
Einheimische standen hier und da zusammen und diskutierten lokale Ereignisse (»Soll die von Borkenmaden befallene Bauminger Blutbuche endlich gefällt werden oder nicht?«) oder zamonische Politik. Bienenstöcke wurden gelüftet und Forellen in den Rauch gehängt. Die Vielfarbigkeit der Buntbärenfelle gab der ganzen Szenerie einen malerischen Anstrich, den keine andere Gemeinde Zamoniens zu bieten hatte. Es war wie ein lebendiges Sinnbild der Harmonie vor dem beruhigenden Hintergrund des grünen Waldes. In Sechserformationen marschierten die Brandwächter durch den Forst, in der Rechten einen Eimer, in der Linken einen feuchten Lappen und das Brandwächterlied auf den Lippen:
»Knistern ist uns nicht geheuer Denn wo’s knistert, qualmt oft Feuer Prasseln auch läßt uns nicht kalt Denn wo’s prasselt, brennt der Wald
Ja, die Brandwächter, die sind wir Nur zum Löschen sind wir hier Feuer mit Wasser, Durst mit Bier …«
Buntbären in weißen Kitteln markierten Baumdoktoren und horchten wichtigtuerisch mit überdimensionalen Stethoskopen an Rinden und Astlöchern. Hier und da amputierten sie unter viel Brimborium mit Scheren und Sägen einen von Läusen befallenen Ast oder umwickelten von Spechten geklopfte Baumwunden mit Mullbinden, getränkt in essigsaurer Tonerde.
Laub wurde zu exakt gleich hohen Komposthügeln geschichtet, Ameisenstraßen kanalisiert und verkehrsberuhigt, und ständig wedelten Trupps von Waldfegern mit Reisigbesen die Tannennadeln von den Wegen, natürlich unter Absingen ihres Waldfegerliedes:
»Wir kehren und fegen, auf all unsren Wegen, hinweg mit den Nadeln, denn Nadeln sind zu tadeln« – und so fort.
Fliegende Händler offerierten an den meisten Weggabelungen heiße Maronen und kühle Waldmeisterlimonade als Wanderproviant. Der Große Wald war in seinem touristisch erschlossenen Bereich der mit Abstand bestorganisierte von ganz Zamonien.
Man konnte die Buntbärenschule besuchen (Anmeldung erwünscht, Gruppen bevorzugt) und von den hinteren Bänken aus den putzigen kleinen Buntbärchen beim Absingen von Waldverherrlichungsliedern oder dem Herunterbeten von Absätzen aus Professor Doktor Nachtigallers Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung zuhören. Freundliche, aber Autorität verströmende Lehrkräfte erläuterten die Gesetze der Photosynthese und des Chlorophyllkreislaufs.
Die Touristen durften an Schnupperkursen im Bienenzüchten und Giftpilzerkennen oder an öffentlichen Vorlesungen der Buntbärenverfassung (»Alle Buntbären sind ungleich«), Beerenkundeseminaren und freiwilligen Feuerwehrübungen teilnehmen.
Es gab mächtig viel zu unternehmen im Buntbärenwald. Väter angelten in dafür vorgesehenen Teichen nach gezüchteten Regenbogenforellen, während die Mütter mit kleinen dressierten Ferkeln nach Trüffeln suchten. In den Imkereien konnte man beim Honigfiltern zusehen und probeschmecken. Die kleineren Feriengäste durften mit Eimerchen an den Rändern der Wanderwege nach Himbeeren und anderen Waldfrüchten fahnden.
Dieser vorbildlichen Touristenkinderbeschäftigung gingen zumindest Ensel und Krete von Hachen nach, ein Geschwisterpärchen aus Fhernhachingen, das mit seinen Eltern schon seit zwei Wochen im Großen Wald logierte. Sie hatten sich weit vorgewagt und befanden sich gerade auf einem der Holzwege, an deren Säumen besonders fruchtreiche Beerensträuche wucherten.
»Hier ist eine Himbeere«, rief Krete und zupfte die überreife Frucht vom Stengel.
»Ich kann keine Himbeeren mehr sehen«, stöhnte Ensel und warf seinen Eimer auf den Boden.
Krete erschrak. Fhernhachen3 waren eine friedliebende, von extremer, ja fast fanatischer Sanftheit geprägte Daseinsform. Gefühlsausbrüche dieser Art gab es unter Fhernhachen äußerst selten.
»Jeden Tag Himbeeren suchen!« schimpfte Ensel. »Jeden Abend Himbeerpfannkuchen! Sie behandeln uns wie kleine Kinder.« Er trat gegen seinen Sammeleimer, daß die Beeren nur so durch die Luft flogen.
»Aber wir sind kleine Kinder!« widersprach Krete und bückte sich, um die Früchte wieder aufzusammeln. »Wir sind achteinviertel.« Ensel und Krete waren Zwillinge.
»Und wenn schon! Ich möchte mal richtig in den Wald, nicht nur auf den doofen Wegen rumschleichen. Ich will mal eine Höhle finden. Ich will auf einen Baum klettern.«
»Dann holt dich die böse Hexe!« mahnte Krete mit erhobenem Zeigefinger. Sie warf die aufgesammelten Beeren in ihren Eimer, was Ensel in seiner Erregung entging.
»Ach was Hexe! Die Hexe ist tot. Außerdem war es keine Hexe, sondern eine Riesenspinne, die wegen ihrer Kopfform Waldspinnenhexe genannt wurde.« Ensel war zwar erst achteinviertel, aber er kannte jede Gruselgeschichte von Zamonien.
»Mit Bäumen treibt man keinen Scherz – Auch die Birke spürt den Schmerz«, zitierte Krete die Bauminger Verfassung.
Ensel stöhnte. Die Parkwächter hatten es mit ihrer täglichen Gehirnwäsche beinahe geschafft, seine Schwester in eine fanatische kleine Buntbärin zu verwandeln. Es war an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Ensel kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, um auf seine Schwester den Eindruck der Unberechenbarkeit zu machen.
»Ich sag dir was«, flüsterte er mit jenem verschwörerischen Ton in der Stimme, den er immer anschlug, wenn er Krete in eine seiner Geschichten mit ungewissem Ausgang verwickeln wollte. »Wir gehen in den Wald, bis uns niemand mehr sieht. Und da klettere ich auf einen Baum. Nur einmal.«
»Das ist verboten.«
»Eben! Das ist ja der Spaß dabei.« Ensel lachte rebellisch.
Krete steckte sich ihren kleinen Finger in den Mund. Das tat sie immer, wenn sie darüber nachdachte, ob sie den Einflüsterungen ihres Bruders folgen sollte oder nicht.
»Aber was ist, wenn wir uns verlaufen?«
Ensel setzte eine überlegene Miene auf, eine Mischung aus Mitleid über die Ahnungslosigkeit seiner Schwester, Kaltblütigkeit und organisatorischem Weitblick. »Darüber habe ich nachgedacht. Wir verlaufen uns nicht. Wir haben die Himbeeren.«
»Die Himbeeren?«
Ensel lächelte. »Wir streuen die Himbeeren hinter uns aus. Alle paar Schritte eine. Und wenn wir zurückkommen, sammeln wir sie wieder auf.
Alter Trolljägertrick.«
»Hm«, sagte Krete und nahm den Finger wieder aus dem Mund.
Ensel warf die erste Beere ins Laub.
»Hier beginnt das Abenteuer!« rief er feierlich. »Wir lassen die Zivilisation hinter uns und erkunden als erste Fhernhachen den Großen Wald.«
Krete wurde es durch Ensels großspurige Ankündigung noch mulmiger.
»Aber nicht weit!«
»Nur so weit, bis ich eine Eiche gefunden habe, die würdig ist, von mir erstbeklettert zu werden.« Ensel marschierte voran und warf bei jedem vierten, fünften Schritt eine Himbeere hinter sich, während Krete ängstlich zurückblickte und nach Waldwächtern Ausschau hielt. So verschwanden die beiden im immer dichter werdenden Gehölz.
Einen Augenblick lang war Ruhe über der Lichtung. Dann knisterte es im Waldboden, vertrocknetes Laub flog auf, Erdkrumen platzten, und direkt neben der Himbeere wühlte sich ein Erdgnömchen aus dem Boden. Es trug ein dunkles maulwurfähnliches Fell, und sein Kopf hatte die erdgnömchentypische Bohrgewindeform. Strahlend vor Entdeckerstolz begutachtete es die saftstrotzende Waldfrucht. Dann erspähte es die nächste Beere, ein paar Meter weiter. Eine dritte, noch etwas weiter. Es warf die Hände zum Himmel und tanzte einen kurzen Erdgnömchentanz, wobei es rhythmisch brummte. Dies war der größte Fund vorgepflückter Himbeeren in der Geschichte seines Stammes. Ja, das könnte seine Bestrebungen, zum stellvertretenden Stammesvorsitzenden gewählt zu werden, mächtig voranbringen.
Das Erdgnömchen legte seine Wühlklauen auf die Beere und schloß für einen Moment der Besinnung die Augen. Sie würden ihn »Häuptling Viele Himbeeren« nennen. Das Gnömchen seufzte dankbar. Dann hob es die erste Beere auf und verschwand damit in seinem Tunnel, um seine Artgenossen darüber zu unterrichten, daß dort, wo diese köstliche Süßfrucht herkam, noch viel mehr davon waren.
s dauerte ungefähr hundert Himbeeren, bis die beiden eine Eiche gefunden hatten, die Ensel der Bekletterung würdig erschien. Krete wartete unten, die fast leeren Eimerchen in beiden Händen.
Zunächst stellte Ensel fest, daß das Schwierigste an einer Eichenbesteigung der Anfang ist. Das Problem lag im unteren Bereich des Baumes, wo die Eiche enttäuschend glatt und astlos war und kaum Halt bot.
Weiter oben, wo Ensel gerne gewesen wäre, rankte ein natürlich gewachsenes Klettergerüst der Spitzenklasse, mit Hunderten von ineinander verwucherten Ästen, Griffmöglichkeiten, Ranken und Rindenwülsten. Ensel konnte große Astlöcher erkennen, hinter denen sich offensichtlich geräumige Baumhöhlen befanden – welche womöglich mit verschollenen Goldschätzen gefüllt waren! Er konnte sich mühelos eine von Dublonen und Perlenketten berstende Holzkammer vorstellen, in der womöglich auch noch ein schauriges Ganovengerippe saß, einen goldenen Säbel in den gebleichten Fingerknochen und eine Made in der linken Augenhöhle. Ensel keuchte vor Einbildungskraft.
Aber zunächst gelang es ihm nur, auf eine Erdwurzel zu steigen, die sich vielleicht einen Meter hoch aus dem Waldboden wölbte.
»Na?« fragte Krete. »Was ist?«
»Ich suche noch nach der besten Route zur Besteigung. Die Eiche ist das Hochgebirge unter den Bäumen.«
Krete fing bereits an, sich zu langweilen. Das Innere des Waldes hatte sich als weniger märchenhaft erwiesen, als sie es sich vorgestellt hatte. Es gab keine Einhörner, die an Flußbiegungen zur Tränke gingen, keine verwunschenen Schlösser aus Glas, nicht mal eine Riesenbohnenranke, die in die Wolken ragte. Ja, da waren kleine fliegende Elfenwespen, aber die schwirrten im Hochsommer auch in Fhernhachingen herum. Es gab hier wesentlich mehr Bäume als im äußeren Kreis des Waldes, das war alles. Es war einer von diesen typischen Ferientagen: Der Spätsommer bäumte sich noch einmal mit aller Kraft gegen den nahenden Herbst, die Sonne brannte viel zu heiß, die Mücken schwirrten, man hatte Durst und wartete auf ein Wunder, das nicht geschah.
Ensel klebte inzwischen in ungefähr anderthalb Metern Höhe am Baumstamm. Er hatte ein paar Vorsprünge in der Rinde genutzt, um dorthin zu gelangen, die Arme und Beine bis zum Zerreißen gestreckt. Sein Keuchen und Ächzen verstärkte den Eindruck, daß er von unsichtbaren Kräften gevierteilt wurde. Der Ast, den er eigentlich erreichen wollte, war noch gut einen Meter von ihm entfernt. Er kam weder vorwärts noch zurück.
»Hmpf!« machte Ensel.
Ein Korallensalamander erwachte in seiner Behausung unter der vertrockneten Baumrinde, geweckt durch die Ruhestörung. Der Salamander steckte seinen Kopf ins Freie, wurde vom Sonnenlicht geblendet und schlüpfte in Ensels Ärmel, den er, halbblind und schlaftrunken, für ein Astloch hielt.
Ensel schrie vor Entsetzen, als er das schleimige Etwas unter seiner Achselhöhle spürte. Er ließ die Eiche los, fiel auf den weichen Waldboden, sprang sofort wieder auf und tanzte schreiend durch die Gegend, sehr zu Kretes Verblüffung. Der Salamander flitzte zum Hemdkragen heraus, plumpste ins Laub und tauchte darin ein wie in tiefe See.
Krete sah ihren Bruder neugierig an: »Was war das denn?«
Ensel stand schwer atmend vor der Eiche.
»Das war gar nichts«, keuchte er. »Wir gehen zurück.«
»Wo sind die Himbeeren?« fragte Krete.
Nachdem sie eine halbe Stunde lang die Lichtung vergeblich nach den Beeren abgesucht hatten, setzten sich Ensel und Krete ins Gras.
»Und was machen wir jetzt?« fragte Krete.
»Halb so wild«, winkte Ensel ab. »Wir sind ja nicht weit gegangen. Wir gehen da lang, wo wir hergekommen sind. Da vorne lang. Und dann immer geradeaus.«
»Aber wir sind von da gekommen.« Krete zeigte in die entgegengesetzte Richtung.
»Gar nicht!«
»Wohl!«
»Gar nicht!«
»Wohl!«
»Gar nicht!«
»Wohl!«
Sie schwiegen eine Weile, wie immer nach ihren erschöpfenden Diskussionen.
»Wir gehen da lang. Da ist Norden«, sagte Ensel schließlich und zeigte in den Wald hinein. In den Abenteuergeschichten des Prinzen Kaltbluth,4 die er so gerne las, ging man in Konfliktsituationen immer nach Norden.
»Woher weißt du, daß da Norden ist?«
»Vom Stand der Sonne.«
Ensel und Krete rafften sich auf und marschierten in die Richtung, die Ensel zum Norden erklärt hatte. Es war jetzt genau Mittag, denn die Sonne stand im Zenit über dem Großen Wald.
Kühlschattige Waldeinsamkeit umfing die beiden, als sie durch die hohen Baumhallen schritten. Jeder Tritt war ein Ächzen, jedes Atmen ein Seufzer, der Wald schien sämtliche Geräusche auf geheimnisvolle Weise bedeutsamer zu machen. Ein endloser Flickenteppich aus grünem, braunem und gelblichem Laub erstreckte sich unter ihnen in jede Himmelsrichtung. Alles war in einen unwirklichen rotbraunen Glanz getaucht, der vom Widerschein des Lichtes auf den Baumrinden herrührte. Vieläugig starrte der Wald die Kinder aus seinen Astlöchern an. Ensel kam es vor, als habe er ohne Erlaubnis den Palast eines Zauberers betreten, in dem das Mobiliar belebt war und ihn heimlich beobachtete.
Nachdem er seine Schwester kurz von der Seite gemustert hatte, beschloß er, seine Empfindungen für sich zu behalten. Ihr Kopf zuckte bei jedem Knacken im Wald hin und her wie der eines jungen nervösen Vögelchens.
Ensel fand, daß die meisten Bäume gleich aussahen. Außer Tannen, Birken und Eichen, die konnte er von anderen Bäumen unterscheiden, aber wenn alle Bäume Tannen waren, wie es nun seit einiger Zeit der Fall war, kam es wieder aufs gleiche raus. Er hatte kein Beil oder Messer, um die eine oder andere Borke zu markieren, und er konnte soviel mit einem Ast auf eine Tanne eindreschen, wie er wollte, die Lektion war immer die gleiche: Man kann einen Baum nicht mit einem Baum kennzeichnen. Daß man Markierungen zu hinterlassen hatte, wenn man durch die Wildnis wanderte, wußte er aus der Lektüre seiner Prinz-Kaltbluth-Bücher. Also nahm er sich kleinere Pflanzen vor.
Schon mehrmals waren die beiden an Plätzen vorbeigekommen, die ihnen bekannt vorkamen: Farne, die Ensel geknickt, oder Brennnesselgebüsche, die er zur Kennzeichnung zertrampelt hatte. Gelegentlich hatten sie den Gesang von Brandwächtern gehört und dann ihre Marschrichtung geändert. Aber sie hatten sich nicht getraut, um Hilfe zu rufen, weil sie befürchteten, mitsamt ihren Eltern aus dem Wald geworfen zu werden.
Sie wollten sich heimlich wieder auf einen Weg schleichen und so tun, als ob nichts geschehen wäre. Jetzt waren sie gut zwei Stunden unterwegs, und den Gesang der Wächter hatten sie auch seit längerer Zeit nicht mehr vernommen.
Sie betraten eine Lichtung, auf der ein umgestürzter Baumriese lag. Er war hohl und schwarz verkohlt, als sei er vom Blitz getroffen worden und ausgebrannt, wahrscheinlich schon vor sehr vielen Jahren, denn er war von
Schwamm und Pilzen bewachsen und tief in den Erdboden eingesunken. Sein Aussehen befeuerte erneut Ensels Phantasie. Die größere Öffnung des Stammes sah aus wie ein gähnender Schlund, aus dem eine dicke grüne Mooszunge hing, ein Astloch wirkte wie eine skelettierte Augenhöhle, und der einzige übriggebliebene Ast krümmte sich verzweifelt in die Höhe, der Kralle eines toten Vogels ähnlich.
Ensel wußte aus der Bauminger Forstschule, daß die Buntbären im bewohnten Bereich des Großen Waldes keine umgestürzten Bäume duldeten, weil sich darin gefährliche Kolonien von Wildhornissen bilden konnten. Der gefällte Baum bedeutete, daß sich Ensel und Krete nicht mehr im zivilisierten Teil des Waldes befanden. Ensel und Krete hatten sich im Großen Wald verlaufen.
Nun, bis zu dieser Stelle wird Ihnen dieses zamonische Märchen bekannt vorgekommen sein, nicht wahr? Oder zumindest das gleichnamige Kinderlied: Ensel und Krete, die gingen in den Wald … Nur die leicht modernisierte Fassung, die Sache mit dem Buntbärwald, hat Sie bei der Stange gehalten, stimmt’s? Tja, das war ein kleiner professioneller Trick, um Sie dazu zu veranlassen, bis hierhin durchzuhalten – wenn Sie diesen Satz lesen, sind Sie darauf reingefallen. Darf ich mich zunächst vorstellen?
Mein Name ist Hildegunst von Mythenmetz, und er dürfte Ihnen wohl zur Genüge bekannt sein. Wahrscheinlich haben Sie in der Zamonischen Elementarschule meine Finsterbergmade auswendig aufsagen müssen, bis Ihnen die Mandeln gebrannt haben. Das ist der Nachteil davon, wenn man als Schriftsteller einer Daseinsform angehört, die mit etwas Glück tausend Jahre alt werden kann: Man muß selber miterleben, wie man zum Klassiker wird. So ähnlich stelle ich es mir vor, bei lebendigem Leib von Würmern aufgefressen zu werden. Aber es geht hier nicht um die Befindlichkeiten eines Erfolgsschriftstellers.
Worum geht es dann? Es geht um Großes, natürlich: Sie, der Leser, dürfen Augenzeuge einer Sternstunde der zamonischen Literatur sein. Sie haben es vielleicht noch nicht bemerkt, aber Sie sind schon mittendrin in einer von mir entwickelten und vollkommen neuartigen schriftstellerischen Technik, die ich die Mythenmetzsche Abschweifung nennen möchte.
Diese Technik ermöglicht es dem Autor, an beliebigen Stellen seines Werkes einzugreifen, um, je nach Laune, zu kommentieren, zu belehren, zu lamentieren, kurzum: abzuschweifen. Ich weiß, daß Ihnen das jetzt nicht gefällt, aber es geht nicht darum, was Ihnen gefällt. Es geht darum, was mir gefällt. Wissen Sie eigentlich, wie mühselig es für einen Schriftsteller ist, den gleichmäßigen Fluß seiner Erzählung aufrechtzuerhalten? Natürlich nicht, woher sollten Sie als bloßer Konsument das auch wissen? Für Sie ist der anstrengende Teil mit dem Gang in die Buchhandlung beendet, jetzt haben Sie sich mit einer Tasse heißer Honigmilch in Ihren Lieblingssessel gelümmelt, tauchen ein in den Strom der von Meisterhand verwobenen Worte und Sätze und lassen sich von ihm von Kapitel zu Kapitel tragen. Aber vielleicht können Sie wenigstens einmal versuchen, sich vorzustellen, wie sehr dem Autor manchmal seine Charaktere, der Ereigniszwang, die Dialogroutine und die Beschreibungspflicht auf die Nerven gehen? Wie peinigend es für ihn ist, ständig in feingedrechselten Stanzen oder makelloser Prosa zu formulieren? Wie er sich dann danach sehnt, einmal den Spannungsbogen zu entdehnen, auf die erzählerische Kohärenz und künstlerische Formgebung zu pfeifen und einfach nur ein bißchen zu plaudern?
Worüber? Na, wonach ihm eben gerade ist – was geht Sie das an? Schreibe ich Ihnen vielleicht vor, worüber Sie in Ihrer Freizeit zu plaudern haben?
Mit der Mythenmetzschen Abschweifung wird dem zamonischen Schriftsteller endlich die Freiheit gegeben, die allgemein für selbstverständlich gehalten wird – zu reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ohne darüber nachzudenken, was irgendein mißgünstiger Schnösel von Literaturkritiker davon halten könnte. Ohne darauf zu spekulieren, dafür den Gralsunder Silbenpokal verliehen zu bekommen. Worüber? Wie wäre es zum Beispiel mit dem Wetter? Oder mit den Problemen, die ich gelegentlich mit meiner Gallenblase habe? Oder wie wäre es damit, wenn ich Ihnen einmal das mir Naheliegendste beschreibe, meinen Arbeitsplatz? Ist das nicht hochinteressant: Der berühmte Dichter öffnet sein Allerheiligstes, seine vielfach verriegelte Schreibklause, und bittet den Leser hinein, damit der ausgiebig darin herumschnüffeln kann. Ja, hereinspaziert, bitteschön, da wäre zunächst mein Arbeitstisch: fünf Quadratmeter seltenstes Nurnenwaldholz, blankpoliert und blaugefaßt, mit Tintenspritzern und spontanen Gedichtzeilen übersät, auf vier soliden rundgedrechselten Beinen direkt unter einem dreigeteilten großen Fenster stehend. Der Blick geht hinaus auf meinen prächtigen, ungezähmten Garten, in dem sich die zamonische Kleinflora dramatische Existenzkämpfe liefert, die der Befruchtung meiner Einbildungskraft nicht unzuträglich sind. Im Moment kann ich davon nur das Wenige erkennen, was vom Glimmen vereinzelter Glühwürmchen erleuchtet wird, denn es ist eine fast mondlose Nacht. Brennende Kerzen tauchen mein Arbeitszimmer in warmes, leicht wogendes Licht, meine Lieblingsform der Beleuchtung, erzeugt von sieben Talgstumpen in einem silbernen Leuchter aus einer Gralsunder Metallmanufaktur, den ich auf einem Flohmarkt von einem feilschsüchtigen Midgardzwerg erstanden habe. In die sieben Arme des Leuchters sind in Altzamonisch die sieben Grundtugenden des Dichters eingeprägt:
1. Furcht
Die Furcht ist außer der Schwerkraft die mächtigste Kraft im Universum.
Die Schwerkraft setzt den toten Gegenstand in Bewegung, die Furcht das lebende Wesen. Nur der Furchtsame ist zu Großem befähigt, der Furchtlose kennt keinen Antrieb und verliert sich im Müßiggang.
2. Mut
Das scheint der ersten Grundtugend zu widersprechen, aber man braucht Mut, um die Furcht zu überwinden. Man braucht Mut, um den Fährnissen der literarischen Unternehmung standzuhalten, als da sind: Schreibhemmung, unsensible Lektoren, zahlungsunwillige Verleger, gehässige Kritiker, niedrige Verkaufszahlen, ausbleibende Preise usw.
3. Vorstellungskraft
Es gibt genügend zamonische Schriftsteller, die sehr gut ohne diese Tugend durchkommen, man erkennt sie daran, daß ihre Werke vorwiegend um sie selbst kreisen oder von aktuellen Ereignissen handeln. Diese Schriftsteller schreiben nicht, sie schreiben nur auf, langweilige Stenotypisten ihrer selbst und der Alltäglichkeit.
4. Orm
Genaugenommen keine echte Tugend, eher eine geheimnisvolle Macht, die jeden guten Schriftsteller umgibt wie eine Aura. Niemand kann sie sehen, aber der Dichter kann sie spüren. Orm, das ist die Kraft, die einen die ganze Nacht wie im Fieber schreiben, einen tagelang an einem einzigen Satz feilen, einen das Lektorat eines dreitausendseitigen Romans lebend überstehen läßt. Orm, das sind die unsichtbaren Dämonen, die um den Dichtenden tanzen und ihn auf seine Arbeit bannen. Orm, das ist der Rausch und das Brennen. (Ormlose Dichter siehe unter 3.)
5. Verzweiflung
Der Humus, der Torf, der Kompost der Literatur, das ist die Verzweiflung. Zweifel an der Arbeit, an den Kollegen, am eigenen Verstand, an der Welt, am Literaturbetrieb, an allem. Ich habe es mir zur Regel gemacht, mindestens einmal pro Tag für mindestens fünf Minuten an irgend etwas zu verzweifeln, und sei es nur an den Kochkünsten meiner Haushälterin. Das damit einhergehende Lamentieren, Händegenhimmelwerfen und Blutwallen sorgt übrigens für die notwendige körperliche Betätigung, die ja ansonsten im schriftstellerischen Leben chronisch zu kurz kommt.
6. Verlogenheit
Ja, sehen wir der Sache ruhig ins Gesicht: Alle gute Literatur lügt. Beziehungsweise: Gute Literatur lügt gut, schlechte Literatur lügt schlecht – aber die Unwahrheit sagen beide. Schon der bloße Vorsatz, die Wahrheit in Worte fassen zu wollen, ist eine Lüge.
7. Gesetzlosigkeit
Jawohl, der Dichter gehorcht keinen Gesetzen, nicht einmal denen der Natur. Frei von allen Fesseln muß sein Schreiben sein, damit seine Dichtung fliegen kann. Gesellschaftliche Gesetze sind ebenfalls verpönt, besonders die von Anstand und Sitte. Und auch moralischen Gesetzen darf sich der Dichter nicht unterwerfen, damit er gewissenlos das Werk seiner Vorgänger plündern kann – Leichenfledderer sind wir alle.
Herrje, ich schweife ab! Aber macht ja nichts, schließlich ist dies eine Mythenmetzsche Abschweifung. Fahren wir also fort in der Beschreibung meines Arbeitsplatzes: Links und rechts neben Schreibtisch und Fenster stehen an weißgetünchten Wänden zwei schmucklose schwarze Holzregale, die an den Erstausgaben meiner eigenen Werke schwer zu tragen haben. Gerne lasse ich während der Arbeit meinen Blick über die Buchrücken schweifen, allein die stattliche Anzahl beweist mir, daß das Orm stets mit mir war. Mir gegenüber, auf der langen Fensterbank aneinandergereiht, steht meine Referenzbibliothek.
Da ich aufgrund meiner Zugluftempfindlichkeit die Fenster nie öffne (schon der zarteste Lufthauch kann meine Mandeln zur Schwellung bringen), kann ich die Fensterbank als Regalbord nutzen. So finden sich meine mir liebsten Lexika und sonstigen Nachschlagewerke nur auf Armeslänge von mir entfernt: zunächst natürlich das Zamonische Wörterbuch von A–Z, die Gralsunder Universitätsausgabe in ihrer aktuellsten Fassung. Ich benutze es nie, weil es mir zu schwer zum Heben und mir selbstverständlich jedes zamonische Wort aufs intimste vertraut ist, aber es ist ein gutes Gefühl für einen Schriftsteller, seine Muttersprache komplett zwischen zwei Buchdeckel gebündelt und gebändigt zu sehen. Manchmal verzweifle ich am Zamonischen, und dann genügt ein einziger Blick auf das Wörterbuch, um mich zu beruhigen: Was sich von einem Grüppchen vertrottelter Sprachwissenschaftler in das Korsett eines Lexikons zwängen läßt, werde ich mir ja wohl auch noch gefügig machen können! Manche Bücher wirken schon durch bloße Anwesenheit. Direkt daneben das Zamonische Namenregister. Zwei Bekenntnisse: Ja, ich entlehne ihm gelegentlich die Namen meiner Romangestalten, und ja, ich habe es aus der öffentlichen Bibliothek entwendet, denn es ist nicht im Buchhandel erhältlich. Wenn man sich selber Namen ausdenkt, neigt man entweder zum Überschwang oder zur Banalität, und mit dem geballten Erfindungsreichtum sämtlicher Generationen eines ganzen Kontinents braucht man es gar nicht erst aufzunehmen: Photan von Tortengetz, Enk Orr, Ölemenn Zock, Chenkchenk Hühnchen, Pantiffel Voliander, Üleg Plo, Opert Untermtisch, Blahack Blaha – ich zitiere wahllos aus diesem unersetzlichen Nachschlagewerk.
Ebenfalls von unschätzbarem Wert ist Das Buch der Inneren Befindlichkeiten