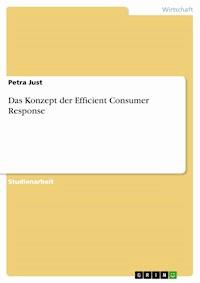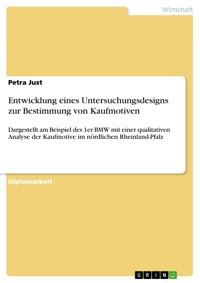
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich BWL - Offline-Marketing und Online-Marketing, Note: 1,0, Hochschule Koblenz (ehem. FH Koblenz) (Betriebswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: „Es gibt oft große Unterschiede zwischen dem, was die Kunden sagen und was sie tun, zwischen dem, was sie tun und was sie im Innersten wirklich wollen, und zwischen dem, was sie sich vornehmen und was sie aufgrund einer Sinnesänderung in letzter Minute dann tatsächlich tun.“ Diese Widersprüche zu verstehen und die Kaufmotive seiner Kunden zu kennen, wird für ein Unternehmen in der heutigen Welt immer wichtiger. Der in der westlichen Welt schon lange vorherrschende und in immer weiteren Teilen der Welt zunehmende Käufermarkt, ein immer höherer Konkurrenzdruck in einem globalisierten Umfeld, immer kürzer werdende Produktlebenszyklen, ein ansteigender Individualisierungsgrad in der Gesellschaft und daraus resultierende immer differenziertere Angebote erfordern eine immer differenziertere und differenzierende Ansprache der Verbraucher. Die Kenntnis von Kaufmotiven ermöglicht die motivgerichtete Ansprache von Konsumenten. Nicht die rational genannten, sondern die unbewussten, inneren Beweggründe für einen Kauf können in der Kommunikation aufgegriffen werden und somit ein Produkt und damit letztlich die ganze Unternehmung zum Erfolg führen. Ziel dieser Arbeit ist es, ein Untersuchungsdesign zur Ermittlung von Kaufmotiven im Automobilmarkt zu erstellen. Eine standardisierte Vorgehensweise zur Ermittlung von Kaufmotiven für Automobile wurde bislang nicht entwickelt, weshalb diese Arbeit als Pilotstudie zu betrachten ist. Neben der theoretischen Herleitung des Designs zur Ermittlung der Kaufmotive umfasst die Arbeit eine empirische, qualitative Vorstudie. Diese Vorstudie dient der Bildung von Hypothesen, die in einer aufbauenden quantitativen Studie zu untersuchen sind. Neben der Ermittlung des zukünftigen Forschungsbedarfs soll die Vorstudie bereits erste Anhaltspunkte über die Motivstrukturen der Käufer des BMW 1er und dem Unternehmen BMW Hinweise für die Gestaltung seiner Kommunikationsmaßnahmen liefern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Page 4
Abkürzungsverzeichnis IV
Abkürzungsverzeichnis
AG Aktiengesellschaft BFW Bayerischen Flugzeug-Werke BMW Bayrische Motoren Werke bspw. beispielsweise bzw. beziehungsweise bzgl. bezüglich d. Verf. die Verfasserin engl. englisch ggf. gegebenenfalls GfK Gesellschaft für Konsumforschung GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung IAA Internationale Autoausstellung IEA Internationale Energieagentur i.d.R. in der Regel i.S.v. im Sinne von KW Kilowatt lat. lateinisch Mio. Millionen Mrd. Milliarden NCBS New Car Buyer Survey o.S. ohne Seite Pkw Personenkraftwagen PR Public Relations RLP Rheinland-Pfalz S-O-R Stimulus-Organismus-Response S-R Stimulus- Response TÜV Technischer Überwachungs-Verein VW Volkswagen USP Unique Selling Proposition u.a. unter anderem u.U. unter Umständen z.T. zum Teil
Page 5
Page 7
Einleitung Seite 1
1 Einleitung
1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung
„Es gibt oft große Unterschiede zwischen dem, was die Kunden1sagen und was sie tun, zwischen dem, was sie tun und was sie im Innersten wirklich wollen, und zwischen dem, was sie sich vornehmen und was sie aufgrund einer Sinnesänderung in letzter Minute dann tatsächlich tun.“2
So fassenKotler/BliemelDiskrepanzen des Käuferverhaltens zusammen, mit denen Entscheider im Unternehmen konfrontiert werden und worauf sie sich so gut wie möglich einzustellen versuchen. Hierbei hilft es zu wissen, was ursächlich ist für solche Widersprüche. Wie entstehen derartige Divergenzen? Einen Erklärungsbeitrag liefert die Kaufverhaltensforschung mit dem Motivkonstrukt3. Demnach ist - vereinfacht gesagt - der Kauf eines bestimmten Produkts immer das Ergebnis einer Reihe von Erfahrungen und Assoziationen, die häufig nicht offenkundig und dem Individuum nicht bewusst sind. Darüber hinaus müssen die nicht wahrgenommenen, einem Kauf zu Grunde liegenden Motive auch nicht immer mit dem übereinstimmen, was dem Individuum rational sinnvoll erscheint. Aus dieser Konstellation von Bewusstem und Unbewusstem, Rationalem und scheinbar Irrationalem ergeben sich die beschriebenen Widersprüchlichkeiten.4
Diese Widersprüche zu verstehen und die Kaufmotive seiner Kunden zu kennen, wird für ein Unternehmen in der heutigen Welt immer wichtiger. Der in der westlichen Welt schon lange vorherrschende und in immer weiteren Teilen der Welt zunehmende Käufermarkt, ein immer höherer Konkurrenzdruck in einem globalisierten Umfeld, immer kürzer werdende Produktlebenszyklen, ein an-1Kunde,Entscheider, Käufer und Konsument sind unterschiedliche Rollen, die je nach Zielgerichtetheit in Theorie und Praxis differenziert werden. Da die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte qualitative Studie (s. Kap. 3) die Annahme bestätigen konnte, dass diese Rollen beim Produkt Automobil i.d.R auf eine Person fallen, findet an dieser Stelle und im Folgenden keine explizite Differenzierung der Begriffe statt.
2Vgl. Kotler, Bliemel, (Marketing-Management, 2001), S. 323.
3Im Verlauf der Arbeit wird auf die inhaltlich verwandten Begriffe Bedürfnis, Emotion, Motiv, Einstellung im Einzelnen eingegangen. An dieser Stelle ist folgende Definition ausreichend: Der Begriff Motiv [lat. movere - bewegen; d. Verf.] dient als Sammelname für verschiedene Bezeichnungen wie Bedürfnis, Beweggrund, Streben usw. „Bei allen Bedeutungsunterschieden im Einzelnen verweisen alle diese Bezeichnungen auf eine ‚dynamische’ Richtungskomponente. Es wird eine Gerichtetheit auf gewisse, wenn auch im Einzelnen recht unterschiedliche […] Zielzustände angedeutet.“ Vgl. Heckhausen, (Motivation und Handeln, 1980), S. 24. Eine weitergehende Definition des Begriffs folgt in Abschn. 2.2.3.2.1.
4Vgl. Knispel, (Tiefenbefragung bei Kaufmotiven, 1953), S. 41.
Page 8
Einleitung Seite 2
steigender Individualisierungsgrad in der Gesellschaft und daraus resultierende immer differenziertere Angebote erfordern eine immer differenziertere und differenzierende Ansprache der Verbraucher. Die Kenntnis von Kaufmotiven ermöglicht die motivgerichtete Ansprache von Konsumenten. Nicht die rational genannten, sondern die unbewussten, inneren Beweggründe für einen Kauf können in der Kommunikation aufgegriffen werden und somit ein Produkt und damit letztlich die ganze Unternehmung zum Erfolg führen.
Ziel dieser Arbeit ist es,ein Untersuchungsdesign zur Ermittlung von Kaufmotiven im Automobilmarkt zu erstellen.Eine standardisierte Vorgehensweise zur Ermittlung von Kaufmotiven für Automobile wurde bislang nicht entwickelt, weshalb diese Arbeit als Pilotstudie zu betrachten ist.
Die Entwicklung des Untersuchungsdesigns wird in Zusammenarbeit mit BMW Hanko, Koblenz, am Beispiel des BMW 1er (gesprochen „Einser“) durchgeführt, mit dem BMW im Jahr 2004 erstmals seit den 60er Jahren wieder in das Marktsegment der Premium-Kompaktklasse zurückkehrte.5Das neue Modell erfreut sich großen Zuspruchs, die Absatzzahlen sind zufrieden stellend. Mit tief gehenden Erkenntnissen über die Motive der Käufer dieses Modells erhofft sich BMW Hanko, Kommunikationsmaßnahmen ergreifen zu können, die den Erfolg noch weiter ausbauen.
Neben der theoretischen Herleitung des Designs zur Ermittlung der Kaufmotive umfasst die Arbeit eine empirische, qualitative Vorstudie. Diese Vorstudie dient der Bildung von Hypothesen, die in einer aufbauenden quantitativen Studie zu untersuchen sind. Neben der Ermittlung des zukünftigen Forschungsbedarfs soll die Vorstudie bereits erste Anhaltspunkte über die Motivstrukturen der Käufer des BMW 1er und dem Unternehmen BMW Hanko Hinweise für die Gestaltung seiner Kommunikationsmaßnahmen liefern.
1.2 Aufbau der Arbeit
Kapitel 2beschreibt im ersten Teil den idealtypischen Verlauf des Marktforschungsprozesses und geht mit Hinblick auf die empirische Studie insbesondere auf die Rolle qualitativer Marktforschung ein. Der zweite Teil des Kapitels beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der Kaufverhaltensfor-
5Vgl. Reinking, (BMW 1er Serie, 2004), S. 8.
Page 9
Einleitung Seite 3
schung, der die Analyse von (Kauf-)Motiven zugeordnet wird. Abschließend wird das Zufriedenheitskonstrukt behandelt, das in der qualitativen Motivbefragung miterfasst wurde.
InKapitel 3werden die theoretischen Erkenntnisse des vorhergehenden Kapitels auf die konkrete Situation bei BMW Hanko in Koblenz übertragen. Es wird ein Untersuchungsdesign analog des in Kapitel 2 vorgestellten Marktforschungsprozesses entwickelt und durchlaufen: Problemformulierung und Definition der Untersuchungsziele, Konzipierung des Forschungsplans, Erhebungsphase, Auswertungs- und Kommunikationsphase. Das Kapitel beinhaltet somit neben der Darstellung der Vorarbeiten zur Befragung, der Beschreibung sowie der Auswertung der durchgeführten Interviews ebenso die Ergebnisse der qualitativen Befragung. Es endet mit der Beschreibung des zukünftigen Forschungsbedarfs und der Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Vermarktung des BMW 1er für BMW Hanko.
Kapitel 4schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
Page 10
Theoretische Grundlagen Seite 4
2 Theoretische Grundlagen einer Untersuchung zur Be-
stimmung von Kaufmotiven
2.1 Ziel und Ablauf der Marktforschung
2.1.1 Ziel der Marktforschung für das Marketing
In einem Unternehmen werden jeden Tag viele Entscheidungen getroffen, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden und somit von hoher Wichtigkeit für die weitere Entwicklung des Unternehmens sind. Die Basis jeder unternehmerischen Entscheidung bilden Informationen über die gegenwärtige (Markt-) Situation, aber auch über die zukünftigen Verhältnisse des Unternehmens und der Umwelt, in der es existiert.6
Die Bedeutsamkeit exakter und aktueller Informationen steigt mit zunehmendem Wettbewerb auf globalen Märkten, immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen7und nicht zuletzt den sich wandelnden Verhaltensweisen der Konsumenten. Diese entscheiden selbstbestimmt, was sie wo und wie kaufen und wie viel sie bereit sind, dafür auszugeben.8Ihre Wünsche, Bedürfnisse, Träume und Ängste sind einem immer schnelleren Wandel unterworfen.9
Informationen über die vielfältigen Facetten der Verbraucher schaffen die Grundlage möglicher Handlungsalternativen, die denkbare Wege zur Erreichung unternehmerischer Ziele aufzeigen. Häufig liegen den Entscheidungsträgern Informationen jedoch nur in unzureichendem Maße vor und werden durch Prognosen fehlender Variablen ergänzt. Dies hat zur Folge, dass Entscheidungen i.d.R. unter unsicheren Bedingungen getroffen werden.10
Ziel eines Unternehmens sollte sein, die Unsicherheit auf das geringstmögliche Maß zu reduzieren, um unnötige Investitionen zu vermeiden.11Deswegen ist es zwingend notwendig, Entscheidungen auf verlässliche Informationen zu stüt-
6Vgl.Berekoven, Eckert, Ellenrieder, (Marktforschung, 1996), S. 19ff, ebenso Kamenz, (Markt-forschung, 1997), S. 9 u. S. 20, ebenso Herrmann, Homburg, (Marktforschung, 2000), S. 5.
7Vgl. Herrmann, Homburg, (Marktforschung, 2000), S. 5.
8Vgl. Lewis, Bridger, (Die neuen Konsumenten, 2001), S. 16f.
9Vgl. Engeser, (Emotionale Visitenkarte, 2003), S. 65.
10Vgl. Berekoven, Eckert, Ellenrieder, (Marktforschung, 1996), S. 19ff, ebenso Kamenz, (Marktforschung, 1997), S. 9 u. 20, ebenso Herrmann, Homburg, (Marktforschung, 2000), S. 5.
11Vgl. Kamenz, (Marktforschung, 1997), S. 9.
Page 11
Theoretische Grundlagen Seite 5
zen.12Hierfür bedient sich das Marketing derMarktforschung,die einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion von Unsicherheit mittels der Prognose zukünftiger Entwicklungen leisten kann. Marktforschung ist die„systematische und wissenschaftliche Erhebung, Analyse und Interpretation von Informationen über Gegebenheiten und Entwicklung auf Märkten“13sowie über die Verhaltensweisen von Individuen in diesen Märkten als Informationsgrundlage für Marketingentscheidungen.14Marktforschung soll dazu beitragen, bisherige Entwicklungen besser verstehen zu können und zukünftige Entwicklungen berechenbarer zu machen und so das Management bei unzureichendem In-formationsstand in seiner Entscheidungsfindung zu unterstützen.15
2.1.2 Der Marktforschungsprozess
2.1.2.1 Ablauf des Marktforschungsprozesses
Eine Marktforschungsstudie lässt sich als „Prozess der Problemlösung“16beschreiben, dessen idealtypischer Ablauf wie folgt grafisch dargestellt werden kann:
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nieschlag, Dichtl, Hörschgen, (Marketing, 1997), S. 685, Kamenz, (Marktforschung, 1997), S. 11 und Kotler, Bliemel, (Marketing-Management, 2001), S. 203
Die oben aufgeführten Phasen bilden die Arbeitsschritte einer Marktforschungsstudie. Dieses Schema dient dem Forscher als Orientierungshilfe und zeigt die zu berücksichtigenden Aspekte auf.17
12Vgl. Herrmann, Homburg, (Marktforschung, 2000), S. 5.
13Weis, Steinmetz, (Marktforschung, 2005), S. 16.
14Vgl. Kamenz, (Marktforschung, 1997), S. 6.
15Vgl. Hildebrandt, (Hypothesenbildung, 2000), S.35.
16Herrmann, Homburg, (Ziel der Marktforschung, 2000), S. 17.
17Vgl. Böhler, (Marktforschung, 2004), S. 30.
Page 12
Theoretische Grundlagen Seite 6
2.1.2.2 Problemformulierung und Definition der UntersuchungszieleDie erste Phase des Marktforschungsprozesses zeichnet sich durch die möglichst präzise Formulierung des Untersuchungsproblems sowie durch die Definition der Untersuchungsziele aus. Wichtig ist hier die genaue Kommunikation zwischen Marktforscher und Auftraggeber, um Verständigungsprobleme zu vermeiden, die zu Fehlern in der Problemdefinition und so zu abweichenden Untersuchungszielen führen können.18
Die Darstellung der Ausgangssituation bildet die Grundlage für die Problem-formulierung. Diese Beschreibung wird auch Ist-Analyse genannt und beinhaltet je nach Problemstellung die UntersuchungsbereicheMarkt(In welchem/n Markt/Märkten sind wir aktiv?),Kunde(Wer ist unser Kunde?),Unternehmen(Wer sind wir?, Was wollen wir erreichen?, Wo liegen unsere Stärken/Schwächen?),Wettbewerb(Wer ist unsere Konkurrenz?) undUmwelt(Welche gegenwärtigen und künftigen Umwelteinflüsse sind für uns relevant?).19
Die Ist-Analyse zeigt den Informations- und Entscheidungsbedarf des Auftraggebers und resultiert in der Definition der Untersuchungsziele.20Um Fehler oder Unstimmigkeiten, die sich in den folgenden Phasen nicht mehr beheben lassen, zu vermeiden, ist es von unerlässlicher Wichtigkeit, die zu beantwortende Frage so konkret und exakt wie möglich zu formulieren und einzugrenzen, um nicht Gefahr zu laufen, nutzlose Informationen zu erhalten.21
2.1.2.3 Konzipierung des Forschungsplans
Der Aufbau und Plan des Forschungsprojekts, der die weiteren Forschungsschritte wesentlich prägt, erfolgt in der zweiten Phase.22Der Ablauf der Untersuchung wird hier in seiner Grundstruktur festgesetzt.23Die Konzipierung des Forschungsplans beinhaltet die Erstellung eines detaillierten Erhebungsplans, der die Wahl der Erhebungsmethoden, -einheiten und -instrumente beschreibt und die zu nutzenden Informationsquellen festlegt.24
18Vgl. Herrmann, Homburg, (Ziel der Marktforschung, 2000), S. 18.
19Vgl. Kamenz, (Marktforschung, 1997), S. 25.
20Vgl. Herrmann, Homburg, (Ziel der Marktforschung, 2000), S. 18.
21Vgl. Böhler, (Marktforschung, 2004), S. 33.
22Vgl. Böhler, (Marktforschung, 2004), S. 37.
23Vgl. Wöhe, Döring, (Einführung BWL, 2000), S. 498.
Page 13
Theoretische Grundlagen Seite 7
Grundsätzlich lassen sich explorative25, deskriptive26und kausalanalytische27Forschung unterscheiden, die in der folgenden Abbildung überblicksartig von-einander abgegrenzt sind.28
Abbildung 2: Forschungsart, Forschungsdesign und Forschungsmethode zur jeweiligen
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wöhe, Döring, (Einführung BWL, 2000), S. 495 und Dannenberg, Barthel, (Effiziente Marktforschung, 2004), S. 114.
Explorative Forschungdient der Sammlung grundlegender Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse bilden die Basis für Theorie- und Hypothesenbildung.29Ein exploratives Forschungsdesign wird eingesetzt, wenn wenig bis gar keine In-formationen über das Forschungsproblem vorliegen.30Dabei werden verschiedenste Aspekte des Untersuchungsgegenstands beleuchtet, aus denen sich Hypothesen für deskriptive oder experimentelle Forschungsvorhaben ableiten lassen.31Resultate explorativer Forschung dienen als Ansatzpunkt für weiterführende Marktforschungsprojekte und sind somit als Anfang der Marktforschung zu sehen und nicht als deren Ergebnis.32Zum Einsatz kommen hier vorwiegend qualitative Methoden.33
24Vgl. Herrmann, Homburg, (Ziel der Marktforschung, 2000), S. 18f.
25Explorieren bedeutet [lat.]: (aus)forschen, prüfen, vgl. Müller [Bearb.] (Duden Fremdwörterbuch, 1974), S. 228.
26Deskriptiv stammt aus dem lateinischen und bedeutet „beschreibend“, vgl. Müller [Bearb.] (Duden Fremdwörterbuch, 1974), S. 169.
27Kausal bedeutet „ursächlich, das Verhältnis Ursache - Wirkung betreffend“, analytisch bedeutet „zerlegend“, vgl. Müller [Bearb.] (Duden Fremdwörterbuch, 1974), S. 370 u. S. 58.
28Vgl. Böhler, (Marktforschung, 2004), S. 37.
29Vgl. Kamenz, (Marktforschung, 1997), S. 53.
30Vgl. Wöhe, Döring, (Einführung BWL, 2000), S. 495.
31Vgl. Böhler, (Marktforschung, 2004), S. 87.
32Vgl. Dannenberg, Barthel, (Effiziente Marktforschung, 2004), S. 114.
33Vgl. Kamenz, (Marktforschung, 1997), S. 53.
Page 14
Theoretische Grundlagen Seite 8
Mit Hilfedeskriptiver Studienwerden festgelegte Hypothesen überprüft.34Die Forschungsziele deskriptiver Studien liegen in der quantitativen Beschreibung von Markttatbeständen und der Ermittlung der Häufigkeit ihres Auftretens sowie in der Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Variablen und einer daraus resultierenden Prognose.35Der Forscher ist bestrebt, möglichst standardisierbare Informationen zu erheben.36Im Vordergrund steht hier nicht eine große Flexibilität bei der Vorgehensweise, sondern eine hohe Exaktheit der Ergebnisse. Die Informationsbeschaffung erfolgt hauptsächlich mittels quantitativer Methoden in Form standardisierter Befragung oder Beobachtung einer repräsentativen Stichprobe. Daneben ist die systematische und statistische Analyse und Auswertung von Sekundärdaten typisch für ein quantitatives Vorgehen.37
Bei derkausalanalytischen Forschungsteht die Aufdeckung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen im Vordergrund.38Diese versucht der Forscher, ausgehend von festgelegten Forschungshypothesen, mit Hilfe experimenteller und quasi-experimenteller Forschungsdesigns zu ermitteln.39Unter einem Experiment wird eine „wiederholbare, unter kontrollierten vorher festgelegten Umweltbedingungen durchgeführte Versuchsanordnung verstanden, die es mit Hilfe der Messung von Wirkungen eines oder mehrerer unabhängiger Faktoren auf die jeweilige(n) abhängige(n) Variablen(n) gestattet, aufgestellte Hypothesen empirisch zu überprüfen“40. Bedingungen für einen experimentellen Versuchsaufbau sind die Kontrolle der sog. Störvariablen, die aktive Manipulation der unabhängigen Variablen (=Ursache) und die genaue Messung der abhängigen Variablen.41Ein Experiment kann entweder als Feld- oder Laborexperiment ausgeführt werden. Ein Feldexperiment findet im natürlichen, realistischen und marktnahen Umfeld statt (Marktexperimente, Testmärkte). Anders verhält es sich bei einem Laborexperiment, das sich in einem künstlichen, dem Markt fernen Umfeld (Studio) abspielt.42Im Gegensatz zur explorativen Forschung liegen hier präzise Untersuchungsziele in Form von Hypothesen vor. Von der auch Zusammenhänge überprüfenden, deskriptiven Forschung unterscheiden sich experimentelle Forschungsmethoden durch die Kontrolle störender Ein-
34Vgl.Kamenz, (Marktforschung, 1997), S. 53.
35Vgl. Böhler, (Marktforschung, 1985), S. 31.
36Vgl. Kepper, (Qualitative Marktforschung, 1996), S. 26.
37Vgl. Böhler, (Marktforschung, 1985), S. 31f.
38Vgl. Meffert, (Käuferverhalten, 1992), S. 206.
39Vgl. Kepper, (Qualitative Marktforschung, 1996), S. 21.
40Meffert, (Marketing, 1998), S. 152.
41Vgl. Berekoven, Eckert, Ellenrieder, (Marktforschung, 1996), S. 152.
42Vgl. Wöhe, Döring, (Einführung BWL, 2000), S. 497.
Page 15
Theoretische Grundlagen Seite 9
flussfaktoren.43
Bei vorliegender Arbeit sind bzgl. des in Kapitel 1 beschriebenen Entscheidungsproblems nur geringe Kenntnisse vorhanden. Es wird die Frage aufge-worfen, welche Motive den Kauf des BMW 1er antreiben. Hier liegen dem Entscheidungsträger keine hinreichenden Informationen vor. Es ist die Aufgabe dieser Arbeit, mögliche Ansatzpunkte „auszuforschen“, weshalb die vorzunehmende Forschungsarbeit als explorativ zu bezeichnen ist.
Im Folgenden soll daher der Fokus auf der Betrachtung der explorativen Forschung liegen und deshalb qualitative Methoden betrachtet werden. Hierbei wird insbesondere das qualitative Interview als Methode der empirischen Motivuntersuchung betrachtet, das von der Verfasserin - wie später beschriebenals das geeignetste Instrument ausgewählt wurde.
Das Zielqualitativer Marktforschungliegt im „Erkennen, Beschreiben und Verstehen psychologischer und soziologischer Zusammenhänge“44und nicht in deren Messung.45So sucht qualitative Forschung nach der Antwort auf die Frage nach dem „Warum“: Warum kauft ein Mensch? Warum kauft er nicht? Was regt ihn zum Handeln an? Was hindert ihn, zu handeln?46und will Motive, Einstellungen oder Erwartungen von Personen erkennbar machen.47Der Versuch einer möglichst vollständigen Erfassung und Interpretation des Untersuchungsproblems steht im Vordergrund, um so Einblicke in die facettenreichen geistigen „Wahrnehmungsdimensionen“ der untersuchten Personen zu erhalten.48Bei dieser Art der Forschung geht es nicht um die Beschreibung, sondern um die Interpretation menschlichen Verhaltens. Es geht darum zu verstehen, warum Individuen etwas tun.49Demnach steht die Erfassung von Konsumenten mit ihren Weltbildern, Sichtweisen und Lebensgeschichten im Mittelpunkt qualitativer Forschung. Die Aussagen und Handlungen der Individuen können bei ganzheitlicher Betrachtung ihrer sozialen, kulturellen, situativen, biographischen und historischen Hintergründe in ihrer vollen Bedeutung erfasst werden.50
43Vgl. Böhler, (Marktforschung, 1985), S. 32.
44Kepper, (Qualitative Marktforschung, 2000), S.162.
45Vgl. Kepper, (Qualitative Marktforschung, 2000), S. 162.
46Vgl. Mauser, (Marketing Research, 1950), S. 75, zit. nach Knispel, (Tiefenbefragung bei Kaufmotiven, 1953), S. 6.
47Vgl. Weis, Steinmetz, (Marktforschung, 2005), S. 30.
48Vgl. Kepper, (Qualitative Marktforschung, 2000), S. 162.
49Vgl. Dichter, (Kaufmotive, 1983), S. 38.
Page 16
Theoretische Grundlagen Seite 10
Das Untersuchungsproblem zeichnet sich häufig durch noch undurchschaubare Zusammenhänge und noch nicht erkannte und abgeleitete Hypothesen aus, die eine ganzheitliche Erfassung erfordern.51Qualitative Studien sind oft Pilot-Studien, die einen Überblick über die Dimensionen geben und deren Ergebnisse die Basis für quantitative Studien bilden. Auf Grund ihrer Zielsetzung, aber auch wegen der häufig relativ hohen Kosten, begnügen sich Pilot-Studien mit einer relativ geringen Fallzahl. So reichen in der Explorationsphase zuweilen zwanzig Fälle völlig aus, um erste aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.52
Gänzlich im Hintergrund stehen bei qualitativen Methoden statistischrepräsentative Überlegungen, denn qualitative Analysen streben weder Aussagen über Häufigkeiten oder quantitativ zu beziffernde Unterschiede an, noch versuchen sie die „standardisierte und damit verkürzende Zuordnung von Symbolen, Messzahlen oder sonstigen Größen“53zu erreichen.54Eher strebt qualitative Marktforschung nach inhaltlicher Repräsentanz. Hierunter ist das Bemühen zu verstehen, nach solchen Inhalten zu suchen, die kennzeichnend für eine bestimmte Problemstellung sind.55So sollen die gewonnenen Daten das Typische des jeweiligen Untersuchungsfalls ausdrücken und erkennen lassen.56Hypothesen sollen entwickelt, Strukturen erschlossen und Gemeinsamkeiten festgestellt werden, um typisierende Existenzaussagen zu erhalten.57Für die Auswertung gilt, dass im Vorfeld der Untersuchung keine festen Kategorien feststehen, sondern eigens aus den erhobenen Daten individuell gebildet werden.58