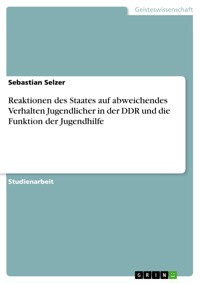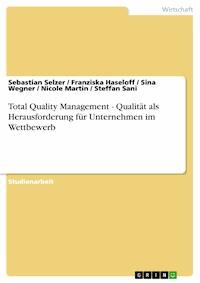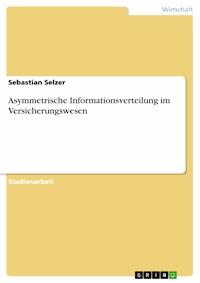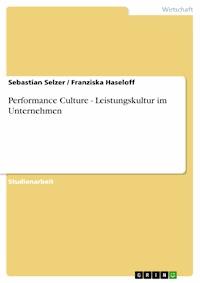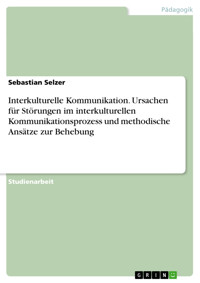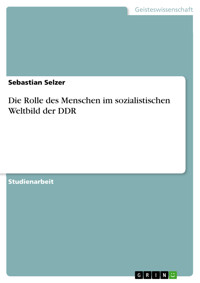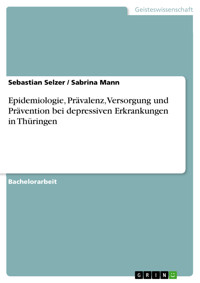
Epidemiologie, Prävalenz, Versorgung und Prävention bei depressiven Erkrankungen in Thüringen E-Book
Sebastian Selzer
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,5, Fachhochschule Erfurt (Fakultät Angewandte Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Weltweit wird vermutet, dass 350 Millionen Menschen von Depressionen betroffen sind. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass im Jahr 2020 affektive Störungen zu der zweithäufigsten Krankheit weltweit zählen werden. In Deutschland gibt es schätzungsweise drei Millionen Menschen die betroffen sind. Die Versorgungssituation bietet trotz der hohen Anzahl noch keine adäquate Behandlung. Wie viele sind In Thüringen betroffen und gibt es regionale Unterschiede? Wie verteilt sich die Depression in der Thüringer Bevölkerung und wie sieht es mit der Versorgung im Freistaat aus? Mit vielen Fakten, Zahlen und Belegen geben die Autoren einen Überblick über die Lage. Bei ihrer Forschungsarbeit konnten sie eine Menge an Datenmaterial sammeln und auswerten, die bis dahin noch nicht bekannt waren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung (Sabrina Mann)
2 Empirische Arbeitsschritte (Sebastian Selzer)
3 Diagnose Depression (Sabrina Mann)
3.1 Merkmale einer Depression (Sabrina Mann)
3.2 Affektive Störungen und Burn-out Syndrom (Sabrina Mann)
3.2.1 Rezidivierende depressive Episode (Sabrina Mann)
3.2.2 Depressive Episode (Sabrina Mann)
3.2.3 Anhaltende affektive Störungen (Sabrina Mann)
3.2.4 Sonstige affektive Störungen (Sabrina Mann)
3.2.5 Bipolare affektive Störungen (Sabrina Mann)
3.2.6 Manische Episode (Sabrina Mann)
3.2.7 Burn-out-Syndrom (Sabrina Mann)
3.3 Ursachen von Depressionen (Sabrina Mann)
3.3.1 Psychosoziale Faktoren (Sabrina Mann)
3.3.2 Genetische Faktoren (Sabrina Mann)
3.3.3 Neurobiologische Faktoren (Sabrina Mann)
3.4 Depression unter Einfluss der Komorbidität, des Alters und des Geschlechtes (Sabrina Mann)
3.4.1 Depression und Alter (Sabrina Mann)
3.4.2 Depression und Geschlecht (Sabrina Mann)
3.4.3 Komorbidität (Sabrina Mann)
3.5 Interventionsmöglichkeiten (Sabrina Mann)
4 Prävalenz von depressiven Erkrankungen in der bundesdeutschen Bevölkerung (Sebastian Selzer)
4.1 Depression im Zusammenhang mit dem Lebensalter (Sebastian Selzer)
4.1.1 Depressive Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (Sebastian Selzer)
4.1.2 Depressive Erkrankungen im erwerbsfähigen Alter (Sebastian Selzer)
4.1.3 Depressive Erkrankungen ab dem regulären Renteneintrittsalter (Sebastian Selzer)
4.2 Depression und Geschlecht (Sebastian Selzer)
4.3 Depression im Zusammenhang mit beruflicher Tätigkeit und sozioökonomischem Status (Sebastian Selzer)
4.4 Depressionserkrankungen und Komorbidität (Sebastian Selzer)
4.5 Rentenzugänge aufgrund chronischer depressiver Erkrankungen in Deutschland (Sebastian Selzer)
4.6 Todesfälle durch Suizide aufgrund einer Depression in Thüringen und anderen Bundesländern (Sebastian Selzer)
5 Prävalenz und Fehlzeiten durch die Diagnose depressive Episode (F32), rezidivierende Depression (F33) und Burn-out-Syndrom in Thüringen (Sebastian Selzer)
5.1 Stationäre Verweil- und Behandlungsdauer aufgrund psychischer und depressiver Erkrankungen in Thüringer Kliniken (Sebastian Selzer)
5.1.1 Depressive Kinder und Jugendliche in stationärer Behandlung (Sebastian Selzer)
5.1.2 Depressive Erwachsene in stationärer Behandlung (Sebastian Selzer)
5.2 Krankschreibungen aufgrund diagnostizierter depressiver Erkrankungen (Sebastian Selzer)
5.2.1 Arbeitsunfähigkeiten aufgrund psychischer Störungen in Deutschland und Thüringen (Sebastian Selzer)
5.2.2 Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund der Diagnosen F32 (Sebastian Selzer)
5.2.3 Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund der Diagnosen F32 und F33 (Sebastian Selzer)
5.3 Regionale Verteilung von depressiven erkrankten Personen (Sebastian Selzer)
5.3.1 Regionale Verteilung aller Depressionsdiagnosen (Sebastian Selzer)
5.3.2 Regionale Verteilung spezifischere Depressionsdiagnosen Verteilung (Sebastian Selzer)
5.3.3 Diagnoserate bei schweren Depressionen (Sebastian Selzer)
5.3.4 Verteilung Diagnoserate chronischer Depressionsfälle (Sebastian Selzer)
5.3.5 Verteilung von Depressionen und psychischer Komorbidität (Sebastian Selzer)
5.4 Ambulant diagnostizierte Depressionfallzahlen nach Region Alter und Geschlecht (Sebastian Selzer)
5.5 Prävalenz der depressiven Störungen von Thüringer Studierenden (Sebastian Selzer)
5.6 Burn – out – Syndrom (Sebastian Selzer)
6 Versorgungsstruktur von depressiv erkrankten Menschen in Deutschland - speziell im Freistaat Thüringen, Psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung von depressiv erkrankten Menschen in Thüringen (Sabrina Mann)
6.1 Allgemeine Daten zur Versorgungsstruktur in Deutschland (Sabrina Mann)
6.1.1 Stationäre Versorgung (Sabrina Mann)
6.1.2 Psychotherapeutische und fachärztliche Versorgung (Sabrina Mann)
6.1.3 Versorgung durch Hausärzte/Hausärztinnen (Sabrina Mann)
6.1.4 Regionale Unterschiede leitlinienorientierter Behandlung (Sabrina Mann)
6.2 Psychiatrische und psychotherapeutische Fachkrankenhäuser in den Kreisen und kreisfreien Städten Thüringens (Sabrina Mann)
6.2.1 Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (Sabrina Mann)
6.2.2 PIA – Psychiatrische Institutsambulanzen (Sabrina Mann)
6.2.3 Tageskliniken (Sabrina Mann)
6.3 Psychiatrische/ psychotherapeutische Fachkrankenhäuser, Fach-abteilungen, PIA´s und Tageskliniken für Kinder und Jugendliche in Thüringen (Sabrina Mann)
6.4 Niedergelassene Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Fachärzte/ Fachärztinnen (Sabrina Mann)
6.5 Niedergelassene Kinder und Jugendpsychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Fachärzte/Fachärztinnen für Kinder und Jugendliche (Sabrina Mann)
6.6 Arzneimittelverordnung von Antidepressiva (Sebastian Selzer)
6.7 Die Rolle der Sozialen Arbeit in der psychiatrischen Versorgungsstruktur (Sabrina Mann)
7 Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen in Thüringen (Sabrina Mann)
7.1 Durchgeführte und bestehende Präventionsmaßnahmen (Sabrina Mann)
7.2 Selbsthilfegruppen (Sabrina Mann)
7.3 Bezug zur Sozialen Arbeit (Sabrina Mann)
8 Zusammenfassung und Fazit (Sebastian Selzer)
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Depression: Diagnosekriterien und Schweregrad
Abbildung 2 Prävalenz aller Depressionsdiagnosen nach Bundesland, 2011
Abbildung 3 Regionale Depressionsraten in Thüringen in %, 2011
Abbildung 4 Regionale Verteilung spezifizierter Depressionsdiagnosen in %, 2011
Abbildung 5 Regionale Verteilung chronischer Depressionen in %, 2011
Abbildung 6 Regionale Verteilung komorbider Angststörungen bei diagnostizierten Depressionen in %, 2011
Abbildung 7 Anzahl der Diagnosefallzahlen nach Region und Jahr
Abbildung 8 Verteilung der Depressionsfälle nach Lebensjahren in Thüringen
Abbildung 9 Geschlechterverhältnisse in Thüringer Regionen
Abbildung 10 Diagnostizierende Fachgruppen bei depressiven Erkrankungen
Abbildung 11 Verteilung leitlinienorientierter behandelten: mittelgradigen, schweren, Depressionen und Dysthymien
Abbildung 12 Regionale Anteile von Antidepressiva Verordnungen
Abbildung 13 Suizidrate nach Bundesland und Geschlecht, 2012
Abbildung 14 Regionale Verteilung aller Depressionsfälle in Deutschland 2011, Prävalenz in %
Abbildung 15 Prävalenz spezifizierter Depressionsdiagnosen nach Bundesland, 2011
Abbildung 16 Regionale Verteilung komorbider somatoformer Störungen bei spezifizierten Depressionsdiagnosen, 2011
Abbildung 17 Anteile der Antidepressiva-Verordnungen nach Bundesland, 2011
Abbildung 18 Versorgungsmöglichkeiten der Hilfen des Psychiatriewegweisers Thüringen
Abbildung 19 niedergelassene Fachärzte/Fachärztinnen und Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen in Erfurt, 2014
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Symptome einer Depression
Tabelle 2 Leitlinienorientierte Behandlung bei depressiven Erkrankungen
Tabelle 3 Sterbefälle durch Suizid in Thüringen 2010
Tabelle 4 Stationäre psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungszahlen von Kindern und Jugendlichen
Tabelle 5 Vollstationär behandelte PatientenInnen nach Wohnort und Diagnose
Tabelle 6 Vollstationär behandelte PatientenInnen in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nach Wohnort, Geschlecht und Diagnose
Tabelle 7 Stationär behandelte PatientenInnen mit Wohnort in Thüringen nach Diagnose, Jahr und Einrichtung
Tabelle 8 In Kliniken stationär behandelte PatientenInnen mit Wohnort in Thüringen nach Diagnose, und Jahr
Tabelle 9 In Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen behandelte PatientenInnen mit Wohnort in Thüringen nach Diagnose und Jahr
Tabelle 10 Vollstationär behandelte PatientenInnen mit Wohnsitz in Thüringen nach Jahr, Geschlecht, Diagnose und Region
Tabelle 11 Durchgeführte Leistungen in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen aufgrund einer F32 und F33 Diagnose nach Geschlecht, Region und Alter, 2013
Tabelle 12 Durchgeführte Leistungen in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen aufgrund einer F32 und F33 Diagnose nach Geschlecht, Region und Alter, 2012
Tabelle 13 Durchgeführte Leistungen in Vorsorge und Rehabilitationseinrichtungen aufgrund einer F32 und F33 Diagnose nach Geschlecht, Region und Alter, 2011
Tabelle 14 Regionale Depressionsraten in Thüringen in %, 2011
Tabelle 15 Anzahl der Depressionsdiagnosen nach Region und Jahr
Tabelle 16 Anzahl der Depressionsdiagnosen nach Region und Geschlecht, 2013
Tabelle 17 Bettenzahl in den kreisfreien Städten und Landkreisen
Tabelle 18 Bettenzahl der jeweiligen Versorgungsregionen
Tabelle 19 Krankenhausbetten durch den Qualitätsbericht der jeweiligen Krankenhäuser/ Fachkrankenhäuser
Abkürzungsverzeichnis
AOK : Allgemeine Ortskrankenkasse
AU: Arbeitsunfähigkeit
AU-Fälle je 100 VJ - Arbeitsunfähigkeitsfälle je 100 Versicherungsjahre: Ist ein statistischer Wert, der die Anzahl der Arbeitsunfälle angibt, die innerhalb eines Jahres erfasst wurden. Die 100 gibt die Nachkommastelle an (1 AU-Fall je VJ entspricht 100 AU-Fällen je 100VJ)
AU-Tage je Fall - Arbeitsunfähigkeitstage je Fall: Ist ein Wert, welches die Durchschnittliche Dauer einer einzelnen Arbeitsunfähigkeitsfalles angibt.
AU-Tage je 100 VJ – Arbeitsunfähigkeitstage je 100 Versicherungsjahre: Dieses Maß gibt an, wie viele erkrankungsbedingte Fehlzeiten innerhalb eines Jahres erfasst wurden
BG: Berufsgenossenschaft
BKK: Betriebskrankenkasse
DAK: Deutsche Angestellten-Krankenkasse
DGPPN: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V.
DSM:Diagnostic and Statistical Manualof Mental Disorders
HKK: Handelskrankenkasse
ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme)
ICD 10- GM: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - German ModificationVersion
IKK: Innungskrankenkasse
KKH: Kaufmännische Krankenkasse
MRT: Mangnetresonanztomographie
RKI: Robert-Koch-Institut
SRH-Wald-Klinikum: ursprünglich Stiftung Rehabilitation Heidelberg, heute ein privater Anbieter von Bildungs- und Gesundheitsleistungen
TLPE e.V.:Thüringer Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen e. V., Sitz in Erfurt
TLS: Thüringer Landesamt für Statistik, Sitz in Erfurt
TMSFG: Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit
TKK: Techniker Krankenkasse
VJ: Versicherungsjahre a 365 Tage – Bezugsgröße für Berechnungen
5- HTTLPER: Serotonin Transporter Length Polymorphic Region, ist ein genetischer Vulnerabilitätsfaktor
1 Einleitung (Sabrina Mann)
„Naja, man geht ja auch nicht zum Arzt und sagt, mir geht’s heut nicht gut oder so. Man versucht dann erstmal selber sich zu erklären oder so. Und gut da heul ich heut halt mal, und da ist das eben so. Aber wenn man dann tagelang heult und man weiß eigentlich gar nicht warum, weil ein die Fliege so leid tut oder irgendwas“ (Interview 4, Zeile: 283-287).
Das Wort Depressionen leitet sich aus dem lateinischen Wort „depremire“ ab und bedeutet so viel wie „niederdrücken“ (Nickel, 30.07.2014). Weltweit wird vermutet, dass 350 Millionen Menschen von Depressionen betroffen sind. Die Weltgesundheitsorganisation -WHO- geht davon aus, dass im Jahr 2020 affektive Störungen zu der zweithäufigsten Krankheit weltweit zählen wird (www.bmg.bund.de, 25.07.2014). Zur weltweit häufigsten und folgereichsten Krankheit zählt sie bereits heute schon unter den psychischen Störungen (Busch u.a. 2011, 1). In Deutschland gibt es schätzungsweise drei Millionen Menschen die betroffen sind. Die Versorgungssituation bietet trotz der hohen Anzahl noch keine adäquate Behandlung. Die WHO schätzt, dass jeder Vierte eine leitlinienorientierte Behandlung erfährt (www.gesundheitsforschung-bmbf.de, 25.07.2014). Schaut man in die Medien, kann man immer wieder von Burn-out oder auch depressiven Berichten lesen. Auch das Internet bietet zahlreiche Aufklärungen und Hinweise zur Erkrankung. Immer wieder liest man, dass die Depressionen zugenommen haben und Geschäftsmänner/Geschäftsfrauen mit viel Arbeit unter dem „Ausgebranntsein“ leiden. In der vorliegenden Bachelor-Thesis wurde sich mit der Versorgung und Epidemiologie von depressiven Störungen in Deutschland beschäftigt. Jedoch wurde hauptsächlich der Freistaat Thüringen unter die Lupe genommen. „Wie sieht die Prävalenz bei depressiven Erkrankungen in der Bevölkerung des Freistaates Thüringen aus? Wie hoch ist die Depressionsrate und wie verteilt sich diese in den Landkreisen und kreisfreien Städten? Welche ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen stehen in den einzelnen Regionen in Thüringen zur Verfügung und welche Maßnahmen zur Prävention finden statt?“ Genau mit diesen Fragen wurde sich ausführlich beschäftigt. Wie die empirische Vorgehensweise des Erarbeitens der vorliegenden Thesis stattfand, ist im folgenden Kapitel beschrieben.
Um den Einstieg in die Thematik zu ermöglichen, werden zu Beginn der Bachelor-Arbeit verschiedene Formen der Depression vorgestellt und erklärt. Was sind Depressionen eigentlich und wie werden diese diagnostiziert? Im Kapitel vier und fünf wird auf die epidemiologische Prävalenz der depressiven Erkrankungen eingegangen. Schwerpunkte bilden hierbei die Häufigkeitsverteilungen innerhalb Thüringens und der Vergleich mit anderen Bundesländern. Dabei wird der Bezug zum Geschlecht, Alter, sozioökonomischen Status, zur Differentialdiagnose und Region hergestellt. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung von depressiv erkrankten Menschen im stationären und ambulanten Bereich für das Bundesland Thüringen. Im siebten Kapitel wird ein kurzer Einblick über die Präventionsmaßnahmen und –kampagnen dargestellt, die in Thüringen derzeit stattfinden oder bereits stattgefunden haben. Dabei wird ebenfalls auf die Rolle der Sozialen Arbeit/ Sozialpädagogik eingegangen.
Für die Quellenanalyse, Bearbeitung der Arbeit, für Kritiken und Hilfestellung und allen weiteren Unterstützungen möchten wir uns hiermit bei allen Firmen, Unternehmen, Institutionen, Professoren/Professorinnen und natürlich bei allen Bekannten, Freunden und unseren Familien herzlich bedanken.
2 Empirische Arbeitsschritte (Sebastian Selzer)
Thüringen besteht aus 4 Planungsregionen, 14 Landkreisen und 6 kreisfreien Städten (Sedlacek 2011, 27). Insgesamt hat das Bundesland 913 Gemeinden. In ihnen wohnen 2.227.072 Thüringerinnen und Thüringer (www.thueringen.de, 31.07.2014). In der Bachelor-Arbeit wird der Bezug zwischen depressiven Erkrankungen und dem Auftreten in den einzelnen Regionen des Bundeslandes hergestellt. Zugleich wird ein Vergleich mit anderen Bundesländern geschaffen.
Um an Daten und Hintergrundwissen zu gelangen, wurden insgesamt sechs Experteninterviews an unterschiedlichen Orten durchgeführt. Diese waren leitfadengestützt, um eine bessere Vergleichbarkeit und Auswertbarkeit herzustellen. Drei der sechs Interviews fanden mit Chefärzten und Chefärztinnen von psychiatrischen Kliniken in Nord-, Ost- und Südthüringen statt. Ein Weiteres wurde mit einem niedergelassenen psychologischen Psychotherapeuten in Erfurt geführt. Die Kontaktaufnahme einer Selbsthilfegruppe in Ostthüringen ermöglichte uns, eine Psychiatrieerfahrene zu interviewen, die aufgrund einer depressiven Erkrankung teilstationär in einem Krankenhaus behandelt worden ist und die noch aktuell erkrankt ist. Ein sehr interessantes Telefongespräch ergab sich mit einer leitenden Vertreterin einer relativ großen Krankenkasse / Krankenversicherung aus. Der Kontakt zu den Interviewten kam entweder durch E-Mail-Korrespondenz, Telefongespräche oder durch persönliches Ansprechen vor Ort zustande. Die InterviewpartnerInnen wurden in der Annahme gewählt, dass dieser Personenkreis bestens mit der Thematik vertraut ist und kompetente Aussagen darüber treffen kann. Von den sechs Interviews wurden vier digital aufgezeichnet und anschließend wortgemäß transkribiert. Die zwei anderen Gespräche durften nicht aufgezeichnet werden. Deren Inhalte und Äußerungen wurden in den Niederschriften sinngemäß wiedergegeben. Alle Transskriptionen nebst Interviewliste befinden sich im Anhang. Neben den geführten Interviews bestanden auch unterstützende Kontakte zu einigen Einrichtungen und Instituten. Zu nennen sind unter anderem das Robert Koch-Institut, das IGES - Institut, die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, das Thüringer Landesamt für Statistik, die Knappschaft, die medizinischen Fakultäten der Universitäten Leipzig und Jena sowie eine Vielzahl von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften. Durch Anfragen konnten einige Quellen in Form von Berichten, Reporten, Statistiken und anderen Dokumenten zusammengetragen werden. Darüber hinaus wurden hilfreiche Informationen für die Recherchen u. a. durch persönliche Hinweise erworben. Ebenfalls sehr aufschlussreich war ein einstündiger Konsultationstermin mit zwei Mitarbeitern der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in Weimar. Dort wurde für uns das Datenmaterial aufbereitet und anhand einer Präsentation vorgetragen. Die im Kapitel 5.4 gewonnenen Erkenntnisse und Beschreibungen sind das Resultat dieser Konsultation. Das gesamte statistische Datenmaterial wurde anschließend von der KV-Thüringen via E-Mail übermittelt.
Alle Daten und Informationen, die durch die Interviews und Dokumente gewonnen wurden, sind nach den Verfahren von Böhm, Legewie und Muhr ausgewertet. Während der Arbeit wurden die Gütekriterien von Steinke beachtet. Es kamen viele unterschiedliche empirische Methoden zum Einsatz, um eine bessere Überprüfbarkeit und Standardisierbarkeit zu erreichen und um mögliche methodische Verzerrungen zu kompensieren (Steinke 2007, 319 ff). In der Fachhochschule Erfurt gab es ein Lehrforschungsprojekt, in dem sich verschiedene ForscherInnen gegenseitig austauschen konnten und ihre Ergebnisse zum Diskurs vorstellten.
3 Diagnose Depression (Sabrina Mann)
Depressionen können in verschiedenen Formen auftreten. Ebenso können die Ursachen durch mehrere Faktoren begründet werden. Symptome gibt es viele unter denen depressiv Erkrankte leiden. All diese wichtigen Erkenntnisse werden im Kapitel drei genauer betrachtet und erläutert.
3.1 Merkmale einer Depression (Sabrina Mann)
Depressionen gehören nicht nur zu den komplexesten Störungen, da sie gleichzeitig mehrere Bereiche des Lebens beeinträchtigen können, sondern auch zu den folgereichsten Erkrankungen weltweit. National und auch international wird geschätzt, dass ein Mensch zu 16 – 20 % das Risiko hat, im Laufe seines Lebens an einer Depression zu erkranken. Pro Jahr erfüllen 8% der deutschen Bevölkerung die Kriterien einer Depressionsdiagnose (Melchior u.a. 2014, 11ff). Viele der Gefühlszustände und Beschwerden, die Depressionen verursachen, sind den Menschen allgemein bekannt.
Bringen diese Gefühle keine bestimmte Intensität und Dauer mit sich, dann sind diese ganz normale Erfahrungen und Reaktionen durch bestimmte Ereignisse wie Verlust, Misserfolg oder auch Erschöpfung. Typische Symptome für Depressionen sind Niedergeschlagenheit, Gefühllosigkeit, Angst, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Appetitstörungen, Libidoverlust, Konzentrationsprobleme oder z.B. auch Schmerzen. Die Liste der Symptomatik ist lang. Die Depression als psychische Störung umfasst also kein einheitliches Krankheitsbild, sondern vereint verschiedene Sub-komplikationen. Der Begriff Depression wird in der Psychopathologie sowohl auf symptomatologischer als auch auf syndromaler Ebene verwendet. Bei der symptomatologischen Ebene geht es z.B. um Symptome wie Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit. Auf der syndromalen Ebene werden zusammenhängende Merkmalskomplexe mit emotionalen, kognitiven, motorischen, motivationalen, psychologischen und endokrinologischen Komponenten besprochen. Symptome der Erkrankung lassen sich in fünf Kategorien einteilen. Die folgende Tabelle enthält nur einige Beispiele für die Symptome der jeweiligen Kategorie. Die farblich hervorgehobenen Anhaltspunkte sind die Hauptsymptome und die weiteren die sogenannten Zusatzsymptome einer Depression.
Tabelle 1 Symptome einer Depression
Quelle: Hautzinger 2010, 5
Um eine möglichst zielgenaue Diagnose stellen zu können, wurde ein internationaler Katalog erstellt, in dem sich Hauptsymptome von Zusatzsymptomen unterscheiden. Je nachdem, wie ausgeprägt die Symptome auftreten, erfolgt eine Einteilung des Krankheitszustandes in leicht, mittel oder schwer. Die Diagnosekriterien zur Einteilung des Schweregrades sehen folgendermaßen aus:
Abbildung 1 Depression: Diagnosekriterien und Schweregrad
Quelle: Bundesverband für Gesundheitsinformationen und Verbraucherschutz – Info Gesundheit e.V. 2013, 11
Die Diagnostik erfordert bei Depressionen eine sehr genaue Untersuchung, da keine der aufgeführten Symptomatik in Tabelle 1 vorkommen muss. Zugleich können die Merkmale häufig auch Begleiterscheinungen von anderen Erkrankungen sein (Hautzinger 2010, 4). In der Symptomatologie ist es von hoher Wichtigkeit, die Verbundenheit zwischen Depression und Suizidalität zu beachten. Es ist nicht selten, dass aufgrund von depressiver Erkrankung Suizidgedanken, Suizidversuche entstehen oder gar vollendete Suizide geschehen. Es wird geschätzt, dass 15% der Patienten mit schweren Depressionen durch einen Suizid versterben (Robert-Koch-Institut 2011, 93). Eine Studie der Bertelsmann Stiftung ergab, dass sich einer von sieben Menschen mit schwerer Depression suizidiert (Faktencheck 2014, 21). Bei Kindern und Jugendlichen ist die Gefahr noch höher. Die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen mit psychischen Störungen haben einen Suizidversuch hinter sich, 80% davon probieren einen Zweiten. Unter den psychischen Störungen ist besonders Depression als Gefahr gekennzeichnet (Baierl 2011, 22). Weiterhin ist bei Depressionen zu erwähnen, dass die Erkrankung im Verlauf der Jahre von Patienten und Patientinnen wiederkehrend auftritt. So erleben 80% von den zu Behandelnden in den nachfolgenden Jahren weitere depressive Episoden. Bei 15% - 30% der Betroffenen wird davon ausgegangen, dass sich eine chronische Depression entwickeln wird (Wittchen u.a. 2010, 12). Depressionen werden unter affektiven Störungen subsumiert. Dies zeigt sich im ICD 10 und im DSM V.
Hier wurde versucht, Depressionen verschiedener Ausprägungen nach klar operationalisierbaren und deskriptiven Faktoren einzuordnen (Althaus 2010, 6).
3.2 Affektive Störungen und Burn-out Syndrom (Sabrina Mann)
Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Arten der affektiven Erkrankungen kurz beschrieben. Hierzu wurde der Bezug hauptsächlich zu der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheit und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD 10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gewählt, da die vorliegende Arbeit die deutsche Bevölkerung, vor allem den Freistaat Thüringen betrifft und die deutschen Ärzte/Ärztinnen vorgeschrieben bekommen, die Diagnose nach dem ICD 10 zu stellen. Zusätzlich verwenden auch Krankenkassen bei Abrechnungen, Erhebungen und Auswertungen sämtlicher Daten die Klassifikationen nach dem ICD 10 (Melchior u.a. 2014, 14). An diesem Punkt ist zu erwähnen, dass der Diagnosekatalog Diagnostic and Statisctical Manual (DSM) von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft als Vorreiter für das ICD zählt und auch einige Neuerungen für das ICD aus dem DSM übernommen wurden. In der fünften und aktuellsten Version des DSM V wurde die persistierende depressive Störung eingeführt, die eine Dysthymie und chronische depressive Störung (nach DSM Majore Depression) zusammenfasst, da die Unterscheidung der Symptome und Beschwerden sich kaum separieren lassen (Melchior u.a. 2014, 16). Affektive Störungen, wozu die depressiven Erkrankungen, manische Episoden sowie auch bipolare Störungen zählen, sind im ICD 10 unter F3, genauer F30 – F39 zu finden. Diese Gruppe enthält Störungen, deren Hauptsymptome zur Veränderung der Emotionalität des Menschen beitragen (siehe Tab.1). Die weiteren Symptome stehen im Zusammenhang mit dem Stimmungswechsel. Depressionen und Manien werden je nach Verlauf und Dauer sowie nach psychotischen Symptomen eingestuft. Dabei spielt bei Depressionen der Schweregrad des Krankheitsverlaufes eine Rolle; bei Manien hingegen hypomane und manische Episoden. (Melchior u.a. 2014, 11ff). Nicht selten treten Rückfälle im Bereich der affektiven Störungen auf. Der Anfang der einzelnen Episoden ist oftmals durch belastende Ereignisse oder Situationen gekennzeichnet (www.Icd-Code.de, 03.06.2014). Schaut man sich die Prävalenz der spezifischen Diagnosen bei den affektiven Störungen an, ist zu erkennen, dass der größte Teil der Betroffenen mit 42% unter einer mittelgradigen Episode leidet; gefolgt von den schweren Depressionen mit 30% und den leichten Depressionen mit 28% der deutschen Bevölkerung (Melchior u.a. 2014, 12).
Allgemein ist die Punktprävalenz für affektive Störungen bei 2% - 7% (Wittchen 2013, 10). Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die Diagnosen F32 – F34 von großer Bedeutung. Da depressive Krankheitsbilder auch in weiteren affektiven Störungen erscheinen, werden weitere Diagnosen genannt bzw. in der vorliegenden Arbeit auftreten. Als nächstes werden Klassifikationsgruppen erläutert; und die ersten drei Gruppen angeordnet nach epidemiologischer Bedeutung. Dabei wird allein im Punkt 3.2.4 auf die letzten Einteilungen der jeweiligen Klassifikationsgruppen, der sonstigen und nicht näher bezeichneten Störungen eingegangen, die ebenfalls bei den anderen Diagnosegruppen der affektiven Störungen als die letzten zwei Punkte im ICD 10 vorkommen. Da das Schema gleich bleibt, wird es nur einmal erwähnt.
3.2.1 Rezidivierende depressive Episode (Sabrina Mann)
Im ICD 10 findet sich in der Anamnese unter F33 die rezidivierende depressive Episode, die sich durch eine leichte depressive Episode – F33.0, mittelgradig depressive Episode – F33.1, schwere depressive Phase ohne psychotische Symptome – F33.2 und einer schweren Episode mit psychotischen Symptomen – F33.3 unterscheiden lässt. Weiterhin gibt es noch die Einteilung F33.4 – gegenwärtig remittiert. Sie bedeutet, dass die rezidivierende depressive Störung erfüllt war. Weitere Diagnosen sind sonstige rezidivierende depressive Störung – F33.8 und die nicht näher bezeichnete rezidivierende depressive Störung, deren Merkmale mit einer kürzeren Dauer oder weniger bzw. leichteren Symptomen einhergeht (Dilling u.a. 2004, 110). Allgemein ist die wiederkehrende depressive Erkrankung mit 40% die häufigste affektive Störung der unipolaren Depressionen in der Bundesrepublik. Das Wiedererkrankungsrisiko einer depressiven Episode steigt vor allem mit dem Alter (Melchior u.a. 2014, 12 ff).
3.2.2 Depressive Episode (Sabrina Mann)
Die depressive Episode ist kodiert unter F32 im ICD 10. Das DSM benennt diese Störung „Major Depression“. Sie ist mit 36% die zweithäufigste Störung der unipolaren Depressionen (Melchior u.a. 2014, 16). Unterteilt wird diese Episode in leichte – F32.0, mittelgradige - F32.1 und schwere - F32.2 Episode. Auch in dieser Einteilung bekommt die depressive Episode mit psychotischen Symptomen wie Halluzinationen oder Stupor eine extra Kodierung mit F32.3. Depressionen allgemein gehören zu den wiederkehrenden Krankheiten, 80% der Patienten/Patientinnen bekommen in den folgenden Jahren eine weitere depressive Episode.
Geschätzt wird, dass Betroffene innerhalb von 20 Jahren im Durchschnitt fünf bis sechs depressive Episoden erleiden müssen (Wittchen u.a. 2010, 9ff).
3.2.3 Anhaltende affektive Störungen (Sabrina Mann)
Unter den anhaltenden affektiven Störungen, die im ICD 10 unter F34 verschlüsselt sind, befindet sich die Dysthymie mit dem Code F34.1. Mit 24% nimmt sie die dritthäufigste Störung der unipolaren Beeinträchtigung ein. Das Merkmal einer Dysthymie ist ein leichterer Ausprägungsgrad. Dafür ist die Dauer der Störungen über Jahre hinweg zu beobachten. Zusätzlich tritt zu 20% eine depressive Episode mit auf. Meistens beginnt sie im Jugendalter und wiederholt sich bei 10 – 25% mit voll ausgeprägten depressiven Episoden; oftmals bleibt ein chronischer Verlauf (Volz 2008, 121). Die Lebenszeitprävalenz der dysthymen Störungen ist bei 6%, wobei die Punktprävalenz bei 3% liegt (Saß, 2003 ,410). Das DSM teilt die Wiederholungsdiagnose in die sogenannte „double depression“ ein (Wittchen u.a. 2010, 10). Unter den anhaltenden affektiven Störungen gehört auch die Zyklothymia – F34.0, die zu den bipolaren Störungsbildern zählt. Wie auch bei der Dysthymie findet die Episode über mindestens zwei Jahre statt (Dilling u.a. 2004, 110). Die Lebenszeitprävalenz einer Zyklothymia beträgt 0,4% - 1,0%. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% - 75% beginnt die Erkrankung zwischen dem 15. – 25. Lebensjahr (Volz 2008, 121).
3.2.4 Sonstige affektive Störungen (Sabrina Mann)
Im letzten Teil der F3 Diagnosen befinden sich die sonstigen affektiven Störungen – F38, die eine Restkategorie für Stimmungsstörungen beinhalten. Unterteilt wird die Gruppe in sonstige einzelne affektive Störungen – F38.0 und sonstige rezidivierende affektive Störungen F38.1 sowie sonstige affektive Störungen F38.8 (Dilling u.a. 2004, 111). Sonstige affektive Störungen werden diagnostiziert, wenn ein schneller Wechsel oder die Mischung von hypomanischen, manischen und depressiven Symptomen auftritt. Der Wechsel kann innerhalb weniger Stunden auftreten. Die Mindestdauer dieser Episoden beträgt zwei Wochen (Dilling 2009, 4).
3.2.5 Bipolare affektive Störungen (Sabrina Mann)
Entwickelt sich eine Depression innerhalb kürzester Tage, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine bipolare Störung vorliegt. Die bipolaren Störungen – F31 haben die spezifischste Einteilung im ICD 10. Die gegenwärtige hypomanische Episode hat den Schlüssel F31.0, gefolgt von den gegenwärtig manischen Episoden mit psychotischen Symptomen – F31.1 und ohne F31.2. Danach folgen die Kriterien für eine gegenwärtig leichte oder mittelgradige Episode – F31.3, gefolgt von den gegenwärtig schweren Episoden mit psychiotischen Symptomen – F31.4 und ohne F31.5. Die nächsten Klassifikationen sind die gegenwärtige gemischte Episode F31.6 und die gegenwärtige remittierte – F31.7 (Dilling 2004, 101 ff). Für die klinische Diagnostik ist es hilfreich, bipolare Störungen nochmals nach Bipolar I und II zu unterscheiden, auch wenn es im ICD 10 nicht explizit aufgegliedert ist. So treten bei der bipolaren Störung I neben den depressiven Episoden ausschließlich vollständig ausgeprägte manische Episoden auf. Bei der bipolaren Störung II treten ausschließlich hypomanische Episoden auf. Bei der bipolaren Störung I beträgt die Lebenszeitprävalenz 1%, bei der bipolaren Störung II: 0,5 % (Volz 2008, 120). Die Störungen gehen mit manischen und depressiven Phasen einher, bei denen allerdings die letztere Phase bei der bipolaren Störung II überwiegt. Insgesamt entwickeln sie sich zu 4% - 7% im weiteren Verlauf bei Depressionen (Wittchen u.a. 2010, 12).
3.2.6 Manische Episode (Sabrina Mann)
Zu 60% - 70% tritt eine manische Episode unmittelbar vor oder nach einer depressiven Episode oder auch Major Depression auf (Saß 2003, 415). Die manische Episode wird unterteilt in Hypomanie – F30.0, Manie ohne psychotische Symptome- F30.1 und mit psychotischen Symptomen – F30.2 (Dilling 2004, 99 ff).
3.2.7 Burn-out-Syndrom (Sabrina Mann)
Im ICD 10 findet man Burn-out nicht unter den affektiven Störungen. Das Burn-out-Syndrom bzw. Ausgebranntsein wird unter der Verschlüsselung ICD 10- Z73.0– GM - Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung - klassifiziert. Die Zusatzkodierungen des Kapitels Z werden zur Dokumentation von Faktoren gewählt, die einen Gesundheitszustand zusätzlich zu einer Diagnose beeinflussen.