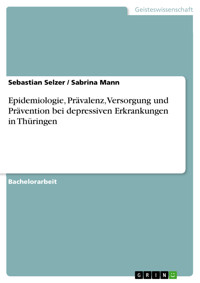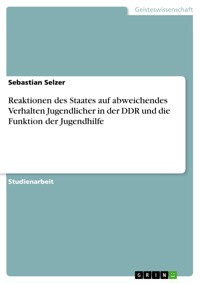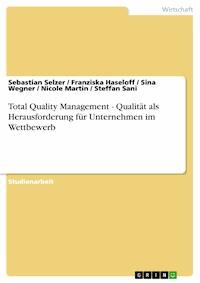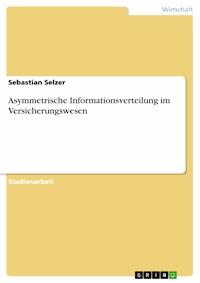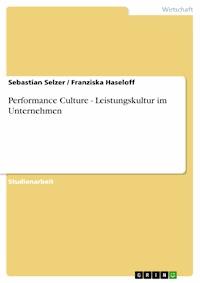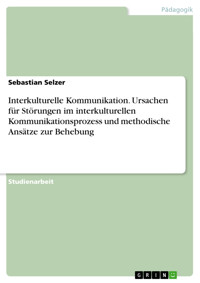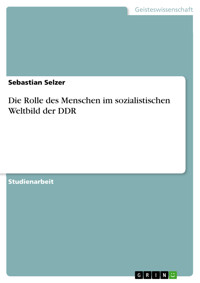Gesellschaftlicher Umgang mit Flüchtlingen vor dem Hintergrund der Flüchtlingsbewegungen von 1945 E-Book
Sebastian Selzer
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
65 Millionen Menschen waren 2016 auf der Flucht vor Verfolgung, Diktatur, sozialem Elend oder Krieg. Vor etwa 70 Jahren, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, waren auch zahlreiche Deutsche auf der Flucht. Fluchterfahrungen – am eigenen Leib oder aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern – sind daher auch heute noch ein bekanntes Thema für viele Deutsche. Vor diesem Hintergrund untersucht diese Arbeit, ob das Wissen über die Flucht und Vertreibung von 1945 heute noch einen Einfluss auf den gesellschaftlichen Umgang mit Geflüchteten und Migranten hat, die nach Deutschland kommen. Darüber hinaus wird betrachtet, wie die Auswirkungen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges sowie der anschließenden Flucht und Vertreibung für die heutige Zeit eingeschätzt werden. Ferner befasst sich der Autor auch mit der Frage, wie sich die Flüchtlinge und Vertriebenen von 1945 in die neue Gesellschaft integrieren konnten. Wie wurden sie von der Aufnahmegesellschaft behandelt? Was weiß die heutige Bevölkerung noch über diese Ereignisse? Hat dieses Wissen einen Einfluss auf die Einstellungen der Menschen gegenüber den heutigen Geflüchteten? Aus dem Inhalt: - Abgrenzung von Migration, Flucht und Vertreibung; - Geschichte der Flucht und Vertreibung in Deutschland und Europa; - Einwanderungswellen in die BRD bis in die 1990er; - Flucht- und Migrationsbewegungen seit 2014; - Heutiger Umgang mit der Flucht und Vertreibung von 1945
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Themenaufriss
1.2 Zentrale Fragestellung
1.3 Methodische Vorgehensweise
2 Entwicklungsprozesse und Überlegungen während des Schreibens
3 Definitionsversuche der Begriffe Migration, Emigration, Flucht, Vertreibung, Integration und Inklusion
3.1 Migration, Emigration und Flucht
3.2 Vertreibung
3.3 Integration
3.4 Inklusion
4 Geschichte der Emigration, Migration, Flucht und Vertreibung in Deutschland und Europa
4.1 Migrationsbewegungen vom Dreißigjährigen Krieg bis 1933
4.2 Migrationsbewegungen in Deutschland von 1933 bis 1948
4.2.1 Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich von 1933 bis 1938
4.2.2 Situation deutscher Flüchtlinge in den Vereinigten Staaten von Amerika
4.2.3 Situation jüdisch deutscher Flüchtlinge im Deutschen Reich von 1941 bis 1945
4.2.4 Politische Reaktionen auf die Migrations- und Flüchtlingsbewegungen von 1933 und heute
4.3 Flucht und Vertreibung der Deutschen ab 1944
4.3.1 Flucht und Evakuierung 1944/45
4.3.2 Vertreibung der Deutschen
4.4 Displaced Persons
4.5 Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen in der Nachkriegszeit
5 Situation der Asylbewerber/innen, Gastarbeiter/innen und Flüchtlinge in Deutschland in der Nachkriegszeit bis in die 1990er Jahre
5.1 Gastarbeiter/innen in der BRD und DDR
5.2 Flüchtlinge und Asylsuchende in Deutschland
5.3 Situation der (Spät-)Aussiedler/innen
5.4 Gesellschaftlicher Umgang mit der Minderheit der Roma
5.5 Fremdenangst in Gesamtdeutschland
6 Flucht- und Migrationsbewegungen seit 2014
6.1 Fluchtursachen
6.2 Aufnahme der Flüchtlinge und Migranten/innen durch die deutsche Zivilgesellschaft
6.3 Ansichten und Einstellungen der Thüringer Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen und Migranten/innen
7 Zum heutigen gesellschaftlichen Umgang mit der Flucht und Vertreibung von 1945
7.1 Retroperspektive Ansichten der heutigen Gesellschaft auf die Flucht und Vertreibung von 1945
7.2 Gegenwärtige gesellschaftliche Ansichten über die aktuelle Flucht- und Migrationsbewegung in Bezugnahme auf die historischen Ereignisse der Flucht und Vertreibung von 1945
8 Zwischenzusammenfassung
9 Empirische Forschungsergebnisse
9.1 Aufbau und Ablauf des Forschungsprozesses
9.2 Beschreibung der Forschungsergebnisse aus dem Fragebogen
9.3 Beschreibung der Forschungsergebnisse der Interviews
9.4 Teilzusammenfassung empirischer Teil
10 Fazit und Schlussfolgerung
11 Literaturverzeichnis
12 Anhang
12.1 Übersicht der geführten Interviews
12.2 Interview 1: 85-jährigen Frau, die 1945 aus Oberschlesien flüchten musste. Interview durchgeführt am 1. Mai 2016 in Gera. Begrüßung
12.3 Interview 2: Durchgeführt am 12.06.2016 mit einer männlichen Person, 40 Jahre
12.4 Interview 3: Studentin (25 Jahre) der Universität Erfurt, durchgeführt am 07. 06. 2016Begrüßung.
12.5 Tabellen
12.6 Fragebögen
1 Einleitung
Die Einleitung ist in drei Unterpunkte eingeteilt. Der erste Abschnitt eröffnet das Thema, im Zweiten befindet sich die zentrale Fragestellung und der dritte Punkt beschreibt die methodische Vorgehensweise.
1.1 Themenaufriss
Nach Angaben der UN sind zurzeit etwa 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Sie flüchten vor Krieg, Verfolgung, Diktatur, Armut und vor sozialem Elend. Viele machen sich aus diesen oder ähnlichen Gründen auf den Weg nach Europa. Während ihrer Flucht sind sie vielen Anstrengungen und Strapazen ausgesetzt. Viele Tausende haben dabei ihr Leben verloren (vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2016). Bisher gibt es wenig gesicherte Zahlen darüber, wie viele Menschen auf der Flucht verunglückt sind (vgl. Wegner 2014). Fast jeden Tag finden sich in den Nachrichten Bilder und Berichte von Flüchtlingen, die sich auf den Weg nach Europa gemacht haben und dabei auf der Überfahrt im Mittelmeer oder anderswo gestorben sind. Eine Gruppe von Journalisten/innen hatte sich die Mühe gemacht, die Zahlen über das Ausmaß der Flüchtlingsbewegungen von 2000 bis 2014 zusammenzutragen. Hierbei sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass in diesem Zeitraum etwa 23.000 Flüchtlinge auf ihren Weg nach Europa verstorben sind oder als vermisst gelten (vgl. Wegner 2014). Aber auch wenn sie in Europa und in Deutschland angekommen sind, befinden sie sich in einer schwierigen Situation. Mit der zunehmenden Zahl ankommender Flüchtlinge steigt die Zahl der Übergriffe auf Migranten/innen und Flüchtlingsunterkünfte, ebenso sind Hasskommentare in den sozialen Netzwerken sehr häufig zu finden. Bei vielen Bürgern/innen steigt die Ablehnung gegenüber den Flüchtlingen und Migranten/innen mit zunehmender Tendenz. Zugleich steht ein anderer Teil der Bevölkerung den Neuankömmlingen positiv gegenüber und heißt sie willkommen. Sie engagieren sich ehrenamtlich, versuchen ihnen zu helfen und geben Unterstützung (vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden – Württemberg 2016).
Vor etwa 70 Jahren waren die Deutschen selbst von einer der größten Fluchtbewegung betroffen. Mit beginnendem Kriegsende sind ab 1944/45 ca. 14 Millionen Deutsche geflüchtet oder wurden nach Kriegsende aus ihrer Heimat vertrieben (vgl. Brühns 2008). Somit sollten für die meisten Deutschen Flucht, Vertreibung und Migration keine unbekannten Themen sein, da sie diese entweder selbst miterlebt haben oder es aus den Erzählungen und Berichten ihrer Eltern oder Großeltern kennen.
1.2 Zentrale Fragestellung
Aus diesem Grund stellt sich für mich die Frage, ob das Wissen über die Flucht und Vertreibung von 1945 einen Einfluss auf den gesellschaftlichen Umgang mit Flüchtlingen und Migranten/innen hat, die aktuell nach Deutschland kommen. Weiterhin interessiert mich, wie die Menschen die Auswirkungen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges mit der anschließenden Flucht und Vertreibung für die heutige Zeit auf politischer und gesellschaftlicher Ebene einschätzen und welches Wissen sie über diese historischen Vorgänge besitzen. Ferner möchte ich mich der Frage annehmen, wie sich die Flüchtlinge und Vertriebenen von 1945 in die neue Gesellschaft integrieren konnten, wie sie von der Aufnahmegesellschaft behandelt wurden, was die heutige Bevölkerung darüber weiß und inwieweit das Wissen über diese Vorgänge einen Einfluss auf die Einstellungen der Menschen gegenüber den heutigen Flüchtlingen hat.
1.3 Methodische Vorgehensweise
2 Entwicklungsprozesse und Überlegungen während des Schreibens
Zu Beginn der Masterarbeit überlegte ich mir, wie ich das Thema bestmöglich bearbeite und wie ich mich der zentralen Fragestellung annähern kann. Um einen ersten Überblick zu erhalten, las ich einige Zeitschriften, Tageszeitungen, Magazine, Bücher, Internetartikel und schaute mir Filme an, die über die Flucht von 1945 und von heute berichteten. Zusätzlich kaufte und lieh ich mir Bücher und Magazine. Einige Medien musste ich über die Fernleihe bestellen. Ebenso interviewte ich meine Großmutter, die im Winter 1945 aus Niederschlesien geflohen ist und besuchte einen Vortrag von Frau Dr. Schrafstetter, die über das Thema der Flucht und Verfolgung der Jüdinnen und Juden in Deutschland referierte. Den Vortrag habe ich anschließend wortwörtlich transkribiert und im Anhang beigefügt
Somit konnte ich mir einen Überblick über die damalige und aktuelle Lage von flüchtenden und geflüchteten Menschen verschaffen, die entweder aus, nach oder innerhalb Deutschlands geflohen sind oder sich noch auf der Flucht befinden. Während meiner Recherchen im Internet habe ich mehrere Namenslisten gefunden, welche die Flucht meiner Großmutter mit ihrer Familie dokumentiert. Auf der Liste standen Namen, Wohnanschriften, der genaue Zeitpunkt der Flucht, die Fluchtrichtung und die mutmaßlichen Todesumstände einiger Verwandten. Dadurch hatte ich einen sehr persönlichen Bezug zu meiner Masterarbeit bekommen. Höchstwahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich mich mit der Geschichte der Flüchtlinge und Vertriebenen von 1945 sehr intensiv beschäftigt habe und diese innerhalb der Masterarbeit einen relativ großen Stellenwert einnimmt.
Für das Kapitel 4.3.2 (Vertreibung der Deutschen) habe ich mir das Buch – „Germany. Memories of a Nation“ – des britischen Kunsthistorikers und Leiter des Britischen Nationalmuseums als Grundlage ausgesucht, um auch eine externe Sichtweise für das Themenfeld der Flucht und Vertreibung einzuholen. Hierbei fand ich die Außenperspektive eines ausländischen Historikers sehr interessant. Als ich mich im weiteren Verlauf meiner Recherchen mit der Aufnahmebereitschaft der Flüchtlinge und Vertriebenen beschäftigte, war ich sehr erstaunt darüber, wie schlecht sie von der einheimischen Bevölkerung behandelt wurden. Ebenso überrascht war ich über die große Anzahl an Flüchtlingen und Vertriebenen und dass trotz dieser großen Zahl an Heimatlosen heutzutage nur noch wenige Menschen von diesen Vorgänge Kenntnis haben.
Neben den Flüchtlingen und Vertriebenen von 1945, wurde es den anderen nichtdeutschen Flüchtlingen, Asylbewerbern/innen, ausländischen Arbeitskräften und Migranten/innen in der Nachkriegszeit und nach der Wiedervereinigung nicht immer leicht gemacht, in Deutschland verweilen zu können. Während der Literaturrecherche stieß ich auf einen Videobericht aus dem Jahr 1992, der über die Brandanschläge von Rostock-Lichtenhagen berichtete. Die Ausschreitungen dauerten mehrere Tage an. Bis dahin hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass sich so viele Menschen an den Anschlägen beteiligt hatten und so etwas überhaupt hierzulande möglich ist. Als ich die Bilder von Rostock sah, dachte ich, dass die Situation von 1992 mit der heutigen Lage fast wieder vergleichbar ist, denn gegenwärtig brennen auch wieder Flüchtlingsunterkünfte und die Gewaltbereitschaft ist gestiegen.
Aufgrund der gesamten stattgefundenen Ereignisse war ich beinahe zu der Überzeugung gelangt, dass sich die Prozesse der Ausgrenzung und Diskriminierung in regelmäßigen Abständen wiederholen und es eine latente Fremdenfeindlichkeit innerhalb der Gesellschaft gibt, die hin und wieder zum Vorschein kommt. Jedoch sind mir auch die Bilder und Berichte von Menschen in den Sinn gekommen, die sich derzeit ohne Eigennutz für Flüchtlinge engagieren und helfen. Daraufhin bin ich der Frage nachgegangen, was die Menschen eigentlich antreibt, so zu handeln wie sie handeln und welche Rolle das Wissen über die Vorgänge der Flucht und Vertreibung von 1945 für sie spielt, zumal viele von ihren Familienmitgliedern selbst Flüchtlinge waren.
Während des gesamten Schreibprozesses fragte ich mich natürlich, warum so viele Menschen so viel Hass und/oder Vorurteile gegenüber Flüchtlinge oder andere Fremde haben. Die ganze Zeit dachte ich, dass eine bestimmte Angst dahinter stecken könnte und sich einige Menschen dieser Angst bedienen. Dem wollte ich nachgehen und habe aus diesem Grund das Buch von Heinz Bude – Gesellschaft der Angst – gelesen. Ebenso habe ich mich mit den thematischen Inhalten der AfD beschäftigt, da sie sich der Angst der Bevölkerung bedienen und diese für sich nutzen. Jedoch kommt das Themengebiet nicht als eigenständiger Teil in der Arbeit vor, da es zu umfangreich wäre. Für eine eigene Masterthesis würde es sich aber gut eignen.
3 Definitionsversuche der Begriffe Migration, Emigration, Flucht, Vertreibung, Integration und Inklusion
In diesem Kapitel wird der Versuch unternommen, die Begriffe Migration, Flucht, Vertreibung, Integration und Inklusion zu beschreiben. Es wird dargestellt, welche Migrationsformen es gibt und der Übergang zwischen den Begriffen Migration und Flucht fließend ist. Ebenso wird im Unterkapitel 3.2 erklärt, dass die definierten Unterscheidungsformen zwischen einer Flucht und einer Vertreibung grundlegende Folgen für die betreffenden Personenkreise haben können.
3.1 Migration, Emigration und Flucht
Der Ursprung des Wortes Migration kommt aus dem lateinischen (migratio) und bedeutet Wanderung. Weitere Begriffe für Migration sind Emigration (Auswanderung) und Immigration (Einwanderung) und wurden aus dem englischen Wortschatz in das Deutsche übernommen. Alle drei Begriffe sind in Deutschland gebräuchlich. Jedoch hat sich in den letzten Jahren der Begriff Migration durchgesetzt. Es bezeichnet im Allgemeinen die Verlagerung eines Lebensmittelpunktes von einem Land in das Andere. Die Vereinten Nationen definieren Migration als Aufenthalt in einem Aufnahmeland, welches mehr als ein Jahr andauert (vgl. Meier-Braun 2015, S. 33). Flüchtlingsströme und Wanderungsbewegungen sind eine weltweite Herausforderung. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts galt Europa überwiegend als Auswanderungsregion. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich die neu gegründeten EU-Staaten zum bevorzugten Ziel der transnationalen Migration. Mittlerweile sind fast alle EU-Staaten zu Einwanderungsländern geworden und weisen somit eine positive Einwanderungsbilanz auf. Nicht alle Mitgliedsstaaten sind von der Einwanderung gleichermaßen betroffen. Im Verhältnis zur jeweiligen Bevölkerungsgröße hatte Luxemburg bis zum Jahr 2013 die höchsten Nettozuwanderungszahlen, gefolgt von der Schweiz, Irland und Spanien. Die niedrigsten Zuwanderungszahlen ließen sich in Portugal, Frankreich und Italien feststellen (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 616).
Die Migrationsforschung unterscheidet mehrere Migrationstypen die vorrangig auf die Ursachen der Migration schaut. So liegen die Hauptursachen der Zuwanderung vorrangig in der Flucht vor Verfolgung, Krieg/Bürgerkrieg, familiären Gründen und der Suche nach besseren Arbeits- und Lebensbedingungen begründet. In der BRD sind seit den ersten Anwerbungen für Gastarbeiter/innen von 1955 mehr als 30 Millionen Migranten/innen eingewandert, von denen rund 8 Millionen Menschen auf dauerhaft geblieben sind (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 616). Insgesamt unterscheidet die Migrationsforschung fünf Zuwanderungstypen: Den/die Unionsbürger/in, den/die Spätaussiedler/in, den Familiennachzug, den/die Asylbewerber/in und die Arbeitsmigration.
Dem/der Unionsbürger/in wird in der migrationspolitischen Debatte nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Aufgrund der Freizügigkeit innerhalb der Staatengemeinschaft können EU-Bürger/innen sich frei bewegen. In der gesamten Europäischen Union kommen maximal 2% aller Arbeitskräfte aus anderen Mitgliedsstaaten. Diese Form der Freizügigkeit setzt keine Zuwanderungswelle frei. In den 1970er Jahren befürchteten Deutschland und Frankreich eine starke Zuwanderung von italienischen Arbeitskräften auf ihrem heimischen Arbeitsmarkt, der jedoch ausblieb. Durch die Angleichung des wirtschaftlichen Entwicklungs- und Einkommensniveaus in den EU-Mitgliedstaaten verringerte sich der Wanderungsimpuls der Unionsbürger/innen und eine geringe Mobilität stellte sich ein. Jedoch kam es durch die EU-Osterweiterung zu einem leichten Anstieg der Migrationsbewegung von Ost- nach Mitteleuropa (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 616).
Spätaussiedler/innen sind deutsche Volkszugehörige, die seit Generationen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und anderen osteuropäischen Staaten wohnen, die deutsche Vorfahren haben und im Rahmen eines speziellen Aufnahmeverfahrens ihren Aufenthalt in Deutschland anstreben (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2013). Die Zuwanderung von Spätaussiedlern in die Bundesrepublik verlief bis Mitte der 1980er Jahre aufgrund der vorhandenen Deutschkenntnisse relativ unauffällig und unproblematisch. Erst mit dem Zerfall der Ostblockstaaten und der Sowjetunion stieg die Zahl der Migrationsbewegung. Ab 1993 forderte die Bundesrepublik, dass Spätaussiedler/innen nur unter der Bedingung die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, wenn sie einen Nachweis über ihre deutschen Vorfahren erbringen können und zusätzlich über ausreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügen. Dadurch verringerten sich die Zuzugszahlen in der BRD (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 617).
Der dritte Zuwanderungstyp ist der des Familiennachzuges. Dieser ist für die Zuwanderung nach Deutschland von quantitativer Bedeutung. Aufgrund des besonderen grundgesetzlichen Schutzes von Ehe und Familie haben ausländische Ehepartner und minderjährige Kinder bis 16 Jahren einen Anspruch auf Einreise, wenn ein Ehepartner die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder sich legal in der BRD aufhält. Mit Beginn des Anwerbestopps von 1973 nahm diese Form der Zuwanderung kontinuierlich zu (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 617).
Die vierte Form der Migration ist die des Asyls bzw. die des Asylsuchenden (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 617). Unter Asyl versteht man einen sicheren Zufluchts- und Aufenthaltsort, von dem der/die Asylsuchende nicht gewaltsam weggeholt werden kann. Für die Gewährung eines Asylantrages prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Voraussetzungen (vgl. Gilles 2016). Asylbewerber/innen sind Menschen, die ihr Herkunftsland wegen Furcht vor Verfolgung, aus politischen, religiösen, ethnischen, nationalen, geschlechtsspezifischen Gründen oder durch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Minderheit, verlassen müssen. Bis Ende der 1980er Jahre kamen jährlich rund 7.000 Personen aus dieser definierten Gruppe nach Deutschland. Bis 1992 stieg ihre Zahl auf 438.191 Asylsuchende stark an. Im gleichen Jahr reagierte die Politik mit dem sogenannten Asylkompromiss darauf, um die Zahl der Flüchtlinge einzudämmen. Ab 1993 gingen die Zahlen zurück und im Jahr 2005 gab es noch 28.914 Asylsuchende in Deutschland. Im Jahr 2007 ist der Anteil der Asylanträge wieder angestiegen. 2010 waren es mehr als 41.000 Anträge, das ist im Vergleich zu 2009 ein Anstieg von fast 50%. 2010 kam ein hoher Anteil der Asylsuchenden aus Afghanistan, Serbien, Irak, Iran und Somalia, jedoch wurden im gleichen Jahr 27.000 Asylbewerber/innen abgelehnt und nur 7.700 wurden anerkannt. In der Zeit der 1990er Jahre hatte Deutschland rund 350.000 Bürgerkriegsflüchtlinge, die überwiegend aus Bosnien-Herzegowina kamen. Bis auf wenige Ausnahmen sind die meisten Flüchtlinge wieder in das Gebiet des ehemaligen Jugoslawien zurückgekehrt (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S.617).
Der fünfte und letzte Zuwanderungstyp ist der der Arbeitsmigration. Dieser Typ nimmt innerhalb der Migranten/innen einen großen Anteil ein, wobei die gezielte Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer in Westdeutschland offiziell 1973 eingestellt wurde (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 617). In dem Zeitraum von 1955 bis 1973 kamen rund 14 Millionen Arbeitsmigranten/innen nach Westdeutschland, davon kehrten im gleichen Zeitraum 11 Millionen wieder in ihre Heimat zurück. Die Türkei, Italien, ehem. Jugoslawien, Portugal, Griechenland und Spanien waren die Hauptanwerbeländer der Bundesrepublik. Jedoch fanden nach 1973 weiter Arbeitsmigrationen statt. Durch bestimmte Ausnahmegenehmigungen wie z. B. durch Saison- und Werkvertragsarbeitnehmerverträge oder im Rahmen der Green Card Regelung von 2000 bis 2004, hat die Bedeutung der Arbeitsmigration für die BRD nie wirklich abgenommen (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 617).
3.2 Vertreibung
Eine einheitliche völkerrechtliche Definition für die Beschreibung des Begriffes Vertreibung gibt es, im Gegensatz zu den Definitionen der Begriffe Flüchtlinge, Asylbewerber/in, Emigranten/innen und Migranten/innen, nicht. Weder in der politischen Praxis noch in der Forschung besteht Einigkeit darüber, wer in diese Gruppe fällt. Die Vereinten Nationen (UN) bezeichnen aber diejenigen als Vertriebene, die aufgrund von bewaffneten innerstaatlichen Auseinandersetzungen und Bürgerkriegen, Menschenrechtsverletzungen, menschlich verursachten Katastrophen und Naturkatastrophen gezwungen sind, ihren Lebensmittelpunkt zu verlassen, dabei jedoch keine international anerkannte Staatsgrenze überschritten haben, also innerhalb eines Landes geflohen sind. Aus diesem Grund werden sie auch als Binnenvertriebene oder Binnenflüchtlinge bezeichnet. Wegen dieser Besonderheit gibt es für Vertriebene kein offizielles Mandat durch humanitäre Hilfsorganisationen, diese zu schützen. In der alltäglichen Praxis leisten aber viele internationale Hilfsorganisationen in den Krisengebieten Hilfe, da die Notsituationen sehr komplex sind und es häufig zu einer Vermischung zwischen Binnenflucht und grenzübergreifender Flucht kommt. Auch geht es den meisten humanitären Hilfsorganisationen nicht um den Flüchtlingsstatus, hier steht die Situation des Vertriebenen im Mittelpunkt.
Die Vereinten Nationen nehmen noch die zusätzliche Unterscheidung zwischen den Gruppen der Flüchtlinge bzw. der Vertriebenen und denen der Migranten/innen vor, da davon ausgegangen wird, dass Migranten/innen ihre Wanderungsbewegung freiwillig angetreten haben und sie grundsätzlich mehrere Handlungsalternativen besitzen würden. Für die Gruppe der Migranten/innen hat sich in den letzten Jahren eine Interessenvertretung gebildet, die aber im Vergleich zu den anderen Flüchtlingsvertretern/innen eine institutionelle und völkerrechtliche geringere Durchsetzungskraft hat (vgl. Angenendt o.J., S. 1f.). Durch die Unterscheidungen zwischen Flüchtlingen, Vertriebenen und Migranten/innen ist das Problem der Zuständigkeiten aufgetreten. Dadurch stellt sich die Frage, wer für wen zuständig ist und wer welche Maßnahmen für wen durchführt und finanziert bzw. welches Mandat ausgeführt werden soll. So stehen zum Beispiel Flüchtlinge unter dem Schutz der internationalen Flüchtlingskonventionen. Migranten/innen kommt dieser Schutz nicht zu. Diese gruppenbezogenen Definitionen und Unterscheidungen haben für die Betroffenen existenzielle Auswirkungen, da es hier nicht selten um ihr Überleben geht. In den aktuellen Krisengebieten wird die Unterscheidung jedoch immer schwieriger, zumal viele Migranten/innen nicht immer ihren Lebensmittelpunkt freiwillig verlassen (vgl. Angenendt o.J., S. 3).
3.3 Integration
Das Wort Integration komm aus dem Lateinischen (integrare) und bedeutet wörtlich übersetzt wiederherstellen oder herstellen eines Ganzen. In diesem Zusammenhang ist es so zu verstehen, dass das Verschiedene zusammengeführt werden soll, wobei das Verschiedene als solches immer kenntlich bleibt. Bei der Integration geht es in erster Linie um die Chancengleichheit in wichtigen Bereichen der Gesellschaft und um die Angleichung der Lebensverhältnisse für solche Personen, die einen Migrationshintergrund haben. Sie sollen an die Verhältnisse der Aufnahmegesellschaft angepasst werden. Im Allgemeinen werden vier Bereiche der Integration unterschieden: die sogenannte strukturelle Dimension, den Zugang zu Kernbereichen der Gesellschaft, (z. B. Bildungssystem und Arbeitsmarkt), die kulturelle Integration (Erlernen der Sprache, Übernahme von Verhaltensweisen und Normen der Aufnahmegesellschaft) und die soziale Integration (Kontakte zwischen Einwanderern und Einheimischen) (vgl. Meier-Braun 2015, S. 33). In der politischen Diskussion wurde Integration oft als Assimilation missverstanden. Assimilation bedeutet, dass die Gruppe der Migranten/innen die eigenen kulturellen und sprachlichen Identitäten aufgeben müssen und sich der neuen Gesellschaft voll und ganz anpassen sollen. Aus diesem Grund bietet der Begriff der Integration viel Raum für Diskussionen und Streitigkeiten (vgl. Meier-Braun 2015, S. 34). Integration ist ein wechselseitiger Prozess zwischen der Aufnahmegesellschaft und den Migranten/innen und Flüchtlingen. Hierbei sollen nicht nur die Einwanderer/innen an die Gesellschaft angepasst werden, sondern auch die einheimische Bevölkerung sollte ihren Beitrag dazu leisten (vgl. Meier-Braun 2015, S. 34).
Gesellschaftliche Integration setzt im Wesentlichen zwei Bedingungen voraus. Das Eine ist die wechselseitige Akzeptanz und Toleranz zwischen den Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft und den Mitgliedern der Migranten/innen. Das Andere betrifft die Gleichbehandlung bzw. Chancengleichheit in den oben genannten vier Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 619). Die jahrzehntelange Festlegung, dass Deutschland kein Einwanderungsland wäre, erschwerte von politischer Seite aus die Integration der Migranten/innen. Diese normative Ansicht wurde erst vor kurzem aufgegeben. Sie verhinderte eine gestaltende und aktive Integrationspolitik und leugnete bis dahin gleichzeitig die Veränderungen der Gesellschaft durch eben diese Zuwanderung (vgl. Kreft & Mielenz 2013, S. 618). Tatsache ist aber, dass allein schon von 1955 bis 1973 ca. 14 Millionen Migranten/innen in die Bundesrepublik kamen und weitere 4,5 Millionen Spätaussiedler/innen aus Südost- und Osteuropa einreisten. Von den 14 Millionen Migranten/innen zogen 11 Millionen wieder zurück. Viele, die sich in der Bundesrepublik eine neue Heimat aufbauten, holten im Rahmen der Familienzusammenführung ihre Angehörigen nach oder gründeten eine neue Familie (vgl. Meier-Braun 2015, S. 35). Aktuell leben in Deutschland rund 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Und dennoch gibt es auch heute wieder viele Streitigkeiten darüber, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht ist (vgl. Meier-Braun 2015, S. 36).
3.4 Inklusion
Im Rahmen der politisch geführten Integrationsdebatte von 2011 kam die Frage auf, wie der Begriff Inklusion, der bekannter weise im Hinblick auf Menschen mit Behinderung verwendet wird, auch die Integrationsdebatte weiterentwickeln kann und ein neues Leitbild für eine inklusive Gesellschaft entstehen könne (vgl. Özdemir 2011). Ziel einer inklusiven Politik ist die Schaffung einer Gesellschaft, in der jedem Menschen die gesellschaftliche Teilhaben möglich ist. Hierbei sollen die Verschiedenheiten und einzelnen Lebensrealitäten nicht an der Mehrheitsgesellschaft angepasst oder abgeändert werden, sondern vielmehr anerkannt, akzeptiert und geschätzt werden bzw. als Gewinn für die Aufnahmegesellschaft betrachtet werden. Jeder Mensch soll demnach unabhängig von seinen persönlichen Merkmalen den gleichen Anspruch auf Würde, einen barrierefreien Zugang zur gesellschaftlichen Infrastruktur und gleiche Rechte auf Teilhabe besitzen dürfen. Eine soziale Ausgrenzung soll damit verhindert werden (vgl. Özdemir 2011).