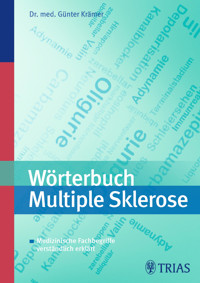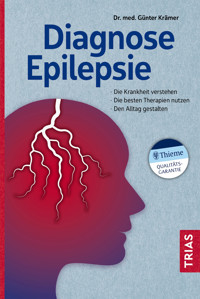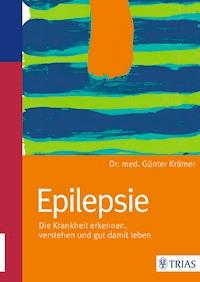
19,99 €
Mehr erfahren.
Werden Sie Experte in Sachen Epilepsie Epilepsie ist weitverbreitet, und über kaum eine Krankheit gibt es so viele Vorurteile. Wissen macht stark im Umgang mit der Krankheit, hier vermittelt es Dr. Günter Krämer, einer der international renommiertesten Experten auf diesem Gebiet. Er erklärt die oft sehr komplexen Zusammenhänge, informiert über Krankheitsursachen, Behandlungsmöglichkeiten und die Herausforderungen des Alltags, mit denen Betroffene und Angehörige umgehen müssen. - Schule, Ausbildung, Beruf - Was ist machbar? Was muss ich in meiner Freizeit, beim Sport und auf Reisen beachten? - Das ist Ihr gutes Recht - Alles über die neueste Sozialgesetzgebung und geltende Rechte. - Ausführlicher Service-Teil - Nützliche weiterführende Informationen. 200 Antworten auf 200 Fragen - Hier erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Epilepsie wissen müssen! Dr. med. Günter Krämer ist Arzt für Neurologie und Medizinischer Direktor des Epilepsie-Zentrums Zürich. Er hat zahlreiche Patientenratgeber zu verschiedenen neurologischen Themen geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Autor
Dr. med Günter Krämer ist Facharzt für Neurologie und seit 1994 Medizinischer Direktor des Schweizerischen Epilepsie-Zentrums in Zürich. Neben wissenschaftlichen Aktivitäten und Mitgliedschaften in vielen nationalen und internationalen Fachgesellschaften (seit 2001 Präsident der Schweizerischen Liga gegen Epilepsie) hat er sich seit vielen Jahren besonders für die Patienteninformationen bei Epilepsien und anderen chronischen neurologischen Krankheiten (Multiple Sklerose und Alzheimer-Krankheit) engagiert.
Dr. med. Günter Krämer
Epilepsie
Die Krankheit erkennen, verstehen und gut damit leben
Inhalt
Zu diesem Buch
Begriffe und Häufigkeit
1. Was sind Anfälle?
2. Was sind epileptische Anfälle?
3. Was sind nichtepileptische Anfälle?
4. Was sind Epilepsien?
5. Was ist ein Syndrom, und was sind Epilepsiesyndrome?
6. Was sind Epilepsie-Krankheiten?
7. Was sind epileptische Enzephalopathien?
8. Wie häufig sind epileptische Anfälle und Epilepsien?
9. Was sind die Lebensaltersabschnitte, in denen eine Epilepsie am häufigsten beginnt?
Nervensystem, Gehirn und Epilepsie
10. Wie sind das Nervensystem und das Gehirn aufgebaut?
11. Welche Spezialisierungen innerhalb des Gehirns gibt es?
12. Welche Aufgaben haben die verschiedenen Teile des Gehirns?
13. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Hälften des Großhirns?
14. Was bedeutet es, dass jede Hirnhälfte für die gegenüberliegende Körperseite zuständig ist?
15. Wie funktionieren die Nervenzellen des Gehirns?
16. Wie stehen Nervenzellen untereinander in Verbindung?
17. Was geschieht bei einem epileptischen Anfall an den Nervenzellen?
18. Was geschieht bei einem epileptischen Anfall im Gehirn?
Anfallsformen
19. Welche unterschiedlichen Formen epileptischer Anfälle gibt es?
20. Was ist das Bewusstsein, und welche Formen einer Bewusstseinsstörung können bei epileptischen Anfällen vorkommen?
21. Was sind fokale Anfälle ohne Bewusstseinsstörung (einfache fokale Anfälle)?
22. Was sind Auren?
23. Was sind fokale Anfälle mit Bewusstseinsstörung (komplexe fokale Anfälle)?
24. Was sind sekundär generalisierte tonisch-klonische (Grand-Mal-) Anfälle?
25. Was sind Absencen?
26. Was sind myoklonische Anfälle?
27. Was sind tonische Anfälle?
28. Was sind epileptische Spasmen?
29. Was sind klonische Anfälle?
30. Was sind primär generalisierte tonisch-klonische (Grand-Mal-) Anfälle?
31. Was sind atonische Anfälle?
32. Was sind epileptische Sturzanfälle?
33. Was sind amorphe Neugeborenenanfälle?
34. Was sind andere seltene Anfallsformen?
35. Was ist ein »konvulsiver« Status epilepticus?
36. Was ist ein »nonkonvulsiver« Status epilepticus?
37. Was sind psychogene nichtepileptische Anfälle?
38. Womit können epileptische Anfälle sonst noch verwechselt werden?
Epilepsieformen
39. Was heißt genetisch, strukturell-metabolisch und unbekannter Ursache?
40. Was sind die wichtigsten Epilepsieformen?
41. Was sind die häufigsten Epilepsieformen in Abhängigkeit vom Lebensalter und Verlauf?
42. Was sind gutartige Epilepsieformen?
43. Was sind schwer behandelbare Epilepsieformen?
44. Was sind die wichtigsten Epilepsieformen bei Neugeborenen?
45. Was ist ein West-Syndrom?
46. Was ist ein Lennox-Gastaut-Syndrom?
47. Was ist eine kontinuierliche Spike-Wave-Aktivität im Schlaf mit langsamen Wellen (CSWS-Syndrom)?
48. Was ist ein Landau-Kleffner-Syndrom?
49. Was sind gutartige okzipitale Epilepsien des Kindesalters?
50. Was ist eine Rolando-Epilepsie oder gutartige Epilepsie des Kindesalters mit zentro-temporalen Spitzen?
51. Was ist eine Rasmussen-Enzephalitis?
52. Was ist eine gutartige fokale Adoleszenten-Epilepsie?
53. Was ist eine kindliche Absencenepilepsie?
54. Was ist eine juvenile Absencenepilepsie?
55. Was ist eine frühkindliche myoklonische (epileptische) Enzephalopathie mit Burst-Suppression im EEG (Ohtahara-Syndrom)?
56. Was ist eine gutartige frühkindliche myoklonische Epilepsie?
57. Was ist eine schwere frühkindliche myoklonische Epilepsie (Dravet-Syndrom)?
58. Was ist eine Epilepsie mit myoklonisch-astatischen Anfällen?
59. Was ist das Syndrom der Lidmyoklonien mit Absencen?
60. Was ist eine Epilepsie mit myoklonischen Absencen?
61. Was ist eine juvenile myoklonische Epilepsie (Janz-Syndrom)?
62. Was ist eine frühkindliche Epilepsie mit generalisierten tonischklonischen Anfällen (frühkindliche Grand-Mal-Epilepsie)?
63. Was ist eine Aufwach-Grand-Mal-Epilepsie?
64. Was ist eine Schlaf-Grand-Mal-Epilepsie?
65. Was ist eine Grand-Mal-Epilepsie ohne tageszeitliche Bindung?
66. Was ist eine Temporallappenepilepsie?
67. Was ist eine Frontallappenepilepsie?
68. Was ist eine Parietallappenepilepsie?
69. Was ist eine Okzipitallappenepilepsie?
70. Was sind Reflexepilepsien?
71. Was sind progressive Myoklonusepilepsien?
Ursachen
72. Welche Tiermodelle für Anfälle und Epilepsien gibt es?
73. Was sind die häufigsten Ursachen von Anfällen und Epilepsien?
74. Was sind die wichtigsten Risikofaktoren für Anfälle und Epilepsien?
75. Welche Rolle kann eine Vererbung spielen?
76. Welche Rolle können frühkindliche Hirnschädigungen spielen?
77. Welche Rolle können Stoffwechselstörungen spielen?
78. Welche Rolle können Entzündungen des Gehirns spielen?
79. Welche Rolle können Durchblutungsstörungen des Gehirns spielen?
80. Welche Rolle können so genannte Gefäßfehlbildungen spielen?
81. Welche Rolle können Hirntumore spielen?
82. Welche Rolle können so genannte kortikale Dysplasien spielen?
83. Welche Rolle können Kopfverletzungen spielen?
84. Welche Rolle können so genannte degenerative Erkrankungen des Gehirns spielen?
85. Welche Rolle können mit einer körperlichen Behinderung einhergehende Erkrankungen spielen?
86. Welche Rolle können mit einer geistigen Behinderung einhergehende Erkrankungen spielen?
Anfallsauslöser
87. Was sind Gelegenheitsanfälle?
88. Was sind fiebergebundene epileptische Anfälle (Fieberkrämpfe)?
89. Welche Rolle kann Schlaf spielen?
90. Welche Rolle kann Schlafentzug spielen?
91. Welche Rolle kann Alkohol spielen?
92. Welche Rolle können andere Drogen spielen?
93. Welche Rolle können Medikamente spielen?
94. Welche Rolle kann die Ernährung spielen?
95. Welche Rolle kann bei Frauen die Periode spielen?
96. Welche Rolle können Impfungen spielen?
97. Wann können Fernsehen oder Videospiele zu Anfällen führen?
98. Wann kann Stress zu Anfällen führen?
99. Was sind andere mögliche Auslöser?
Folgen
100. Was sind die häufigsten Verletzungen durch Anfälle, und wie hoch ist das Unfallrisiko für Menschen mit einer Epilepsie?
101. Wann können epileptische Anfälle zu einem Absterben von Nervenzellen führen?
102. Welche Störungen des Gedächtnisses können vorkommen?
103. Welche psychischen Störungen können vorkommen?
104. Welche Störungen der Hormone und der Sexualität können bei Frauen mit Epilepsie vorkommen?
105. Welche Störungen der Hormone und der Sexualität können bei Männern mit Epilepsie vorkommen?
106. Welche anderen körperlichen Störungen und Begleitkrankheiten können bei einer Epilepsie auftreten?
107. Wieso haben Menschen mit Epilepsie eine leicht verkürzte Lebenserwartung, und woran sterben sie?
108. Was ist ein so genanntes SUDEP-Syndrom?
Untersuchungen
109. Was sind wichtige Merkmale für die Beschreibung von Anfällen?
110. Welche Angaben aus der Vorgeschichte sind wichtig?
111. Warum sind Angaben Dritter oft so wichtig?
112. Welche Angaben aus der Familie sind wichtig?
113. Was kann bei der körperlichen Untersuchung festgestellt werden?
114. Welche Bedeutung können Kopfschmerzen im Zusammenhang mit Anfällen haben?
115. Was ist ein EEG, und was kann damit festgestellt werden?
116. Was sind spezielle EEG-Ableitungen, und was kann damit festgestellt werden?
117. Was ist eine bildgebende Diagnostik?
118. Was ist die Magnetresonanztomographie, und was kann mit ihr festgestellt werden?
119. Was ist die Computertomographie, und was kann mit ihr festgestellt werden?
120. Was ist der so genannte Blutspiegel, und was kann damit festgestellt werden?
121. Was ist eine neuropsychologische Untersuchung, und was kann mit ihr festgestellt werden?
122. Welche anderen Untersuchungen können sinnvoll sein?
123. Was ist eine prächirurgische Abklärung?
Behandlung und Verlauf
124. Was sind die Grundlagen einer wirksamen Epilepsiebehandlung?
125. Wie sollte die Zusammenarbeit mit dem Arzt aussehen?
126. Wann ist das Führen eines Anfalls-, Behandlungs- oder Therapiekalenders sinnvoll?
127. Wie bereitet man sich am besten auf Arztbesuche vor?
128. Wann kann ein Notfallausweis sinnvoll sein?
129. Was sind die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei epileptischen Anfällen?
130. Welche Notfallmedikamente können auch Laien verabreichen?
131. Wann sollte nach einem Anfall ein Arzt gerufen werden?
132. Wann sollte eine notfallmäßige Einweisung in ein Krankenhaus erfolgen?
133. Wann ist eine stationäre Untersuchung oder Behandlung erforderlich?
134. Wann sollte eine medikamentöse Behandlung begonnen werden?
135. Was sind die Grundlagen und Mechanismen der Wirkung von Medikamenten gegen Anfälle?
136. Was ist die Pharmazeutik, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von Medikamenten?
137. Was sind die wichtigsten Medikamente gegen Anfälle?
138. Was sind Originalpräparate, und was ist von so genannten Generika zu halten?
139. Wie werden die wichtigsten Medikamente zur Epilepsiebehandlung eingesetzt?
140. Was sind die häufigsten Nebenwirkungen der wichtigsten Medikamente zur Epilepsiebehandlung?
141. Worin bestehen Vorteile »neuer« im Vergleich zu »alten« Antiepileptika?
142. Wann sind Kontrollen des Blutbilds und anderer Laborwerte erforderlich?
143. Was ist eine Monotherapie, und was ist eine Kombinationstherapie?
144. Was sind wichtige Wechselwirkungen der Antiepileptika untereinander?
145. Was sind wichtige Wechselwirkungen der Antiepileptika mit anderen Medikamenten?
146. Warum kann man die Medikamente nicht nach Bedarf einnehmen?
147. Was kann man tun, um das Vergessen der Einnahme von Medikamenten zu verhindern?
148. Was sollte man tun, wenn man die Einnahme der Medikamente einmal vergessen hat?
149. Warum ist es gefährlich, Medikamente gegen Anfälle plötzlich (versuchsweise) wegzulassen?
150. Was sollte man bei Erbrechen und Durchfall beachten?
151. Wie findet man die richtige Behandlung für sich heraus?
152. Was ist bei Narkosen und Operationen zu beachten?
153. Wann ist eine Behandlung begleitender psychischer Störungen sinnvoll?
154. Was versteht man unter Pharmakoresistenz?
155. Wann kann die Teilnahme an einer so genannten Studie mit einem neuen Medikament sinnvoll sein?
156. Wann kommt eine operative Behandlung infrage?
157. Welche operativen Behandlungsverfahren gibt es?
158. Was ist die Vagusnervstimulation, und wann ist ihre Anwendung sinnvoll?
159. Was versteht man unter einer Selbstkontrolle von Anfällen?
160. Was ist Biofeedback?
161. Was ist eine ketogene Diät?
162. Welche möglichen anderen Behandlungsansätze werden zurzeit untersucht?
163. Welche sonstigen alternativen oder komplementären Methoden gibt es?
164. Wann ist eine Epilepsie ausgeheilt oder geheilt?
165. Wann und wie kann eine medikamentöse Behandlung beendet werden?
Leben mit Epilepsie
166. Welche Vorurteile gegenüber Menschen mit einer Epilepsie gibt es (immer noch)?
167. Warum fällt es vielen Menschen schwer, eine Epilepsie zu akzeptieren und womit haben sie die meisten Probleme?
168. Was ist das Besondere am ersten Anfall?
169. Was versteht man unter Lebensqualität?
170. Was sind Besonderheiten der Eltern-Kind-Beziehung bei Epilepsie, und warum kann »Überbehütung« schädlich sein?
171. Was ist bei einer Partnerschaft zu beachten?
172. Welche Auswirkungen können eine Epilepsie und Antiepileptika auf die Sexualität haben?
173. Was ist bei der Schwangerschaftsverhütung zu beachten?
174. Was ist bei einem Kinderwunsch möglichst schon vor Eintritt der Schwangerschaft zu beachten?
175. Was ist während einer Schwangerschaft zu beachten?
176. Was ist bei einer Geburt zu beachten?
177. Was ist im Wochenbett zu beachten?
178. Was ist beim Stillen zu beachten?
179. Wie sollte man Babysitter informieren, und was ist bei einem Kindergartenbesuch zu beachten?
180. Was ist bei der Schulausbildung zu beachten?
181. Was sind besondere Probleme von Jugendlichen mit Epilepsie?
182. Was ist bei der Berufswahl zu beachten?
183. Welche Berufe kommen bei einer Epilepsie in der Regel nicht in Betracht?
184. Was ist bei Bewerbungen und Einstellungsgesprächen zu beachten?
185. Welche Auswirkungen hat eine Epilepsie auf Fehlzeiten am Arbeitsplatz?
186. Wann kann ein Schwerbehindertenausweis sinnvoll sein?
187. Was sollte sinnvollerweise vor einem Rentenantrag getan werden?
188. Was sind sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen im Alltag?
189. Was ist beim Trinken von Alkohol zu beachten?
190. Was ist beim Fernsehen und bei Videospielen zu beachten?
191. Was ist bei sportlichen Aktivitäten zu beachten?
192. Was ist bei Urlaubsreisen zu beachten?
193. Was ist bei Flugreisen zu beachten?
194. Was ist bei Impfungen zu beachten?
195. Was ist bei einer Malariaprophylaxe zu beachten?
196. Was ist bei der Fahrtauglichkeit zu beachten?
197. Was ist bei Krankenversicherungen zu beachten?
198. Was ist bei sonstigen Versicherungen zu beachten?
199. Wann kann der Besuch von Selbsthilfegruppen sinnvoll sein?
200. Wie kann man im Internet nützliche Informationen finden?
Service-Teil
Adressen, die weiterhelfen
Bücher zum Weiterlesen
Stichwortverzeichnis
Zu diesem Buch
»Wir wissen gerade genug, um unser Unwissen zu verbergen« William Gowers (1907)
Diese Einschätzung stammt aus dem Vorwort des berühmten englischen Neurologen und Epilepsiespezialisten Sir William Gowers (1845–1915) für sein 1907 verfasstes und ein Jahr später auch in deutscher Sprache erschienenes Buch »Das Grenzgebiet der Epilepsie«. Im Prinzip hat sich auch mehr als ein Jahrhundert später noch nicht allzu viel daran geändert: Die genaue Ursache der meisten Epilepsien ist nach wie vor unklar, und auch bei der Behandlung weiß man von den meisten Medikamenten zwar erfreulicherweise, dass sie wirken, ohne aber die teilweise vielfältigen Mechanismen im Einzelnen zu kennen. Wenn also schon die Fachleute in weiten Bereichen noch auf Vermutungen angewiesen sind, wie soll es dann erst den Betroffenen und Laien gehen?
Dennoch ist die Situation für Menschen mit einer Epilepsie heute im Vergleich zu derjenigen vor 100 Jahren viel günstiger geworden. Der Hauptgrund, mich schon als Assistenzarzt besonders intensiv mit den Epilepsien zu beschäftigen und an einer Neurologischen Universitätsklinik eine spezielle Sprechstunde (eine so genannte Anfallsambulanz oder Epilepsiesprechstunde) aufzubauen, bestand darin, dass den Betroffenen im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen des Nervensystems oft sehr wirkungsvoll geholfen werden kann. Dabei muss man sich allerdings die Mühe machen, die Besonderheiten jedes einzelnen Menschen, nicht nur bezüglich seiner Anfälle und Epilepsie, herauszufinden und bei der Beratung und Behandlung zu beachten. Es gibt nicht »die« Epilepsie, die mit »dreimal einer Tablette« eines Standardmedikaments erfolgreich behandelt werden kann, sondern sehr viele unterschiedliche Epilepsien, die auch jeweils eine andere Behandlung benötigen!
Das Wissen über Epilepsie wächst von Jahr zu Jahr. Bei wenigen anderen neurologischen Erkrankungen sind die Fortschritte sowohl bei der Erkennung möglicher Ursachen als auch bei den Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren derart ermutigend wie bei den Epilepsien. Bei den Untersuchungen haben insbesondere die beeindruckenden Fortschritte bei der Erkennung und Zuordnung erblicher Störungen als auch die Verbesserungen der so genannten bildgebenden Diagnostik dazu beigetragen, dass der Anteil ursächlich nicht zuzuordnender Erkrankungen immer kleiner wird. Für die Behandlung stehen immer mehr gut wirksame und insbesondere besser verträgliche Medikamente zur Verfügung, und einem Teil der Betroffenen, bei denen Medikamente allein nicht zum gewünschten Erfolg führen, kann durch Operationen am Gehirn geholfen werden. Außerdem wurden teilweise durchaus Erfolg versprechende Erfahrungen mit nichtmedikamentösen Behandlungsverfahren gemacht.
Acht Jahre nach der dritten Auflage (mit einem unveränderten Nachdruck) und 15 Jahre nach der ersten Auflage erscheint hiermit eine erneut überarbeitete und aktualisierte Fassung dieses Buches für Menschen mit Epilepsie und andere an diesem Thema Interessierte. Im Vergleich zur dritten Auflage ist die Zahl der Fragen (und entsprechenden Antworten) unverändert geblieben. Als Ergänzung zu dem vorliegenden Buch habe ich ebenfalls im TRIAS Verlag ein Fach- und Fremdwörterbuch verfasst, in dem nicht nur unmittelbar die Epilepsie betreffende Fachausdrücke, sondern auch einige aus benachbarten Fachgebieten erläutert werden (»Epilepsie von A–Z. Medizinische Fachwörter verstehen«, 4. und bislang letzte Auflage 2005). Insbesondere für Eltern epilepsiekranker Kinder, Lehrer und andere Bezugspersonen steht auch vom TRIAS Verlag ein Buch des Kinderarztes Dr. Hansjörg Schneble zur Verfügung (»Epilepsie bei Kindern: Wie Ihre Familie damit leben lernt«, 1999), darüber hinaus ein weiteres Buch über die so genannte ketogene Diät (Petra Platte, Christoph Korenke: »Epilepsie: Neue Chancen mit der ketogenen Diät«, 2005). Weitere Bücher, Broschüren und Zeitschriften mit unterschiedlichen Schwerpunkten sind am Ende des Buches (siehe → S. 399) zusammengestellt. Für nur an den wichtigsten Fragen interessierte Leser gibt es eine deutlich kürzere Version (»Diagnose Epilepsie. Kurz & bündig. Wie Sie die Krankheit verstehen, die besten Therapien für sich nutzen und Ihren Alltag optimal gestalten«, 2. Auflage, TRIAS Verlag 2013).
Das Buch ist für »Betroffene« gedacht, unabhängig davon, ob sie selbst an Epilepsie erkrankt sind oder ein Angehöriger beziehungsweise eine andere Bezugsperson. Es richtet sich sowohl an Neuerkrankte, bei denen kürzlich die Diagnose einer Epilepsie gestellt wurde und die jetzt wissen wollen, wie es weitergeht und was möglicherweise auf sie zukommt, als auch an Menschen, die schon länger betroffen sind und über einige Aspekte genauer Bescheid wissen möchten. Immer noch weit verbreitete Vorurteile gegenüber Epilepsien – wie zum Beispiel eine Einordnung als Geisteskrankheit oder als eine zwangsläufig zur Behinderung führende Erkrankung – führen zu vielen Ängsten und Befürchtungen, mit denen man sich auseinander setzen muss. Insgesamt ist das Buch systematisch aufgebaut und ein Lesen der früheren Kapitel erleichtert zumeist das Verständnis der späteren. Häufige Querverweise im Text ermöglichen aber ein Einsteigen an fast jeder beliebigen Stelle. Für kritische Kommentare bin ich nicht zuletzt im Hinblick auf weitere Auflagen stets dankbar.
Wegen der besseren Lesbarkeit spreche ich der Einfachheit halber in der Regel von dem Arzt oder dem Betroffenen beziehungsweise Patienten, ohne damit irgendeine Geschlechtsbevorzugung zum Ausdruck bringen zu wollen. Obwohl sich meine Angaben soweit als möglich auf abgesicherte Forschungsergebnisse stützen, wird manches nicht unbedingt die Zustimmung aller Fachleute oder auch Betroffenen finden. Die in diese Neuauflage eingearbeiteten Vorschläge einer Kommission der Internationalen Liga gegen Epilepsie zur diagnostischen Beschreibung von Menschen mit Epilepsie werden ebenso wie bei Fachleuten sicherlich auch unter den Betroffenen noch für Diskussionen sorgen.
Dieses Buch wäre nicht ohne die Anregungen und Hilfe einer Reihe von Menschen entstanden, bei denen ich mich herzlich bedanken möchte. In erster Linie sind dies von mir betreute Menschen mit einer Epilepsie, die mir ihr Vertrauen entgegengebracht haben. Durch ihre Erzählungen und Beschreibungen habe ich mehr über epileptische Anfälle und Epilepsien gelernt als aus manchen Fachbüchern. Bei Herrn Willi Näf bedanke ich mich für die Erlaubnis, einen Teil seines Erlebnisberichtes über seinen ersten »großen« Anfall abdrucken zu dürfen. Es wäre schön, wenn viel mehr Betroffene mit ihrer Epilepsie so offen und gleichzeitig sowohl kritisch-interessiert als auch hurmorvoll-amüsant umgehen könnten.
Frau Diplom-Psychologin Irmtraud Teschner (früher am Sächsischen Epilepsiezentrum Radeberg in Kleinwachau bei Dresden), einer Expertin der Hypnosetherapie bei Epilepsie, danke ich für die Erlaubnis, zwei Texte von ihr zur Selbstkontrolle von Anfällen abdrucken zu dürfen. Meinem Mitarbeiter Ian Mothersill, M. Sci, danke ich für die Unterstützung bei den → Abbildungen 15 bis 17 sowie 27 und meinem Mitarbeiter Dr. Peter Hilfiker für die Textvorlage zur Frage 200 (→ S. 392–395). Frau Simone Claß von der TRIAS-Programmplanung danke ich für ihre Sorgfalt und Geduld. Schließlich geht mein Dank für ihr Verständnis und ihre Unterstützung wie immer an meine Frau Doris, unsere Tochter Judith sowie unseren Sohn Dirk.
Zürich, im Januar 2013 Günter Krämer
Begriffe und Häufigkeit
1. Was sind Anfälle?
Anfälle sind plötzlich auftretende Zustands- oder Verhaltensänderungen, die die Gesundheit oder das Wohlbefinden stören und im Verlauf einer chronischen Erkrankung oder Störung wiederholt auftreten können. Beispiele für entsprechende körperliche Störungen sind neben epileptischen Anfällen, die im nächsten Abschnitt und später im Buch noch genauer besprochen werden, Asthma-, Herz-, Husten-, Migräne- oder auch Schlaganfälle. Alle diese Störungen treten plötzlich auf und hinterlassen mit Ausnahme von Schlaganfällen meist keine dauerhaften Folgen.
Anfälle können körperliche oder psychische (»seelische«) Ursachen haben. Auf einige körperlich bedingte nichtepileptische Anfälle, die mit epileptischen Anfällen verwechselt werden können, wird an anderer Stelle noch etwas ausführlicher eingegangen (siehe →S. 18). Beispiele für psychische Anfälle sind zunächst einmal epileptischen Anfällen ähnelnde, so genannte psychogene nichtepileptische Anfälle (siehe →S. 83). Weitere Beispiele sind Lach- oder Wutanfälle, die in jedem Lebensalter vorkommen können (allerdings können selten Lachen und noch seltener Wutausbrüche auch einmal Zeichen epileptischer Anfälle sein!). Nichtepileptische körperliche oder psychische Anfälle sind insgesamt deutlich häufiger als epileptische Anfälle.
Obwohl auch in diesem Buch oft der Einfachheit halber nur kurz von Anfällen gesprochen wird, sollte man also immer daran denken, dass ein Anfall keineswegs zwangsläufig mit einem epileptischen Anfall gleichzusetzen ist. Es gibt sehr viele andere Erkrankungen und Störungen, die mit Anfällen einhergehen. Dies sollte Anlass zur Vorsicht sein, nach einem oder auch mehreren »Anfällen« nicht vorschnell von einer Epilepsie zu sprechen. Bei bis zu jedem fünften Patienten, der oft nach vielen Jahren mit erfolgloser Behandlung einer vermeintlichen Epilepsie einem speziellen Epilepsiezentrum zugewiesen wird, liegt überhaupt keine Epilepsie vor! Darüber hinaus können auch Menschen mit einer bekannten Epilepsie zusätzliche andere Anfallsformen haben, die nichts mit ihrer Epilepsie zu tun haben.
2. Was sind epileptische Anfälle?
Eine allgemein gültige und für alle Anfallsformen zutreffende Beschreibung epileptischer Anfälle könnte folgendermaßen lauten: Epileptische Anfälle sind relativ kurz dauernde, plötzlich auftretende und unwillkürlich ablaufende Änderungen des Bewusstseins, Verhaltens, Wahrnehmens, Denkens, Gedächtnisses oder der Anspannung der Muskulatur aufgrund einer vorübergehenden Funktionsstörung von Nervenzellen im Gehirn in Form kurz dauernder, vermehrter und gleichzeitig erfolgender Entladungen von Nervenzellen (siehe →S. 46). Diese Definition ist zwar richtig, aber viel zu lang, um sie behalten und im Alltag verwenden zu können. Man kann epileptische Anfälle deswegen vereinfachend auch als vorübergehende Funktionsstörung von Nervenzellen des Gehirns aufgrund vermehrter gleichzeitiger Entladungen definieren, wobei die Auswirkungen beziehungsweise Störungen davon abhängen, welche Aufgabe die beteiligten Nervenzellen normalerweise haben.
Viele Menschen glauben, es sei ganz einfach, einen epileptischen Anfall zu beschreiben. Jemand stoße aus heiterem Himmel einen Schrei aus, verliere das Bewusstsein, werde steif, beiße sich gegebenenfalls auf die Zunge und falle um. Er halte den Atem an und werde blau, »krampfe« oder zucke für eine gewisse Zeit an Armen und Beinen, bis er vor Erschöpfung in eine Art Tiefschlaf falle. Hinterher klage er unter Umständen über Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Schwindel oder Muskelkater; manchmal komme es auch zu einem unwillkürlichen Urinabgang. Es stimmt zwar, dass diese Beschreibung für eine Form epileptischer Anfälle (den so genannten Grand-Mal-Anfall oder generalisierten tonisch-klonischen Anfall, siehe →) zutrifft, aber diese Anfallsform ist nur eine von vielen und nicht unbedingt die häufigste. Ein bewährter Merksatz lautet: Nicht alles was zuckt, ist ein epileptischer Anfall, und bei einem epileptischen Anfall muss man nicht zucken!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!