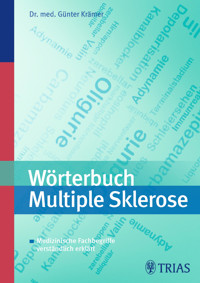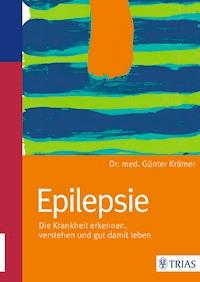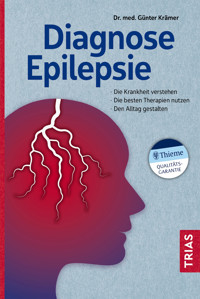
19,99 €
Mehr erfahren.
Erkrankung mit vielen Gesichtern
Epilepsien sind weit verbreitet: Über 800 000 Menschen sind im deutschsprachigen Raum betroffen. Die Diagnose trifft viele unvorbereitet. Schon kurze "Aussetzer" können Anzeichen einer Epilepsie sein, nur bei manchen tritt ein "großer" Krampfanfall auf.
Verstehen, wovon der Arzt spricht
Dieser Ratgeber informiert über Ursachen, unterschiedliche Anfallsformen, den Verlauf der Krankheit und die Aussicht auf Anfallsfreiheit. Der Autor erklärt, welche Untersuchungen sinnvoll sind und beschreibt die aktuellsten und wirksamsten Behandlungen.
So meistern Sie Ihr Leben selbstbewusst und stark
Mit einer Epilepsie lässt es sich meist gut leben. Viele Tipps zu Sport, Freizeitgestaltung, Führerschein, Fernsehen, Alkohol usw. geben Ihnen Sicherheit und Zuversicht im Alltag. Auch Fragen zur Lebensplanung wie Berufswahl und Familiengründung kommen nicht zu kurz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Diagnose Epilepsie
· Die Krankheit verstehen · Die besten Therapien nutzen · Den Alltag gestalten
Dr. med. Günter Krämer
3. Auflage 2021
Vorwort
Fast zehn Jahre nach Erscheinen der »Diagnose Epilepsie« halten Sie nun eine aktualisierte Auflage in Händen. Sie ist aus dem Bedürfnis heraus entstanden, eine kurzgefasste Darstellung der wichtigsten Aspekte von Epilepsien zur Verfügung zu stellen. Mein inzwischen in vierter Auflage vorliegendes Buch »Das große TRIAS-Handbuch Epilepsie« (TRIAS Verlag 2013, im Druck) ist im Vergleich zu dem vorliegenden Titel mehr als doppelt so umfangreich. Viele Leserinnen und Leser haben auf mein Nachfragen zwar verneint, dass dieses Buch für den an schnell verfügbaren Fakten interessierten »Durchschnittsleser« zu umfassend und mit zu viel Hintergrundwissen vollgepackt sei. Ich vermute jedoch, dass diese Einschätzung in erster Linie darauf beruht, dass die von mir Befragten meist überdurchschnittlich interessierte Mitglieder von Epilepsie-Selbsthilfegruppen waren. So passten ein bei mir selbst gewachsenes Bedürfnis und eine Anregung des Verlages zueinander, ein ergänzendes, sowohl kompakteres als auch vermehrt grafisch aufbereitetes Epilepsiebuch vorzulegen.
Ziel dieses Buches ist nicht, ein »Lehrbuch für Laien« vorzulegen. Es soll vielmehr unter Verzicht auf Selteneres eine knappe Orientierung zu den wichtigsten Fragen ermöglichen. Bei den häufigsten Anfalls- und Epilepsieformen erfolgt jeweils eine Besprechung aller wichtigen Aspekte ohne Notwendigkeit, beispielsweise zu den Ursachen, den erforderlichen Untersuchungen und zur Behandlung, an drei verschiedenen Stellen des Buches nachschlagen zu müssen. Beim Schreiben habe ich der Einfachheit halber in der Regel von »dem« Arzt gesprochen. Damit soll natürlich keinerlei Geschlechtsbevorzugung zum Ausdruck gebracht werden. Ergänzend zu den beiden genannten Titeln habe ich ebenfalls im TRIAS Verlag »Der erste epileptische Anfall« (TRIAS Verlag, 2006) herausgebracht. Dieses Buch wendet sich in erster Linie an Betroffene nach dem erstmaligen Auftreten eines Anfalls.
Mein Dank geht wie immer an meine Frau Doris, unsere Tochter Judith und unseren Sohn Dirk. Ohne sie hätte vieles in meinem Leben keinen Sinn.
Zürich, im Juni 2012 Günter Krämer
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort
Was Sie wissen sollten
Warum gerade ich?
Die wichtigsten Begriffe
Unterschiedliche Anfallsformen
Zeichen epileptischer Anfälle
Wie ein epileptischer Anfall abläuft
Die Folgen eines epileptischen Anfalls
Häufigkeit und Alter beim Beginn
Der erste Anfall
Der erste Anfall ist nicht unbedingt der Beginn einer Epilepsie
Erster Anfall oder erster beobachteter Anfall?
Beim Arzt
Behandlung beginnen oder abwarten
Ursachen und Auslöser
Die häufigsten Ursachen von Anfällen und Epilepsien
Genetische Anfälle und Epilepsien
Strukturelle und metabolische Epilepsien und Epilepsien unbekannter Ursache
Gelegenheitsanfälle
Was einen Gelegenheitsanfall auslöst
Fiebergebundene epileptische Anfälle (»Fieberkrämpfe«)
Komplizierte fiebergebundene Anfälle
So untersucht der Arzt
Behandlung und Vorsorgemaßnahmen
Vorsorgliche medikamentöse Dauerbehandlung selten erforderlich
Der Verlauf
Ist Epilepsie eine Erbkrankheit?
Wie hoch ist das Epilepsierisiko für Kinder von Eltern mit Epilepsie?
Wie hoch ist das Epilepsierisiko für die Geschwister?
Kopfverletzungen und Epilepsie
Das Risiko einer Epilepsie nach einer Kopfverletzung
Risikofaktoren für posttraumatische Anfälle
Die Behandlung mit Medikamenten
Hirntumoren und Epilepsie
Hirntumoren als Ursache von epileptischen Anfällen und Epilepsien
Die Rolle des Lebensalters
Verschiedene Tumorarten
Behandlung und Verlauf
Entzündungen des Gehirns und Epilepsie
Durchblutungsstörungen des Gehirns und Epilepsie
Altersepilepsien
Der zeitliche Zusammenhang zwischen Durchblutungsstörung und Epilepsie
Medikamentöse Behandlung
Häufige Anfallsformen
Absencen
So verlaufen die Anfälle
Meist lässt sich keine Ursache finden
Alter beim erstmaligen Auftreten
Absencen beginnen meistens im Schulalter
Absencen können auch erstmals bei Jugendlichen oder Erwachsenen auftreten
Fokale Anfälle ohne Bewusstseinsstörung
Jackson-Anfälle
Sensible fokale Anfälle ohne Bewusstseinsstörung (»sensible Herdanfälle«)
Sensorische fokale Anfälle ohne Bewusstseinsstörung
Vegetative oder autonome fokale Anfälle ohne Bewusstseinsstörung
Fokale Anfälle ohne Bewusstseinsstörung mit psychischen Symptomen
Fokale Anfälle mit Bewusstseinsstörung
So verläuft der Anfall
Störung des Bewusstseins
Automatismen
Anfallsdauer
Wie beginnt ein Anfall?
Anfallsursprung und Ursachen
Beteiligte Abschnitte des Gehirns
Kombination mit anderen Anfallsformen
Ursachen
Generalisierte tonisch-klonische (»Grand-mal«-) Anfälle
So verläuft der Anfall
Tonische Phase
Klonische Phase
Nachphase
Ursachen
Primär generalisierte tonisch-klonische Anfälle
Sekundär generalisierte tonisch-klonische Anfälle
Untersuchungen
Behandlung und Verlauf
Status epilepticus
Formen von Status epileptici
Konvulsiver Status generalisierter tonisch-klonischer Anfälle (Grand-mal-Status)
Nichtkonvulsiver generalisierter Status epilepticus (Absencenstatus [Petit-mal-Status, Spike-wave-Stupor])
Status fokaler Anfälle ohne Bewusstseinsstörung
Epilepsia partialis continua
Status nichtkonvulsiver fokaler Anfälle ohne Bewusstseinsstörung
Status fokaler Anfälle mit Bewusstseinsstörung (komplex-fokaler Status, psychomotorischer Status)
Ursachen
Alter beim erstmaligen Auftreten
Wichtige Epilepsieformen
West-Syndrom
So können die Anfälle verlaufen
Häufigere Ursachen
Strukturell/metabolisches West-Syndrom
West-Syndrom unbekannter Ursache
Genetisches West-Syndrom
Alter beim erstmaligen Auftreten
Untersuchungen
Gibt es weitere Menschen mit Epilepsien in der Familie?
Der körperliche Untersuchungsbefund ist meist auffällig
Das EEG zeigt immer typische Veränderungen
Blut- und Urinuntersuchungen
Bildgebende Untersuchungen des Gehirns
Behandlung und Verlauf
Lennox-Gastaut-Syndrom
Häufige Anfallsformen beim LGS
Häufigere Ursachen
Strukturelles oder metabolisches Lennox-Gastaut-Syndrom
Untersuchungen
Der körperliche Untersuchungsbefund ist meist auffällig
Das EEG zeigt immer typische Veränderungen
Weitere Untersuchungen sind meist nötig
Behandlung und Verlauf
Rolando-Epilepsie
So verlaufen die Anfälle
Alter beim erstmaligen Auftreten
Untersuchungen
Sehr häufig gibt es Angehörige mit Epilepsien
Meist normale Untersuchungsbefunde
Eindrucksvolle EEG-Veränderungen
Behandlungserfolg und Verlauf
Absencenepilepsien
Kindliche Absencenepilepsie
Juvenile Absencenepilepsie
Juvenile myoklonische Epilepsie
So verlaufen die Anfälle
Meist lässt sich keine Ursache finden
Alter beim erstmaligen Auftreten
Untersuchungen
Häufig gibt es weitere Menschen mit Epilepsien in der Familie
Der körperliche Untersuchungsbefund ist normal
Das EEG zeigt meist typische Veränderungen
Weitere Untersuchungen sind nur ausnahmsweise nötig
Behandlung und Verlauf
Temporallappenepilepsie
Anfallsformen
Häufigkeit
Ursachen
Anfallsformen
Behandlung und Verlauf
Möglichkeit einer chirurgischen Behandlung früh prüfen!
Untersuchungen
Die Vorgeschichte
Die Eigenanamnese
Die Fremdanamnese
Das Elektroenzephalogramm (EEG)
Die Aufzeichnung der Messungen
Ein EEG ist völlig harmlos und schmerzfrei
Maßnahmen zur Erhöhung der Aussagekraft
Was kann man im EEG sehen?
Wann sollte ein EEG abgeleitet werden?
Bildgebende Untersuchungen
Magnetresonanztomographie
So verläuft die Untersuchung
Blutspiegelbestimmung
Wovon hängt der Blutspiegel ab?
Der Referenzbereich
Die neuropsychologische Untersuchung
Was prüfen die Tests?
Die Untersuchung psychischer Störungen
Psychische Störungen zwischen den Anfällen
Depressionen
Ängstlichkeit
Aufmerksamkeitsstörungs- und Hyperaktivitätssyndrom
Reizbarkeit und Aggressivität
Behandlung
Grundlagen der medikamentösen Behandlung
Das Für und Wider von Medikamenten
Das Ziel einer medikamentösen Behandlung
Die Wahl des richtigen Medikaments
Jedes Medikament sollte »ausdosiert« werden!
Mono- und Kombinationstherapie
Die unbeliebten Medikamente
Was kann man tun, wenn man die Medikamente einmal vergessen hat?
Das Wichtigste über Medikamente gegen Anfälle
Antiepileptika
So werden Antiepileptika angewendet
Wichtige Hinweise zur Dosierung von Antiepileptika
Die Einnahme zusammen mit anderen Medikamenten
Das Absetzen von Antiepileptika
Die wichtigsten Nebenwirkungen von Medikamenten gegen Anfälle
Nebenwirkungen und die Dosis
Möglichkeiten der Epilepsiechirurgie
Für wen kommt die Epilepsiechirurgie infrage?
Die Therapie mit Medikamenten ist allein nicht ausreichend wirksam
Alle Anfälle gehen von einer Stelle aus
Möglichst früh operieren!
Erforderliche Untersuchungen
Chancen der Behandlung
Nichtmedikamentöse und »komplementäre« Behandlungsmethoden
Selbstkontrolle bei Epilepsie
Biofeedback
Ketogene Diät
Leben mit Epilepsie
Sexualität
Kann eine Epilepsie Einfluss auf die Sexualität haben?
Kann Geschlechtsverkehr epileptische Anfälle auslösen und wann sollte man den Partner über seine Epilepsie informieren?
Kann eine Epilepsie das sexuelle Verlangen verringern?
Haben die Antiepileptika Auswirkungen auf die Sexualität?
Was kann bei entsprechenden Nebenwirkungen getan werden?
Wo findet man Hilfe bei Problemen mit der Sexualität?
Hat die Periode Einfluss auf die Anfälle?
Hat die Antibabypille einen Einfluss auf die Anfälle?
Haben die Antiepileptika Einfluss auf die Antibabypille?
Kinderwunsch
Wie hoch ist das Vererbungrisiko?
Gibt es vermehrt Anfälle in der Schwangerschaft?
Besteht das Risiko einer Fehlbildung des Kindes durch Antiepileptika?
Was müssen Mütter bei der Geburt beachten?
Ist Stillen trotz einer Epilepsie möglich?
Schule
Vorurteile gegenüber Kindern mit Epilepsie
Auch Kinder mit Epilepsie sollten an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen
Beruf
Leistungsfähigkeit, Fehlzeiten und Unfälle
Epilepsiemerkmale und Berufstätigkeit
Was soll man den Kollegen erzählen?
Was tun bei Problemen am Arbeitsplatz?
Urlaubsreisen
Vor der Reise
Reisezeit und Buchung
Reiseziel und Unterkunft
Alleine oder in Begleitung?
Essen und Trinken
Zusätzliche Versicherung erforderlich?
Flugreisen und Zeitverschiebung
Medikamente
Immer ausreichend Vorrat mitnehmen!
Aktivitäten am Urlaubsort
Alkohol
Was kann Alkohol bewirken?
Trinken großer Flüssigkeitsmengen
Alkoholentzugsanfälle
»Alkoholepilepsie«
Fernsehen und Videospiele
Flickerndes Licht und »Fotosensibilität«
Lichtreize im Alltag
Vermehrte Lichtempfindlichkeit in der Kindheit und Jugend
Fernsehen
Videospiele
Sport
Folgen körperlicher Anstrengung
Schul- und Vereinssport
Eine mögliche Gefährdung einschätzen
Geeignete und ungeeignete Sportarten
Wettkämpfe und Leistungssport
Besonderheiten des Wassersports
Kraftfahrtauglichkeit
Die rechtliche Situation
Empfehlungen von Dr. med. Günter Krämer
Deutschland
Österreich
Schweiz
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
Was Sie wissen sollten
Wird die Diagnose Epilepsie gestellt, tauchen viele Fragen auf. Dabei ist die Kenntnis einiger medizinischer Grundlagen hilfreich, um sich mit der Krankheit zurechtzufinden.
Der erste epileptische Anfall
Warum gerade ich?
Warum gerade ich? »Warum unser Angehöriger?« »Warum gerade mein/unser Kind?« Solche Fragen nach der Ursache drängen sich auf, wenn die Diagnose »Epilepsie« gestellt wird. Allerdings ist der genaue Grund für die meisten Epilepsien noch immer unbekannt, und trotz allen Fortschritts mit immer exakter werdenden Untersuchungsmöglichkeiten kommt es nach wie vor häufiger vor, dass der Arzt am Ende der Untersuchungen keine eigentliche Ursache gefunden hat. Selbst wenn diese Auskunft zunächst frustrierend sein kann, so bedeutet sie doch zumindest, dass am Gehirn keine Schäden zu erkennen sind, die für seine zeitweisen »Aussetzer« verantwortlich sind.
Hingegen finden sich häufiger bestimmte Hinweise, wie etwa »Zeichen einer erhöhten zerebralen Erregbarkeit« oder sogar »epilepsietypische Potenziale« im Elektroenzephalogramm (EEG; siehe S. ▶ 50 ), die je nach Lebensalter auch schon eine Antwort auf die Frage nach der zugrunde liegenden Ursache geben können. Besonders bei Kindern sind bestimmte EEG-Muster verlässliche Hinweise darauf, dass es sich um eine erbliche bzw. »genetische« Epilepsie handelt. Dies muss aber keineswegs bedeuten, dass die Eltern eine Epilepsie haben oder gehabt haben müssen, obwohl sich bei sorgfältiger Nachforschung in der weiteren Familie häufiger andere Betroffene finden. Erfreulicherweise sind diese »erblichen« Epilepsien fast ausnahmslos medikamentös leicht behandelbar und haben darüber hinaus eine starke Tendenz, spätestens bis zum Erreichen des Erwachsenenalters von alleine auszuheilen (»sich auszuwachsen«).
Wissen
Auch mit der derzeit empfindlichsten Untersuchungsmethode zur Abklärung der Ursache einer Epilepsie, der sogenannten Magnetresonanztomographie, lässt sich nur bei etwa 30–40 % der Menschen, bei denen eine Epilepsie festgestellt wird, die Ursache herausfinden.
In jedem Lebensalter können Hirntumoren oder die Folgen von Schlaganfällen oder Kopfverletzungen Ursachen sein. Daneben kommen auch entzündliche Krankheiten des Gehirns oder Folgezustände von schon von Geburt an vorhandenen Fehlbildungen in Frage (siehe folgende Abbildung).
Geht man bei einem durchschnittlichen Risiko an Epilepsie zu erkranken von einem angenommenen Wert 1 aus, so zeigt sich in einer Übersicht, dass bestimmte Faktoren, wie etwa eine Kopfverletzung oder Hirnhautentzündung das Erkrankungsrisiko deutlich steigern. Am auffälligsten ist dies bei einer Steigerung fast um den Faktor 600 für Schussverletzungen des Gehirns, die ja aber Gott sei Dank sehr selten sind.
Mögliche Ursachen von Epilepsien.
(Zeichnung: Heike Hübner, Berlin)
wichtig
In jedem Fall sollten Betroffene sich so früh wie irgend möglich von dem Gedanken befreien, dass sie selbst für ihre Epilepsie, für die ihres Angehörigen oder für die ihres Kindes verantwortlich sind. Derartige Schuldgefühle sind bis auf ganz seltene Ausnahmen – wenn jemand sich z. B. im Rahmen eines Alkoholrausches eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat – völlig unbegründet und stellen eine überflüssige Belastung dar.
Eine häufige Ursache von epileptischen Anfällen ist bei Kindern bis zum fünften Lebensjahr hohes Fieber. Diese »Fieberkrämpfe« sind jedoch in aller Regel nur auf das Kleinkindalter beschränkte sogenannte Gelegenheitsanfälle (siehe S. ▶ 10 ), und nur bei etwa 2–3 % dieser Kinder kommt es später auch zu einer Epilepsie. Bei Jugendlichen und Erwachsenen gilt Ähnliches für die im Zusammenhang mit Schlafentzug und Alkoholmissbrauch auftretenden Anfälle.
Risikofaktoren für das Auftreten einer Epilepsie.
Darüber hinaus hängt die Frage nach der (wahrscheinlichsten) Ursache einer Epilepsie sehr von individuellen Faktoren ab, in erster Linie vom Lebensalter, der Anfallsart und dem Erdteil, in dem man lebt:
Alter bei Beginn
Neugeborene: oft Sauerstoffmangel des Gehirns unter der Geburt oder Stoffwechselstörungen
Klein- und Schulkinder: am häufigsten genetisch bzw. erblich (mit-)bedingt
Erwachsene: zahlreiche verschiedene Ursachen möglich
höheres Lebensalter: Durchblutungsstörungen des Gehirns
Anfallsart
generalisierte, von Anfang an beide Großhirnhälften beteiligende Anfälle: eher keine umschriebene Hirnschädigung
fokale, nur einen umschriebenen Teil des Gehirns beteiligende Anfälle: wahrscheinlich umschriebene Hirnschädigung
Wohnort/Land:
Während dies in Mitteleuropa eine absolute Rarität ist, stellt die häufigste Ursache von Epilepsien in manchen afrikanischen Ländern eine Malaria mit Beteiligung des Gehirns dar, und in manchen südamerikanischen Ländern gilt dies – aufgrund schlechter hygienischer Verhältnisse – für einen Befall des Gehirns mit Larven des Schweinebandwurms!
Die wichtigsten Begriffe
Es gibt mehr als zehn verschiedene Formen epileptischer Anfälle und noch weitaus mehr Formen von Epilepsien, auch weil diese mit einer Kombination mehrerer verschiedener Anfallsformen einhergehen können. Jeder betroffene Mensch hat in der Regel nur eine Epilepsieform mit einer bis drei Anfallsformen. Die Abstände zwischen den einzelnen Anfällen können zwischen Sekunden, Jahren und sogar Jahrzehnten schwanken.
Wissen
Epileptische Anfälle sind Ausdruck kurz andauernder, verstärkter und sich gegenseitig aufschaukelnder Entladungen von Nervenzellen im Gehirn und kommen rund hundertmal häufiger vor als Epilepsien. Von einer Epilepsie spricht man erst bei einer Neigung zu wiederholten epileptischen Anfällen (entweder einem Anfall mit erkennbarem hohen Wiederholungsrisiko oder mindestens zwei Anfällen im Abstand von mehr als 24 Stunden) ohne erkennbare Erklärung für den Zeitpunkt ihres Auftretens.
Unterschiedliche Anfallsformen
Epileptische Anfälle können sehr unterschiedlich aussehen. Sie können ohne Schrei und Bewusstlosigkeit einhergehen, ohne Steifwerden, Zungenbiss und Umfallen, ohne Blauwerden und »Krampfen«. Sie können so harmlos sein, dass weder die Betroffenen selbst irgendetwas davon mitbekommen noch anderen Menschen etwas auffällt, wenn sie bei einem Anfall anwesend sind. Einziges Zeichen eines epileptischen Anfalls kann beispielsweise eine eigenartige Geschmacksempfindung, eine Unaufmerksamkeit von wenigen Sekunden oder ein kurzes Kribbeln in einem Arm sein.
wichtig
Epileptische Anfälle können ganz verschieden aussehen und auch ablaufen, ohne dass der Betroffene oder seine Umgebung etwas davon merken.
Zeichen epileptischer Anfälle
Jede Nervenzelle und jeder Nervenzellverband im Gehirn kann »epileptisch« werden, was dazu führt, dass sie in ihrer normalen Tätigkeit gestört oder unterbrochen werden. Wenn die Zellen etwa für Wahrnehmungen im Bauch zuständig sind, kann es zu einem eigenartigen Gefühl in der Magengrube kommen, das sich typischerweise von dort über die Speiseröhre nach oben bis hin zum Kopf ausbreitet. Sind die Nervenzellen für die Geruchsempfindung verantwortlich, kommt es zu einer Riechstörung; sind sie für das Sehen verantwortlich, kann es beispielsweise zu Wahrnehmungen von Blitzen oder anderen Lichtreizen kommen. Sind die Nervenzellen am Gedächtnis beteiligt, drückt sich dies in einer Störung des Lernens und gegebenenfalls auch in einer Unterbrechung des Bewusstseins mit hinterher bestehender Erinnerungslücke aus.
Wissen
Einfach gesagt sind epileptische Anfälle Ausdruck einer vorübergehenden Funktionsstörung von Nervenzellen, wobei die Auswirkungen des Anfalls davon abhängen, welche Aufgaben die beteiligten Nervenzellen normalerweise haben. Jedes Lebewesen, das ein Gehirn hat, kann epileptische Anfälle bekommen.
Wie ein epileptischer Anfall abläuft
Was genau im Gehirn zu Beginn eines epileptischen Anfalls passiert bzw. was als unmittelbare Ursache des Anfalls angesehen werden kann, ist größtenteils noch unbekannt. Die meisten Nervenzellen entladen oder »feuern« normalerweise relativ langsam oder auch längere Zeit überhaupt nicht. Eine »epileptisch« gewordene Nervenzelle feuert entweder andauernd schnell hintereinander oder in Salven beziehungsweise Impulsserien.
Eine Störung einer einzelnen Nervenzelle würde jedoch niemals ausreichen, um bei einem Menschen einen Anfall auszulösen. Dazu kommt es erst, wenn sehr viele, normalerweise in ihrer Tätigkeit aufeinander abgestimmte Zellen gleichzeitig diese Störung haben und sich gegenseitig »aufschaukeln«. Erst dann lässt sich ein beginnender Anfall auch durch Veränderungen an der Kopfoberfläche erkennen – sichtbar im Elektroenzephalogramm (EEG) .
Bei epileptischen Anfällen kommt es also zu einem Zusammenwirken eines ganzen Netzwerks vorübergehend übermäßig aktiver Nervenzellen, die gewissermaßen außer Kontrolle geraten. Der Ort und das Ausmaß der epileptischen Entladungen bestimmen die Anfallsform und deren Auswirkungen. Bei sogenannten primär generalisierten Anfällen, wie beispielsweise Absencen (siehe S. ▶ 19 ), sind von Beginn an beide Großhirnhälften beteiligt, was auch erklärt, warum die Betroffenen nichts vom Beginn der Anfälle wissen. Im Gegensatz dazu sind die epileptischen Entladungen bei fokalen Anfällen zunächst auf einen Teil einer Gehirnhälfte beschränkt, können sich von dort aber weiter ausbreiten und unter Umständen schließlich ebenfalls das ganze Gehirn beteiligen.
Wissen
Das Großhirn besteht aus zwei Hälften, die sich wie die beiden Hälften einer Walnuss spiegelbildlich entsprechen. Sie stehen durch in der Mitte liegende Verbindungsabschnitte und über den Hirnstamm miteinander in Kontakt. Die Tätigkeit der Nervenzellen ist für unser Denken, Fühlen und Handeln verantwortlich. Kommt es zu einer Störung, kann eine der möglichen Folgen das Auftreten epileptischer Anfälle sein.
Die Folgen eines epileptischen Anfalls
Die abnormen Erregungen von Nervenzellen führen dazu, dass die vom Gehirn über das Rückenmark und die Nerven in die verschiedenen Körperabschnitte bzw. von dort zurück zum Gehirn laufenden elektrischen Impulse gestört oder unterbrochen werden, weshalb es zu vielfältigen unwillkürlichen und oft nicht bewusst erlebten Abläufen kommen kann.
Während beispielsweise im normalen Wachzustand die unter anderem mit den Augen und Ohren aufgenommenen Informationen über die Umwelt vom Gehirn laufend verarbeitet werden, um bei Bedarf darauf reagieren zu können, kann es bei einem Anfall zur Unterbrechung dieser Bahnen kommen. Das führt dann dazu, dass die Betroffenen zwar mit offenen Augen schauen, aber gleichzeitig »abwesend« wirken und nicht reagieren. Ein anderes Beispiel ist das vermehrte Anspannen oder auch Entspannen der Muskulatur in den Beinen, was zu Störungen des Gleichgewichts und Stürzen führen kann. Auch eine Erinnerungslosigkeit beruht auf derartigen Störungen.
Wichtig zu wissen ist, dass bei einer Epilepsie das Gehirn, beziehungsweise Teile des Gehirns, nur in der kurzen Zeit eines Anfalls gestört sind; zwischen Anfällen, also in 99,9 % der Zeit, funktioniert es normal.
Häufigkeit und Alter beim Beginn
Epilepsien sind verbreiteter, als die meisten Menschen glauben. Knapp 1 % aller Menschen leidet an einer Epilepsie; weltweit wird mit mindestens 50 Millionen Betroffenen gerechnet.
Epileptische Anfälle können im Prinzip bei jedem Menschen auftreten, dessen Gehirn plötzlich geschädigt oder durch eine akute Erkrankung in Mitleidenschaft gezogen wird. Im Verlauf des Lebens kommt es bei etwa 3–4 % der Bevölkerung ohne erkennbaren Grund oder Anlass zu wiederholt auftretenden epileptischen Anfällen und damit zu einer Epilepsie, die zum Teil aber nur vorübergehend aktiv ist. In Deutschland wird geschätzt, dass mindestens sechs bis sieben Betroffene pro 1 000 Einwohner, also insgesamt etwa 500 000 Personen mindestens einen Anfall in den letzten fünf Jahren hatten oder medikamentös behandelt werden.
Epilepsien treten bei Kindern und älteren Menschen häufiger auf.
Die Zahl der Neuerkrankungen an Epilepsie pro Jahr wird auf 30–50 pro 100 000 Menschen geschätzt. Dies bedeutet in Deutschland rund 30 000 neu erkrankte Menschen pro Jahr. So wie die allgemeine Krankheitshäufigkeit ist auch die Häufigkeit an Neuerkrankungen altersabhängig. Sie zeigt bezogen auf das Lebensalter einen J-förmigen Verlauf mit den höchsten Werten in den ersten beiden Lebensjahren und jenseits des 60. und 70. Lebensjahrs.
So häufig treten Epilepsien mit fokalen und generalisierten Anfällen in Abhängigkeit vom Lebensalter auf.
(Zeichnung: Heike Hübner, Berlin)
Etwa ein Viertel der Epilepsien tritt in den ersten beiden Lebensjahrzehnten auf. In den folgenden vier Jahrzehnten bis zum 60. Lebensjahr beginnen dann vergleichsweise wenige Epilepsien, während es danach wieder zu einem deutlichen Anstieg kommt. Epilepsien entwickeln sich also immer mehr von einer Kinderkrankheit zu einer Krankheit des höheren Lebensalters!
Der erste Anfall
Der erste bewusst erlebte oder beobachtete epileptische Anfall bleibt vielen Menschen mit Epilepsie und auch den Angehörigen oder Augenzeugen oft besonders dramatisch in Erinnerung. Wenn es sich um einen »großen« (generalisierten tonisch-klonischen oder »Grand-mal-«Anfall, siehe S. ▶ 25