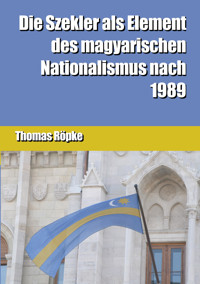4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
13. August 1961: Zeitgleich mit einer Mauer, die niemand bauen wollte, wird Peter Schmonkewitz in die DDR hineingeboren. Versorgt, behütet und aufgezogen von einem treusorgenden Kollektiv, erlebt Peter eine ideale sozialistische Jugend, bis eine Katastrophe sein Leben erschüttert – der Verlust seiner ersten großen Liebe. Was als Gefühlsachterbahn beginnt führt Peter auf eine geschichtsträchtige Zeitreise, die sich als nervenaufreibender Psychotrip durch die undurchsichtigen Windungen des kollektiven Unterbewusstseins entpuppt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Impressum
Kapitel 1
Am 13. August des Jahres 1961, einem wolkenverhangenen sommerlichen Sonntag, erblickte Peter Aljoscha Schmonkewitz in Karl-Marx-Stadt das Licht der Welt. Dass die Stadt einst Chemnitz hieß und bald wieder heißen sollte, ahnte der kleine Peter genauso wenig wie den zeitgleich stattgefundenen Mauerbau in der Hauptstadt der beschaulichen kleinen deutschen Republik, in die er hineingeboren worden war. Seine Mutter hatte an diesem Tag ganz sicher nicht die Absicht eine Mauer zu errichten. Vielmehr hatte sie an diesem Tag, weiß Gott, ganz andere Probleme. Als ob das Gebären eines Kindes (noch dazu eines Dickschädels wie Peter) nicht schon anstrengend genug sei, hatte sich der Kindsvater, nach der Ankündigung des Zigarettenholens zwei Tage vor dem Einsetzen der Wehen, nie wieder blicken lassen, wobei dieses Zigarettenholen mit »Ja chotschu kupitj sigarety« ziemlich russisch artikuliert war.
Sergej Fomin, Peters leiblicher Vater und ein ansonsten recht gewissenhaftes Mitglied der zeitweilig in der DDR stationierten sowjetischen Streitkräfte im Range eines Oberleutnants, bekam wohl einen spontanen Anflug von Heimweh nach seiner Heimatstadt Magnitogorsk. Ob diese Sehnsucht nach den malerischen Industrielandschaften seiner Heimat mit seiner Freundin Svetlana und den drei gemeinsamen Kindern Oleg, Dimitrij und Anastas zusammenhing, blieb bis zum gegenwärtigen Tage ein Rätsel, auf das wohl nur Sergej selbst und sein Vorgesetzter eine gescheite Antwort wussten.
Barbara Schmonkewitz, so hieß Peters liebende Mutter, ahnte zwar, dass Sergej ein ausgesprochener Familienmensch war, jedoch blieben ihr die konkreten Ausprägungen ihres Partners diesbezüglich zeitlebens verborgen. Der kleine Peter wuchs also ohne seinen russischen Papa auf. Gänzlich ohne Vater verblieb der Junge nicht, zumal seine Mutter Barbara kein Kind von Traurigkeit, dafür aber eines umso größeren, aber nie besonders lange anhaltenden Paarbindungsbedürfnisses war. Der Junge hatte somit das zweifelhafte Glück, von einem ganzen Väterkollektiv im stetigen Wechsel großgezogen zu werden. Jeder der Väter zog ein- bis zweimal vornehmlich an seinen Ohren, wenn Peter mal wieder frech war und im Ergebnis wurde der Junge, mindestens aber dessen stattliche Segelohren, irgendwann groß.
Barbara Schmonkewitz arbeitete als Verkäuferin in der bunten Welt des DDR-Einzelhandels. Anfangs im Konsum, später im Fress-Ex in der Straße der Nationen. Aus letzterer Tätigkeit resultierte Peters frühes Kennenlernen eingedoster Südfrüchte vom Typ Ananas und ähnlich exotischer Genüsse des gehobenen Bedarfs. Das ungewöhnliche Konservenobst leistete den wertvollsten Beitrag von Barbara Schmonkewitz zur Erziehung ihres Sohnes, was zwar aus der Retrospektive der modernen Erziehungspädagogik ein Unding war, im Paradies der deutschen Arbeiter und Bauern auf Erden aber kein größeres Problem darstellte. Der Staat als Erziehungsberechtigter kümmerte sich mittels all seiner Organe rührend um den jungen Spross aus dem Hause Schmonkewitz.
Apropos Haus Schmonkewitz; Barbara und ihr Sohn Peter bewohnten anfangs eine recht zugige Wohnung mit Altbaucharme im Zentrum von Karl-Marx-Stadt. Nachdem allerdings nicht nur die Witterungsverhältnisse das Verweilen an der heimischen Herdstatt erschwerten, sondern Teile der Wohnung der Schwerkraft nicht mehr zuverlässig zu trotzen vermochten, bemühte sich die Familie um eine etwas wetterbeständigere Bleibe. Ein solches Obdach fanden die Schmonkewitzens in einer fabrikneuen Plattenbauwohnung in der Dr.-Salvador-Allende-Straße.
Peter Schmonkewitz durchlief das komplette System institutionalisierter elementarer humanistischer Bildung in unmittelbarer Nähe des Familienwohnsitzes. Dass dieser in der Straße lag, die nach dem großen Geist des Friedens und Sozialismus in Chile benannt war, hätte aus heutiger Sicht symbolisch sein können, ließ den kleinen Peter jedoch abermals völlig kalt. Nicht, dass er den großen Errungenschaften des Kampfes der internationalen Arbeiterklasse gegen Faschismus und Imperialismus gegenüber grundsätzlich ignorant gewesen wäre. Vielmehr war der junge Schmonkewitz ideologisch einfach noch nicht gebildet genug. Das sollte sich indessen sehr schnell ändern.
Die Karriere begann beim fachmännischen kollektiven Getopftwerden in der Kinderkrippe und setzte sich fort im Basteln und anschließenden Schwenken von Arbeiterfähnchen im Kindergarten. Dieses Basiswissen wurde in der Grundschule, genauer gesagt der Dr.-Salvador-Allende-Grundschule – Peter wurde in seiner Kindheit von diesem Namen offensichtlich verfolgt – weiter ausgebaut.
Neben vernachlässigbaren, wohl aber sehr fundierten Kenntnissen in Lesen, Schreiben, Rechnen und Bockspringen wurde Peter hier das erste Mal mit der Realität des demokratischen Staates, der ihn, seine Mutter und seine bis dahin knapp 50 Väter beschützte und umsorgte, konfrontiert. Die sah, soweit Peter das aufgrund seines hochwertigen Bildungspensums beurteilen konnte, so aus, dass es da ein Deutschland (West) gab, in das damals nach dem Krieg alle Nazis geflüchtet waren, bloß um bei Zeiten wieder Krieg mit Polen anzufangen. Um zu verhindern, dass die Nazis aus Bonn in Polen einmarschierten, wurde die DDR als Pufferstaat gegründet. Der stellte sicher, dass es allen deutschen Arbeitern und Bauern darin gut ging und dass die zeitweilig dort stationierten sowjetischen Streitkräfte effektiv das entlang der Friedensgrenze benachbarte Polen vor den Nazis beschützen konnten. Die DDR leistete effektiv ihren Beitrag zur Völkerfreundschaft, indem sie aus eigener Kraft des werktätigen Kollektivs eine Wallanlage in Richtung Westen erbaut hatte, um den Bonner Nazis ein weiteres Hindernis entgegenzusetzen. Peter fand, dass das eine richtige Freundschaft zwischen den Bewohnern der DDR, Polen und der Sowjetunion sei. Nur echte Freunde, so befand auch Peter, hielten so entschlossen den Kopf füreinander hin. Und so eine Mauer, die nicht Mauer hieß, sondern Schutzwall, weil das schöner klang – so wie im Mittelalter als es noch Burgen gab – die baute sich ja auch nicht von allein. Da sollten sich die Nazis in Deutschland (West) ja nun wirklich schämen, dass sie die friedliebenden Bürger der DDR zwangen, so ein gewaltiges Bauwerk zu errichten, nur weil sie Polen nach dem Leben trachteten.
›Das ist ja in China damals ähnlich gewesen!‹, dachte sich Peter, der sehr großes Interesse für Geschichte und Staatsbürgerkunde entwickelte.
China hatte seinen eigenen Weg zum Sozialismus gefunden und auch da führte dieser Weg über einen großen antifaschistischen Schutzwall. Warum der allerdings an die Mongolei grenzte, die ja auch durch die Hilfe der großen Sowjetunion einen wieder ganz anderen Weg zum Sozialismus gefunden hatte, konnte ihm sein Geschichtslehrer beim besten Willen nicht erklären. Peter Schmonkewitz gab sich damit zufrieden, dass das halt am materialistischen Dilettantismus lag. So oder so ähnlich hieß das doch, meinte Peter sich zu erinnern, wenn jemandem zum Lachen zumute war, er dann anfing bitterlich zu weinen und am Ende trotzdem oder gerade deswegen der Sozialismus siegte. Peter war zu diesem Zeitpunkt noch klein und ideologisch immer noch in Ausbildung. Es konnte sein, dass er da ein oder zwei Dinge verwechselte. Das war ihm indessen weniger wichtig als sein Bestreben, sich seine Welt zu erklären. Er zeigte in diesem Bereich einen sehr großen Hang zur Transferleistung und verstand es wie kaum einer seiner Klassenkameraden, die historischen Gesetzmäßigkeiten des wissenschaftlichen Sozialismus in kindlich angemessenen Ansätzen eigenständig anzuwenden. So stand es jedenfalls in einem seiner Zeugnisse.
Peter Schmonkewitz wechselte nach der Grundschule zur Polytechnischen Oberschule (POS) Dr.-Salvador-Allende. Peter entwickelte das Gefühl, dieser Name verfolge ihn überall hin. Als er auf seine spätere Erkundigung nach diesem Dr. Salvador Allende erfuhr, dass jener tot sei, machte das Peter etwas betroffen. So lange schon hatte ihn dieser Dr. Allende begleitet und nie würde er ihn wirklich kennenlernen. Peter war zu diesem Zeitpunkt etwa zwölf Jahre alt. Nachdem ihm jemand erzählt hatte, dass Dr. Allende kein Arzt war wie Dr. Guevara, der nicht Doktor, sondern Che genannt wurde, weil man das in Lateinamerika so machte, erfuhr er noch mehr über den Träger des seltsam faszinierenden und allgegenwärtigen Namen Allende.
Peter fand heraus, dass dieser Allende einmal ein Land namens Chile geführt und dort Frieden und Sozialismus verwirklicht hatte, bevor ihn dort die Schergen der Nazis entmachtet hatten. Der Kapitalismus hatte dafür das Geld und die Waffen bereitgestellt, hatte man ihm erzählt. Der Kapitalismus wohnte in den USA und verdiente sein Geld hauptsächlich damit, Kriege in arme Länder zu liefern. Diese Kriege würden auch in die DDR geliefert werden, wenn ebendiese DDR nicht eins der reichsten acht Länder der Erde wäre. Daraus, erklärten ihm seine Lehrer, erwachse die besondere Verantwortung der DDR vor den Völkern der Erde. Die DDR solle diesen Völkern helfen, weniger arm und dafür umso freier und demokratischer zu werden, weil dann dort keiner mehr die Kriege und Waffen annähme, die der US-Kapitalismus dort hinschicken wolle. Wenn die Kinder in Vietnam zum Beispiel, dank der Hilfe der DDR, alle das Lesen und Schreiben lernten, fände sich in Vietnam immer jemand, der auf das Paket aus den USAAnnahme verweigert draufschreiben könne. Dann könne der Kapitalismus in den USA seinen Krieg behalten und niemand müsse hungern oder erschossen werden. Wie der erweiterte Russischunterricht in der DDR den Kindern in Vietnam helfen solle Annahme verweigert auf Englisch auf die Pakete zu schreiben, verstand Peter mit zarten zwölf Jahren noch nicht. Er nahm sich aber vor, in seinem Leben immer fleißig zu lernen, um eines Tages die ungeheuer komplexe Materie hinter dem Sozialismus zu verstehen. Immer wenn der kleine Peter nämlich dachte, er hätte sie begriffen, kam eine neue harte Nuss daher, die er zu knacken hatte.
Mit 13 konnte Peter Schmonkewitz das russische Wort Dostoprimetschatelnosti fehlerfrei aussprechen. Es hieß Sehenswürdigkeiten. Was ihm der Satz: »Samye izvestnye dostoprimetschatelnosti v Moskve – Kreml i Krasnaja ploschtschadj« oder auf Deutsch: »Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Moskau sind der Kreml und der Rote Platz« auf seinem Lebensweg bringen sollten, wenn er nicht vorhatte in der sowjetischen Hauptstadt zum Fremdenführer zu avancieren, wusste er freilich nicht. Fremde Führer mochte man in der Sowjetunion ohnehin nicht. Einen Deutschen würde man als solchen ebenso wenig akzeptieren wie einen jüngst in Ungnade gefallenen Führer aus der Georgischen SSR, über den man aber auch in der DDR kaum mehr Worte verlor. Wahrscheinlich, so lautete Peters kindliche Hypothese, hatte der Mann, den man hinter vorgehaltener Hand Schtahlien oder so ähnlich nannte, irgendwas mit dem Westfernsehen zu tun. Das konnte Familie Schmonkewitz nicht mal empfangen, wenn sie unbedingt wollte. Das sei eine dankbare Situation, meinte Peters Lehrer zu ihm, zumal er so wenigstens vor dem ganzen Schmutz im Äther geschützt sei. Ansonsten sprach auch niemand über das Westfernsehen. Da soll, hatte er von einem Bekannten einmal gehört, über irgendeine Straße des Sesams berichtet worden sein. Peter kannte bis dahin nur die Seidenstraße, die bei der Erbauung des Sozialismus eine ebenso wichtige Rolle spielte wie bei der Verbreitung der Pest. Wenn nun aber über die Straße des Sesams auch irgendwelche Krankheiten in den Westen kamen, dann waren die Kinder in Bonn wirklich nicht zu beneiden. Peter versuchte sich vorzustellen, dass in einem ganzen Land eine schwere Seuche herrschte. Er konnte es beim besten Willen nicht. Das, was einer vorstellbaren Seuche am nächsten kam, war die latente Bedrohung des Friedenslagers durch biologische Waffen, die der US-Kapitalismus auslieferte. Die schlimmsten unter den derartigen Waffen, welche die Lehrer erwähnten, waren Milzbrand und Kartoffelkäfer.
Peter versuchte das Chaos in seinem Kopf zu ordnen. Es gab demnach eine Kartoffelkäferinvasion, die der US-Kapitalismus bereits in Kartons verpackte. Diese Kartoffelkäfer waren alle mit Milzbrand infiziert, was sie extrem gefährlich machte. Dieser Schtahlien hatte den Amerikanern über die Straße des Sesams ein Buch mit allen Postleitzahlen der DDR zukommen lassen, sodass der böse Kapitalismus ganz genau wusste, wohin er die Kartoffelkäfer zu schicken hatte. Wenn die DDR von den Milzbrandkartoffelkäfern aufgefressen worden sei, könne die Bundeswehrmacht aus Bonn mit den LKW des Kapitalismus aus den USA den Krieg der Nazis nach Polen liefern. Das bedeutete den Dritten Weltkrieg und das Ende der Freiheit und des Sozialismus in Europa. Peter war stolz auf sich, dass er dieses komplexe Muster der imperialistischen Weltverschwörung begriff. Insgeheim befand er den Plan indessen für recht primitiv, erkannte aber, wie im Allgemeinen solche Weltverschwörungen größeren Typs ausgestaltet waren und entwickelte reges Gefallen daran, diesen Denkweisen des Kapitalismus auf die Schliche zu kommen.
›Das sind also die Kriegsvorbereitungen und Ergebnisse der Hetze in der BRD, von denen dieser freundliche Onkel Karl-Eduard im Fernsehen spricht‹, dachte Peter. ›Was der nicht alles für gemeine Verschwörungen aufdeckt.‹
Der Schmonkewitz-Junge wollte die Sendung ja zu gern häufiger sehen, nur schaltete seine Mutter den Fernseher meistens aus, bevor der nette Onkel anfangen konnte zu reden. Es gab eine kurze Periode, in der Peter die Sendung regelmäßig und in voller Länge verfolgen konnte und durfte. Diese war deckungsgleich mit der Phase, in der Peters Mutter ein Mitglied der Sicherheitsorgane als Vati Nummer 67 anschleppte. Peter führte genau Buch über all die Vatis, die bis zu seiner Volljährigkeit eine Sollstärke von stattlichen 434 Mann erreichten. Er bekam immerhin von 250 davon noch bis ins Erwachsenenalter regelmäßig Grußkarten zum Geburtstag. Darunter war auch Vati Nummer 67.
Vati 67 hieß Günter-Günther Grabowski. Sein sehr eigentümlicher Vorname rührte daher, dass sich seine Eltern Giesbert Gustav und Gertrude Gerlinde Grabowski (die von den Nachbarn liebevoll 5G genannt wurden) darin einig waren, ihren Sohn nach dessen Großvater zu benennen. Ob der sich allerdings Günter oder Günther schrieb, war wegen eines Tintenkleckses auf dessen Geburtsurkunde zeitlebens nicht feststellbar. So hieß der Sohnemann aus dem Hause Grabowski, so kompromissvoll und einträchtig harmonisch wie es im ersten deutschen Friedensstaat nur vonstattengehen konnte, eben Günter-Günther.
Von Günter-Günther lernte Peter Schmonkewitz enorm viel über den Klassenfeind. Bis dahin verwendete Peter diesen Fachbegriff fälschlicherweise um Paul die Petze zu klassifizieren. Paul ging in der POS in Peters Klasse. Dieser Paul, den Peter als Klassenfeind bezeichnete, hatte die Angewohnheit, die Gespräche seiner Klassenkameraden zu belauschen und sie, im Falle verdächtig konspirativer oder feindlich negativer Inhalte, wie Paul meinte, beim Direktor zu verpfeifen. Erst von Günter-Günther erfuhr Peter, dass Paul kein Klassenfeind, sondern Kundschafter des Friedens sei. Die von ihm verpfiffenen Kinder seien die wahren Klassenfeinde, auch wenn sie das selbst eventuell noch gar nicht merkten. Peter war erstaunt. Es konnte also jemand Klassenfeind sein, der das selbst noch nicht mal mitbekam, weil der amerikanische US-Kapitalismus diesem Jemand das Gehirn wusch. Zum Waschen konnte entweder ein Stück BRD-Seife aus dem Weihnachtspaket oder auch gerne mal ein Glas Kockerkoler herhalten. Peter war von der kapitalistischen Reinigungsmittelindustrie und ihren Produkten regelrecht angeekelt. Auf seine Nachfrage, was denn dieses ominöse Kockerkoler sein solle, entgegnete ihm sein Vati 67 liebevoll und geduldig, wohl aber väterlich warnend, dass er bloß aufpassen solle, weil das Zeug ganz schlecht für die Knochen und den Körperbau sei.
»Warum sollte man so etwas trinken?«, fragte Peter und bekam prompt die Antwort.
»Weil Kockerkoler als braune Brause getarnt ist. Die Kinder denken, dass das Limonade sei, werden abhängig davon, zuckerkrank, dick, faul und träge.« Vati 67 fügte hinzu: »Kockerkoler ist das Getränk, womit die Arbeiterklasse in den USA und der BRD unter Kontrolle gehalten wird.«
Solange Günter-Günther noch ein Wort mitzureden habe, würde kein Kind in der DDR so eine Plörre trinken. Schließlich habe ein ungarischer Wissenschaftler sogar eine Studie veröffentlicht, wie das den Körper und den Geist zerstöre. Die Studie sei auch im Westen bekannt und trotzdem trinke dort fast jedes Kind hektoliterweise Kockerkoler.
Auf Peters Nachfrage, wozu Kockerkoler denn eigentlich zu verwenden sei, entgegnete Vati 67 kurz und knapp: »Als Rostlöser!«
Die Erkenntnis war verstörend. In Deutschland (West) tranken die Leute Rostlöser, um ihr Gehirn gewaschen zu bekommen. Das musste eine Verschwörung sein, anders war das nicht zu erklären. Um dieser Verschwörung ein Schnippchen zu schlagen, schlug sein 67. Ziehvater dem jungen Schmonkewitz vor, der BRD und dem Klassenfeind immer einen Schritt voraus zu sein. Das ginge am besten, wenn er eifrig lernte und sein Wissen über die Welt und ihre Zusammenhänge stetig erweiterte. Peter verschrieb sich genau diesem Ziel.
Mit 14 Jahren hatte Peter die ihm beigebrachten ideologischen Prinzipien tief verinnerlicht und in sein Verhalten übernommen. Er unterstützte Paul nach Kräften, die Klassenfeinde in seiner Schule dingfest zu machen. Eines Tages kam er darauf, dass auch Paul ein tatsächlicher Klassenfeind war. Peter denunzierte Klassenfeinde und Paul denunzierte Klassenfeinde, aber wenn sie sich miteinander unterhielten war Paul irgendwie dennoch immer anderer Ansicht. Er hatte eine sehr abschätzige Meinung von anderen Menschen, respektive ihren Klassenkameraden, die ja, fehlgeleitet wie auch immer sie sein mochten, trotzdem noch Bestandteile des Kollektivs waren. Peter kam auf den Gedanken, dass Paul ein Diversant und Rechtsabweichler war. Der Paul hatte zwar das richtige methodische Wissen, nicht aber das rechte Gespür für sozialistische Moral, um die feinen Unterschiede zwischen dem großen Terror, den er veranstaltete, und der gelegentlichen Säuberung des Kollektivs von zersetzenden und irrigen Vorstellungen und deren destruktiven Folgen zu verstehen und wirklich leben zu können. Peter fand belastendes Material in einem von Pauls Schulheften, in Form eines Schmähgedichtes über den Lehrer für Staatsbürgerkunde, in dem ein äußerst unpassender Reim auf Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit vorkam. Dieses interessante Material ließ er dem Schulleiter zukommen, nachdem er angab, das Heft zufällig auf dem Flur gefunden zu haben. Paul erhielt einen Schulverweis und Peter profilierte sich vor seiner Klasse damit, die Petze Paul erledigt zu haben. Der junge Schmonkewitz hatte damit eine wertvolle Lektion über den realexistierenden Sozialismus und die Gefahr von extremistischen Feinden in den eigenen Reihen gelernt. Diese Erfahrung prägte auch im Weiteren Peters politische Ambitionen.
In seiner Klasse genoss Peter fortan den Ruf eines Volkshelden. Er selbst wusste, diesen Ruf positiv weiterzuentwickeln. Er setzte sich für das Wohl des gesamten Kollektivs ein. Kein Wunder also, dass er zum Vorsitzenden des FDJ-Rats der Klasse aufstieg, was zugleich sein allererstes politisches Amt war. Dieses übte er sehr gewissenhaft aus, denn er fühlte sich stets verantwortlich für das Gemeinwohl. Er wurde sehr gut unterstützt von den anderen Ratsmitgliedern. Gabi Dittrich etwa war seine Stellvertreterin. Sie war ein schönes Mädchen, auf das er bereits beide Augen geworfen hatte. Das Augenwerfen beruhte auf Gegenseitigkeit. Gabi war ideologisch sehr gut geschult, was vermutlich an ihrem Elternhaus lag. Ihr Vater war Baubrigadeleiter und ihre Mutter Montagearbeiterin im IFA-Werk. Auf gut Deutsch gesagt, half ihre Mutter dabei, eine ganze Flotte von Kleintransportern Barkas zusammenzubauen. Aus diesem Elternhaus kommend konnte die Jugendfreundin Gabi nur eine gute Sozialistin werden. Im Stillen befand Peter, dass sie hinsichtlich ihres Körperbaus zum Glück nicht nach ihrer Mutter kam, welche mit den Jahren dem von ihr montierten Kleintransporter Barkas immer ähnlicher wurde.
Kassierer des FDJ-Rats war Udo Kleinschmidt, dessen Vater als Diplom-Ökonom im Centrum Warenhaus arbeitete. Der Umgang mit Geld war ihm von Hause aus ein ganz natürlicher, ohne jedoch der kapitalistischen Versuchung der Habgier zu erliegen. Wäre Peter für dieses Land verantwortlich, wäre Udo seine erste Wahl für den Posten des Finanzministers.
In seinem Schattenkabinett für den Ministerrat, dem er später einmal vorsitzen wollte, hatte Wilhelm Trischanke einen Ehrenplatz. In seinemFDJ-Rat war Trischanke als Agitator hervorragend besetzt. Wilhelm konnte mit Worten umgehen, wie kaum ein anderer. Na gut, Lenin vielleicht! Aber wer war schon ein Lenin verglichen mit Wilhelm Trischanke? Letzterer war die Formvollendung desjenigen Menschen neuen Typs, den Ersterer erst auf dem Reißbrett entworfen hatte. Wilhelm war der Bindestrich zwischen Marxismus und Leninismus.
›Jawohl‹, dachte sich Peter Schmonkewitz, ›So kann man in der Tat den Wilhelm am besten beschreiben.‹
Inge Köhler, die seit Jahren schon die beste im Zeichnen war, hatte den Posten, für den sie bestens geeignet war. Als Wandzeitungsverantwortliche konnte sie ihre gestalterischen Fähigkeiten voll einbringen. Im Ministerrat Schmonkewitz würde sie die neue Margot sein.
Peter fragte sich: ›Wie würde Margot … nein, Quatsch! Wie würde Inge aussehen, wenn sie sich die Haare lila färben würde?‹
Peter fragte sich allerdings auch, ob es für eine Ministerin für Kultur und Volksbildung obligatorisch sei, lila Farbe an der Frisur anzubringen. Er las sehr oft die Werke von Clara Zetkin, um auf diese Frage eine gescheite Antwort zu finden. Dann kam er auf die Lösung. Clara Zetkin kannte damals nur Schwarz und Weiß, weil es vor Gründung der DDR keine Farbe im tristen Leben der unterdrückten Arbeiterklasse gab. Folglich war Margot nach der im wahrsten Sinne des Wortes flächendeckenden Einführung der Farbe im Arbeiter- und Bauernstaat deutschen Typs im Jahr 1969 die erste Ministerin für Kultur und Volksbildung, die überhaupt auf den Gedanken kommen konnte, ob es für eine Frau in ihrer Position verpflichtend sein sollte, die Haare lila zu färben. Peter gab Inge Köhler diesen Gedanken mit auf ihren Weg. Manchmal, wenn sie so still ihre Zeichnungen anfertigte, wirkte sie so melancholisch und in sich selbst versunken, dass er versucht war, an ihren politischen Ambitionen zu zweifeln.
Moritz Kuhn war Peters Kultur- und Sportbeauftragter. Von Kultur verstand er nicht viel, sofern es überhaupt einer Form von Kultur entsprach, sein Kinderzimmer mit Postern der Fußballnationalmannschaft zu tapezieren. Man konnte bereits an dieser Eigenheit der visuellen Raumgestaltung erahnen, dass Moritz den Fokus eher auf den Sportaspekt legte. Neunzig Prozent seiner politischen Aktivität bestand im Planen und Organisieren von Fußballturnieren zwischen den Klassen. Ob er als Minister zu gebrauchen war, hatte Peter noch nicht abschließend geklärt. Als Sportaktivist wäre er in jedem Fall eine erstklassige Besetzung.
Peters Schriftführer schließlich war die eigenartigste Persönlichkeit im Bunde. László Kertész war der Sohn des bekannten ungarischen Professors für Technikgeschichte Tibor Kertész und der Physikdozentin Marianne Kertész. Er war mit der Feder sehr begabt, schrieb Kurzgeschichten und Gedichte und träumte davon, ein berühmter Schriftsteller zu werden. Wer in zwei Sprachen sein Leben begann und auch in Russisch die Klassenleuchte war, dem stand nach Peters Dafürhalten dieser Weg offen. Die Protokolle, die László anfertigte, lasen sich flüssig, ohne den Sinn zu verstümmeln und enthielten einige ungarische Eigenheiten im Satzbau. Diese entsprachen zwar nicht dem lupenreinen Deutsch, wie es von einem vorbildlichen Schüler erwartet wurde, jedoch bildeten sie irgendwie einen erfrischenden Stil, von dem Peter keinen zweiten kannte. Wenn László kein guter Außenminister oder Botschafter war, dann, so beschloss Peter, sollte der freundliche Ungar mit ihm ein Autorenkollektiv bilden, um Schmonkewitz Werke, Band 1 bis 55 mit seinem politischen Erbe zu füllen und über das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK den lesehungrigen und neugierigen Massen in aller Welt zur geistigen Nahrung zu geben.
»Warum ausgerechnet 55 Bände?«, hätte mancher den ambitionierten Jungpolitiker bestimmt fragen wollen. Nun, feinfühlig auf die besonderen Fragestellungen, die die Völkerverständigung im Friedenslager der Brudervölker mit sich brachte, war Peter hinreichend über die düsteren Kapitel der Geschichte der VR Ungarn informiert, um festzustellen, dass ein 56. Band der bloßen Symbolwirkung der Zahl wegen kein Band war, den man mit einem Ungarn verfassen sollte. Aus diesem Dilemma gab es für Peter Schmonkewitz zwei Möglichkeiten, einen Ausweg zu finden. Eine war, es bei 55 Bänden zu belassen. Die andere Möglichkeit bestand darin, zunächst 55 Bände zu verfassen und, bei weiterem literarischem Mitteilungsbedürfnis, den 56. Band auszulassen und gleich bei Band 57 weiterzumachen. Letztere Option hätte den großen Vorteil, dass Peter sich damit den Ruf eines Rebellen erarbeiten konnte. Wenn der 56. Band fehlte, hätte das schließlich den Eindruck erwecken können, dass er der Zensur zum Opfer gefallen war. Warum? Ganz klar: Der Genosse Schmonkewitz war einer, der sich nicht scheute, den Mund aufzumachen, um im Angesicht der werktätigen Massen, deren Fürsprecher er war, das große rote Banner der Wahrheit hochzuhalten. Dies missfiel regelmäßig den etablierten Mitgliedern der politischen Gremien, unter denen sich immer noch unerkannt einige Rechts- und Linksabweichler tummelten, die das wahre Anliegen der Arbeiterklasse durch stillschweigendes Aussitzen gewisser Missstände regelmäßig sabotierten. Peter dachte, dieser Idee sei ohne Frage der Vorzug gegenüber der Beschränkung auf nur 55 Bände zu geben. Die historische Sache der Arbeiterklasse war zu wichtig, um sich kurzzufassen.
Für sein großes Projekt kannte Peter einfach keinen begabteren Autoren als László. Er wollte dieses Anliegen also zu gegebener Zeit mit seinem ungarischen Jugendfreund besprechen.
Kapitel 2
Mit 14 Jahren konnte man kaum mehr vom kleinen Peter sprechen. Immerhin war er nun schon eins neunzig groß und wäre ein ausgezeichneter sowjetischer Basketballspieler oder Boxer geworden, wenn er in der Sowjetunion bei seinem Vater großgeworden wäre. Das heißt, falls man ihn entdeckt hätte, dort in Magnitogorsk, wo sein Vater lebte. In der DDR war Profisport zwar auch Chefsache auf staatlicher Ebene, aber zwei Meter große, muskulöse Leistungssportler waren dort vor allem weiblich. Aufgrund dieser geschlechterspezifischen Ungerechtigkeit blieb Peter nur die Karriere eines halbkriminellen Samizdatautors oder eines aufrichtigen, ehrbaren und gesellschaftlich vollständig akzeptierten Politikers. Es hätte ihn ja weitaus schlimmer treffen können. Von allen möglichen Lebenswegen, die sich aus der intensiven Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen ergaben, hatte er das große Los gezogen.
Was an Peter Schmonkewitz durchaus faszinierend war, war seine Weigerung, sich dem Genörgel der Leute anzuschließen. Der junge Peter sei ein unheilbarer Optimist, befanden viele. Ironischerweise trug ja bereits die Zuschreibung unheilbar eine furchtbar pessimistische Herangehensweise an seine Tatkraft, sein Engagement und seinen Idealismus in sich. Tatsächlich war es aber so, dass Peter Schmonkewitz wie kein anderer die Konzeption, die Theorie und das Verständnis um den planmäßigen Aufbau des Sozialismus, welche er von allen Seiten beigebracht bekam, geradezu in sich aufsog. Peter spürte zwar tief in sich, dass seine Lehrer, Mentoren, die Repräsentanten der Arbeiterklasse und der gesellschaftlichen Kräfte, einschließlich vieler Mitglieder der Partei und der anderen Organisationen, eine sehr halbherzige, wenn nicht sogar zynische Herangehensweise an die große Mission des werktätigen Volkes hatten. Seine Überzeugung von der Richtigkeit der Freisetzung der schöpferischen Kräfte des Kollektivs, sein Glaube an die Werte des Marxismus-Leninismus und seine Einsichten in deren wissenschaftlichen, ja vereinzelt fast schon semi-esoterischen Hintergrund waren so tief und ruhten auf so unerschütterlichen Fundamenten, dass es ihm schlicht egal war, für wie unrealistisch die anderen Menschen den Realexistierenden hielten. Er war beseelt von der stetigen Verbesserung des Menschen durch den Menschen und die flächendeckende, ewige Befreiung des Menschen vom menschengemachten Joch des Imperialismus.
Wegen dieser jugendlichen Frische und Unaufhaltsamkeit belächelten ihn viele. Sogar einige Lehrer waren der Meinung, dass dieser Schmonkewitz-Junge nicht mehr alle Latten am Zaun habe. Das Leben, das würde ihm ja noch zeigen, wohin das alles führe. Er müsse vom Leben nur noch ein paar Schläge bekommen, dann sei er schon noch kuriert, befanden sie in fast einmütiger Übereinstimmung ihrer schallenden und gehässigen Unkenrufe.
Im FDJ-Rat seiner Klasse fand Peter Schmonkewitz tatsächlich die Klassen- und Waffenbrüder, die er sich immer erträumt hatte. Sie waren eine eingeschworene Gemeinschaft, die allen Widrigkeiten trotzte. Sie halfen sich gegenseitig bei allen Problemen und standen auch ihren Mitschülern jederzeit mit vollem Einsatz bei, sobald jene mit ihren Problemen, Sorgen und Nöten zu ihnen kamen.
Eine besonders enge Beziehung ging Peter Schmonkewitz mit seiner Stellvertreterin Gabi Dittrich ein. Peter und Gabi verstanden sich auf Anhieb richtig gut. Sie hatten viele gemeinsame Interessen, allen voran die leidenschaftliche und in vielen schlagworthaltigen Reden bei Schulveranstaltungen jedweder Art manifestierte Hinwendung zum werktätigen Kollektiv. Wirklich funkte es zwischen Gabi und Peter bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Patenbrigade Völkerfreundschaft bei den veb-Barkaswerken. Die Patenbrigade der Klasse gab eine Feier, da sie die Auszeichnung Kollektiv der Sozialistischen Arbeit erhalten hatte. Peter Schmonkewitz und Gabi Dittrich trugen zu diesem feierlichen Anlass einige flammende Redebeiträge vor, die ihr Ghostwriter László Kertész mit seinem unübertrefflichen Sinn für Lyrik und Prosa des sozialistischen Realismus vorbereitet hatte. Allen voran das Gedicht Weiter auf Lenins Wegen, das Gabi rezitierte, erntete nachhaltigen Beifall vonseiten der 25-köpfigen werktätigen Masse der Brigade.
Es ging so:
Schweiße! Nur schweiße, Schweißer! Die Flamme brennt, sie brennt heißer, als des Volkes Herzen jemals. Es ist die Flamme, die hell erleuchtet, der Zukunft weiten Weg euch deutet. Es ist der Weg, den ebnete euch vormals Lenin, mit der Liebe für den Proleten! Lenin, mit dem Geiste des Propheten! Drum lasst uns weitergehen! Weiter, mit Lenins Segen! Weiter, auf Lenins Wegen!
Schweiße! Schweißer! Schweiße heißer! Die Teile des Ganzen zusammen! Glühender Stahl, wenn er gerinnt, die Menschheit aus dem Geschweiße gewinnt den Stahl aus dem die Brücke geschmiedet, den Stahl, den das Kollektiv gesiedet. Die Brücke, sie führt mit Lenins Segen, sie führt weiter, weiter auf Lenins Wegen!
Peter kannte die Worte, denn er hat sie etliche Male mit Gabi zusammen geprobt und auch das Manuskript mit László zusammen einer ausgiebigen Kritik und Selbstkritik unterzogen. Letzteres war notwendig, da László in seinem übermotivierten Sinn für proletarischen Humor ein etwas anderes Reimschema für »Schweiße!« vorgesehen hatte, welches, wie Gabi, Peter und die anderen Ratsmitglieder befanden, dem ernsthaften, wenngleich feierlichen Charakter des Anlasses nicht gänzlich angemessen erschien. Der Jugendfreund Kertész bekam von Peter eine lobende Anerkennung seiner kreativen Fähigkeiten, die er zum Wohle des Volkes stetig weiterentwickeln solle. Inge gab noch die Anregung zum Besten, die religiös anmutenden Elemente vielleicht das nächste Mal etwas zu reduzieren, da diese, ihrer Ansicht nach, mit dem materialistischen Weltbild nicht vereinbar seien. László bedankte sich für die aufrichtige und hilfreiche konstruktive Kritik seiner Genossen und gelobte Besserung. Er habe sich von der Feierlichkeit der sozialistischen Liturgie allzu sehr vereinnahmen lassen.
Auf die Frage, was denn eine Liturgie sei, antwortete er nur noch ausweichend mit: »Diese Diskussion ist jetzt wirklich nicht mehr zielführend, Jugendfreunde.