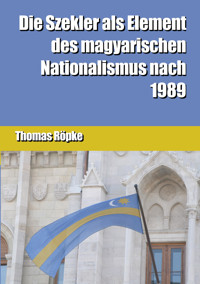
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit dem Jahr 2013 schon weht am Budapester Parlament eine rätselhafte blau-gold-blaue Flagge. Jeder sieht sie, aber für die meisten bedarf es eines Ungarn um zu erfahren, dass dies die Flagge der Szekler ist.Thomas Röpke geht in diesem Buch weiter. Er klärt nicht nur auf, wer die Szekler sind und was deren Flagge in der ungarischen Hauptstadt zu suchen hat. Vielmehr geht dieses Buch der Frage auf den Grund, welche Rolle die Szekler im Konzept des ungarischen Nationalismus seit 1989 spielen. Während der Tourist nämlich nur die Flagge bemerkt, ist es (schon aus sprachlichen Gründen) vornehmlich den ungarischen Einheimischen und Eingeweihten vorbehalten, die Szekler und Ihren Mythos im ungarischen Selbstverständnis überhaupt wahrzunehmen. Neben seiner geschichtswissenschaftlichen Fragestellung zeigt Ihnen dieses Buch zeithistorisches und gesellschaftliches Hintergrundwissen auf, welches für das Verstehen des aktuellen außenpolitischen Selbstverständnisses Ungarns von entscheidender Bedeutung ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Autors
Zwei Flaggen und die Fragen, die sie eröffnen…
Die Szekler im 20. Jahrhundert
Die politische Rezeption der Situation der Magyaren in Siebenbürgen
Die politische Rezeption der Szekler im Besonderen
Die kulturelle Rezeption der Szekler in Ungarn
Die Rezeption von Szeklersymbolen
Die Rezeption der materiellen Kultur der Szekler
Die Szekler als Grenzwächter des authentischen Magyarentums
Literatur- und Quellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anhang I: Die Szeklerhymne (Székely Himnusz) nach György Csanády von 1922
Anhang II: Die Szeklerhymne (Székely Himnusz) in der aktuellen folklorisierten Variante
Impressum
Vorwort des Autors
Das vorliegende Buch basiert auf der von mir Ende 2018 verfassten Arbeit, die die Philosophische Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen dazu bewog, mir den Grad eines Gesellen der Künste (deutsch: Bachelor of Arts) zu verleihen. Ein solches Gesellenstück gehört in der Praxis nur selten zu den wissenschaftlichen Werken, die publiziert werden. Gleichwohl hat mich der viele Zuspruch, den ich erhielt, als ich die Inhalte der Arbeit an verschiedenen Orten vor unterschiedlichem Fach- und Laienpublikum vortrug, dazu bewogen, die hier niedergeschriebenen Inhalte einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Obwohl es sich um einen historischen Fachtext handelt, gehe ich aufgrund meiner Erfahrungen davon aus, dass auch interessierte Laien ihm viel abgewinnen können.
An dieser Stelle verbleibt mir einigen wichtigen Personen zu danken:
Frau Dr. Maria Rhode und Frau Dr. Edda Binder-Iijima für die Betreuung der Arbeit; Frau Dr. Judit Molnár und Herrn Dr. Klaus Rettel für die Möglichkeit, mein Werk einem breiterem Publikum vortragen zu können; Frau Juliane Lange für das intensive Lektorat und, nicht zu vergessen, der wichtigsten Unterstützerin, die mir den Kopf und den Rücken zum Schreiben freigehalten hat und mir mit fachlich kompetenter Unterstützung als Expertin für Ungarische Geschichte zur Seite stand, meiner geliebten Ehefrau Carmen F.A. Naumann.
Den genannten meinen herzlichsten Dank und Ihnen, liebe Leser nun viel Vergnügen und eine anregende Lektüre!
Zwei Flaggen und die Fragen, die sie eröffnen…
Wer derzeit über den Kossuth-Platz in Budapest flaniert und einen genaueren Blick auf den Haupteingang des Parlamentsgebäudes wirft, wird eines bemerkenswerten Details fündig. Neben der rechter Hand angebrachten Nationalflagge Ungarns in rot-weiß-grün hängt linker Hand nicht mehr die Flagge der Europäischen Union. Stattdessen wurde an deren Stelle bereits 2013 eine Flagge in blau-gold-blau mit einer goldenen Sonne und einem silbernen Halbmond angebracht. Hierbei handelt es sich um die Flagge der Szekler (ung.: Székely), einer ungarischsprachigen Volksgruppe im Osten Siebenbürgens.
Obwohl die Entscheidung der ungarischen Landesversammlung (ung.: Országgyűlés), die EU-Flagge durch die Szeklerflagge zu ersetzen, viele, vor allem aktualpolitische, Fragen aufwirft, interessiert mich im Rahmen dieser Arbeit insbesondere die gesonderte, repräsentativ-symbolische Hervorhebung einer einzigen, jenseits der heutigen Staatsgrenzen lebenden, Gruppe von Magyaren.1 Warum sind gerade die Szekler als eine solche Gruppe separat repräsentiert, wenn das politische Selbstverständnis des ungarischen Staates den Gedanken der einheitlichen magyarischen Kulturnation beinhaltet, der auch die Szekler umfasst?2 Folglich müsste jede magyarische Minderheit jenseits der ungarischen Staatsgrenze durch die ungarische Nationalflagge repräsentiert sein.
Als während der Fernsehübertragung des ungarischen Senders Duna TV von den Feierlichkeiten zum 20. August 20183 vor dem Parlament die Szeklerflagge von der Kamera gezeigt wird, merkt der Kommentator an:
„Jetzt sehen wir […] die Szeklerfahne, das Symbol der magyarischen Autonomiebestrebungen im Karpatenbecken, welche die 1900er [und] die 2000er Jahre mit dem König Stephan dem Heiligen verknüpft, denn damals wie heute geht es um die magyarische Selbstbestimmung.“4
Dies zeigt, dass die Szeklerflagge in Budapest gegenwärtig einen abstrakten Symbolcharakter innehat, der weniger die konkrete Gruppe der Szekler, als vielmehr das gesamte Magyarentum im Karpatenbecken repräsentiert. Die Bedeutungsverlagerung szeklerischer Symbolik setzt eine vorangegangene intensive öffentliche Rezeption der Szekler und ihrer Symbole in Ungarn voraus. Aufgrund dieser Annahme gehe ich in meiner Arbeit der Frage nach, welche Rolle die Szeklerrezeption in Ungarn seit dem Ende des Staatssozialismus 1989 bei der Herausbildung des magyarischen Nationalismus spielte.
Ich betrachte den Nationalismus dabei als zweierlei. Einerseits ist er, in Anlehnung an Gellner, als ein politisches Prinzip zu sehen, welches die Kongruenz politischer und nationaler Einheiten propagiert.5 Der Nationalismus ist eine Ideologie, die sich der Konstruktion von Geschichtsmythen bedient, um den Eindruck zu vermitteln, als verteidige sie eine alte, authentische Volkskultur, während sie tatsächlich eine vollkommen neue erzeugt. Diese Ideologie ist eine spezifische Erscheinung der Moderne.6 Andererseits begreife ich den Nationalismus, nach Anderson, als kulturelles System und zugleich als spezifisches kulturelles Produkt der Moderne. Selbiges gilt auch für die moderne Nation, die wiederum vom Nationalismus hervorgebracht wurde.7
Angesichts der politischen und gleichsam kulturellen Natur des Nationalismus untersuche ich in meiner Arbeit die Rezeption der Szekler in Ungarn sowohl auf der politischen als auch auf der kulturellen Ebene. Nach einer Einführung in den historischen Kontext bezüglich Ungarns und der Szekler untersuche ich zunächst die politische Szeklerrezeption, ihren Zusammenhang mit der Magyarentumspolitik und den damit verbundenen politischen Konzepten der magyarischen Nation, die seit Ende des Staatssozialismus einem kontinuierlichen Wandel unterlegen haben. Die vorliegende Arbeit greift diesbezüglich, mangels historischer Aufarbeitung, im Wesentlichen auf publizistisches Quellenmaterial zurück. Die Quellenbasis besteht, neben Ausschnitten aus Nachrichtensendungen des ungarischen Fernsehens, größtenteils aus Beiträgen in zwei der größten Tageszeitungen Ungarns, der Magyar Nemzet (Ungarische Nation) und der Népszabadság (Volksfreiheit). In den späten 1990er bis 2000er Jahren ergaben sich klare Parteipräferenzen der Zeitungen. Während die Magyar Nemzet dem konservativen Parteienspektrum des Ungarischen Demokratischen Forums (ung. Magyar Demokrata Fórum, kurz MDF) und dem Bund Junger Demokraten (ung. Fiatal Demokraták Szövetsége, kurz Fidesz) zuzuordnen war, vertrat die Népszabadság vor allem die politische Linie der Ungarischen Sozialistischen Partei (ung. Magyar Szocialista Párt, kurz MSzP). Die Wahrnehmung der Szekler in der Öffentlichkeit Ungarns kann daher nach politischen Parteipositionen differenziert analysiert werden.
Die kulturelle Szeklerrezeption in Ungarn werde ich an Symbolen sowie an einigen Beispielen der materiellen Kultur untersuchen, die jeweils Aspekte des Szeklertums transportieren. Es geht hierbei darum, die Unterschiede zwischen der Bedeutung als Selbstrepräsentation der Szekler und als Versatzstück zur Repräsentation des Szeklertums in der gesamtmagyarischen Kultur aufzuzeigen.
Im Mai 2018 veranstaltete die Ungarische Akademie der Wissenschaften (ung.: Magyar Tudományos Akadémia, kurz MTA) eine Konferenz zum gerade entstehenden Forschungsfeld der Identitätenbildung der Szekler. Während die historischen Wurzeln dieser Identitätenbildung weit vor die Zeit der modernen Nationenbildung zurückragen, betont der Herausgeber in der Einführung des Konferenzprogrammes die neugewonnene Aktualität des Themenkomplexes nach dem Systemwechsel 1989. Die Identität der Szekler enthalte sowohl Aspekte regionaler Bindung als auch solche, die auf das gesamte kollektive Bewusstsein der Magyaren wesentliche Auswirkungen haben.8 Ich platziere meine Arbeit in diesem Forschungsfeld, um vor allem dem letztgenannten Aspekt der Auswirkungen auf das kollektive magyarische Bewusstsein seit dem Systemwechsel nachzugehen.
Diesbezüglich werde ich am Ende meiner Arbeit meine Fragestellung thesenhaft anhand meiner resümierten Erkenntnisse beantworten.
Anm. T.R.: Aufgrund der ambivalenten Bedeutung des ungarischsprachigen Wortes magyar als Substantiv Ungar, Ungarländer, bzw. als Adjektiv ungarisch, ungarländisch werde ich die Übersetzung Ungar, ungarisch im Sinne des Bezugs zum Staat oder den Staatsbürgern Ungarns oder zur Sprache und Magyare, magyarisch im Sinne des Bezugs zur Volksgruppe und Kultur verwenden.↩︎
Grundgesetz von Ungarn, Artikel D, in: http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/09A650FD-0ACB-4C14-B572-7CDEF40B8966/0/grundgesetz_ungarn.pdf (abgerufen am 30.06.2018).↩︎
Zur Bedeutung des 20. August als ungarischer Nationalfeiertag siehe: Schell, Csilla: Das Fest des St. Stephan als überdachendes Identitätsangebot. Mythen, Fakten, Bilder zur Historie des Festes am 20. August, in: Schell, Csilla/ Prosser, Michael (Hrsg.): Fest, Brauch, Identität – Ünnep, szokás, identitás. Ungarisch-deutsche Kontaktfelder. Beiträge zur Tagung des Johannes-Künzig-Instituts 8.-10. Juni 2005, Freiburg 2008, S. 15-85.↩︎
Duna TV: Ünnepélyes zászlófelvonás és tisztavatás [Feierliches Flaggenhissen und Offiziersvereidigung], in: https://www.mediaklikk.hu/video/unnepelyes-zaszlofelvonas-es-tisztavatas-2/, 63 Minuten, 00:00:50-00:01:13 (abgerufen am 11.09.2018) [Originalzitat: „Most látjuk a Székely zászlót […], a kárpát-medencei magyar autonómiatörekvések jelképét, amely az 1990-as éveket […] a 2000-es éveket összeköti az államalapítás időszakával, Szent István királlyal, hiszen akkor is a magyar önrendelkezésről és ma is a magyar önrendelkezésről beszéltünk és beszélünk.“].↩︎
Gellner, Ernest: Nationalismus und Moderne, Berlin 1991, S. 8-87.↩︎
Ebd., S. 183-200.↩︎
Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, 2. Auflage, Frankfurt a.M./ New York 1993, S. 14-20.↩︎
Hullóidő [Fallende Zeit]. Székely identitásépités a 19.-20. században [Szekler Identitätenbildung im 19.-20. Jahrhundert]. Az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének és az MTA-Lendület Trianon 100 Kutatócsoportjának közös konferenciája [Gemeinsame Konferenz des Instituts für Minderheitenforschung des Gesellschaftswissenschaftlichen Forschungszentrums und der Forschungsgruppe Schwung Trianon 100 der Ungarischen Akademie der Wissenschaften], http://trianon100.hu/cikk/az-mta-tk-kisebbsegkutato-intezetenek-es-az-mta-lendulet-trianon-100-kutatocsoportjanak-kozos-konferenciaja (abgerufen am 30.06.2018).↩︎
Die Szekler im 20. Jahrhundert
In einer Studie aus dem Jahr 1922 definiert der ungarische Völkerkundler Benedek Jancsó die Szekler als das Magyarentum, welches im Szeklerland, also dem Gebiet „in den Komitaten Háromszék, Csík, Udvarhely und Maros-Torda“1, lebt. Dieses Gebiet liegt im nordöstlichen Teil Siebenbürgens, oder, wie Jancsó revisionistisch klarstellt, „im geographischen Sinne [in] Südost-Ungarn“,2 welches der Trianoner Friedensvertrag 1920 dem Königreich Rumänien angeschlossen habe. Das Szeklerland mache, so Jancsó, nach dem „Rumpfungarn“ Trianons, das zweitgrößte zusammenhängende magyarische Siedlungsgebiet aus. 3
Nach magyarischer und szeklerischer Auffassung wird das Szeklerland (ung. Székelyföld) im Jahr 2001 als das Gebiet der Bezirke Maros (rum. Mureş), Hargita (rum. Harghita) und Kovászna (rum. Covasna) betrachtet, welche sich zu dieser Zeit auf dem Staatsgebiet Rumäniens befinden.4 Diese Definition des Szeklerlandes ist territorial nahezu deckungsgleich mit der Jancsós aus dem Jahr 1922. Die zeithistorische Rezeption der Szekler operiert folglich mit ethnischen und territorialen Kategorien, welche mit denen der 1920er Jahre nahezu identisch sind. Auch in den 2000er Jahren ist die ethnische Zusammensetzung ein ungarisches Kernargument für die Wahrnehmung des Szeklerlandes als singuläres territoriales Gebilde. Ethnische Verbreitungskarten markieren sowohl für 19205 als auch für 20036 das Szeklerland als überwiegend oder homogen magyarisch besiedeltes Gebiet. Diese magyarische Exklave geriet durch den Vertrag von Trianon außerhalb des ungarischen Staatsgebietes. Die Karten markieren das Szeklerland als ein Territorium, welches von der sprachlich und kulturell und damit ethnisch definierten Volksgruppe der Magyaren dominiert wird.
In der ungarischen Historiographie stellt der am 4. Juni 1920, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, unterzeichnete Friedensvertrag von Trianon eine bedeutende Diskontinuität und ein wirkmächtiges nationales Trauma dar. Ungarn verlor mit dem Vertrag mehr als zwei Drittel seines Staatsgebietes. Jeder Dritte der im vormaligen „Großungarn“ lebenden Magyaren wurde Staatsbürger eines fremden Staates. Nach einer Teilrevision im Zuge der Wiener Schiedssprüche 1938 und 1940 wurden die Grenzen von Trianon durch den Pariser Friedensvertrag nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 wiederhergestellt. In der Zeit des Sozialismus galt Trianon als Tabuthema, welches die propagierte Eintracht unter den sozialistischen Ländern gefährdet hätte.7
Von 1952 bis 1968 existierte in Siebenbürgen ein autonomes magyarisches Territorium. Dieses wurde im Zuge einer Gebietsreform unter Nicolae Ceauşescu im Jahr 1968 wieder aufgelöst.8 In den 1960er bis 1980er Jahren wurden die Magyaren in den staatlichen Institutionen Rumäniens systematisch diskriminiert und Schlüsselpositionen mit ethnischen Rumänen besetzt.9 Die Parteiführung unter Ceauşescu betonte die nationale Einheit Rumäniens. Die offizielle Minderheitenpolitik war von Repressionen und rein symbolischen Zugeständnissen geprägt.10 Letztere, wie zum Beispiel die Möglichkeit der Herausgabe ungarischsprachiger Zeitungen,11 waren jedoch kaum geeignet, Ceauşescus offen antimagyarische Politik zu verbergen. Bewusst wurde den Magyaren die Möglichkeit genommen, sich in den mehrheitlich magyarisch bewohnten Gebieten ethnisch in der Öffentlichkeit und der Politik zu repräsentieren.12 Im Lichte einer rumänischen Nationalpolitik, die einen ethnisch homogenen, rumänischen Nationalstaat propagierte, war es den Magyaren unter Ceauşescu nicht gestattet, ihre kulturelle, geschichtliche und ethnische Verbindung mit dem ungarischen Mutterlande zu betonen.





























