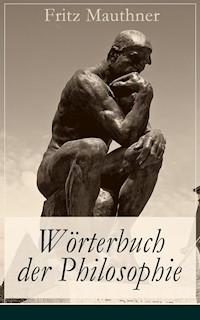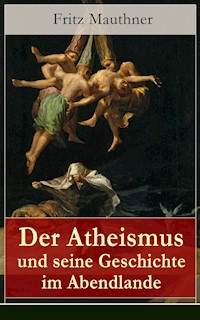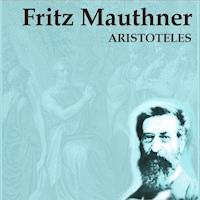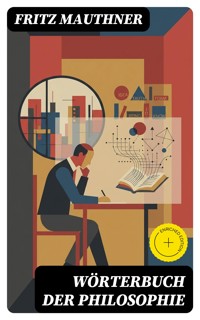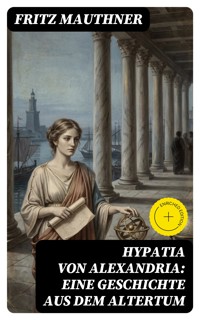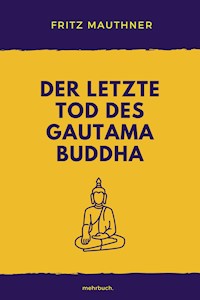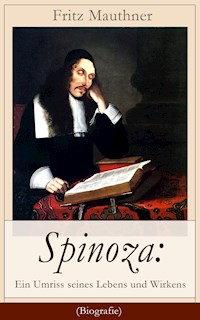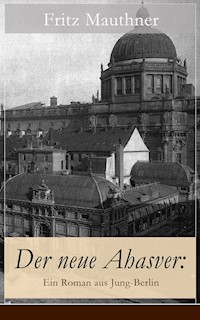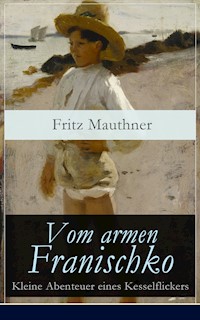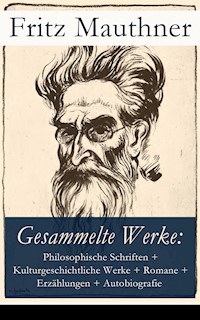Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält den ersten Teil der Biografie Mauthners, die Prager Jugendjahre.
Das E-Book Erinnerungen, Band 1 wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erinnerungen, Band 1
Fritz Mauthner
Inhalt:
Fritz Mauthner – Biografie und Bibliografie
Erinnerungen, Band 1
I. Horzitz.
II. Prag.
III. Die Klippschule.
IV. Erste Sprachstudien.
V. Das Piaristen-Gymnasium.
VI. Ohne Sprache und ohne Religion.
VII. Und wieder die Piaristen.
VIII. 1866.
IX. Das Kleinseitner Gymnasium.
X. Allotria.
XI. Übergang.
XII. Konfession.
XIII. Nationale Kämpfe.
XIV. Einsame Fahrt.
XV. Universitätsjahre.
XVI. Streiche und Feste.
XVII. Die erste Druckerschwärze.
XVIII. Das erste Buch.
XIX. Kritik der Sprache.
XX. Geschäftiger Müßiggang.
XXI. Des Vaters Tod.
XXII. Theaterkritik.
XXIII. Abschied von Prag.
Anhang
Nachwort.
Erinnerungen, Band 1,, Fritz Mauthner
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849618315
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Fritz Mauthner – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 22. Nov. 1849 zu Hořitz bei Königgrätz in Böhmen, studierte in Prag Rechtswissenschaft, trat mit einem Sonettenzyklus: »Die große Revolution« (1871), der ihm beinahe eine Anklage auf Hochverrat eingetragen hätte, zuerst literarisch auf und ließ einige kleinere Lustspiele folgen, die auch mit Beifall ausgeführt wurden. Seitdem widmete er sich ausschließlich dem literarischen Beruf, zunächst als Mitarbeiter der deutschen Blätter Prags, und ließ sich 1876 in Berlin dauernd nieder. Einen durchschlagenden Erfolg erzielte er mit einer Reihe satirischer Studien, die den Stil der hervorragendsten deutschen Dichter der Gegenwart parodierten: »Nach berühmten Mustern« (Stuttg. 1879, 28. Aufl. 1895; neue Folge 1880, ebenfalls in zahlreichen Auflagen; Gesamtausgabe 1897). Weitere Sammlungen von kritischen Feuilletons und Satiren sind: »Kleiner Krieg« (Leipz. 1878), »Einsame Fahrten. Plaudereien und Skizzen« (das. 1879, 3. Aufl. 1890), »Dilettanten-Spiegel. Travestie nach Horazens Ars poetica« (Dresd. 1883), »Aturenbriefe« (2. Aufl., das. 1885), »Credo« (Berl. 1886), »Von Keller zu Zola« (das. 1887), »Schmock, oder die literarische Karrière der Gegenwart« (das. 1888), »Tote Symbole« (Kiel 1891). M. veröffentlichte ferner die Erzählungen und Novellen: »Vom armen Franischko« (Bern 1880; 7. Aufl., Dresd. 1886), »Die Sonntage der Baronin« (1880; 3. Aufl., Dresd. 1884), »Zehn Geschichten« (Berl. 1891), »Bekenntnisse einer Spiritistin (Hildegard Nilson)« (das. 1891), »Der wilde Jockey und anderes« (Münch. 1897), »Der steinerne Riese« (Dresd. 1897); sodann die Romane: »Der neue Ahasver« (das. 1881), »Xantippe« (das. 1884. 6. Aufl. 1894), »Berlin W« (I.: »Quartett«, das. 1886; II.: »Die Fanfare«, 1888; III.: »Der Villenhof«, 1890, mehrfach aufgelegt), »Der letzte Deutsche von Blatna« (Dresd. 1886, 5. Aufl. 1890), »Der Pegasus, eine tragikomische Geschichte« (das. 1889, 3. Aufl. 1894), »Hypatia« (Stuttg. 1892), »Der Geisterseher« (Berl. 1894), »Kraft« (Dresd. 1894, 2 Bde.; 3. Aufl. 1899), »Die bunte Reihe« (Münch. 1896), »Die böhmische Handschrift« (das. 1897). Auch veröffentlichte er Fabeln und Gedichte in Prosa u. d. T.: »Lügenohr« (Stuttg. 1892; 2. Aufl.: »Aus dem Märchenbuch der Wahrheit«, das. 1896). Neuerdings erregte M. die Aufmerksamkeit weiterer Kreise durch ein umfangreiches wissenschaftliches Werk: »Beiträge zu einer Kritik der Sprache« (Stuttg. 1901–02, 3 Bde.), in dem er mit Scharfsinn die Unzulänglichkeit des Ausdrucksmittels der Sprache darlegt.
Erinnerungen, Band 1-Prager Jugendjahre
Mit einiger Verwunderung sehe ich mich selbst bei der Arbeit, meine Lebenserinnerungen niederzuschreiben. Ich darf mich wohl rühmen, in einer mehr als vierzigjährigen schriftstellerischen Tätigkeit niemals meine Person in den Vordergrund, die Person vor die Sache gerückt zu haben; und da spreche ich in einem ganzen Buche, und gleich in dem ersten Satze, nur von mir selbst. Dennoch fühle ich keinen Gegensatz zwischen meiner scheuen Lebensführung und dieser heraustretenden Lebensbeschreibung. Es schien mir auf die Dauer unerträglich, in dem Kampfe gegen die kindermörderische alte Schule stille zu schweigen, nicht ein Bekenntnis zugunsten der neuen freien Schule abzulegen. So reifte der Entschluß, die ganz gewöhnliche, fast lächerliche Tragik der eigenen Schulerinnerungen zu erzählen; und über dem Bekennen wird ja der alte Erzähler etwas schwatzhaft geworden sein und seinen Lesern auch Gleichgültiges vorgetragen haben. Die Beiträge zur Kritik der alten Schule sind aber die Hauptsache. Bene vixit qui bene latuit, jawohl, aber: Mensch sein heißt ein Kämpfer sein; und im Kampfe hat man mit eigener Person zu bezahlen, gern oder ungern.
Wertvolle Selbstbiographien werden immer seltene Bücher bleiben. Wer so gut zu erzählen versteht, daß er auch schlechten Stoff zum Kunstwerke umschaffen kann, oder wer so Merkwürdiges erlebt hat, daß auch eine kunstlose Darstellung den Reiz nicht abzuschwächen vermag, der wird eine lesbare Selbstbiographie schreiben können; aber ein Buch von bleibendem Werte entsteht nur, wenn zu der künstlerischen Darstellung und dem ungewöhnlichen Erlebnisse noch die Kraft hinzutritt, die eigene Seele wie mit den Augen einer fremden Überseele betrachten zu können. Ich möchte also nur vorausschicken, daß ich gar nicht die Absicht habe, letzte Bekenntnisse zu bieten, ein aufwühlendes Buch von bleibendem Werte. Es hat nicht jeder die inbrünstige Offenheit eines Augustinus, die pathologische eines Rousseau.
Eines aber sollte jeder, so gut er es versteht, niederschreiben und veröffentlichen: seine eigenen Schulerinnerungen. Denn die Schule hat seit mehr als hundert Jahren, eigentlich langsam schon seit dem Aufkommen der mittelalterlichen Gelehrtenschule, eine solche Macht gewonnen, eine Macht über die Entwicklung des jungen Menschen, daß das Schicksal des künftigen Geschlechtes in hohem Grade davon abhängig ist, ob wir taugliche oder untaugliche Schuleinrichtungen besitzen. Einzig und allein von der Schule kann die Zukunft einer jungen Welt freilich nicht abhängig sein; denn dann hätte die Menschheit unserer Kulturländer doch wohl schon längst zugrunde gehen müssen. Die kräftige Menschennatur hilft sich selbst gegen die elenden Schuleinrichtungen wie gegen andere schlechte Gesetze. Das Haus bekämpft die Schule. Selbst die Roheiten eines Trunkenboldes von Vater können für den Charakter des Knaben eine günstige Wirkung haben; der Vater jagt den Jungen von den Büchern weg auf die Straße, wo für den spätern Kampf ums Dasein aus dem Raufen mit Altersgenossen mehr zu lernen ist als aus der Geschichte des Königs Hiskias. Desto besser, wenn der Vater kein Trunkenbold ist, wenn der erfahrene Vater oder die mitleidige Mutter das Kind mit Bewußtsein von den Büchern fortjagt und spricht: »Sei meinetwegen ein schlechter Schüler; sei nur ein glücklicher Junge und werde ein tüchtiger Mensch!«
Unsere Schule ist wie eine epidemische Kinderkrankheit, die jeder von uns durchmachen muß; unzählige sind an dieser Krankheit gestorben, unzählige sind zeitlebens seelische Krüppel geblieben. Es wäre gut, Eigenberichte über den Verlauf der Krankheit zu sammeln. Recht gute Anfänge sind schon gemacht worden. Die Gesetzgeber würden dann wenigstens erfahren, wie den Schülern unter der Herrschaft der alten Gesetze zumute war. Der Leser müßte manches zufällige Vorkommnis, müßte manches allzu persönliche Urteil mit in den Kauf nehmen; aber wir würden endlich einmal den Schrei der Kreatur hören und nicht immer wieder die flüsternde Totensprache einer offiziösen Wissenschaft. Es wäre vielleicht überhaupt günstig für die angewandte Medizin, wenn die Krankengeschichten nicht von den Ärzten, sondern von den Patienten geschrieben würden.
Man wird mir einwenden wollen, daß nicht alle erwachsenen Menschen mit Haß und Zorn an ihre Schulzeit zurückdenken. Es gibt sicherlich viele Menschen, die zu guten Staatsbürgern prädestiniert sind, die alle Polizeiverordnungen löblich finden und die darum auch an unsern Schuleinrichtungen nichts auszusetzen wissen. Es gibt ferner an allen unseren Schulen, den niedersten wie den höchsten, viele prächtige Lehrer, die ihren Beruf lieben und die in stetem Kampfe mit dem Schulreglement und mit ihren Vorgesetzen den Kindern und den jungen Leuten freundliche Führer auf der Höllenfahrt der Schule sind. Es kommt aber noch eins hinzu; die guten Menschen, die mit manchem Wenn und Aber freundlich und dankbar an ihre Schulzeit zurückdenken, verwechseln sehr häufig die Stimmung der glücklichen Jugendzeit, die sich nicht einmal von der Schule unterkriegen läßt, mit der Schule selbst; wer es einstens ernst nahm mit den Schulpflichten, und wer es nachher ernst nimmt mit den Pflichten gegen die eigenen Kinder, der kann nicht so optimistisch von seiner Schulzeit denken. Ernste Männer, die ernste Schüler waren, dürften mit seltenen Ausnahmen einig sein in einem Verdammungsurteil über die alte Schule, die immer noch die unsere ist.
Gerade in den letzten Jahren konnte das jeder vernehmen, der seine Ohren nicht verschloß für die zu einer Anklage angewachsenen Klagen gegen die alte Schule. In den sehr lesenswerten Beratungen über die Einrichtung einer einheitlichen Zukunftsschule, einer Neuschule, die die Kinder aus den Fesseln einer rückständigen Pädagogik befreien soll, hörte man immer wieder in fast tragischen Tönen ein Verdammungsurteil über die Schulzeit der jetzt führenden Lehrer und gewiß über die Schulnot just der begabtesten Knaben. Die Verteidigungsreden einzelner Musterschüler, die es zu etwas gebracht haben, vielleicht weil sie Zeit ihres Lebens stets das Wirkliche vernünftig fanden, machen in diesen rebellischen Diskussionen eher einen predigerhaften als einen überzeugenden Eindruck. Es soll mir recht sein, wenn sich die jungen Lehrer auch auf mich alten Herrn werden berufen können.
Meine eigenen Schulerinnerungen nun sind leider nicht typisch für die Leiden eines begabten deutschen Knaben. Ich bin als Jude geboren und habe meine ganze Schulzeit, achtzehn Jahre, in dem schönen hunderttürmigen Prag verbracht, also in einer schon damals sehr slawischen Stadt. Ich kann aber meine Erinnerungen nicht fälschen und muß froh sein, wenn durch diese beiden Umstände ein wenig Abwechslung kommen wird in die Einerleiheit des Schulfabrikbetriebes, durch welchen ich hindurchgeschleppt wurde.
I. Horzitz.
Geboren bin ich zu Horzitz, einem kleinen Landstädtchen zwischen Königgrätz und Trautenau, nicht gar weit von der Sprachgrenze; mein Geburtsort gehört zum tschechischen Gebiete, doch war es in meiner Kindheit noch ganz selbstverständlich, daß die Honoratioren des Städtchens entweder Deutsche waren oder doch mit einigem Stolze etwas deutsch redeten. Zu den deutschen Honoratioren gehörten (damals noch selbstverständlich) die jüdischen Besitzer der kleinen mechanischen Webereien. So ein Fabrikbesitzer war auch mein Vater. Horzitz ist jetzt bekannter geworden durch die Tatsache, daß es am Tage nach der Schlacht von Königgrätz das preußische Hauptquartier war. Für uns Kinder war Sadowa einer der nächsten Ausflugsorte, Königgrätz die nächste große Stadt. Als diese Namen historische Berühmtheit erlangten, lebte ich längst nicht mehr in Horzitz.
In Horzitz übernachteten der König und Bismarck nach der Schlacht, der König feldmäßig auf einem Sofa im Rathause, Bismarck in dem Hause unseres Arztes, das neben dem unsern lag. Von Horzitz sind die ersten Briefe über die Schlacht datiert, die beide Männer an ihre Frauen schrieben. Es ist bezeichnend für die Volksphantasie, daß über den Aufenthalt des Königs sich nicht so viele Legenden bildeten wie über den des Grafen Bismarck. Wahr ist, daß auch Bismarck zunächst kein anständiges Bett vorfand, bis der Herzog von Mecklenburg ihm eins verschaffte; viel später warf der Fürst seinem »Büschchen« fast heftig vor, dieser hätte eine solche Wohltat auf das Konto des ihm feindlichen Prinzen Karl geschrieben. In seinen Gedanken und Erinnerungen macht der Fürst dem Generalstabe, also Moltke, leise den philologischen Vorwurf, er habe den Namen des Städtchens »Horritz« geschrieben (wohl ein Druckfehler für Horitz), gesprochen werde »Horsitz«; was wieder nicht ganz richtig ist. Ich schreibe so, wie der Name von Deutschböhmen geschrieben wird; ausgesprochen wird ungefähr »Horschitz«.
Nach der Monographie Jähns' (»Die Schlacht von Königgrätz«) besaß Horzitz im Jahre 1866 drei- bis viertausend Einwohner, von denen am Tage der Schlacht die allermeisten entflohen gewesen wären. Beides wird nicht ganz stimmen. Die Stadt hatte über fünftausend Einwohner und nur die Wohlhabenden dürften die Flucht ergriffen haben; natürlich vor allem die Hausbesitzer, deren Abwesenheit den Preußen, als sie die Soldaten und dann die Verwundeten unterbringen wollten, zunächst unbequem auffallen mußte.
Ich war noch nicht ganz sechs Jahre alt, als wir Horzitz verließen. Ort und Gegend ist mir aber ganz gegenwärtig geblieben, weil wir noch viele Jahre lang unsere Schulferien dort verlebten, also mit völliger Freiheit in der Landschaft umherzustreifen. In zwei oder drei Sommern waren wir mit den Eltern da, nachher fielen wir einem Onkel zur Last, der sich denn auch später einmal die lärmenden Neffen durch einen Gewaltstreich vom Halse schaffte: unterhalb des Gotthardsberges, auf dem jetzt das ernste Denkmal für die gefallenen Preußen steht, hauste zum Schrecken der Einwohner ein Räuber, dessen gutmütige Art an Raabes »Horacker« erinnern mochte; der Onkel aber machte sich die Schauergerüchte zunutze, packte uns zusammen und schickte uns eines Tages nach Prag, mit der Begründung, wir wären in Horzitz unseres Lebens nicht sicher. Viel Geldwert wäre bei uns Knaben nicht zu holen gewesen.
Das Städtchen liegt genau so da wie andere Landstädte Böhmens. Ein sehr großer, viereckiger Marktplatz, »Ring« genannt, ist mehr die Stadt selbst als bloß der Mittelpunkt. Vom Ringe aus einige schlechte Gäßchen, von denen die beiden längsten sich gegen Süden und gegen Norden erstrecken; die gegen Süden in der Richtung nach Königgrätz bis zur »untern Kapelle«; die andere gegen das Riesengebirge zu bis zur »obern Kapelle«. Auf dem weiten Platze verloren eine Mariensäule und ein Röhrbrunnen. Die untere Hälfte des Rings von Bogengängen umgeben, den sogenannten »Lauben«, in denen es bei den Wochenmärkten und besonders bei den Jahrmärkten geschäftig genug zuging. Den Häusern der obern Hälfte, die offenbar neuern Ursprungs waren, fehlten die Lauben. Das Haus meines Vaters, das er in meinem zweiten Lebensjahre erbaut hatte, stand da auf der obern Hälfte des Rings und dünkte uns Kindern überaus vornehm, weil rechts und links vom Toreingang je ein Pilaster stand mit steinernen Eulen. Als ich das Haus in meinem vierzigsten Jahre nach langer Entfremdung wiedersah, kam es mir nicht mehr so gewaltig vor; merkwürdig, sogar die Bäume des Gartens, die doch recht viel größer geworden sein mußten, kamen mir jetzt kleiner vor. Von den Dachfenstern des Elternhauses war die Schneekoppe zu sehen; ich war elf Jahre alt, als ich sie zum ersten Male erstieg.
Ich habe vergessen zu sagen, daß es in Horzitz auch ein Schloß gab; es war ein unschöner mächtiger Bau, in welchem die Staatsbeamten sich eingerichtet hatten. Hinter dem Schlosse wuchsen in meiner Kinderzeit die ersten Fabriken empor, auch die meines Vaters.
Wollte man von Horzitz nach Prag fahren, so konnte man in meiner frühesten Jugend erst von Pardubitz an die Eisenbahn benützen. Als ich aber im Sommer des Jahres 1867 wieder in meiner Heimat war, da ging die Bahn schon bis Königgrätz, von wo eine schwerfällige, einspännige Britschka in zwei Stunden auf der Kaiserstraße quer über das Schlachtfeld, direkt über Lipa und Sadowa, hart an Chlum vorbei, mich nach Horzitz brachte. Der Eindruck war an diesem friedlichen schönen Augusttage noch traurig genug. Zwar die zerstörten Häuser und Hütten waren wieder aufgebaut und die Kanonenkugeln in den Mauern des Wirtshauses von Sadowa, das jetzt die deutsche Inschrift »Zum Schlachtfelde« trug, sahen nach Reklame aus. Aber rechts und links von der Straße standen Grabsteine; hier waren Offiziere gefallen und an Ort und Stelle begraben worden; bei dem achtzigsten Grabstein hörte ich zu zählen auf. Noch furchtbarer schienen mir die Massengräber der preußischen und österreichischen Soldaten, die in den schnittbereiten Kornfeldern überall deutlich zu erkennen waren, weil die Bauern dort nicht gepflügt und nicht gesät hatten. Von Lipa aus besuchte ich die niedere Höhe von Chlum, wo nichts mehr an die blutigen Stunden der Entscheidung erinnerte, und über Langenhof hinaus die hügeligen Wiesen, wo die »schöne« Reiterschlacht stattgefunden hatte, über welche Jähns den bedenklichen Satz zu schreiben gewagt hat: »Wahrlich ein Schauspiel auch eines Königs in vollem Maße wert!«
Der Kutscher erzählte wilde Geschichten von der Schlacht. Die Legendenbildung war nicht müßig gewesen. Die Flügel einer Windmühle hätten dem Feldzeugmeister Nachricht von den Bewegungen der Preußen gegeben. »Aber ein dummer Kerl war Benedek doch. Er hätte die beiden großen Linden drüben bei Horenowes abhauen sollen. Dann hätte der Kronprinz nicht den Weg von Königinhof hergefunden.« (Bekanntlich marschierte die schlesische Armee wirklich stundenlang auf diese weithin sichtbaren Linden zu; daß es aber auch etwas wie Landkarten gäbe, das wollte der Kutscher nicht glauben.)
In Horzitz selbst wurde mir in aufgeregter Weise viel über die Tage vom zweiten bis fünften Juli des vergangenen Jahres erzählt, Wahres und Falsches durcheinander; aber auch nicht ein einziger Zug von Roheit oder Disziplinlosigkeit der Preußen. Als die schlimmste Tat wurde berichtet, daß sie an der Bistritz zu irgendeinem Zwecke, ich glaube zum Ausbessern der Brücke, Scheunentore ausgehoben hätten. Gegen 20000 Mann waren in Horzitz untergebracht; und dann waren alle besseren Häuser zu Spitälern umgewandelt worden. Allgemein wurde gerühmt, daß die österreichischen Verwundeten ebensogut verpflegt wurden wie die preußischen. Ich habe schon angedeutet, daß das Interesse wie der Haß fast ausschließlich dem Grafen Bismarck galten. Er wäre auf dem Hofe des Doktorhauses »beinahe« in eine Mistgrube gefallen und hätte »beinahe« den Hals gebrochen; kein Kind in Horzitz, das nicht Lust gehabt hätte sich dieses »Beinahe« zu rühmen. Als ich im Jahre 1875 abermals nach Horzitz kam, zur Beerdigung meines Großvaters, vernahm ich nichts mehr über die Schlacht von Königgrätz.
II. Prag.
Mein Vater, im Verkehr mit Frau und Kindern ein stiller Mann, für sich selbst vielleicht nur etwas zu selbstgerecht und stolz, für seine Kinder in seiner Weise ehrgeizig, war im Jahre 1855 – ich war noch nicht sechs Jahre alt – nach Prag übersiedelt, um dort den fünf Knaben einen besseren Schulunterricht bieten zu können. Mein Vater mochte wenige Schulkenntnisse haben und hatte auch darum gewiß keine deutliche Vorstellung davon, was diesen Knaben zu lernen etwa dienlich sein könnte. Wir waren alle fünf zu Kaufleuten bestimmt. Als ich nach Prag kam, hatte ich bereits bei meiner guten Mutter lesen gelernt. Sie zeigte mir in der Gartenlaube, auf die wir abonniert waren, die großen und dann die kleinen Buchstaben der Überschriften und ich brachte es sehr bald dazu, mir ganze Worte und Sätze zu deuten. In Prag war das erste für mich, daß ich die Straßentafeln, Geschäftsfirmen und Wirtshausschilder, die damals noch fast ohne Ausnahme deutsch waren, als geeignete Lesebücher entdeckte. Auf einem Spaziergang wurde zur Freude meiner Mutter festgestellt, daß ich lesen konnte, und daß ich es fast allein erlernt hatte. Das war der Anfang meiner kurzen Wunderkindschaft. Von den Geschwistern erntete ich, nach der schmerzhaften aber gesunden Sitte unseres Hauses, nur Spott. Ich hatte einmal, als wir am Waisenhause vorüberkamen, altklug zu meinem jüngeren Bruder gesagt: »Wenn du auch lesen könntest, würdest du wissen, daß hier das Wirtshaus zum weißen Hans ist.« Das Gelächter, das übrigens noch nach Monaten nicht ganz aufhörte, war meine erste philologische Lektion: über den Unterschied von u und n. Das Gelächter änderte nichts an der Bedeutung des Erlebnisses; ich konnte lesen, darum sollte ich so schnell wie möglich in die Schule. Dumm, aber logisch.
Der Vater hatte vom Lande mit der ganzen Familie auch unsern Hofmeister mitgebracht, Herrn Fröhlich, einen tüchtigen, braven und fleißigen Mann, dem meine Wißbegierde bald gründliche Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen verdanken sollte. Herr Fröhlich, der in Horzitz nur die älteren Brüder für die vorgeschriebenen Prüfungen unterrichtet hatte, machte jetzt aus zwei Zimmern unserer Prager Wohnung eine richtige Schule; wir fünf Knaben, dazu unsere einzige Schwester, ferner ein Vetter und zwei Kusinen namens Sobotka (die jüngste von ihnen ist Frau Auguste Hauschner), wurden so ungefähr in sechs Klassen eingeteilt, in welche von dem unermüdlichen Lehrer von früh bis abend hineingepaukt und hineingeprügelt wurde, was irgend hineinging. Über Methode und Unterrichtsziel unseres Hofmeisters kann ich natürlich heute nicht mehr urteilen. Ich darf nicht verschweigen, daß irgendein Einfluß auf die Persönlichkeiten seiner Schüler und Schülerinnen durchaus fehlte; niemals haben wir von ihm ein Wort vernommen, das für das Leben, für den Charakter hätte bildend wirken können; er war kein Erzieher. War bei seiner Gewissenhaftigkeit auch wohl so müde, wie es sonst nur ein Volksschullehrer in einer Klasse von sechzig Schülern sein kann. Dazu kam – wie schon leise erwähnt – seine Härte bei körperlichen Strafen, die übrigens vom Vater immer gebilligt wurde, da dessen Erziehungsprinzip ebenfalls auf der Prügelstrafe beruhte. Trotzdem habe ich die beste Erinnerung an die Zeit dieses überhasteten und nüchternen Unterrichts. Wenn ich es heute recht bedenke, so hatte Herr Fröhlich den Auftrag und also die Pflicht, uns möglichst rasch für die Prüfungen irgendeiner öffentlichen Schule vorzubereiten. Da die meisten von uns aufgeweckte Kinder waren, etwa die Hälfte von uns sogar ungewöhnlich begabt, so tat die kleine Presse ihre Schuldigkeit. Meine ältesten Brüder gingen immer elegant durch die Prüfungen.
Ich kann nicht sagen, welche Erfolge unser Hofmeister mit mir hätte erzielen können. Denn schon etwa zwei Jahre nach unserer Übersiedelung verließ er uns, um eine höhere Mädchenschule zu leiten, die seine Schwester gegründet hatte. Unsere jungen Damen nahm er natürlich mit in die neue Anstalt. Wir Knaben wurden dahin und dorthin verstreut. Wer seine Prüfungen abgelegt hatte, der war gut daran; er trat eben in die nächst höhere Klasse einer öffentlichen Schule ein. Mir aber geschah damals etwas, woran ich noch heute, nach siebenundfünfzig Jahren, nicht anders als mit äußerster Erbitterung denken kann, ein Unrecht, das von keinem Lebenserfolge gesühnt werden kann. Ich schwanke nicht, es ein schweres, ruchloses Verbrechen zu nennen. Ich war reif fürs Gymnasium und mußte noch drei Jahre auf einer widerwärtigen Klippschule wiederkäuen, was ich bei Herrn Fröhlich gelernt hatte. Als ich die Geschichte dieses Verbrechens vor einigen Jahren einer Exzellenz vom Unterrichtsressort erzählte, konnte der hochmögende Herr die Sache gar nicht so tragisch finden. Die Schulen seien für die Mittelmäßigkeit eingerichtet und das müsse so bleiben.
Ich hatte wirklich bei unserm Hofmeister binnen zwei Jahren genug gelernt, um in allen den kleinen positiven Kenntnissen die neun- und zehnjährigen Knaben zu übertreffen, die bereits in das heißersehnte Gymnasium eintreten durften. Und das Gymnasium sollte ich ja besuchen, zum eigenen Staunen der Eltern, weil der Hausarzt mich für ein Wunderkind erklärt hatte; und ein Wunderkind hieß ich, weil ich im Kopfrechnen stark war, weil ich Gedichte auswendig lernte, leicht und zu meinem Vergnügen.
III. Die Klippschule.
Man muß es mir schon glauben, daß ich damals bereits reif für das Gymnasium war, und nicht erst drei Jahre später. Vielleicht fehlte im Lehrplan unseres Hofmeisters die eine oder die andere Kleinigkeit, die just in jenen Zeitläuften bei der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium verlangt wurde; aber diese Lücken hätte ich sicherlich binnen wenigen Wochen oder Monaten ausfüllen können. So zum Beispiel waren meine Kenntnisse in der tschechischen Sprache wahrscheinlich sehr mangelhaft. Ich mochte bis etwa zum vierten Lebensjahre tschechisch und deutsch gleich gut oder gleich schlecht geplappert haben; tschechisch gar noch etwas früher, weil in Böhmen (d.h. in den gemischten Bezirken des Landes) tschechisch als die gottgewollte Ammensprache angesehen wurde. Seitdem ich aber am Elterntische essen durfte, ging die Übung im Tschechischsprechen langsam verloren; und tschechisch richtig zu schreiben habe ich eigentlich niemals gelernt. Nun war aber tschechisch von Gesetzes wegen die zweite Landessprache geworden und von den armen Schulkindern wurde etwas tschechische Orthographie und etwas tschechische Grammatik verlangt. Wirklich nur ein wenig Sand in die Augen. Wie gesagt, binnen wenigen Wochen hätte ich das Verlangte nachholen können. Ich aber wurde nach tagelangem Schwanken in die zweite Klasse einer vierklassigen Privatschule gesteckt und erst drei Jahre später auf das Gymnasium entlassen. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich jetzt und später bei Erwähnung dieser einfachen Tatsache lebhaft oder gar pathetisch wie ein öffentlicher Ankläger werden sollte. Ich werde immer noch nicht heftig genug anklagen. Wie unser Strafrecht so ist unser ganzes Rechtsgefühl zu materialistisch; ernstliche Angriffe gegen das Geistesleben werden kaum so hart verurteilt wie Einbrüche, die dem Geldschrank gelten; der Erpresser, der der schlimmere ist, wird nicht so streng bestraft wie der Räuber.
Es ist mir gar nicht zweifelhaft, wer für dieses Verbrechen an einem Kinde verantwortlich war. Meine Eltern fügten sich, weil man ihnen sagte, ich wäre schwächlich und müßte im Lernen zurückgehalten werden. Als ob dem wißbegierigen und phantasievollen Knaben nicht anhaltende Arbeit gesünder gewesen wäre, als das fünfzehnjährige Lungern, das dann folgte. Die Sache wurde offenbar zwischen unserem Hofmeister und dem abscheulichen Direktor jener Privatschule abgemacht. Damit dieser Direktor drei Jahre lang ohne jeden Sinn das Schulgeld für mich bekam, darum wurde ich der Gefahr ausgesetzt, an Leib und Seele zu verkommen. Und da habe ich noch nicht einmal hervorgehoben, daß diese Privatschule nur von jüdischen Knaben besucht wurde, daß der Direktor oder der Besitzer ein völlig unkultivierter ungarischer Jude war; vielleicht war es nach dem damaligen Stande der österreichischen Gesetzgebung nicht möglich, das Kind religionsloser, aber jüdischer Eltern anders als in einem solchen Pferche unterzubringen. Ich kann auch heute noch über die Marter nicht lachen, die ich damals zu erleiden glaubte; die ich also erlitten habe.
Nur selten haben Erwachsene ein Verständnis für die ernsten Qualen einer Kinderseele. Ich fühlte es damals noch lebhafter, als ich es heute nachfühle, daß mir ein Unrecht zugefügt wurde: daß ich unter einen Haufen von Schülern versetzt worden war, deren Lehrer ich hätte sein können; daß meine Lehrer tief unter dem Kulturniveau meines einfachen Elternhauses standen. Vielleicht nicht das Gesetz, jedenfalls aber die Praxis machte es unmöglich, auch auf Grund der ungewöhnlichsten Leistungen eine Schulklasse zu überspringen. So war ich verurteilt, die drei Jahre, um welche man mich bestohlen hatte, niemals wieder einbringen zu können. Immer blieb ich zu alt für den aufgezwungenen Studienplan, zwiefach zu alt: durch meine Jahre und durch meine Altklugheit.
Ich möchte nun bei keinem Leser in den Verdacht kommen, als beklagte ich mich über die gestohlenen drei Jahre deshalb, weil ich sonst zu siebzehn Jahren meine Maturitätsprüfung, zu einundzwanzig Jahren meinen Doktor gemacht hätte und ... es ist ja nicht auszudenken, was aus mir dann noch alles Ordentliche hätte werden können. So ist meine Klage wirklich nicht gemeint. Ich wäre auch dann ein freier Schriftsteller geworden, wenn ich zur richtigen Zeit so viel wie möglich gelernt hätte. Die Folgen des Unrechts, des Diebstahls von drei Jahren, die Folgen, die ich zu beklagen habe, sind ganz anderer Art. Ich hatte nichts, aber auch gar nichts zu lernen, um jahrelang immer der Erste unter meinen Schulkameraden zu sein; so gewöhnte ich mich an Faulheit und an Überhebung und blieb faul und überheblich, für die Schule wenigstens, auch dann noch, als in den höheren Gymnasialklassen und auf der Universität Fleiß und Bescheidenheit nützlicher gewesen wären. Ich könnte noch mancherlei über die Folgen der Faulheit, der frühreifen Überhebung und der vollständigen Vereinsamung erzählen. Aber ich möchte nicht moralisieren. »Tetem« könnten mir die Menschen antworten, die Vischers »Auch einer« gelesen haben und darum lieben.
Daß die seelischen Nachteile der widerrechtlichen Einpferchung in jene Klippschule sich aber erst später einstellten und nicht auf jener Schule selbst, das lag an einigen gutartigen Lehrern und wieder an meiner damals noch nicht überwundenen Wunderkindschaft. Daß der Besitzer der Schule ein ekelhafter Geldmacher war, daß einzelne Schulmeister der Nebenfächer recht wurmstichige Persönlichkeiten waren, das kam mir damals nicht zum Bewußtsein und konnte mir darum kaum schaden. Nicht einmal die unsauberen Geschichten, die die Jungen aus dem Internat in die Klassen zu den »Externisten« brachten, machten sonderlichen Eindruck auf mich; ich hielt solche Zustände nicht für möglich und staunte höchstens über die schmutzige Sprache der Berichterstatter. Die Hauptlehrer waren gute und eifrige Menschen. So wurde tüchtig gearbeitet; und gar für die öffentliche Jahresprüfung, welche in Gegenwart des rundlichen Bezirkspfarrers und eines in seinen Kreisen berühmten hageren Rabbiners abgehalten wurde, mußte ein starkes Quantum auswendig gelernt und in sauberen Heften zusammengeschrieben werden. Da wurden die besseren Schüler nach Kräften herangezogen und meine Eitelkeit verhinderte mich, zu dem Gefühle des Müßiggangs zu kommen. Ich wurde bei diesen Prüfungen unaufhörlich vorgeritten, mußte zu diesem Zwecke das ganze Jahr zugeritten werden, trainiert, so daß seltsamerweise die drei gestohlenen Jahre mit die fleißigsten meines Lebens waren. Was so die Lehrer Fleiß nennen. Es ist nicht zu sagen, was ich damals alles gewußt und gekonnt habe. Es ist ein Wunder, daß das unsinnige Auswendiglernen mich nicht blödsinnig gemacht hat. Ich gebe nur ein Beispiel von dem, was mir zugemutet wurde. Am ersten Tage einer solchen öffentlichen Prüfung waren von uns eine Unzahl Schillerscher Gedichte aufgesagt worden. Kurz vor der Mittagspause äußerte der rundliche Bezirkspfarrer den Wunsch, eines dieser wunderschönen Schillerschen Gedichte auch auf tschechisch deklamiert zu hören. In einer ebenso schönen Übersetzung. Wir seien doch gewiß gute Böhmen? Der Schuldirektor katzbuckelte: er (der ungarische Jude) sei ein sehr guter Böhme. Dann nahm mich dieser Mann beiseite, bedrohte mich mit geballter Faust, wenn ich nicht am Nachmittage, also binnen zwei Stunden, Schillers »Bürgschaft« in der tschechischen Übersetzung auswendig gelernt hätte, die in der Schulbibliothek nicht fehlte. Es gelang mir, den ehrenvollen Auftrag auszuführen. Ich sagte die Übersetzung, deren Wortlaut mir nicht völlig begreiflich war, mit Verstand auf und wurde vom Pfarrer und vom Direktor gelobt und gestreichelt. Ich weiß noch, daß ich am nächsten Morgen nicht mehr imstande war, auch nur den dritten Vers der Übersetzung aus dem Gedächtnisse wiederherzustellen.
Es sind aus so viel Wunderkindern später Dummköpfe und Subalternbeamte geworden, auch schlechte Musikanten, daß ich von dieser Art meiner Begabung gewiß unbefangen reden darf. Natürlich wurde meine Überheblichkeit, deren ich mich schon beschuldigt habe, durch diese Art des Schulbetriebs sehr verstärkt, wenn nicht erst geweckt. Ich war der Schnittlauch auf allen Suppen. Der Himmel ist mein Zeuge, sogar im Singen (meiner partie honteuse) leistete ich nach dem Urteile der Lehrer Außerordentliches; als einmal ein zweistimmiger Gesang durch meine Schuld umkippte, bekam mein Banknachbar die Ohrfeigen dafür. Ich erinnere mich, daß einmal die Lehrer aus allen Schulstuben zusammengerufen wurden, um eine Karte von Europa anzustaunen, die ich aus dem Gedächtnisse und aus freier Hand mit der Kreide auf die Tafel gemalt hatte; auch das hatte ich früher bei unserm Hofmeister gelernt; und die Kunst, die Fjorde von Norwegen durch einen zitterigen Kreidestrich hübsch naturalistisch anzudeuten. Auf eine Anregung des rundlichen Pfarrers, dem meine Heldentat vom Direktor schnell gemeldet worden war, mußte ich für die nächste Jahresprüfung eine ebenso schöne Karte von Palästina auf die Tafel malen; ich ließ es auch da nicht an Fjorden fehlen und glaube fast, es war schon Übermut dabei. Diese Wunderkindschaft, welche sich außer in einem seltenen Gedächtnisse noch in einer gewissen Begabung für Mathematik, für Sprachen und für Zeichnen kundgab, hielt ungefähr bis zu meinem vierzehnten Lebensjahre an. Dann hat es sich ja wohl gegeben. Aber ich darf nicht unterlassen zu berichten, was die Schulen mit diesen Begabungen anzufangen gewußt haben.
Mein Sinn für alles Mathematische muß wirklich ursprünglich sehr stark gewesen sein; noch in meinem sechzehnten Jahre, auf dem Gymnasium, machte sich unser Mathematikprofessor, ein unwahrscheinlich dicker Piaristenpriester, an heißen Sommertagen mitunter den Spaß oder die Bequemlichkeit, mich statt seiner die Stunde abhalten zu lassen. Aber ich habe von wissenschaftlicher Mathematik, ja eigentlich von der eigentümlichen mathematischen Logik in allen Schuljahren niemals etwas gehört und habe als vierzigjähriger und dann wieder als siebenundfünfzigjähriger Mann das bißchen Mathematik nachlernen müssen, das ich zu einer Annäherung an die höhere Analyse und zum Verständnis eines naturwissenschaftlichen Buches brauchte. Ich möchte gleich hier auf eine der schlimmsten Lügen unseres Gymnasialbetriebs hinweisen. Der seit der realistischen Gymnasialreform vorgeschriebene mathematische Stoff wird von allen Schülern verlangt; nun gibt es ganz brave Lateiner, die den mathematischen Begriffen völlig hilflos gegenüberstehen, die zwischen dem Logarithmus und dem Wurzelziehen nur unklar unterscheiden können. Soll so ein fleißiger Bursche der Primus in der Klasse bleiben, so muß das mathematische Pensum an allen Ecken beschnitten werden, die Prüfung darf nicht ernst genommen werden und die ganze Klasse lernt nichts. Unsere Klasse auf dem Obergymnasium der Prager Kleinseite war ein Musterbeispiel für diese Zustände. Der Primus, der übrigens seine Stellung durch seine wissenschaftlichen Leistungen und durch seine moralische Untadeligkeit wohl verdiente, war amathematisch geboren. Der Primus hätte nach dem Schulplane nicht versetzt werden dürfen. Der Zweite der Klasse, ein Jude, war in den alten Sprachen nahezu ebensogut, in Mathematik und auch sonst ein Musterschüler. Er blieb im Schatten, bis zu seinem Tode.
Daß ich auch im Zeichnen »ausgezeichnet« war, muß ich meinen Lehrern glauben. In unserer Klippschule gab es auch Zeichenunterricht. Ein heruntergekommener Kalligraph erteilte ihn, mit dem Staberl in der Hand, mit dem Rohrstock. Es ist mir noch heute unverständlich, warum er so grimmig mit dem Staberl auf uns losschlug; es muß ihm wohl Vergnügen gemacht haben. Er teilte diese Leidenschaft übrigens mit dem Direktor, der noch vom Schuldiener regelrechte Schillinge (fünfundzwanzig Stockschläge) aufzählen ließ. Gott habe sie selig, den Direktor und seinen Zeichenlehrer. Sie ruhen beide in Frieden und haben es nicht um uns verdient. Ich war übrigens der Liebling auch dieses Lehrers und habe unter seiner Leitung und mit seiner Hilfe für die öffentlichen Jahresprüfungen Gräßliches zustande gebracht. Ich habe so etwas wie Parkettfußböden gezeichnet und koloriert, ich habe kämpfende wilde Tiere nach Vorlagen gezeichnet. Für ein solches Bild von meiner Künstlerhand soll die Schule einmal einen Preis bekommen haben; ich weiß nicht mehr, waren es Tiger oder Krokodile, oder war es eine gemischte Gesellschaft von Tigern und Krokodilen, oder waren es Bastarde von Tigern und Krokodilen. Niemals wurden wir angeregt, ein Blatt, eine Blume, ein Tier, einen Menschen oder auch nur einen Stein nach der Natur zu zeichnen. Niemals wurde uns auch nur angedeutet, daß es eine Freude sein könnte, die Natur mit eigenen Augen anzusehen. Und auch auf dem Gymnasium habe ich niemals Gelegenheit gehabt, auch nur einen Bleistiftstrich auf ein Blatt Zeichenpapier zu werfen. Nur ein einziges Mal kam die Leidenschaft über mich, als ein bildender Künstler zu schaffen. Das innere Erlebnis mag ein Licht werfen auf den Grad der Vereinsamung, die mich in meiner Jugend von allem Kunstgenießen schied.
Zu Hause erfuhr ich durch die Mutter mancherlei von Büchern und von Theateraufführungen; ich wurde mitunter ins Theater mitgenommen, wo wir ein halbes Abonnement auf zwei Sperrsitze hatten, und die Bücher, die ich meiner Mutter aus der Leihbibliothek holte, verschlang ich gewöhnlich auf dem Heimwege: Dickens, Gerstäcker, Hackländer, Gutzkow, Spielhagen, Auerbach, die Mühlbach. So war für geistige Anregung immerhin gesorgt, wenn auch heimlich. Aber der Begriff Kunst war mir fremd geblieben. Ich kannte eine einzige Oper, allerdings den Freischütz, zu dem ich einmal ins Theater gehen durfte, weil die älteren Geschwister ihn nicht mehr hören wollten. Es gab in unserem Hause nicht einmal ein Klavier. Und gar von Architektur oder Malerei hatte ich in meinen begeisterungsfähigen Jugendjahren wohl niemals einen ganz klar bewußten Eindruck erhalten, trotzdem wir in dem schönen Prag wohnten. Niemals war ich zu Hause oder in der Schule auch nur auf eines der prächtigen alten Gebäude aufmerksam gemacht worden. Was ich von selbst an herrlichen Kirchenportalen und von den Türmen der Altstadt wahrnahm, das machte einen tiefen Eindruck auf mich; da ich aber nicht wußte, daß auch andere Menschen so etwas schön fanden, so sann ich dem Eindruck nicht weiter nach. Ich hielt solche Stimmungen wirklich und wahrhaftig eines gebildeten Menschen unwürdig, ich glaube fast, ich schämte mich ihrer, weil die andern sie nie einer Erwähnung wert erachteten. Ich wunderte mich höchstens darüber, daß die alten winkligen Gassen so viel heimlicher waren, als die geraden Straßen der Neustadt. Von Bildern bekam ich nichts zu sehen als die beiden Stahlstiche an der Wand, die als Prämien eines vaterländischen Kunstvereins in keinem bürgerlichen Hause fehlten. So gelangte ich kunstfremd bis in mein siebzehntes Jahr, als mir einmal ein Schulkamerad das Kupferstichwerk zeigte, das ihm unter den Weihnachtsbaum gelegt worden war. Es brachte in guten Nachzeichnungen gegen sechzig der berühmtesten Gemälde alter Meister. Ich hatte bis dahin Namen wie Rembrandt, wie Tizian niemals vernommen. Ich weiß nicht mehr, ob beim Durchblättern des Werkes mein Entzücken größer war oder mein Neid. Der Mitschüler mußte mir das Werk borgen; zu Hause saß ich davor in einer zornigen Erschütterung. So etwas gab es und so etwas bekamen andere Knaben geschenkt! Das war ja das Höchste, dem ein Jüngling sein Leben widmen konnte! Nun kann ich nicht mehr sagen, ob ich mich in meiner Begeisterung selbst für einen begnadeten Maler hielt oder ob ich mir nur unbemerkt eine Kopie des herrlichen Buches anfertigen wollte. Jedenfalls ging ich, sooft ich mich unbeobachtet wußte, daran, die schönsten Kupferstiche auf kleinen Blättchen mit dem besten Bleistift nachzuzeichnen, den ich auftreiben konnte. Nach einigen Wochen hatte ich meine armselige Künstlermappe beisammen. Einige Rembrandts und Raffaels meiner Faktur existieren noch; nicht nur ein Künstler würde über diese ängstlichen, pedantischen, kümmerlichen Stricheleien lachen. Ich aber besaß eine Kunstgalerie für den heimlichen Gebrauch.
Ungefähr in die gleiche Zeit fällt der noch traurigere Versuch, mir für mein persönliches Kunstbedürfnis ein Leiblied zu komponieren; es läßt sich nicht leugnen, daß zwar der Text von mir war, aber die Melodie eine sehr schöne, liebe und alte Melodie.
Es ist mir oft zum Lobe nachgesagt worden, ich hätte mich beim Kritisieren stets als neidlosen Schriftsteller bewährt. Ich will nicht untersuchen, ob ich dieses Lob gar nicht oder am Ende noch in viel höherem Maße verdient habe; ob ich vielleicht mitunter den Neid unterdrücken mußte, um dem glücklicheren Rivalen wenigstens gerecht zu werden. Sicher ist, daß Neid nicht zu meinen häßlichen Fehlern gehört. Neid aber, bitterer Neid erfüllt mich noch heute, wenn ich sehen muß, wie gut es die jungen Leute haben, wie ihr Interesse für Natur und Kunst geweckt oder gefördert wird. Wie die Lehrer mit ihren Wandervögeln ins Gebirge ziehen, im Walde lagern, abkochen und der Stadt entflohen sind! Wie sie mit offenen Herzen und offenen Augen das Straßburger Münster und die Alpen erblicken dürfen. Genießt, ihr prächtigen Jungen! Aber daß diese Burschen auch einen ernsthaften Unterricht im Singen und im Zeichnen erhalten, daß sie in Konzerte und in Galerien geführt werden, wonach wir durstig waren wie abgehetzte Hunde nach Wasser ... nein, da muß ich den Heutigen schon in die glücklichen Augen sehen, da muß ich schon Glück über Bach und Mozart und Raffael in diesen Augen erblicken, um des Neides Meister zu werden. Genießt, ihr Jungen! Uns wurde es schwerer die Schönheit zu entdecken.
IV. Erste Sprachstudien.
Bitterer wird meine Stimmung, wenn ich daran denke, was Klippschule und Gymnasium mit meinem Sinne für Sprachen angefangen haben; und auch sonst wäre mancherlei zu sagen über die besonderen Verhältnisse, die das Interesse für eine Psychologie der Sprache bei mir bis zu einer Leidenschaft steigerten. Dieses Interesse war bei mir von frühester Jugend an sehr stark, ja, ich verstehe es gar nicht, wenn ein Jude, der in einer slawischen Gegend Österreichs geboren ist, zur Sprachforschung nicht gedrängt wird. Er lernte damals (die Verhältnisse haben sich seitdem durch den Aufschwung der Slawen und durch die bessere Assimilierung der Juden ein wenig verschoben) genau genommen drei Sprachen zugleich verstehen: Deutsch als die Sprache der Beamten, der Bildung, der Dichtung und seines Umgangs; Tschechisch als die Sprache der Bauern und der Dienstmädchen, als die historische Sprache des glorreichen Königreichs Böhmen; ein bißchen Hebräisch als die heilige Sprache des Alten Testaments und als die Grundlage für das Mauscheldeutsch, welches er von Trödeljuden, aber gelegentlich auch von ganz gut gekleideten jüdischen Kaufleuten seines Umgangs oder gar seiner Verwandtschaft sprechen hörte. Der Jude, der in einer slawischen Gegend Österreichs geboren war, mußte gewissermaßen zugleich Deutsch, Tschechisch und Hebräisch als die Sprachen seiner »Vorfahren« verehren. Und die Mischung ganz unähnlicher Sprachen im gemeinen Kuchelböhmisch und in dem noch viel gemeineren Mauscheldeutsch mußte schon das Kind auf gewisse Sprachgesetze aufmerksam machen, auf Entlehnung und Kontamination, die in ihrer ganzen Bedeutung von der Sprachwissenschaft noch heute nicht völlig begriffen worden sind. Ich weiß es aus späteren Erzählungen meiner Mutter, daß ich schon als Kind die törichten Fragen einer veralteten Sprachphilosophie zu stellen liebte: warum heißt das und das Ding so und so? Im Böhmischen so, und im Deutschen so? Mein Vater, der in seiner Weise sich für einen musterhaften Gebrauch der deutschen Sprache einsetzte, würdigte mich manchmal einer Unterhaltung über solche »Belustigungen des Verstandes und des Witzes«, trotzdem er sonst nicht leicht ein persönliches Wort an eines seiner Kinder richtete. Er schien dadurch einige Achtung für meine »gelehrte Laufbahn« äußern zu wollen. Er verachtete und bekämpfte unerbittlich jeden leisen Anklang an Kuchelböhmisch oder an Mauscheldeutsch und bemühte sich mit unzureichenden Mitteln, uns eine reine, übertrieben puristische hochdeutsche Sprache zu lehren. So erinnere ich mich, daß er mir gegenüber einmal das Wort mischen als ein vermeintliches Wort der ihm verhaßten Judensprache heftig tadelte, man müßte gut deutsch melieren dafür sagen; mein Vater wußte nicht, daß sowohl mischen als melieren von dem lateinischen miscere stammt; diese Unkenntnis braucht dem eifrigen Sprachfreunde um so weniger angekreidet zu werden, als noch heute Forscher wie Kluge und Paul eine sogenannte Urverwandtschaft zwischen mischen und miscere für möglich halten.
Ich kam in meiner kindlichen Sprachvergleichung hie und da zu überraschenden Entdeckungen. So hatte ich als Kind das Zeug, mit dem mir beim Waschen die Hände getrocknet wurden, in meinem Kuchelböhmisch hantuch genannt, das Wort in meine deutsche Sprache mit hinübergenommen und kam in meinem fünften Jahre auf den gelehrten Einfall: hantuch bedeute ein Tuch für die Hand, wäre also ein deutsches Wort1.
Man wird mir nun glauben, daß ich als achtjähriger Junge darauf brannte, in der Schule nicht nur ein tadelloses Deutsch zu lernen, sondern auch zu erfahren, warum die böhmischen Deutschen so oft anders redeten, als die richtigen Deutschen in der Gartenlaube schrieben, warum die böhmischen Juden ein noch schlimmeres Kauderwelsch sprachen. Meine Hoffnung wurde gröblich getäuscht. Ich lernte auf der Klippschule ebensowenig Deutsch und gar Tschechisch und Hebräisch, wie ich später auf dem Gymnasium Lateinisch oder Griechisch lernte. Endlos wurden Deklinationen und Konjugationen gebüffelt und wieder gebüffelt, alle Formen der Dingwörter und der Zeitwörter im Deutschen, im Tschechischen und im Hebräischen so behandelt, als ob die lateinische Grammatik die Mustergrammatik für alle Sprachen der Welt wäre. Ich muß daran erinnern, daß meine Klippschule eine von jüdischen und slawischen Tendenzen herumgezerrte Anstalt war; ich muß vorwegnehmen, daß mein erstes Gymnasium wohl mit Recht eine besonders elende Mittelschule genannt werden konnte; aber das Wesentliche meiner Erfahrungen dürfte auch zu den Erfahrungen anderer Schüler gehören. Die geradezu idiotische Art, durch Paradigmen in die Sprachen einführen zu wollen, wird die Freude an jeder Sprache gerade dem begabten Kinde verekeln. Ich habe später oft geweint, als ich lateinische Paradigmen auswendig lernen mußte, anstatt die mit ahnungsvollem Zittern ersehnten lateinischen Autoren lesen zu dürfen. Und man weiß, wie auch heute noch und sogar auf bessern Gymnasien (nicht nur Cicero, der es verdient hat) selbst Homeros, der Köstliche, nur zu dem Zwecke gelesen wird, um an seinen Worten die grammatischen Regeln einzuüben. Neuerdings hat sich eine vernünftigere Art ausgebildet, wenigstens moderne fremde Sprachen den jungen Leuten beizubringen. Ich weiß nicht, ob in meiner Jugend die französische und die englische Sprache ebenso idiotisch gelehrt wurde wie die Muttersprache und wie die lateinische. Denn auch das muß ich gleich vorausschicken, daß auf den österreichischen Gymnasien damals kein englischer und kein französischer Sprachunterricht bestand; man konnte Französisch und Englisch, auch Italienisch treiben, wie man Tanzen oder Schwimmen lernte; verboten war es nicht. Ich habe später einige moderne Sprachen ohne Lehrerhilfe so gelernt, daß ich einen berühmten Dichter mit einem Wörterbuche in der Hand so lange langsam dechiffrierte, bis mir die Sprache geläufig wurde. Ich werde ja noch darauf zurückkommen, wie ich in all den Jahren der Volksschule und des Gymnasiums nicht ein Sterbenswörtchen über die Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Literatur vernahm, natürlich noch weniger jemals ein Sterbenswörtchen über Schönheit und Kraft unserer deutschen Muttersprache; wie ich dagegen von fanatischen Tschechen doch einigermaßen in die Geschichte der tschechischen Sprache und in die philologische Kenntnis eines gefälschten tschechischen Literaturkleinods eingeführt wurde. Niemand von meinen Lehrern hat je daran gedacht, meinem Sprachhunger ein bißchen Futter zu reichen. Auf jener Klippschule zahlte mein Vater drei Jahre lang Schulgeld dafür, daß ich für die Zwecke des Besitzers wie ein Zirkuspferd abgerichtet wurde. Unser Hofmeister war nur kein Erzieher gewesen; der Besitzer der Privatschule war ein schlechter Schulleiter und ein schlechter Mensch: er verprügelte die unbegabten Kinder, mit denen kein Geschäft zu machen war, und versuchte die begabten Kinder aufzublasen, wie betrügerische Händlerinnen mageres Geflügel aufblasen.
Fußnoten
1 Meine liebe und verehrte Freundin Lilli Lehmann hat ihre Jugend ebenfalls in Prag verbracht. Als ich ihr einmal von dieser meiner ersten etymologischen Entdeckung erzählte, gab sie mir lachend aus ihrer eigenen Erinnerung eine ähnliche Leistung zum besten. Sie war von ihrer Mutter oder erst im Ursulinerinnenkloster abgerichtet worden, jedesmal nach Landessitte kißt'hant zu sagen, wenn sie von einer Dame angesprochen wurde; auch sie hielt diese Formel lange für ein tschechisches Wort und kam erst viel später darauf, daß die Formel ich küß' die Hand bedeutete.
V. Das Piaristen-Gymnasium.
Ich war also beinahe zwölf Jahre alt, trotz meiner ursprünglichen Wunderkindschaft, da ich endlich als reif für die »Parva« des Gymnasiums entlassen wurde. Ich war also beinahe zwölf Jahre alt, fleißig und ehrgeizig wie einer, nach meiner geistigen Entwicklung für die Arbeit des Obergymnasiums vorbereitet, als ich endlich in die unterste Klasse des Untergymnasiums aufgenommen wurde. Und doch freute ich mich, als ich zum ersten Male als »Student« den Weg zum Gymnasium gehen durfte (in Österreich nennt man alle Gymnasiasten Studenten, wie man jeden Mann aus dem Volke adelt); ein Abzeichen für Gymnasiasten oder gar für jede einzelne Klasse gab es bei uns nicht, meine gute Mutter hatte es aber erlangt, wer weiß wie schwer, daß ich als Symbol meiner neuen Würde eine schwarze Samtmütze bekam. Die Mütze hatte den Stürmen dreier Jahre widerstanden und war wirklich nicht mehr ganz reinlich, als sie bei Gelegenheit einer Knabenschlacht zwischen »Gymnasiasten« und »Realisten« ein unrühmliches Ende fand. Wieder war es die Mutter, die durch heimlichen Ankauf einer neuen Mütze ein drohendes Unheil von mir abwandte. Mein Vater hätte niemals verstanden, daß ein Gymnasiast die Realschüler befehden müßte und in der Hitze des Gefechts seine Mütze einbüßen könnte.
Als ich mit dem Bewußtsein, von unserm Dienstmädchen Student genannt zu werden, zum ersten Male den Weg zum Gymnasium einschlug, ahnte ich unklar, daß noch nicht die rechte Höhe erreichte, was in meinem Kopfe an kleinen Kenntnissen beisammen war: der ganze Wust von Jahreszahlen großer Schlachten, von Namen der Könige, der Berge und der Flüsse, von Paradigmen und von Gedichten. Wie ein Rausch kam es über mich, daß ich jetzt Lateinisch und Griechisch lernen und alle Wahrheit und Schönheit aus den alten Quellen schöpfen würde. Ein einsichtsvoller Privatlehrer hätte mich damals gewiß binnen zwei Jahren dazu bringen können, Lateinisch zu verstehen, es besser zu verstehen als die Lehrer an meinem Gymnasium; und in der gleichen Zeit die griechische Sprache zu erlernen, wäre mir einfach wie eine Belohnung erschienen. Ich hungerte förmlich nach den alten Sprachen. Die ersten lateinischen Schulbücher nahm ich mit heiliger Andacht in die Hand und empfand es als eine Schande und als eine Entweihung so köstlicher Schriften, daß ich sie um den halben Preis beim Antiquar kaufen mußte.
In dieser Stimmung setzte ich mich in eine Klasse von etwa fünfundsechzig Knaben, die mir ganz und gar nicht andächtig zu sein schienen; so wenig aber ich selbst mir anmerken ließ, welche Sehnsucht nach Wahrheit und Schönheit mich erfüllte, so wenig wird mancher andere Kamerad sein Herz auf der Hand getragen haben; vielleicht hatte ich viele Genossen in meiner Inbrunst und dann in meiner Enttäuschung. Die bessern Elemente waren wie immer in der Minderzahl; etwa vierzig von den Schülern gehörten nicht auf eine Gelehrtenschule, auch nicht in deren unterste Klasse. Wie immer entschieden die schlechtern Elemente über den Fortgang der Studien; wir brauchten beinahe ein halbes Jahr, bevor wir mensa deklinieren konnten. Ich schreibe nicht einen Roman, in welchem die Leiden eines deutschen Kindes an sich erzählt werden sollen; ich schreibe meine Schulerinnerungen nieder, wenn auch mit einer erziehlichen Absicht für Eltern und Lehrer. Ich gebe meine eigenen Erinnerungen und muß darum auf einige Besonderheiten meines ersten Gymnasiums aufmerksam machen. Und auf einige Einrichtungen des österreichischen Gymnasiums überhaupt. Ich muß immer wieder hervorheben, daß ich das Unglück hatte, auf eine ganz besonders elende Schule zu geraten; man würde eine Anstalt wie das damalige Prager Piaristengymnasium in ganz Deutschland vergebens suchen, hoffentlich auch vergebens im heutigen Österreich.
Ich trat in die Prima oder Parva ein. Man zählt in Österreich bekanntlich die Gymnasialklassen nicht von sechs bis eins, sondern von eins bis acht. Der Knabe betritt das Gymnasium als Primaner oder Parvist und verläßt es als Oktavaner. Die alten scholastischen Bezeichnungen für jede der acht Klassen fingen zu meiner Zeit an, in Vergessenheit zu geraten. Und wie schon der kleine Parvist Student genannt wurde, so hieß jeder Lehrer, auch wenn er nur zur Probe oder zur Aushilfe angenommen war, Herr Professor. Auch meine Lehrer hießen Professoren, trotzdem sie eigentlich hochwürdige geistliche Herren waren. Denn mein erstes Gymnasium war eine Anstalt der Piaristen. Es ist mir lieb, daß dieses Neustädter Gymnasium von Prag seitdem in eine ordentliche Staatsanstalt umgewandelt worden ist; so darf ich zugeben, daß nicht mehr für die gegenwärtigen Verhältnisse gilt, was ich zu erzählen habe.