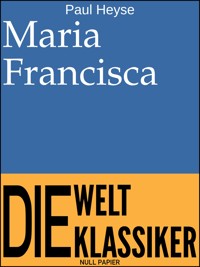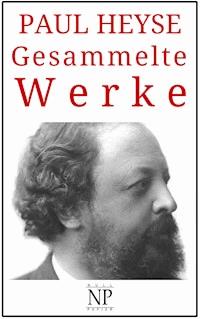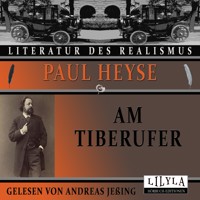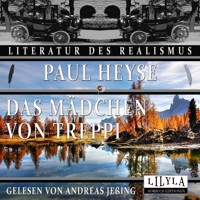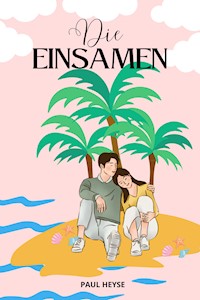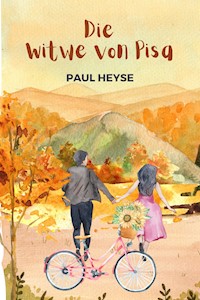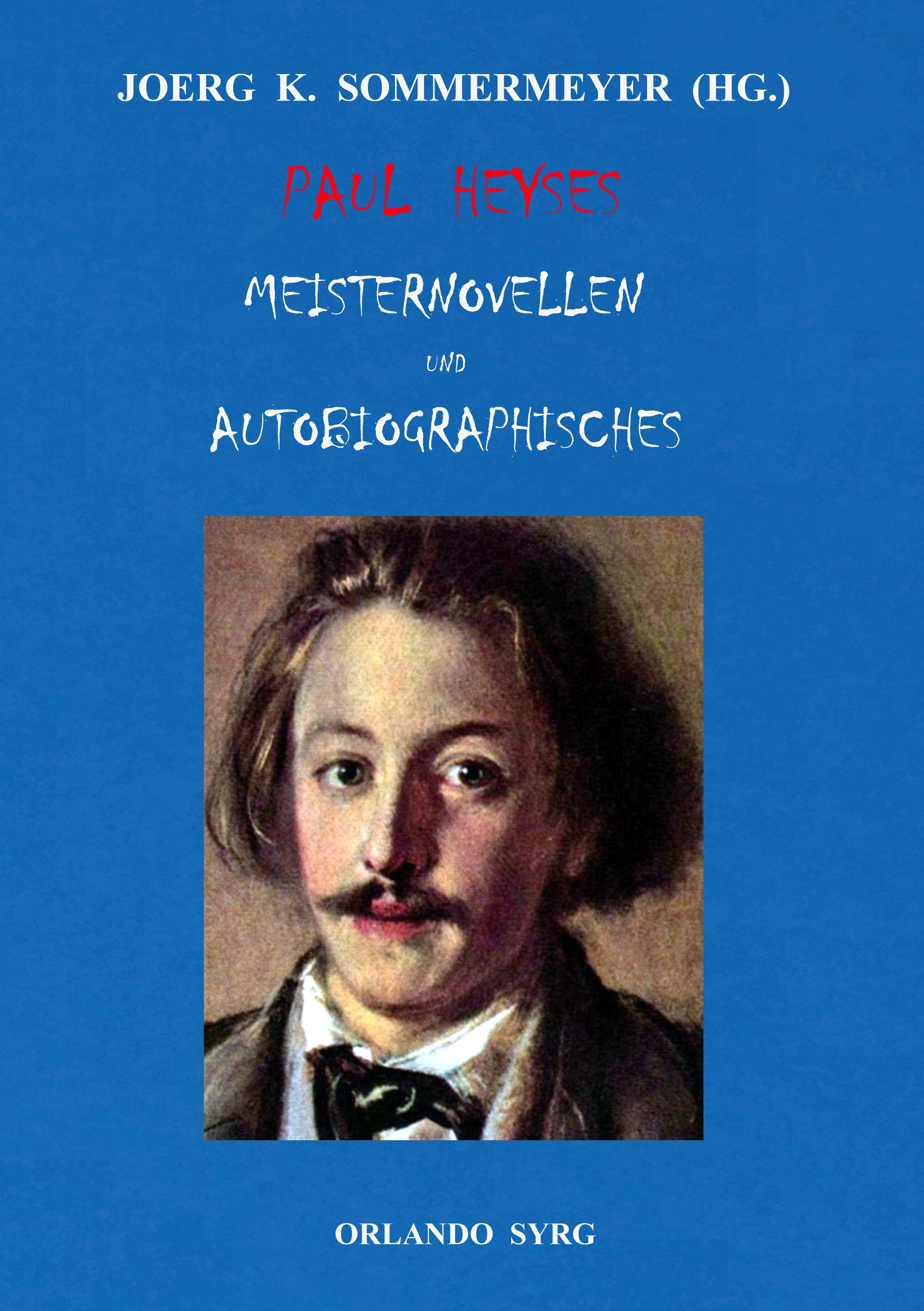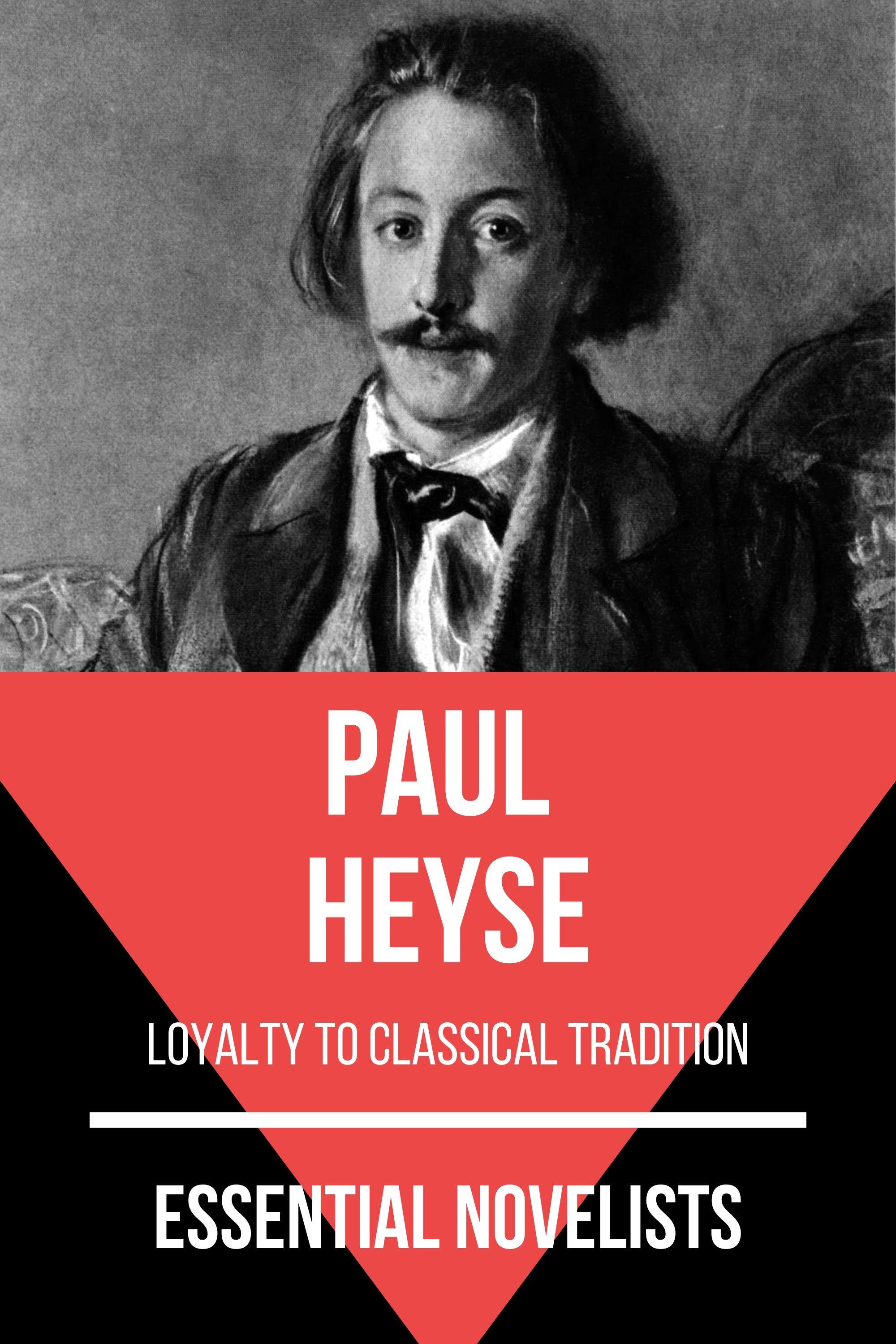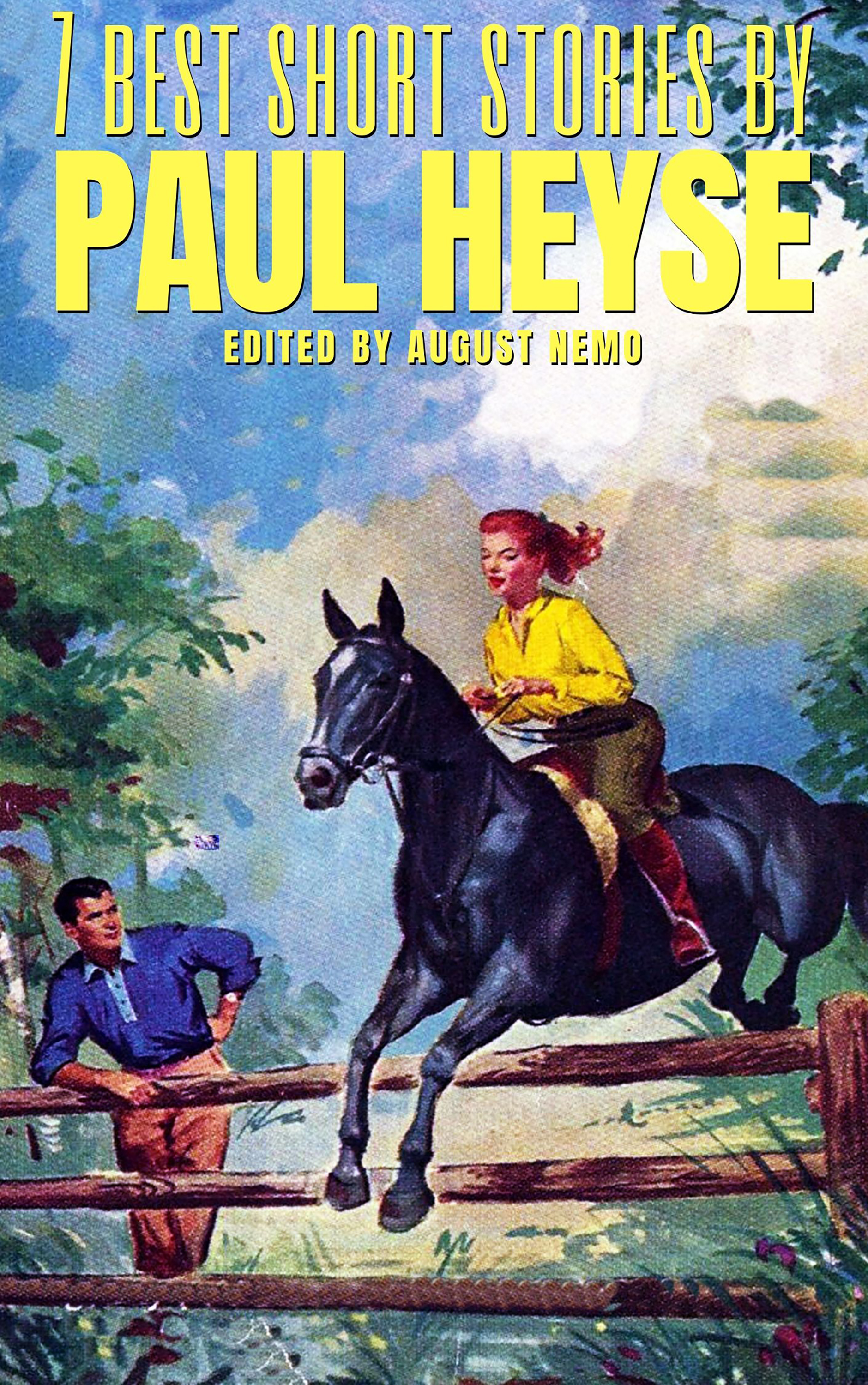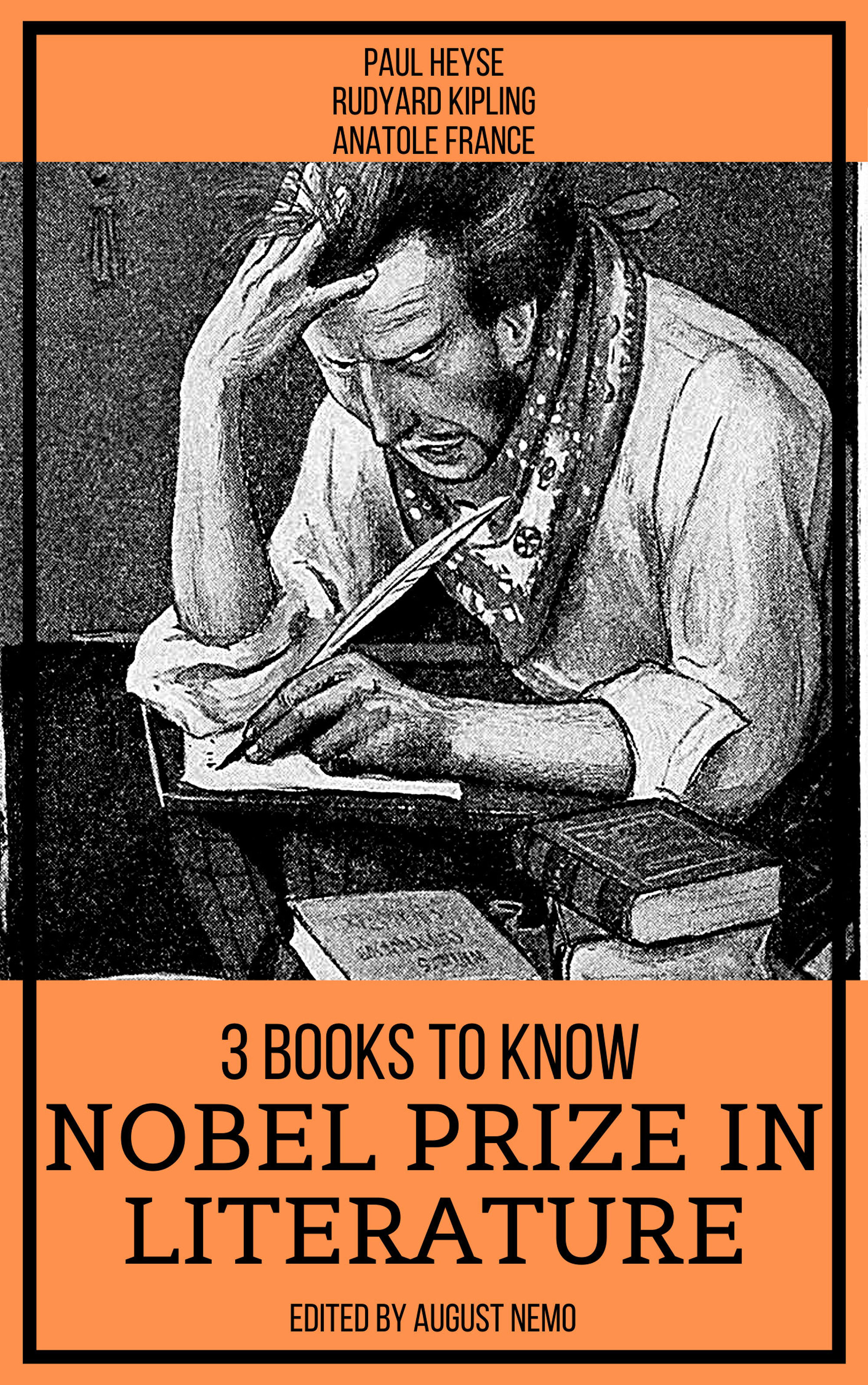Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Erkenne dich selbst
Novelle
Paul Heyse
Erkenne dich selbst
Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-58-7
null-papier.de/neu
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erkenne dich selbst
Seit einer Woche war ich in Florenz und befand mich dort von Herzen wohl. Denn die Stadt vereinigt farbiges nationales Leben in aller schönen Ungebundenheit des Südens mit einem hinlänglichen Maß jener modernen Bildung und geistigen Regsamkeit, ohne die dem Nordländer sein Dasein selbst in der lachendsten Szenerie, unter den liebenswürdigsten Naturmenschen auf die Länge wie ein Traum vorkommt. Auch die toskanische Reinlichkeit erquickt hier ein wohlerzogenes deutsches Gemüt nach so manchen römischen und neapolitanischen Drangsalen, ohne dass es doch an malerischen Lumpen und antiker Halbnacktheit gänzlich mangelte, zumal in der gesegneten Jahresmitte, wo ein Platen-fester Reisender weiß, dass man in Florenz »zur Kohle verglühn« kann, wenn man die landübliche Unbefangenheit sich nicht zu Nutze macht.
Dass ich in all diese Vorzüge des Florentiner Lebens sogleich eingeweiht werden sollte, dafür hatte mein Schutzgeist mit besonderem Wohlwollen gesorgt. Er führte mich bei meiner ersten Umschau nach einer Privatwohnung in ein sauberes, kühles Haus, dessen zweiter Stock von einer würdigen Witwe einzeln vermietet wurde. Die Magd wies mich in ein Hinterzimmer, aus dem mir ein rauhaariger kleiner Hund mit gesittetem, halblautem Bellen entgegenlief. Die Signora Eugenia selbst lag auf dem Sofa, in einer jedem kühleren Lufthauch, der sich durch die Jalousien stehlen wollte, äußert zugänglichen Haustracht. Selbst für einen Kenner des neapolitanischen Sommerkostüms war es verzeihlich, wenn er Abstand nahm, einzutreten, so sehr war diese bei den ersten Anfängen stehen geblieben und wesentlicher Ergänzung bedürftig. Die Dame indes schien nichts zu vermissen. Sie nahm ruhig eine Nadel, steckte das saubere Hemd über der Brust zusammen, zog die Füße in den weißen Strümpfen bescheiden und anmutig unter den Rock und bat mich mit freundlicher Handbewegung, den dadurch freigewordenen Sofaplatz einzunehmen, während sie selbst wie ein Murmeltier zusammengerollt in ihrer Ecke liegen blieb.
Ein gut Teil meiner Blödigkeit wich, als ich in dem Helldunkel des kühlen Gemachs mich von den gesetzten Jahren der Inhaberin überzeugte. Auf der wunderlich verschwommenen Figur saß ein starker Kopf, an das berühmte Birnenhaupt erinnernd, auf dem die französische Krone nicht haften wollte. Keine Art von Haube verunzierte den stattlichen Contour, und ein paar schwarze Locken hingen lose zu beiden Seiten auf die Schultern herab. Es hatte gar nichts Komisches, wenn sie bei jedem Schütteln des Hauptes, ohne welches die Signora kein Nein zu sagen vermochte, langsam hin und her pendelten. Auch die kleinen schwarzen Augen, die männliche Nase und der breite Mund – schätzbare Requisite eines Buffonengesichts – waren eines sehr majestätischen Ausdrucks fähig, besonders der Magd gegenüber, die, eine starkgliedrige Person, nicht viel besser als eine Leibeigene von ihrer Herrin gehalten wurde und vor einem ungnädigen Blicke derselben zitternd zusammenzuschrumpfen schien.
Die Signora hatte ein Buch weggelegt, als ich eintrat; ich konnte in dem grünen Jalousiendämmer nur sehen, dass es Verse waren. Eine kleine Ausgabe des Alfieri lag auf dem Tisch neben ihr, darüber und darunter ein bunter Haufe Journale und Zeitungen. Auch im Übrigen war in dem Zimmer von weiblichem Apparat wenig zu erblicken, nicht einmal ein Spiegel an der Wand; wogegen die Lage nach dem Hofe, die Stille und Kühle zur Meditation sehr einluden.
Ich fragte, ob noch ein ähnliches Zimmer frei stehe, worauf sie ruhig das Haupt schüttelte und mich im besten Toskanisch, fließend, aber nicht überflüssig, nach den Himmelsgegenden über die Vorzüge dieses einzigen Gemachs aufklärte. Doch stehe auf den übrigen Zimmern nur die Morgensonne, über Tag seien sie bis auf die Unruhe der Straße nicht minder behaglich als dieses. Sie werden begreifen, fuhr die Signora fort, ich gehe nie aus, außer ins Theater. Mein Zimmer ist mein Florenz; so muss ich es mir schon nach meinen Bedürfnissen aussuchen.
Die Magd wurde dann gerufen und geheißen, mich zu den leeren Zimmern zu führen. Sie selbst blieb bis auf eine entlassende Handbewegung unerschütterlich liegen. Ich bin noch nicht angezogen, Sie müssen verzeihen, sagte sie. Ich verbeugte mich und ging, die Magd pantoffelte voran; ein Gang durch den Korridor, den fünf oder sechs Türen vorbei, die alle offen standen, zeigte mir, dass ich noch die Wahl völlig frei hatte, und so wählte ich das mittelste Zimmer, wo mich ein kleiner runder Marmortisch mit vergoldetem Fuß aus der Ferne anlachte. Bei näherer Untersuchung teilte das Sofa dahinter freilich den Ruhm des Wagens, der mich von Siena hergebracht hatte: beide waren, wie sich der Vetturin schmunzelnd auszudrücken pflegte, »hart, aber reinlich«. Ich kehrte es seufzend um und sagte: Reinlich, aber – hart! Zum Glück ließ sich dem Bett dasselbe nachsagen, und das weiße, dicht schließende Netz gegen die Zanzaren, jene nächtlichen, geflügelten Blutsauger, beruhigte mich vollends darüber, dass ich eine Gelehrte zur Wirtin hatte.
Denn das war sie, wie mir die Magd, sobald wir allein waren, fast mit gefalteten Händen vertraute. »Alle Professoren in Florenz kennen und besuchen sie, und wenn ich über die Straße gehe, Signor, rufen sie mich an: Was macht Eure Herrin, Stella? oder: Grüßt die Signora Eugenia! dass ich ganz rot werde von der Ehre, eine dumme Person, wie ich bin. Ich bin auch eine Witwe, und mein seliger Mann, der ein Koch war, hat mir noch auf dem Sterbebette gesagt, der Kutscher seines Herrn Grafen, der Luigi habe ein Auge auf mich, ich solle mein Glück nicht von mir stoßen. Aber nein, Herr, ich halte was auf die Ehre, und wenn auch Manche sich nichts Besseres wünschen kann, als ihren Mann auf dem hohen Bock zu sehen, mit den Sammethosen und veilchenblauer Livree, – ich hatte schon als Jungfer bei der Signora gedient, und es ist besser, dacht’ ich, du gehst wieder zu ihr, die so viel Genie hat, und bleibst da bis an dein seliges Ende, wenn sie dich behalten will, eine dumme Person, wie du bist, als du lässest dich von dem Tölpel, dem Kutscher, schlagen, der nicht einmal Heu und Hafer zusammenrechnen kann. O Signor, wenn ich von nebenan höre, wie sie lauter so Sachen reden, die ich nicht kapiere, werde ich so stolz und zufrieden, wie ich nicht sein könnte, wenn mich auch der Kutscher des Großherzogs geheiratet hätte!«
So brauchte ich denn, wie ich nach dem Anfang schließen konnte, um Unterhaltung in diesem Hause nicht besorgt zu sein. Doch benutzte ich die Gelegenheit nur mäßig, besonders was die brave Stella betrifft, und selbst das »Genie« der Signora Eugenia unterbrach nur selten die langen, feierlichen oder heiteren Gespräche, die ich mit dem Genius der alten Stadt im Stillen pflog. Es gingen zu viel Ehrenmänner bei ihr aus und ein, und Dieser und Jener schien sich näher an mich anschließen zu wollen, was mich aus meiner empfangenden Stille herauszureißen drohte. Das Glück, sich ungestört mit den herrlichen Werken der großen alten Zeit zu erfüllen, gleichsam auf windstillem Kahn stromaufwärts in die Vergangenheit zurückzufahren und die fernen Ufer zu bestaunen, wollte ich mir durch keinen heutigen Menschenwitz und Menschenverstand verkümmern lassen.
Ich war darum wenig froh überrascht, eines Tages einem alten Bekannten aus Deutschland zu begegnen. Schon auf der Universität, wo ich ihn kennen gelernt, war ich ihm gern ausgewichen. Auch jetzt, als er mich, über Eis und Theaterzeitung vertieft, in einem Kaffeehause anredete, machte ich einen schwachen Versuch, durch ein fremdes Aufblicken ihn von mir fern zu halten. Er hatte leider von je her die Art, mit einer schadenfrohen Schärfe des Blicks dergleichen zu wittern und zu vereiteln, indem er es einem ins Gesicht sagte.
Sie freuen sich nicht sehr, mich zu sehen, wie ich merke, sagte er ruhig. Wie lange ist es doch her, seit wir das letzte Wort mit einander tauschten? Vier Jahre oder fünf? Jedenfalls Zeit genug, sich zu verändern. Sie haben gewiss diese Zeit benutzt; ich leider nur, um immer eigensinniger der zu bleiben, der ich damals war. Wenn mir recht ist, konnten Sie mich früher nicht leiden. Dieselbe Freiheit haben Sie natürlich auch jetzt noch. Es wäre aber freundlich von Ihnen, sich derselben nicht gleich von vorn herein zu bedienen; denn wie Sie mich da sehen, bin ich zwar vielleicht noch unleidlicher, als sonst, aber mit dem Unterschiede, dass ich mir selber dabei leid tue.
Seine Stimme, deren schneidende Schärfe mir noch sehr gut in der Erinnerung war, klang bei diesen Worten weicher und herzlicher als je. Ich stand auf und gab ihm die Hand.
Lassen Sie mich die Torheiten meiner Mondscheinjahre nicht entgelten, Franz, sagte ich lachend. Wie wir uns damals trafen, litt ich gerade am lyrischen Fieber, und Sie fühlten mir zuweilen unsanft den Puls und dachten mich durch Sturzbäder zu heilen. Mein Fall wird Sie darüber aufgeklärt haben, dass man besser tut, die Krankheit austoben zu lassen. Ich entsinne mich noch jenes wilden Schwindelanfalls, in welchem ich auf mein Recht trotzte, so krank und verrückt und hitzig zu sein, wie mir beliebte, und Ihre kühle Gesundheit gründlich zu verachten. Welcher meiner lyrischen Heiligen war es doch, den sie mir gelästert und seiner Glorie beraubt hatten?
Ich weiß nicht mehr, sagte er nachdenklich – das aber weiß ich, dass ich Sie schon damals um alles das beneidete, was ich einen sentimentalen Wahn schalt. Die schnödeste Missgunst reizte mich, Ihre Begeisterung zu verspotten. Begeistert sein – um den Preis hätte ich selbst ein dummer Mensch werden mögen. Freilich waren diese Wünsche damals seltene Gäste in mir, während jetzt – aber kommen Sie ins Freie.
Wir gingen. Der Abend war schattig, allein so schwül, als glühe statt einer goldenen eine schwarze Sonne auf die Stadt herab. Doch wogte in der schönen Straße, die den Domplatz mit dem Platz des Großherzogs verbindet, ein müßiger Menschenstrom auf und ab, alle Kaffeehäuser standen offen, Geschrei der Verkäufer, die an den niedrigen Tischen ihre Waren ausgelegt hatten, gellte in das Summen aller europäischen Zungen hinein, und schon begannen die ersten schüchternen Mondstrahlen über den beweglichen Menschenköpfen ihr Netz zu weben.
Nein, sagte Franz, als ich in eine stillere Seitenstraße ablenken wollte, bleiben wir unter der Menge. Ich weiß, dass Sie sich auf Geständnisse gefasst machen, und mit Recht, denn was ich Ihnen über acht Tage doch vertrauen würde, kann ich Ihnen eben so gut in der ersten Stunde sagen. Aber zu meiner Handvoll Schicksal braucht es keiner geheimnisvollen Szenerie, plätschernder Brunnen, einsamer Paläste, mauzender Kater und verliebter Pärchen, die sich in die Schatten drücken, wenn wir vorbeikommen. Es reizt mich gerade, mitten unter dem Geplapper und Gewäsch dieser friedlichen Spaziergänger Ihnen meine aufrichtige Meinung über mich zu sagen. Doch gestehen Sie selbst, ob es Ihnen nicht wie eine Sünde vorkommt, dass ich Ihnen auch hier den Abend verderben will, wie so manchen am Rhein! Was gehe ich Sie an? Was können Sie mir helfen? Es kam mir vorhin, als ich Sie so zufrieden sitzen und sich der Kritik über Signora Ristori erfreuen sah, in den Sinn, dass ich meine alten Spottsünden nicht besser wieder gut machen könnte, als indem ich nun Ihnen Gelegenheit gäbe, meiner zu spotten. Wenn Sie Lust zur Schadenfreude haben, nun gut, so mögen Sie erfahren, dass der, den ihr guten Jungen den Mephisto zu nennen pflegtet, weil er eure Schwärmereien verneinte, im Grunde nur ein sehr dummer Teufel war. Denn ein Klügerer hätte sich wohl gehütet, sich selbst zu verneinen.
Er sagte das Alles hastig, leise, mit dem Tone völliger Resignation; ich erkannte ihn kaum wieder.
Tun Sie, wie Sie wollen, erwiderte ich; reden Sie, schweigen Sie – meine Abende sind nicht mehr so leicht zu verderben, wie sonst. Ich möchte wissen, was mich jetzt um den Genuss bringen sollte, in diesem Strome von Lebensluft mitzuschwimmen, der uns zuletzt vor der Loggia dei Lanzi absetzen wird.
Ich erkenne daran unseren Unterschied, sagte Franz. Sie merken nur die Eine Richtung des Stromes, in der Sie