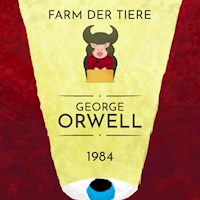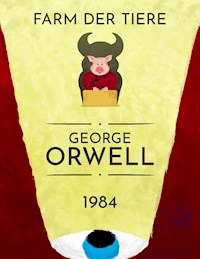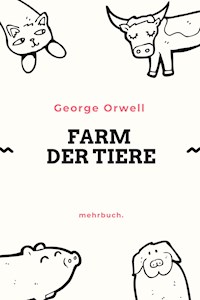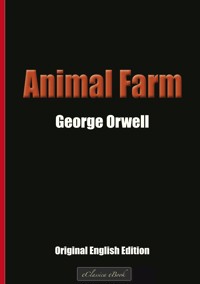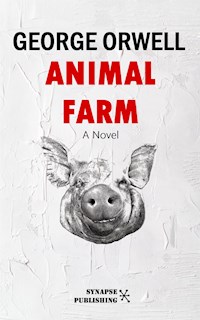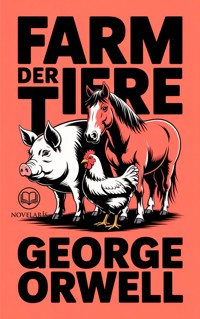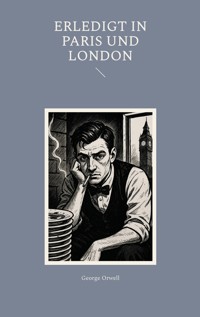
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erledigt in Paris und London gehört zu den fesselndsten frühen Werken von George Orwell. In diesem autobiografischen Bericht taucht der Leser in die verborgenen Schichten zweier berühmter Städte ein und erlebt eine Welt, die nichts mit Glanz oder Romantik zu tun hat. Orwell zeigt das Leben jener Menschen, die im Schatten stehen. Köche, Tellerwäscher, Hausangestellte, Obdachlose und Gelegenheitsarbeiter. Menschen, die hart arbeiten oder ums Überleben kämpfen und dabei kaum wahrgenommen werden. Mit ehrlichem Blick beschreibt Orwell seinen eigenen Absturz in Armut, Hunger und körperliche Erschöpfung. Paris erscheint als rastloser Ort voller Hitze, Lärm und schmutziger Küchen. London dagegen wirkt kalt, grau und durchdrungen von endloser Hoffnungslosigkeit. Doch in beiden Städten entdeckt Orwell die gleiche Wahrheit. Wer unten angekommen ist, kämpft nicht nur gegen Kälte oder Hunger, sondern vor allem gegen eine Gesellschaft, die wegsieht. Dieser Bericht ist schonungslos, bewegend und erstaunlich modern. Orwell zeigt, wie dünn die Linie zwischen Sicherheit und Absturz sein kann und warum eine Gesellschaft daran gemessen wird, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Wenn Sie ein Werk suchen, das gleichzeitig aufrüttelt, berührt und tief in das Herz der sozialen Wirklichkeit blickt, dann ist dieses Buch genau richtig. Tauchen Sie ein in George Orwells eindringliche Welt und entdecken Sie die Wurzeln seines politischen Denkens. Greifen Sie jetzt zu und erleben Sie einen Klassiker, der bis heute nichts von seiner Kraft verloren hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
I
Die Rue du Coq d'Or, Paris, sieben Uhr morgens. Eine Folge von wütenden, erstickten Schreien auf der Straße. Madame Monce, die das kleine Hotel gegenüber dem meinen führte, war auf den Bürgersteig getreten, um mit einem Mieter im dritten Stock zu sprechen. Ihre nackten Füße steckten in Stiefeln und ihr graues Haar hing in Strähnen herab.
Madame Monce:: 'Salope! Salope! Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst keine Käfer auf der Tapete zerquetschen? Glaubst du, du hast das Hotel gekauft, hm? Warum kannst du sie nicht aus dem Fenster werfen wie alle anderen? Pu-tain! Salope!'
Die Frau aus dem dritten Stock: "Vache!
Daraufhin ertönte ein bunter Chor von Schreien, während auf allen Seiten die Fenster aufgerissen wurden und die halbe Straße sich in den Streit einmischte. Zehn Minuten später verstummten sie abrupt, als eine Schwadron Kavallerie vorbeiritt und die Leute aufhörten zu schreien, um sie zu sehen.
Ich skizziere diese Szene, um etwas von der Stimmung in der Rue du Coq d'Or zu vermitteln. Nicht, dass es dort nur Streit gegeben hätte - aber wir haben den Morgen selten ohne mindestens einen Ausbruch dieser Art überstanden. Streitereien und die wüsten Schreie der Straßenhändler, das Geschrei der Kinder, die Orangenschalen über das Kopfsteinpflaster jagen, und nachts lauter Gesang und der saure Gestank der Müllwagen machten die Atmosphäre der Straße aus.
Es war eine sehr schmale Straße - eine Schlucht mit hohen, aussätzigen Häusern, die sich in einer seltsamen Haltung aneinander schmiegten, als wären sie alle im Moment des Einsturzes eingefroren worden. Alle Häuser waren Hotels und bis unter die Dachziegel vollgestopft mit Mietern, meist Polen, Araber und Italiener. Am Fuße der Hotels befanden sich winzige Bistros, in denen man sich für den Gegenwert eines Schillings betrinken konnte. An Samstagabenden war etwa ein Drittel der männlichen Bevölkerung des Viertels betrunken. Es gab Streit um Frauen, und die arabischen Marineinfanteristen, die in den billigsten Hotels wohnten, trugen geheimnisvolle Fehden aus, die sie mit Stühlen und manchmal auch mit Revolvern austrugen. Nachts kamen die Polizisten nur zu zweit durch die Straße. Es war ein ziemlich schäbiger Ort. Und doch lebten inmitten des Lärms und des Schmutzes die üblichen respektablen französischen Ladenbesitzer, Bäcker, Wäscherinnen und dergleichen, die für sich blieben und in aller Ruhe ein kleines Vermögen anhäuften. Es war ein ziemlich repräsentatives Pariser Elendsviertel.
Mein Hotel hieß "Hôtel des Trois Moineaux". Es war ein dunkler, klappriger Bau mit fünf Stockwerken, der durch hölzerne Trennwände in vierzig Zimmer unterteilt war. Die Zimmer waren klein und unendlich schmutzig, denn es gab kein Zimmermädchen, und Madame F., die Patronin, hatte keine Zeit zum Fegen. Die Wände waren dünn wie Streichhölzer, und um die Risse zu verbergen, hatte man sie mit einer Schicht rosa Papier überzogen, die sich gelöst hatte und unzählige Wanzen beherbergte. In der Nähe der Decke marschierten den ganzen Tag über lange Reihen von Wanzen wie Soldatenkolonnen, und nachts kamen sie hungrig herunter, so dass man alle paar Stunden aufstehen und sie in Hakenkästen töten musste. Manchmal, wenn die Wanzen zu schlimm wurden, verbrannte man Schwefel und trieb sie in das Zimmer nebenan, woraufhin der Untermieter nebenan sich revanchierte, indem er sein Zimmer schwefeln ließ, und die Wanzen zurücktrieb. Es war ein schmutziger Ort, aber heimelig, denn Madame F. und ihr Mann waren gute Menschen. Die Miete für die Zimmer schwankte zwischen dreißig und fünfzig Franken pro Woche.
Bei den Untermietern handelte es sich um eine wandernde Bevölkerung, größtenteils Ausländer, die ohne Gepäck auftauchten, eine Woche blieben und dann wieder verschwanden. Sie kamen aus allen möglichen Berufen - Maurer, Steinmetze, Arbeiter, Studenten, Prostituierte, Lumpen-sammler. Einige von ihnen waren ausgesprochen arm. Auf einem der Dachböden wohnte ein bulgarischer Student, der schicke Schuhe für den amerikanischen Markt herstellte. Von sechs bis zwölf saß er auf seinem Bett, fertigte ein Dutzend Paar Schuhe und verdiente fünfunddreißig Francs; den Rest des Tages besuchte er Vorlesungen an der Sor-bonne. Er studierte für die Kirche, und die theologischen Bücher lagen mit dem Gesicht nach unten auf seinem le-derbespannten Fußboden. In einem anderen Zimmer wohnte eine russische Frau mit ihrem Sohn, der sich selbst als Künstler bezeichnete. Die Mutter arbeitete sechzehn Stunden am Tag und stopfte Socken für fünfundzwanzig Centimes pro Socke, während der Sohn, anständig gekleidet, in den Cafés des Montparnasse herumlungerte. Ein Zimmer war an zwei verschiedene Mieter vermietet, der eine ein Tagelöhner, der andere ein Nachtarbeiter. In einem anderen Zimmer teilte sich ein Witwer das Bett mit seinen beiden erwachsenen Töchtern, die beide schwindsüchtig waren.
Im Hotel gab es exzentrische Gestalten. Die Pariser Slums sind ein Treffpunkt für exzentrische Menschen - Menschen, die in einsame, halb verrückte Lebensrillen gefallen sind und den Versuch aufgegeben haben, normal oder anständig zu sein. Die Armut befreit sie von normalen Verhaltensweisen, so wie das Geld die Menschen von der Arbeit befreit. Einige der Untermieter in unserem Hotel führten ein Leben, das unbeschreiblich kurios war.
Da waren zum Beispiel die Rougiers, ein altes, zerlumptes, zwergenhaftes Ehepaar, das einen außergewöhnlichen Beruf ausübte. Sie verkauften Postkarten auf dem Boulevard St. Michel. Das Kuriose daran war, dass die Postkarten in versiegelten Paketen als pornografisch verkauft wurden, in Wirklichkeit aber Fotos von Schlössern an der Loire waren; die Käufer entdeckten das erst zu spät und beschwerten sich natürlich nie. Die Rougiers verdienten etwa hundert Franken in der Woche und schafften es durch strenge Sparsamkeit, immer halb verhungert und halb betrunken zu sein. Der Dreck in ihrem Zimmer war so groß, dass man ihn auf dem Boden darunter riechen konnte. Nach Angaben von Madame F. hatte sich keiner der Rougiers vier Jahre lang ausgezogen.
Oder da war Henri, der in der Kanalisation arbeitete. Er war ein großer, melancholischer Mann mit lockigem Haar, der in seinen langen Kanalarbeiter-Stiefeln eher romantisch aussah. Henris Besonderheit war, dass er nicht sprach, außer für die Arbeit, und das buchstäblich tagelang. Noch ein Jahr zuvor war er ein gut bezahlter Chauffeur gewesen, der Geld sparte. Eines Tages verliebte er sich, und als das Mädchen ihn zurückwies, verlor er die Beherrschung und trat sie. Daraufhin verliebte sich das Mädchen unsterblich in Henri, und vierzehn Tage lang lebten sie zusammen und gaben tausend Franken von Henris Geld aus. Dann wurde das Mädchen untreu; Henri rammte ihr ein Messer in den Oberarm und wurde für sechs Monate ins Gefängnis gesteckt. Nach der Messerstecherei verliebte sich das Mädchen mehr denn je in Henri, und die beiden legten ihren Streit bei und vereinbarten, dass Henri, sobald er aus dem Gefängnis käme, ein Taxi kaufen sollte, und dass sie heiraten und sich niederlassen würden. Aber vierzehn Tage später wurde das Mädchen wieder untreu, und als Henri erfuhr, dass sie schwanger war, stach er sie nicht noch einmal. Er hob sein gesamtes Erspartes ab und begab sich auf eine Sauftour, die mit einer weiteren einmonatigen Haftstrafe endete; danach ging er in der Kanalisation arbeiten. Nichts würde Henri zum Reden bringen. Wenn man ihn fragte, warum er in der Kanalisation arbeitete, antwortete er nicht, sondern kreuzte einfach seine Handgelenke, um Handschellen anzudeuten, und schüttelte den Kopf in Richtung Gefängnis. Das Pech schien ihn an einem einzigen Tag zu einem Halbidioten gemacht zu haben.
Oder da war R., ein Engländer, der sechs Monate des Jahres in Putney bei seinen Eltern und sechs Monate in Frankreich lebte. Während seiner Zeit in Frankreich trank er vier Liter Wein am Tag und sechs Liter an Samstagen; er war einmal bis zu den Azoren gereist, weil der Wein dort billiger ist als überall in Europa. Er war ein sanftes, häusliches Wesen, nie unruhig oder streitsüchtig und nie nüchtern. Bis zum Mittag lag er im Bett, und von da an bis Mitternacht saß er in seiner Ecke des Bistros und badete ruhig und methodisch. Während er einnässte, sprach er mit feiner, weiblicher Stimme über antike Möbel. Außer mir war R. der einzige Engländer in diesem Viertel.
Es gab viele andere Menschen, die ein ebenso exzentrisches Leben führten wie diese: Monsieur Jules, der Rumäne, der ein Glasauge hatte und es nicht zugeben wollte, Furex, der Steinmetz aus dem Limousin, Roucolle, der Geizhals - er starb vor meiner Zeit -, der alte Laurent, der Lumpen-sammler, der seine Unterschrift von einem Zettel in seiner Tasche abzuschreiben pflegte. Es würde Spaß machen, einige ihrer Biographien zu schreiben, wenn man die Zeit dazu hätte. Ich versuche, die Menschen in unserem Viertel zu beschreiben, nicht aus reiner Neugierde, sondern weil sie alle Teil der Geschichte sind. Ich schreibe über die Armut, und in diesem Slum hatte ich meinen ersten Kontakt mit ihr. Der Slum mit seinem Dreck und seinem seltsamen Leben war zunächst ein Lehrstück in Sachen Armut und dann der Hintergrund für meine eigenen Erfahrungen. Aus diesem Grund versuche ich, eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie das Leben dort war.
II
Leben im Quartier. Unser Bistro, zum Beispiel, am Fuße des Hôtel des Trois Moineaux. Ein winziger Raum mit Backsteinboden, halb unter der Erde, mit weinverschmierten Tischen und einem Foto von einer Beerdigung mit der Aufschrift "Crédit est mort"; und rotgekleidete Arbeiter, die mit großen Klappmessern Wurst schnitzen; und Madame F., und Madame F., eine prächtige Bäuerin aus Auvergnat mit dem Gesicht einer willensstarken Kuh, die den ganzen Tag Malaga "für den Magen" trank; und Würfelspiele als Aperitifs; und Lieder über "Les Fraises et Les Framboises" und über Madelon, die sagte: "Comment épouser un soldat, moi qui aime tout le régiment?"; und außerordentlich öffentliches Liebeswerben. Das halbe Hotel hat sich abends im Bistro getroffen. Ich wünschte, man könnte in London einen Pub finden, der auch nur ein Viertel so fröhlich ist.
Man hörte merkwürdige Gespräche im Bistro. Als Beispiel gebe ich Ihnen Charlie, eine der lokalen Kuriositäten, im Gespräch.
Charlie war ein junger Mann mit Familie und Bildung, der von zu Hause weggelaufen war und von gelegentlichen Geldüberweisungen lebte. Stellen Sie ihn sich sehr rosig und jung vor, mit den frischen Wangen und den weichen braunen Haaren eines netten kleinen Jungen, und mit übermäßig roten und feuchten Lippen, wie Kirschen. Seine Füße sind winzig, seine Arme ungewöhnlich kurz, seine Hände haben Grübchen wie die eines Babys. Er hat die Angewohnheit, zu tanzen und zu toben, während er spricht, als wäre er zu glücklich und zu lebendig, um auch nur einen Augenblick stillzuhalten. Es ist drei Uhr nachmittags, und außer Madame F. und ein oder zwei arbeitslosen Männern ist niemand im Bistro, aber Charlie ist es egal, mit wem er spricht, solange er von sich selbst reden kann. Er deklamiert wie ein Redner auf einer Barrikade, rollt die Worte auf der Zunge und gestikuliert mit seinen kurzen Armen. Seine kleinen, etwas schweinischen Augen glitzern vor Begeisterung. Irgendwie ist sein Anblick zutiefst abstoßend.
Er spricht über die Liebe, sein Lieblingsthema.
'Ah, l'amour, l'amour! Ah, que les femmes m'ont tué! Ach, messieurs et dames, die Frauen haben mich ruiniert, über alle Hoffnung hinaus meinen Ruin. Mit zweiundzwanzig bin ich völlig erschöpft und am Ende. Aber was habe ich nicht alles gelernt, welche Abgründe der Weisheit habe ich nicht ausgelotet! Wie großartig ist es, die wahre Weisheit erlangt zu haben, im höchsten Sinne des Wortes ein zivilisierter Mensch geworden zu sein, raffiné, vicieux, etc. etc.
Messieurs et dames, ich sehe, dass Sie traurig sind. Ah, mais la vie est belle - Sie dürfen nicht traurig sein. Seid fröhlicher, ich flehe euch an!
Füllt die Schüssel mit dem Wein aus Samia, damit ihr nicht an Samen wie diese versinkt!
'Ah, que la vie est belle! Hören Sie, messieurs et dames, aus der Fülle meiner Erfahrung heraus werde ich Ihnen von der Liebe erzählen. Ich werde Ihnen erklären, was die wahre Bedeutung der Liebe ist - was die wahre Sensibilität ist, die höhere, raffiniertere Freude, die nur zivilisierten Menschen bekannt ist. Ich werde Ihnen von dem glücklichsten Tag meines Lebens erzählen. Doch leider ist die Zeit vorbei, in der ich ein solches Glück erleben konnte. Es ist für immer vorbei - die Möglichkeit, ja sogar der Wunsch danach, sind verschwunden.
'Dann hör mal zu. Es war vor zwei Jahren; mein Bruder war in Paris - er ist Anwalt - und meine Eltern hatten ihm aufgetragen, mich zu suchen und zum Essen auszuführen. Wir hassen uns, mein Bruder und ich, aber wir zogen es vor, meinen Eltern nicht ungehorsam zu sein. Wir aßen zu Abend, und beim Essen wurde er von drei Flaschen Bordeaux sehr betrunken. Ich brachte ihn zurück ins Hotel und kaufte unterwegs eine Flasche Brandy, und als wir dort ankamen, zwang ich meinen Bruder, einen Becher voll davon zu trinken - ich sagte ihm, es sei etwas, das ihn nüchtern machen würde. Er trank es, und sofort fiel er um wie jemand, der einen Anfall hat, sturzbetrunken. Ich hob ihn auf und stützte ihn mit dem Rücken gegen das Bett; dann durchsuchte ich seine Taschen. Ich fand elfhundert Franken, und damit eilte ich die Treppe hinunter, sprang in ein Taxi und floh. Mein Bruder kannte meine Adresse nicht - ich war in Sicherheit.
Wohin geht ein Mann, wenn er Geld hat? Natürlich in die Bordelle. Aber Sie nehmen doch nicht an, dass ich meine Zeit mit einer vulgären Ausschweifung vergeuden wollte, die nur für Landstreicher geeignet ist? Verflixt, man ist doch ein zivilisierter Mensch! Ich war anspruchsvoll, exi-geant, verstehen Sie, mit tausend Franken in der Tasche. Es war Mitternacht, als ich fand, was ich suchte. Ich hatte mich mit einem sehr eleganten Achtzehnjährigen getroffen, im Smoking und mit einem Haarschnitt à l'américaine, und wir unterhielten uns in einem ruhigen Bistro abseits der Boulevards. Wir verstanden uns gut, dieser Junge und ich. Wir sprachen über dieses und jenes und darüber, wie man sich ablenken kann. Irgendwann nahmen wir gemeinsam ein Taxi und ließen uns wegfahren.
Das Taxi hielt in einer engen, einsamen Straße, an deren Ende eine einzige Gaslaterne flackerte. Zwischen den Steinen befanden sich dunkle Pfützen. An einer Seite verlief die hohe, leere Mauer eines Klosters. Mein Führer führte mich zu einem hohen, ruinösen Haus mit vergitterten Fenstern und klopfte mehrmals an die Tür. Plötzlich hörte ich Schritte und das Schießen von Riegeln, und die Tür öffnete sich einen Spalt. Es war eine große, krumme Hand, die sich mit der Handfläche nach oben unter unsere Nase hielt und Geld forderte.
Mein Führer stellte seinen Fuß zwischen die Tür und die Stufe. "Wie viel wollen Sie?", fragte er.
"Tausend Franken", sagte eine Frauenstimme. "Bezahlen Sie sofort, oder Sie kommen nicht rein."
Ich drückte ihm tausend Francs in die Hand und gab die restlichen hundert meinem Führer, der mir eine gute Nacht wünschte und mich verließ. Ich hörte die Stimme drinnen, die die Scheine zählte, und dann streckte eine dünne alte Krähe von Frau in einem schwarzen Kleid ihre Nase heraus und betrachtete mich misstrauisch, bevor sie mich einließ. Drinnen war es sehr dunkel: Ich konnte nichts sehen außer einem flackernden Gasstrahl, der einen Fleck an der verputzten Wand beleuchtete und alles andere in tiefere Schatten warf. Es roch nach Ratten und Staub. Ohne ein Wort zu sagen, zündete die alte Frau eine Kerze an der Gasdüse an und humpelte dann vor mir einen steinernen Gang hinunter bis zum oberen Ende einer Steintreppe.
"Voilà", sagte sie, "geh in den Keller und mach, was du willst. Ich werde nichts sehen, nichts hören, nichts wissen. Du bist frei, verstehst du - vollkommen frei."
Ha, messieurs, muss ich Ihnen - cément, Sie wissen es selbst - diesen Schauer beschreiben, der einen in diesen Momenten halb vor Schrecken und halb vor Freude durchläuft? Ich kroch hinunter und tastete mich vor; ich hörte meinen Atem und das Scharren meiner Schuhe auf den Steinen, ansonsten war alles still. Am Fuß der Treppe stieß meine Hand auf einen elektrischen Schalter. Ich drehte ihn um, und ein großer Elektrolyt aus zwölf roten Kugeln erhellte den Keller mit einem roten Licht. Und siehe da, ich befand mich nicht in einem Keller, sondern in einem Schlafzimmer, einem großen, reichen, grellen Schlafzimmer, das von oben bis unten blutrot gefärbt war. Stellen Sie es sich vor, meine Herren und Damen! Roter Teppich auf dem Boden, rotes Papier an den Wänden, roter Plüsch auf den Stühlen, sogar die Decke war rot, überall rot und brannte in den Augen. Es war ein schweres, erdrückendes Rot, als ob das Licht durch Schalen mit Blut schimmerte. Am anderen Ende stand ein riesiges, quadratisches Bett, dessen Bettdecken ebenso rot waren wie die anderen, und darauf lag ein Mädchen, das ein Kleid aus rotem Samt trug. Bei meinem Anblick wich sie zurück und versuchte, ihre Knie unter dem kurzen Kleid zu verstecken.
Ich war an der Tür stehen geblieben. "Komm her, mein Huhn", rief ich ihr zu.
Sie gab ein Wimmern vor Schreck von sich. Mit einem Ruck war ich neben dem Bett; sie versuchte, sich mir zu entziehen, aber ich packte sie an der Kehle, so wie hier, siehst du? Sie wehrte sich, sie begann um Gnade zu schreien, aber ich hielt sie fest, drückte ihren Kopf zurück und starrte ihr ins Gesicht. Sie war vielleicht zwanzig Jahre alt; ihr Gesicht war das breite, stumpfe Gesicht eines dummen Kindes, aber es war mit Farbe und Puder überzogen, und ihre blauen, dummen Augen, die im roten Licht glänzten, trugen jenen schockierten, verzerrten Blick, den man nirgendwo anders als in den Augen dieser Frauen sieht. Sie war zweifellos ein Bauernmädchen, das von seinen Eltern in die Sklaverei verkauft worden war.
Ohne ein weiteres Wort zog ich sie vom Bett und warf sie auf den Boden. Und dann fiel ich über sie her wie ein Tiger! Ah, die Freude, die unvergleichliche Verzückung von damals! Das, messieurs et dames, ist es, was ich Ihnen erklären möchte: Voilà l'amour! Da ist die wahre Liebe, da ist das Einzige in der Welt, das es wert ist, angestrebt zu werden; da ist das, neben dem alle Ihre Künste und Ideale, alle Ihre Philosophien und Glaubensbekenntnisse, alle Ihre schönen Worte und hohen Haltungen so blass und nutzlos wie Asche sind. Wenn man die Liebe - die wahre Liebe - erfahren hat, was gibt es dann noch in der Welt, das mehr als ein bloßes Gespenst der Freude zu sein scheint?
Immer wilder griff ich sie an. Immer wieder versuchte das Mädchen zu fliehen; sie schrie erneut um Gnade, aber ich lachte sie aus.
"Barmherzigkeit!" Ich sagte: "Glauben Sie, ich bin hierher gekommen, um Barmherzigkeit zu zeigen? Glauben Sie, dass ich dafür tausend Francs bezahlt habe?" Ich schwöre Ihnen, messieurs et dames, wenn es nicht dieses verfluchte Gesetz gäbe, das uns unserer Freiheit beraubt, hätte ich sie in diesem Augenblick ermordet.
Ah, wie sie schrie, mit welch bitteren Schmerzensschreien. Aber es war niemand da, der sie hören konnte; dort unten unter den Straßen von Paris waren wir so sicher wie im Herzen einer Pyramide. Die Tränen rannen über das Gesicht des Mädchens und wuschen das Pulver in langen, schmutzigen Schlieren weg. Ach, diese unwiederbringliche Zeit! Sie, messieurs et dames, die Sie die feineren Empfindungen der Liebe nicht kultiviert haben, für Sie ist ein solches Vergnügen fast unvorstellbar. Und auch ich, jetzt, da meine Jugend vorbei ist - ach, die Jugend! - werde nie wieder ein so schönes Leben sehen. Es ist zu Ende.
Ach ja, es ist weg - für immer weg. Ach, die Armut, die Kürze, die Enttäuschung der menschlichen Freude! Denn wie lange dauert in Wirklichkeit - car en realité - der höchste Augenblick der Liebe? Es ist nichts, ein Augenblick, eine Sekunde vielleicht. Eine Sekunde der Ekstase, und danach - Staub, Asche, Nichts.
Und so erfasste ich für einen einzigen Augenblick das höchste Glück, das höchste und feinste Gefühl, das ein Mensch erreichen kann. Und im selben Augenblick war es zu Ende, und ich war verlassen - was? Meine ganze Wildheit, meine Leidenschaft waren wie die Blütenblätter einer Rose verstreut. Ich blieb kalt und träge zurück, voller eitlem Bedauern; in meiner Abscheu empfand ich sogar eine Art Mitleid mit dem weinenden Mädchen am Boden. Ist es nicht ekelhaft, dass wir die Beute solch gemeiner Gefühle sind? Ich sah das Mädchen nicht mehr an; mein einziger Gedanke war, wegzukommen. Ich eilte die Stufen des Gewölbes hinauf und hinaus auf die Straße. Es war dunkel und bitterkalt, die Straßen waren leer, die Steine hallten unter meinen Absätzen mit einem hohlen, einsamen Klang wider. Mein ganzes Geld war weg, ich hatte nicht einmal mehr das Geld für ein Taxi. Ich ging allein zurück in mein kaltes, einsames Zimmer.
Aber da, messieurs et dames, das ist es, was ich Ihnen zu erklären versprochen habe. Das ist die Liebe. Das war der glücklichste Tag in meinem Leben.'
Er war ein seltsames Exemplar, Charlie. Ich beschreibe ihn, um zu zeigen, welch unterschiedliche Charaktere sich im Coq d'Or-Viertel tummeln können.
III
Ich lebte etwa eineinhalb Jahre lang im Coq d'Or-Viertel. Eines Tages, im Sommer, stellte ich fest, dass ich nur noch vierhundertfünfzig Francs übrig hatte, und darüber hinaus nichts als sechsunddreißig Francs pro Woche, die ich mit Englischunterricht verdiente. Bis dahin hatte ich mir noch keine Gedanken über die Zukunft gemacht, aber jetzt wurde mir klar, dass ich sofort etwas tun musste. Ich beschloss, mir eine Arbeit zu suchen, und - sehr zum Glück, wie sich herausstellte - zahlte ich vorsichtshalber zweihundert Franken für eine Monatsmiete im Voraus. Mit den anderen zweihundertfünfzig Franken, abgesehen von den Englischstunden, konnte ich einen Monat leben, und in einem Monat sollte ich wahrscheinlich Arbeit finden. Mein Ziel war es, Fremdenführer bei einer der Tourismusgesell-schaften zu werden, oder vielleicht auch Dolmetscher. Doch ein Unglücksfall verhinderte dies.
Eines Tages tauchte im Hotel ein junger Italiener auf, der sich als Setzer bezeichnete. Er war eine ziemlich zweideutige Person, denn er trug einen Backenbart, der entweder ein Zeichen für einen Apachen oder einen Intellektuellen ist, und niemand war sich sicher, in welche Kategorie man ihn einordnen sollte. Madame F. mochte sein Aussehen nicht und verlangte von ihm eine Woche Miete im Voraus. Der Italiener zahlte die Miete und blieb sechs Nächte in dem Hotel. In dieser Zeit gelang es ihm, einige Nachschlüssel anzufertigen, und in der letzten Nacht raubte er ein Dutzend Zimmer aus, darunter auch meines. Glücklicherweise fand er das Geld in meinen Taschen nicht, so dass ich nicht mittellos dastand. Mir blieben nur siebenundvierzig Francs, das sind sieben und zehn Pence.
Damit waren meine Pläne, mir eine Arbeit zu suchen, hinfällig. Ich lebte nun von etwa sechs Franken pro Tag, und von Anfang an war es zu schwierig, an etwas anderes zu denken. Jetzt begann meine Erfahrung mit der Armut, denn sechs Francs pro Tag sind, wenn nicht wirkliche Armut, so doch am Rande davon. Sechs Francs sind ein Schilling, und man kann in Paris von einem Schilling am Tag leben, wenn man weiß, wie. Aber es ist eine komplizierte Angelegenheit.
Es ist schon merkwürdig, dass Sie zum ersten Mal mit Armut in Berührung kommen. Sie haben so viel über Armut nachgedacht - es ist das, was Sie Ihr ganzes Leben lang gefürchtet haben, das, wovor Sie wussten, dass es Sie früher oder später treffen würde; und es ist alles so völlig und prosaisch anders. Sie dachten, es wäre ganz einfach; es ist außerordentlich kompliziert. Du dachtest, es würde schrecklich sein; es ist nur schmutzig und langweilig. Es ist die eigentümliche Niedrigkeit der Armut, die du als erstes entdeckst; die Schichten, die sie dir auferlegt, die komplizierte Gemeinheit, das Abwischen der Kruste.
Sie entdecken zum Beispiel das Geheimnis, das mit der Armut verbunden ist. Mit einem Schlag sind Sie auf ein Einkommen von sechs Franken pro Tag reduziert worden. Aber natürlich wagt man nicht, es zuzugeben - man muss so tun, als ob man ganz normal leben würde. Von Anfang an verstrickt man sich in ein Netz von Lügen, und selbst mit den Lügen schafft man es kaum. Du schickst keine Wäsche mehr in die Wäscherei, und die Wäscherin ertappt dich auf der Straße und fragt dich nach dem Grund; du murmelst etwas, und sie denkt, du schickst die Wäsche woanders hin, und ist dein Feind fürs Leben. Der Trafikant fragt dich immer wieder, warum du nicht mehr rauchst. Es gibt Briefe, die Sie beantworten wollen, aber nicht können, weil die Briefmarken zu teuer sind. Und dann sind da noch Ihre Mahlzeiten - die Mahlzeiten sind die größte Schwierigkeit von allen. Jeden Tag gehen Sie zu den Mahlzeiten aus, vorgeblich in ein Restaurant, und verweilen eine Stunde im Jardin du Luxembourg, um die Tauben zu beobachten. Danach schmuggeln Sie Ihr Essen in Ihren Taschen nach Hause. Ihr Essen besteht aus Brot und Margarine oder aus Brot und Wein, und sogar die Art des Essens wird von Lügen bestimmt. Du musst Roggenbrot statt Haushaltsbrot kaufen, denn die Roggenbrote sind zwar teurer, aber rund und können in den Taschen geschmuggelt werden. Das kostet dich einen Franken pro Tag. Manchmal muss man, um den Schein zu wahren, sechzig Rappen für ein Getränk ausgeben und hat dementsprechend wenig zu essen. Die Wäsche wird schmutzig, die Seife und die Rasierklingen gehen zur Neige. Deine Haare wollen geschnitten werden, und du versuchst, sie selbst zu schneiden, mit einem so schrecklichen Ergebnis, dass du schließlich doch zum Friseur gehen musst und den Gegenwert eines Tagesessens ausgibst. Den ganzen Tag erzählen Sie Lügen, und zwar teure Lügen.
Sie stellen fest, dass Ihre sechs Francs pro Tag äußerst prekär sind. Fiese Unglücke passieren und rauben Ihnen die Nahrung. Du hast deine letzten achtzig Rappen für einen halben Liter Milch ausgegeben und kochst sie über der Spi-rituslampe. Während sie kocht, rinnt dir ein Käfer über den Unterarm; du schnippst ihn mit dem Fingernagel, und er fällt, plopp! direkt in die Milch. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Milch wegzuwerfen und ohne Nahrung zu bleiben.
Sie gehen zum Bäcker, um ein Pfund Brot zu kaufen, und warten, während die Verkäuferin ein Pfund für einen anderen Kunden schneidet. Sie ist ungeschickt und schneidet mehr als ein Pfund ab. Pardon, Monsieur", sagt sie, "ich nehme an, es macht Ihnen nichts aus, zwei Sous mehr zu bezahlen? Das Brot kostet einen Franc pro Pfund, und Sie haben genau einen Franc. Wenn du daran denkst, dass auch du zwei Sous zu viel zahlen sollst und dann zugeben müsstest, dass du das nicht kannst, flüchtest du in Panik. Es dauert Stunden, bis Sie sich wieder in eine Bäckerei trauen.
Sie gehen in den Gemüseladen, um einen Franken für ein Kilogramm Kartoffeln auszugeben. Aber eines der Stücke, aus denen sich der Franken zusammensetzt, ist ein belgisches Stück, und der Verkäufer verweigert es. Du schleichst dich aus dem Laden und kannst ihn nie wieder betreten.
Sie haben sich in ein angesehenes Viertel verirrt und sehen einen wohlhabenden Freund kommen. Um ihm aus dem Weg zu gehen, flüchten Sie in das nächstgelegene Café. Im Café angekommen, müssen Sie etwas kaufen und geben Ihre letzten fünfzig Centimes für ein Glas schwarzen Kaffee mit einer toten Fliege darin aus. Man könnte diese Katastrophen mit hundert multiplizieren. Sie sind Teil des Prozesses, in dem man sich befindet.
Sie entdecken, wie es ist, hungrig zu sein. Mit Brot und Margarine im Bauch gehst du hinaus und schaust in die Schaufenster. Überall beleidigen dich Lebensmittel in riesigen, verschwenderischen Haufen: ganze tote Schweine, Körbe mit warmen Broten, große gelbe Butterblöcke, Wurstket-ten, Berge von Kartoffeln, riesige Gruyère-Käse wie Schleifsteine. Ein wehleidiges Selbstmitleid überkommt dich bei dem Anblick von so viel Essen. Du willst dir ein Brot schnappen und losrennen, um es zu verschlingen, bevor sie dich erwischen, aber du unterlässt es aus lauter Scham.
Du entdeckst die Langeweile, die untrennbar mit der Armut verbunden ist; die Zeiten, in denen du nichts zu tun hast und dich, da du unterernährt bist, für nichts interessieren kannst. Einen halben Tag lang liegt man auf seinem Bett und fühlt sich wie die jeune squelette in Baudelaires Gedicht. Nur das Essen kann Sie aufwecken. Sie stellen fest, dass ein Mann, der sich eine Woche lang nur von Brot und Margarine ernährt hat, kein Mann mehr ist, sondern nur noch ein Bauch mit ein paar zusätzlichen Organen.
Das - man könnte es noch weiter beschreiben, aber es ist alles im gleichen Stil - ist das Leben mit sechs Francs pro Tag. Tausende von Menschen in Paris leben so - Künstler und Studenten, die sich abmühen, Prostituierte, wenn sie Pech haben, Arbeitslose aller Art. Es ist gewissermaßen die Vorstadt der Armut.
Etwa drei Wochen lang machte ich so weiter. Die siebenundvierzig Franken waren bald weg, und ich musste mit sechsunddreißig Franken pro Woche aus dem Englischunterricht auskommen. Da ich unerfahren war, ging ich schlecht mit dem Geld um, und manchmal war ich einen Tag ohne Essen. In solchen Fällen verkaufte ich ein paar meiner Kleider, indem ich sie in kleinen Paketen aus dem Hotel schmuggelte und zu einem Secondhand-Laden in der Rue de la Montagne St. Geneviève brachte. Der Verkäufer war ein rothaariger Jude, ein außerordentlich unangenehmer Mann, der beim Anblick eines Kunden in Wut auszubrechen pflegte. Seinem Benehmen nach hätte man annehmen können, dass wir ihm etwas angetan hatten, als wir zu ihm kamen. Merde!", rief er, "Sie schon wieder hier? Was glaubt ihr, was das hier ist? Eine Suppenküche?' Und er zahlte unglaublich niedrige Preise. Für einen Hut, den ich für fünfundzwanzig Schilling gekauft hatte und der kaum getragen wurde, gab er fünf Francs; für ein gutes Paar Schuhe fünf Francs; für Hemden je einen Francs. Er zog es immer vor, zu tauschen, anstatt zu kaufen, und er hatte einen Trick, um einem irgendeinen nutzlosen Gegenstand in die Hand zu drücken und dann so zu tun, als ob man ihn angenommen hätte. Einmal sah ich, wie er einer alten Frau einen guten Mantel abnahm, ihr zwei weiße Billardkugeln in die Hand drückte und sie dann schnell aus dem Laden schob, bevor sie protestieren konnte. Es wäre ein Vergnügen gewesen, dem Juden die Nase zu plätten, wenn man es sich nur hätte leisten können.
Diese drei Wochen waren schmutzig und ungemütlich, und es sollte noch schlimmer kommen, denn meine Miete würde bald fällig sein. Trotzdem war es nicht ein Viertel so schlimm, wie ich erwartet hatte. Denn wenn man sich der Armut nähert, macht man eine Entdeckung, die einige der anderen aufwiegt. Man macht die Entdeckung, dass man sich langweilt, dass es Komplikationen gibt und dass man zu hungern beginnt, aber man macht auch die Entdeckung, dass die Armut eine große Erlösung ist: dass sie die Zukunft vernichtet. Innerhalb gewisser Grenzen gilt tatsächlich: Je weniger Geld man hat, desto weniger Sorgen hat man. Wenn man hundert Franken hat, ist man zu den verrück-testen Paniken fähig. Wenn du nur drei Franken hast, ist dir das völlig gleichgültig; denn drei Franken ernähren dich bis morgen, und darüber hinaus kannst du nicht denken. Man langweilt sich, aber man hat keine Angst. Man denkt vage: "In ein oder zwei Tagen werde ich verhungern - schockierend, nicht wahr? Und dann schweifen die Gedanken zu anderen Themen ab. Eine Diät mit Brot und Margarine ist in gewissem Maße ein eigenes Beruhigungsmittel.
Und es gibt noch ein anderes Gefühl, das ein großer Trost in der Armut ist. Ich glaube, jeder, der schon einmal in Not war, hat es erlebt. Es ist ein Gefühl der Erleichterung, fast der Freude, wenn man weiß, dass man endlich wirklich am Ende ist. Sie haben so oft davon gesprochen, vor die Hunde zu gehen - und nun, hier sind die Hunde, und Sie haben sie erreicht, und Sie können es aushalten. Das nimmt einem eine Menge Angst.
IV
Eines Tages hörte mein Englischunterricht abrupt auf. Das Wetter wurde heiß, und einer meiner Schüler, der sich zu faul fühlte, mit dem Unterricht fortzufahren, entließ mich. Der andere verschwand ohne Vorankündigung aus seiner Wohnung und blieb mir zwölf Francs schuldig. Ich hatte nur noch dreißig Centimes und keinen Tabak mehr. Anderthalb Tage lang hatte ich nichts zu essen oder zu rauchen, und dann packte ich, zu hungrig, um es noch länger hinauszuzögern, meine restlichen Kleider in meinen Koffer und brachte sie zum Pfandhaus. Damit war es vorbei mit dem Schein, Geld zu haben, denn ich konnte meine Kleider nicht aus dem Hotel mitnehmen, ohne Madame F. um Erlaubnis zu fragen. Ich erinnere mich jedoch daran, wie überrascht sie war, dass ich sie darum gebeten hatte, anstatt die Kleider heimlich zu entfernen, denn in unserem Viertel war es üblich, auf den Mond zu schießen.
Es war das erste Mal, dass ich in einem französischen Pfandhaus war. Man ging durch ein großes steinernes Portal (natürlich mit der Aufschrift "Liberté, Egalité, Fraternité" - das steht in Frankreich sogar über den Polizeistationen) in einen großen, kahlen Raum, der wie ein Klassenzimmer aussah, mit einem Tresen und Reihen von Bänken. Vierzig oder fünfzig Leute warteten. Man reichte sein Pfand über den Tresen und setzte sich hin. Als der Beamte den Wert des Pfandes festgestellt hatte, rief er: "Numéro so und so, nehmen Sie fünfzig Francs?" Manchmal waren es nur fünfzehn Francs, oder zehn, oder fünf - was auch immer es war, der ganze Raum wusste es. Als ich hereinkam, rief der Angestellte beleidigt: "Numéro 83 - hier!" und gab einen kleinen Pfiff und ein Winken von sich, als würde er einen Hund rufen. Numéro 83 trat an den Schalter, ein alter, bärtiger Mann mit einem bis zum Hals zugeknöpften Mantel und ausgefransten Hosenbeinen. Ohne ein Wort schoss der Angestellte das Bündel über den Tresen - offensichtlich war es nichts wert. Es fiel auf den Boden, wurde geöffnet und enthielt vier Paar Herrenhosen aus Wolle. Keiner konnte sich das Lachen verkneifen. Die arme Numéro 83 raffte ihre Hosen zusammen und schlurfte, vor sich hin murmelnd, hinaus.
Die Kleider, die ich zusammen mit dem Koffer verpfändete, hatten über zwanzig Pfund gekostet und waren in gutem Zustand. Ich dachte, sie müssten zehn Pfund wert sein, und ein Viertel davon (man rechnet in einem Pfandhaus mit einem Viertel des Wertes) waren zweihundertfünfzig oder dreihundert Franken. Ich wartete unbesorgt und erwartete schlimmstenfalls zweihundert Franken.
Schließlich rief der Beamte meine Nummer auf: "Numéro 97!
Ja", sagte ich und stand auf.
Siebzig Franken?
Siebzig Franken für Kleider im Wert von zehn Pfund! Aber es hatte keinen Sinn, sich zu streiten; ich hatte gesehen, wie jemand anderes es versuchte, und der Angestellte hatte das Pfand sofort abgelehnt. Ich nahm das Geld und den Pfand-schein und ging hinaus. Ich hatte nun keine Kleidung mehr, außer dem, in dem ich aufgestanden war - der Mantel war am Ellbogen ausgeleiert -, einen Mantel, der einigermaßen verpfändbar war, und ein Ersatzhemd. Später, als es zu spät war, erfuhr ich, dass es klüger war, am Nachmittag in ein Pfandhaus zu gehen. Die Angestellten sind Franzosen, und wie die meisten Franzosen sind sie schlecht gelaunt, bis sie ihr Mittagessen gegessen haben.
Als ich nach Hause kam, fegte Madame F. gerade den Boden des Bistros. Sie kam mir die Treppe hinauf entgegen. Ich konnte in ihren Augen sehen, dass sie wegen meiner Miete beunruhigt war.
"Nun", sagte sie, "was hast du für deine Kleidung bekommen? Nicht viel, was?
Zweihundert Franken", sagte ich prompt.
Tiens", sagte sie überrascht, "das ist doch nicht schlecht. Wie teuer müssen diese englischen Kleider sein!
Die Lüge ersparte mir eine Menge Ärger, und seltsamerweise wurde sie wahr. Einige Tage später erhielt ich genau zweihundert Franken, die mir für einen Zeitungsartikel zustanden, und obwohl es weh tat, zahlte ich sofort jeden Pfennig davon in Miete. Obwohl ich in den folgenden Wochen fast verhungert wäre, war ich fast nie ohne Dach über dem Kopf.
Jetzt musste ich unbedingt Arbeit finden, und ich erinnerte mich an einen Freund von mir, einen russischen Kellner namens Boris, der mir vielleicht helfen konnte. Ich hatte ihn zum ersten Mal in der öffentlichen Abteilung eines Krankenhauses getroffen, wo er wegen Arthritis im linken Bein behandelt wurde. Er hatte mir gesagt, ich solle zu ihm kommen, wenn ich jemals in Schwierigkeiten sei.
Ich muss etwas über Boris sagen, denn er war eine seltsame Persönlichkeit und lange Zeit mein enger Freund. Er war ein großer, soldatischer Mann von etwa fünfunddreißig Jahren und sah gut aus, aber seit seiner Krankheit war er durch das Liegen im Bett ungeheuer dick geworden. Wie die meisten russischen Flüchtlinge hatte auch er ein abenteuerliches Leben hinter sich. Seine Eltern, die in der Revolution gefallen waren, waren reiche Leute gewesen, und er hatte während des Krieges im Zweiten Sibirischen Schüt-zenkorps gedient, das seiner Meinung nach das beste Regiment der russischen Armee war. Nach dem Krieg hatte er zunächst in einer Bürstenfabrik gearbeitet, dann als Portier in Les Halles, war dann Tellerwäscher geworden und hatte sich schließlich zum Kellner hochgearbeitet. Als er krank wurde, arbeitete er im Hôtel Scribe und kassierte hundert Francs Trinkgeld pro Tag. Sein Ziel war es, Maître d'hôtel zu werden, fünfzigtausend Franken zu sparen und ein kleines, feines Restaurant am rechten Ufer zu eröffnen.
Boris sprach immer vom Krieg als der glücklichsten Zeit seines Lebens. Krieg und Soldatentum waren seine Leidenschaft; er hatte unzählige Bücher über Strategie und Militärgeschichte gelesen und konnte Ihnen alles über die Theorien von Napoleon, Kutusof, Clausewitz, Moltke und Foch erzählen. Alles, was mit Soldaten zu tun hatte, gefiel ihm. Sein Lieblingscafé war die Gloserie des Lilas in Mon-tparnasse, einfach weil dort die Statue von Marschall Ney steht. Später gingen Boris und ich manchmal zusammen in die Rue du Commerce. Wenn wir mit der Métro fuhren, stieg Boris immer an der Station Cambronne statt Com-merce aus, obwohl Commerce näher lag; er mochte die Assoziation mit General Cambronne, der bei Waterloo zur Kapitulation aufgefordert wurde und einfach "Merde!" antwortete.
Das Einzige, was Boris von der Revolution geblieben war, waren seine Medaillen und einige Fotos seines alten Regiments, die er aufbewahrt hatte, als alles andere in die Pfandleihe ging. Fast jeden Tag breitete er die Fotos auf dem Bett aus und sprach über sie:
Voilà, mon ami. Da sehen Sie mich an der Spitze meines Unternehmens. Feine große Männer, was? Nicht wie diese kleinen Ratten von Franzosen. Ein Hauptmann mit zwanzig - nicht schlecht, was? Ja, Hauptmann bei den Zweiten Sibirischen Schützen, und mein Vater war Oberst.
Ah, mais, mon ami, die Höhen und Tiefen des Lebens! Ein Hauptmann in der russischen Armee, und dann, piff! die Revolution - jeder Pfennig weg. 1916 war ich eine Woche im Hôtel Édouard Sept; 1920 habe ich mich dort um eine Stelle als Nachtwächter beworben. Ich war Nachtwächter, Kellner, Bodenschrubber, Tellerwäscher, Portier, Toilet-tenwärter. Ich habe Kellnern Trinkgeld gegeben, und ich habe von Kellnern Trinkgeld bekommen.
Aber ich habe erfahren, was es heißt, wie ein Gentleman zu leben, mon ami. Ich sage das nicht, um mich zu rühmen, aber neulich habe ich versucht auszurechnen, wie viele Mätres-sen ich in meinem Leben gehabt habe, und ich kam auf über zweihundert. Ja, mindestens zweihundert... Ah, nun, ça reviendra. Der Sieg gehört dem, der am längsten kämpft. Nur Mut!" usw. usw.
Boris hatte ein seltsames, wechselhaftes Wesen. Er wünschte sich immer zurück in die Armee, aber er war auch lange genug Kellner gewesen, um sich die Einstellung eines Kellners anzueignen. Obwohl er nie mehr als ein paar Tausend Franken gespart hatte, hielt er es für selbstverständlich, dass er eines Tages sein eigenes Restaurant eröffnen und reich werden würde. Alle Kellner, so stellte ich später fest, reden und denken daran; es ist das, was sie mit dem Kellnern versöhnt. Boris pflegte auf interessante Weise über das Hotelleben zu sprechen:
Kellnern ist ein Glücksspiel", pflegte er zu sagen, "du kannst arm sterben, du kannst in einem Jahr ein Vermögen machen. Du bekommst keinen Lohn, sondern bist auf Trinkgeld angewiesen - zehn Prozent der Rechnung und eine Provision von den Weinfirmen für die Champagnerkorken. Manchmal ist das Trinkgeld enorm. Der Barmann im Maxim's zum Beispiel verdient fünfhundert Franken am Tag. Mehr als fünfhundert, in der Saison... Ich habe selbst schon zweihundert Francs am Tag verdient. Das war in einem Hotel in Biarritz, während der Saison. Das ganze Personal, vom Direktor bis zu den Plongeurs