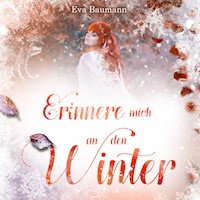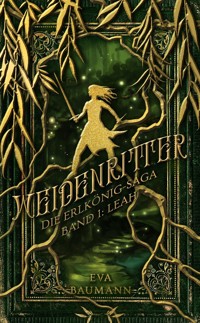4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die "Erlkönig"-Ballade jetzt als Romanreihe (zwei in sich abgeschlossene Bände)! Das Leben eines Kindes für das eines ganzen Volkes? Erlkönig Valentin steht vor einer unlösbaren Wahl: Entführt er den Jungen Jakob, der das Alverreich retten kann, oder wartet er, bis die Geburtsbäume sterben und mit ihnen sein Volk? Seit Monaten kommen keine Menschenkinder mehr ins Alverreich. In der Menschenwelt erzählt man Schauergeschichten über „Elfen“, die Kinder entführen, und Kinder haben zu viel Angst, dem Ruf der alveronischen Spielleute ins Land ihrer Träume zu folgen. Valentin war einst der beste Spielmann des Alverreiches, und wo alle anderen Spielleute versagen, gelingt es ihm, das Kind zu holen. Im Tausch muss er in die Menschenwelt gehen. Dort will er versuchen, Jakobs Familie beizustehen und gleichzeitig ergründen, woher diese unerklärliche Angst vor seinem Volk kommt. Er landet in einer Welt, in der alles von seiner Herkunft bis zu seiner Musik verhasst und gefürchtet ist. Der Rückweg ins Alverreich ist versperrt, und Jakobs Vater schwört, nicht eher zu ruhen, bis alle Elfen auf dem Scheiterhaufen brennen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Danksagung
Impressum
Über die Autorin
Außerdem von Eva Baumann
Kapitel 1
Als er aus dem Traum hochschreckte, wusste er, dass seine Magie nicht ausreichen würde. All die Macht, die er als Herrscher des Alverreiches besaß, würde nicht genug sein, um denen zu helfen, die ihn um Hilfe anflehten. Er würde sie wieder nicht finden, genauso, wie er all die anderen Traumsuchenden nicht finden konnte.
Valentin rieb sich die Augen. Es dämmerte bereits, und wenn er sich nicht beeilte, würde er zu spät zur Ratssitzung kommen. Er kleidete sich hastig an, flocht sein rotes Haar in einen Zopf und nahm die Krone vom Tisch. Er hielt inne und betrachtete den schmalen, kupfernen Reif mit den eingefassten Saphiren. Prachtvoll. Königlich. Ein Schmuck, den jemand tragen sollte, der mit eiserner Hand die Geschicke eines ganzen Reiches lenkte.
Er seufzte. Das war nicht er. Er war ein Spielmann, dem der Zauber seiner Musik näher am Herzen lag als das Spiel der Politik. Er war der Hüter des Hains, den die Menschenkinder mit herbstbunten Zweigen und gelben Beeren krönten statt mit einem metallenen Reif. Ein Hüter der Kinderseelen, die farbenfroher leuchteten als die Blüten des Frühlings, die Früchte des Sommers, die Blätter des Herbstes. In der Natur war alles eins, alles in Harmonie. In dem von Alveronen geschaffenen Reich störten von Alveronen geschaffene Probleme die Einheit, und Valentin wusste nicht, wo er beginnen sollte, sie zu lösen. Er konnte Leben schaffen und zur Blüte bringen … keine ehernen Strukturen zerschlagen. Er war ein Spielmann, ein Hüter des Hains. Er war kein König.
Er setzte die Krone auf sein Haupt, blickte sich im Spiegel an und bemerkte zufrieden, dass das Kupfer beinahe mit seinem herbstblattfarbenen Haar verschmolz. Er flocht zwei Strähnen und steckte sie an der Krone fest. Die Krone verschwand hinter seinem Haar, und der Erlkönig verschwand hinter Valentin. Mit seiner schlichten Tunika aus blaugrauer Seide, in die zarte Kupferranken eingestickt waren, sah er wieder aus wie ein Spielmann an einem Festtag – oder der Hüter des Hains, wenn eine Geburtenzeremonie anstand und der Garten hohen Besuch erwartete. Er blickte aus dem Fenster. Der Königsbaum war der höchste Baum im Alverreich, und von seiner Wohnung in der Baumkrone aus konnte Valentin am Horizont den Hain der Geburtsbäume sehen. Seinen Hain. Den Garten, der so lange sein Zuhause gewesen war.
Seine Gedanken folgten den Sonnenstrahlen, die die Baumwipfel mit Gold krönten und sich an der eisernen Mauer brachen, die um den Hain gezogen war. Ihn schauderte, als er an das Gefängnis dachte, das Ulmenkönig und Pflaumenkönigin aus seinem Garten gemacht hatten. Das Königspaar war tot, ihre Grausamkeiten besiegt … doch die Mauer ragte weiterhin als Mahnmal empor. Sie erinnerte ihn jeden Morgen daran, warum Leah und er die Wahl des Volkes als neues Königspaar angenommen hatten.
Er löste die Strähnen von der Krone. Das spiegelnde Metall ließ bunte Sonnenpunkte über die Wände tanzen. Kein schweres, schwarzes Eisen, das das Licht schluckte. Kupfer, ein warmer Orangeton, der samtiges Licht verbreitete. Goldene, rote, blaue Punkte. Eine farbenfrohe Zukunft. Und er musste helfen, sie mitaufzubauen. Er nahm die Schultern zurück, durchquerte sein Schlafgemach mit wenigen Schritten und trat hinaus in den Gang. Sein Volk brauchte einen König, und solange Leah auf Reisen war, um ihren Traumsuchenden zu helfen, würde er sein Bestes geben, sie würdig zu vertreten.
Er schüttelte die letzten Anzeichen von Schlaf ab und eilte durch die Gänge. Er stieß die Tür zum Thronsaal auf, überblickte in wenigen Sekunden die anwesenden Ratsmitglieder und wandte sich an den Lindengrafen. »Habt Ihr sie gefunden?«
»Nein, Majestät. Wir finden die Suchenden aus den Träumen der Weidenkönigin, doch Eure Traumsuchenden scheinen nicht zu existieren.«
Er schüttelte den Kopf. Das Versagen durfte sich nicht wiederholen, nicht so oft, nicht bereits zum dritten Mal. »Sucht weiter. Die Frau hat haselnussbraunes, langes Haar. Kastanienrote Augen. Ihre Haut ist von der Farbe des frisch geschnittenen Ahorns.« Was nutzte seinem Volk all die Macht, die er als König dazugewonnen hatte, wenn es ihm nicht gelang, diejenigen zu finden, die ihn im Traum um Hilfe angefleht hatten?
Vielleicht waren es einfach nur Träume. Normale Träume, wie sie jeder Alverone oder Mensch hatte. Sie bedeuteten nichts, oder zumindest nichts Konkretes. Die Suchenden mussten nicht real sein, vielleicht waren es nur Gebilde seiner Fantasie.
Doch warum war es bei seiner Frau anders? Leah träumte auch von Suchenden, genau wie er. Fünfmal war sie im Traum besucht worden, und jedes Mal hatte sie die Traumsuchenden ausfindig machen und ihnen helfen können. Es waren keine bloßen Formen ihres Geistes, sondern Untertanen, die sich in ihrer Not an die Königin wandten. Die Traummagie war neu für sie beide. Sie schien dem Herrscherpaar vorbehalten zu sein, und der Gedanke daran, wie das frühere Königspaar diese Gabe missbraucht hatte, schüttelte ihn. Auch sie hatten die Traumsuchenden gefunden – und sich an ihrer Not geweidet. Valentin und Leah hatten dies geändert, wie sie viele Dinge geändert hatten, seit sie vom Volk zu Erlkönig und Weidenkönigin gewählt wurden.
Er setzte sich auf den Thron. »Schickt noch einmal Boten in die Seelande. Sie sollen nach dem jungen Mann mit den grauen Haaren und einer Haut wie Olivenholz suchen, nach dem Mädchen mit blonden Locken und birkenheller Haut und nach der Frau mit dem haselnussfarbenen Haar und der Ahornhaut.« In allen Teilen des Reiches waren die Boten unterwegs gewesen, in den Siedlungen, den Wäldern, den Lichtungen, sogar in den Eislanden, den Seelanden und am Tor …
Er zuckte zusammen. Das Tor. Man war am Tor gewesen, doch was war mit –
»Lindengraf, wartet.« Er sprang auf und packte den Grafen, der eben den Raum verlassen wollte, am Arm. Der Lindengraf zog seinen Arm zurück und musterte Valentin mit hochgezogenen Augenbrauen. Berührungen waren im Alverreich bei Todesstrafe verboten gewesen, und obwohl der Lindengraf an der Seite der Weidenkönigin für das Stürzen des alten Systems eingestanden hatte, schien er die neue Lebensweise noch nicht verinnerlicht zu haben. »Verzeiht, Graf.« Valentin räusperte sich. »Hört mir zu und beantwortet genau meine Fragen. Das Königspaar vor uns träumte, und im Traum sah es notleidende Bürger unseres Reiches, richtig?«
Der Graf schaute Valentin verwirrt an. »Ja, Ihr habt mich dazu schon mehrfach befragt, Majestät. Was –«
»Nur Bürger unseres Reiches?«, unterbrach Valentin. »Oder auch Menschen?«
»Menschen, Alveronen, … Nach Euren neuen Gesetzen sind all diese Wesen nun gleichgestellte Bürger, die Menschen sind auf einer Ebene mit unserem Volk und –«
»Ich meine Menschen …« Valentin holte tief Luft. »… in der Menschenwelt? Hinter dem Tor?«
»Natürlich. Der Ulmenkönig hatte von der Menschenwelt geträumt und die Pflaumenkönigin vom Alverreich.«
Valentin starrte den Lindengrafen an. »Und das sagt Ihr mir erst jetzt? Seit Wochen suchen wir die Notleidenden im Alverreich!«
»Ihr habt nie gefragt.«
Valentin schob den Grafen auf den Gang hinaus und schloss die Tür. Die Ratsmitglieder mussten seinen Unmut nicht mitbekommen. Ein kurzes Nicken in Richtung der Wachen, und man ließ sie allein.
»Graf! Ich hatte Euch mit der Suche beauftragt –«
»Im Alverreich.« Der Lindengraf blickte ihm fest in die Augen. »Ihr habt mir den Auftrag gegeben, im Alverreich zu suchen. Ich kann nicht in Euren Kopf sehen und erkennen, dass Ihr etwas anderes meint als das, was Ihr sagt.«
Valentin starrte ihn mit offenem Mund an. »Wenn ich nichts davon weiß, kann ich es nicht in meine Befehle einschließen«, knurrte er. »Wenn auch der Ulmenkönig von der Welt hinter dem Tor geträumt hatte … Es ist doch wohl offensichtlich …« Er schüttelte den Kopf. Es war sinnlos, hier weiter zu streiten. Valentin sollte dem Lindengrafen keine absichtliche Täuschung unterstellen. Der Graf hatte ihn angefleht, die Weidenkönigin auf ihren Reisen begleiten zu dürfen, und Valentin hatte abgelehnt, weil er ihn hier brauchte. Der Graf hatte sich offen gegen das alte Königspaar gestellt. Er war einer der wenigen, bei denen Valentin sich sicher sein konnte, dass er nicht dem alten System hinterhertrauerte, und genau solche Leute brauchte er im Königsbaum.
»Vielleicht hätte ich die Weidenkönigin begleiten sollen«, sagte der Graf. Er schluckte und kämpfte um den Rest seiner Würde. »Dort hätte ich besser von Nutzen sein können als hier. Wenn Ihr mit meiner Arbeit nicht zufrieden seid, so schickt mich fort.« Seine Stimme war immer leiser geworden.
Valentin schüttelte den Kopf. »Lindengraf, verzeiht meinen Ausbruch, er war ungerechtfertigt. Ich vertraue Euch und brauche Euch hier, an meiner Seite.«
Der Graf schaute mit leuchtenden Augen zu ihm auf. »Danke, Majestät. Ich werde mich Eures Vertrauens würdig erweisen.«
Valentin lächelte. »Dessen bin ich mir sicher. Gehen wir wieder zur Ratssitzung zurück.« Er öffnete die Tür, trat hinter dem Grafen ein und setzte sich mit an den Tisch der Ratsmitglieder. »Um welche Themen soll es in der heutigen Sitzung gehen?«
Die Lärchenfürstin erhob sich: »Die Schlehendame lässt sich entschuldigen, Majestät, ihr ist nicht wohl. Ich werde sie von den Ergebnissen der Ratssitzung unterrichten und sie während ihrer Abwesenheit als Vorsitzende des Rates vertreten.« Sie sammelte ihre Zettel zusammen. »Heute geht es um Heime für die Wilden Kinder, die Spielleute am Tor und …« Sie schluckte. »Das Baumsterben.«
Valentin runzelte die Stirn. Das Baumsterben hatte vor vier Wochen begonnen. Die Kiefern im Geburtshain hatten begonnen, abzusterben, und die Art und Weise, wie die Fürstin das Wort »Baumsterben« ausgesprochen hatte, ließ ihn Schlimmes befürchten. Doch zuerst die Kinder. »Kinderheime«, sagte er. »Die Weidenkönigin besichtigt auf ihren Reisen das neue Zuhause für die verlassenen Kinder in den Seelanden im Süden des Reiches, doch ich denke, auch im Königswald sollte es ein Kinderheim geben. Es darf nicht so aussehen, als würden wir diese Kinder an den Rand der Gesellschaft schieben.«
»Majestät, mit Verlaub«, mischte sich der Wacholderbaron ein. »Wilde Kinder, hier, unter uns? Sie kommen von unter der Erde, kennen keine Gesellschaftsstrukturen und Regeln, sind … nicht so wie wir.« Den letzten Teilsatz flüsterte er.
»Ihr scheint zu vergessen, dass meine beiden adoptierten Töchter ebenfalls Wilde Kinder sind«, sagte Valentin mit scharfer Stimme. »Ich versichere Euch, jedes dieser Kinder wäre lieber auf traditionelle Art in einem Geburtsbaum geboren worden, statt sich durch die Erde zu graben. Alveronen haben diese Kinder empfangen und sie nicht austragen wollen. Alveronen haben die Bäume verschlossen, Alveronen haben die Wilden Kinder geschaffen. Es liegt nun in unserer Verantwortung, uns um sie zu kümmern.«
Die Lärchenfürstin warf ein: »Keiner von uns wusste, dass diese Kinder auch bei verschlossenen Bäumen wachsen. Ihr Leben ist nicht unsere Schuld.«
»Unwissenheit macht uns nicht weniger schuldig«, flüsterte Valentin. Mit Schaudern dachte er daran, wie er selbst als Hüter des Hains etliche Geburtsbäume mit Harz verschlossen hatte, weil Eltern ihr empfangenes Kind nicht zur Welt holen wollten. Diese Schuld würde er nie begleichen können, egal, wie viele Wilde Kinder er adoptierte.
Doch er konnte ihnen einen Platz im Leben an der Oberfläche schaffen. »Nun, da wir von den Kindern wissen, haben wir umso mehr die Pflicht, sie zu integrieren. Ich bleibe dabei: Wir bauen ein Kinderheim, an der Weggabelung zum Hain. Die Lichtung ist hervorragend geeignet.«
»Sicherlich wollt Ihr auch dieses Kinderheim auf die Erde bauen?«, fragte der Lindengraf. »Um den Kindern die Umstellung von Erdhöhlen zu Baumwohnungen zu erleichtern?«
Valentin nickte dankbar. »Gut beobachtet, Graf. In der Tat sollen die Kinder nicht gleich in Baumwohnungen einziehen, das würde sie mehr verunsichern, als sie es ohnehin schon sind.«
»Soll ich den Bau überwachen?«, fragte der Lindengraf.
»Ich habe eine andere Aufgabe für Euch – wenn Ihr sie annehmen wollt. Kommt nach der Sitzung in meine Gemächer, dort besprechen wir alles Weitere. Doch zunächst … die Spielleute und das Baumsterben.« Er seufzte. Zwei Themen, zu deren Lösung er auf die volle Unterstützung seines Rates bauen musste. Ein Rat, der sich bereits über die Wilden Kinder uneins war.
Kapitel 2
Valentin ließ seinen Blick über die Ratsmitglieder schweifen. Der Lindengraf nickte ihm aufmunternd zu. Wenigstens ein Mitglied im Rat, das Valentin den Rücken stärkte. Er fasste neuen Mut. »Kommen wir zu den Spielleuten am Zaun. Seit fünf Monaten schaffen es die Musikerinnen und Musiker nicht, neue Menschenkinder in unsere Welt herüberzuretten. Wir haben ihnen neue Instrumente bauen lassen, doch dies hatte keinen Erfolg. Brachte denn die Suche nach anderen, besseren Spielleuten keine Ergebnisse?« Er blickte erwartungsvoll in die Runde.
Alle schüttelten den Kopf, blickten betreten zu Boden, doch es kamen keine neuen Vorschläge. War den Ratsmitgliedern denn nicht bewusst, was auf dem Spiel stand? »Vier Kinder sind volljährig geworden und können sich damit nicht mehr um die Geburtsbäume kümmern. Drei weitere Kinder werden im kommenden Monat volljährig, fünf bis Ende des Jahres. Bleiben drei. Wenn keine Kinder nachkommen, haben wir irgendwann keine Fantasiegärtner mehr – und wie sollen die Bäume genährt werden, wenn nicht mit der Fantasie von Menschenkindern? Was passiert mit dem Hain, wenn er keine Gärtner mehr hat?«
Der Lindengraf erhob sich. »Es werden keine alveronischen Kinder mehr geboren werden«, sagte er. »Zumindest nicht in Bäumen. Vielleicht wäre es an der Zeit, sich die Funktionsweise der Körpergeburten anzuschauen, wie es die Menschen –« Scharfes Zischen unterbrach ihn.
»Ihr wollt ein Jahrtausende altes System umstürzen?« Der Wacholderbaron war aufgesprungen. »Die Geburtsbäume sind so alt wie das Alverreich! Noch nie hat es jemand gewagt, Körpergeburten vorzuschlagen, oder auch nur darüber nachzudenken!«
Der Lindengraf blieb beharrlich. »Es hat auch vor der Weidenkönigin niemand daran gedacht, wie tyrannisch es ist, unfruchtbare Frauen aus der Gesellschaft auszustoßen. Sollte eine Frau nichts wert sein, nur weil sie nicht in einem Obstbaum geboren wurde und keine Kinder empfangen kann? Habt Ihr vergessen, dass sogar die Eschenprinzessin aus diesem Grund aus dem Reich flüchten musste? Vor ihren eigenen Eltern?« Er atmete tief durch. »Nein, Baron, dieses System ist herzlos. Es ist an der Zeit, dass es mit dem alten Reich stirbt.«
Valentin war einen Moment lang sprachlos, doch er fing sich schnell wieder. »Gut gesagt, Graf. Wir werden das alte System abstreifen, nach und nach. Ich möchte, dass der Übergang sanft verläuft, damit das Volk Zeit hat, sich daran zu gewöhnen. Nicht jeder denkt so wie wir, nicht jeder hat die gleichen Erfahrungen und Meinungen. Wir wollen das Volk nicht über diesem Thema spalten, im Gegenteil, wir sollten mehr zu einer Einheit werden, als wir es je waren. Und bis der Übergang abgeschlossen ist, müssen wir dafür sorgen, dass der Geburtshain weiterhin wächst und gedeiht. Es gehören Lösungen her.« Seine Stimme klang fester und sicherer, als ihm zumute war. Baron und Graf wechselten noch einmal zornige Blicke, dann setzten sich beide wieder hin.
Valentin nickte zufrieden. Der erste wirkliche Konflikt unter den Ratsmitgliedern, und er hatte ihn lösen können. Seine Anspannung ließ ein wenig nach, und er konnte seine Gedanken wieder voll und ganz der Problemlösung widmen. »Letzte Woche habe ich die Schichten verstärkt: Es spielen nun drei statt zwei Musiker zusammen, und gemeinsam müssen sie einfach Erfolg haben. Gibt es schon Nachricht von neuen Kindern?«
»Nun …« Die Lärchenfürstin erhob sich. »Keine Kinder, doch … Entschuldigt mich.« Sie ging zur Tür und redete leise mit den Wachen. Fußgetrappel draußen, und dann ein herzhaftes Gähnen. Valentin musste sein Schmunzeln unterdrücken, obwohl er liebend gern loslachen – und mitgähnen – wollte.
Die Wachen schoben einen jungen Mann herein, dessen graues Haar ihm bis auf die breiten Schultern herabhing. Seine Haut war dunkel wie die der Alveronen aus den Seelanden, wie Olivenholz –
Valentin erstarrte. Das war der Mann aus seinen Träumen. Ganz sicher, dies hier war einer der Traumsucher. Graues Haar, dunkle Haut … »Du bist der Traumsucher, richtig? Stammst du aus dem Alverreich oder der Menschenwelt?«
Die Lärchenfürstin antwortete: »Er kam durch das Tor, nachdem Ihr die Schichten auf drei Spielleute verstärkt hattet. Leider ist er nach seinen eigenen Aussagen schon dreiundzwanzig und damit völlig nutzlos, was die Pflege der Geburtsbäume angeht.«
Der junge Mann hob die Augenbrauen. »Nutzlos? In meinem Garten sterben die Bäume nicht weg wie in Eurem. Wer auch immer die Verantwortung dafür hat, sollte vielleicht den Beruf wechseln.« Er grinste.
Valentin wusste nicht, ob er lachen oder empört auffahren sollte. Der junge Mann nahm ihm die Entscheidung ab. Er verbeugte sich vor Valentin. »Mein Name ist Gerald. Majestät, ich möchte mich bei Euch bedanken, dass Ihr mich gefunden habt. Als Eure Spielleute das Tor öffneten, brauchte ich nicht lange zu zögern. Was auch immer mich hier in Eurer Welt erwartet – alles ist besser als daheim. Es hätte kein gutes Ende genommen, wenn ich geblieben wäre.« Er rieb sich die Handgelenke, auf denen dunkle Abdrücke beinahe mit seiner braunen Haut verschmolzen. »Ich hoffe, ich kann Euch im Garten assistieren und mich damit erkenntlich zeigen. Doch zuerst … ist sie auch hier? Edith?«
Valentin schaute ihn irritiert an.
Geralds Gesicht nahm einen traurigen Ausdruck an. »Eine Grafentochter? Ein zwanzig Jahre altes Mädchen mit blonden Locken und einer hellen Haut? Nein? Sie wird kommen, ganz sicher. Wir haben uns versprochen, dass wir uns hier wiedersehen.« Seine Stimme wurde leiser. »Vielleicht hat unsere Liebe in dieser Welt eine Chance.« Er räusperte sich. »Ich schaue mir gern Euren Garten an und versuche, zu helfen. Sagt mir nur, an wen ich mich wenden soll. Wer ist der Gärtner?«
Valentin setzte ein strenges Gesicht auf. »Das bin ich.«
Gerald trat einen Schritt zurück. »Verzeiht … nein, wirklich … Ihr seid doch … Seid Ihr nicht der König?«
Der Wacholderbaron schnitt dazwischen: »Du stehst vor Seiner Majestät, dem Erlkönig, Menschenmann. Etwas mehr Respekt würde dir guttun.«
»Ihr seid der König … und auch der Gärtner?« In Geralds Kopf schien beides nicht zusammenzupassen.
»Und ein Spielmann«, entgegnete Valentin. »All dies sind nur Berufsbezeichnungen, und keiner davon steht höher oder niedriger als der andere. Was eine Person tut, sagt mehr über sie aus als alle Titel.«
Gerald prustete los. »Jemanden wie Euch brauchen wir drüben. Wollt Ihr nicht mal mit in die Menschenwelt kommen und den Adligen dort zeigen, dass Titel nur leere Worte sind, dass Stand nichts bedeutet?«
Der Wacholderbaron schien am Ende mit seiner Geduld. »Hüte deine unflätige Zunge, Menschenmann! Du –«
»Gerald«, berichtigte der junge Mann grinsend. »Ist kürzer als ›Menschenmann‹. Und klingt besser, das müsst Ihr zugeben.«
Valentin biss sich auf die Zunge. Es würde nicht hilfreich sein, laut aufzulachen. Wenn er in seiner Position als König respektiert werden wollte, konnte er Gerald mit dieser Respektlosigkeit nicht davonkommen lassen. »Du hast anscheinend zu viel überschüssige Energie, Gerald. Das trifft sich hervorragend, ich brauche jemanden, der die Kiefernwurzeln ausgräbt.« Der Gedanke an seinen Großvater, der ein Kieferngeborener war und krank irgendwo in der Menschenwelt verschollen war, löschte sein Lachen und ließ ihn in Düsternis versinken.
Geralds Grinsen fiel in sich zusammen. »Kiefernwurzeln …«
»Der abgestorbenen Bäume, ja. Die Wurzeln reichen über fünf Mannlängen in die Tiefe, und ich bin froh, dass du uns mit deiner Körperkraft unterstützen willst. Die Kinder können das nicht allein schaffen.«
Der Wacholderbaron lachte hämisch, doch ein finsterer Blick Valentins brachte ihn zum Schweigen. Die Lärchenfürstin, die an der Tür stehengeblieben war, winkte Gerald zu sich. »Wartet draußen, Gerald. Wenn ich Seine Majestät richtig einschätze, wird er Euch zum Garten begleiten und selbst nach dem Rechten sehen wollen. Majestät …« Sie kam herüber und setzte sich mit an den Tisch. »Es sind nicht nur die Kiefern, auch die Schlehen sind mittlerweile von jener unbekannten Krankheit befallen. Wir haben Kiefern und Schlehen im Königswald untersuchen lassen, außerdem im Osten und Westen des Reiches. Es scheint nur die Geburtsbäume des Hains zu treffen.«
»Ist es ein Zufall …« Valentins Stimme wurde heiser. »… dass die Schlehendame erkrankt ist?«
Er kannte die Antwort, fühlte sie in seinem Körper, hörte die Stimme der Holzmagie in seinen Ohren, als würden die Bäume zu ihm sprechen. Jeder Alverone beherrschte eine Art von Magie, und die Holzmagie war seine besondere Kraft. Keine Fähigkeit, die im Kampf half, wie die Metallmagie, die der Lindengraf beherrschte … Doch er war mit seinem Garten verwachsen, und unter seinen Händen war der Hain fruchtbarer denn je gewesen. Bis jetzt. Bis zu seiner Krönung, mit der er die Traummagie dazugewonnen hatte. Das Königspaar beherrschte als einzige Wesen im Alverreich mehr als eine Art Magie, doch war diese zweite Kraft teuer bezahlt? Bedrohte seine Abwesenheit vom Hain das Leben dort?
Doch Leahs Magie war stärker geworden, was normal war, wenn man im Rang aufstieg. Ihr Haar besaß Heilkräfte, und da es ihr erlaubt war, ihr Haar wachsen zu lassen, war die Kraft in ihr mächtiger denn je. Es konnte nicht mit der Krönung zu tun haben. Womit dann?
»Es ist kein Zufall«, bestätigte die Lärchenfürstin. »Kiefern- und Schlehengeborene in allen Teilen des Reiches sind erkrankt, als würde ihr Leben mit dem der Bäume zusammenhängen.«
»Es sind die Kinder«, sagte Valentin tonlos. »Wir haben zu wenige Menschenkinder, und es kommen keine nach. Wenn es so weitergeht …« Seine Stimme brach ab. Nicht nur das Leben seines Großvaters stand auf dem Spiel.
»Wenn es so weitergeht«, flüsterte der Lindengraf. »… ist das Leben aller Alveronen in Gefahr.« Sein Gesicht hatte jegliche Farbe verloren. »Tut etwas, Majestät.«
Valentin erhob sich. »Wir gehen zum Hain. Sofort. Lindengraf, bringt diesen Gerald mit. Er war Gärtner in der Menschenwelt, ich will seine Meinung zu diesen Fällen hören.«
Der Wacholderbaron fuhr auf: »Ein Menschenmann ist wohl kaum der richtige –«
»Wir haben keine Zeit für Völker- und Standesdünkel, Baron!«, herrschte Valentin ihn an. »Wenn Ihr eine Idee habt, wie das Baumsterben aufzuhalten ist, dann freue ich mich darauf, sie zu hören. Bis dahin greife ich nach jeder Möglichkeit, mein Volk zu retten!« Er erhob sich. »Die Ratssitzung ist beendet. Lindengraf, lasst uns gehen.«
Kapitel 3
Als sie die breite Straße vom Königsbaum zum Geburtshain entlangschritten, war die Sonne schon über die Baumwipfel gestiegen und tauchte alles in goldenes Licht. Bürger des Reiches, die zu dieser frühen Stunde wach waren, grüßten ehrerbietig, statt sich wie früher ängstlich hinter Baumstämmen zu verstecken. Die emsige Betriebsamkeit, die nach und nach einsetzte, störte nicht den Frieden des Morgens. Es könnte so perfekt sein … Wenn nicht die Worte, die in der Ratssitzung gesprochen worden waren, schwer auf Valentins Schultern lasteten.
Er warf dem Lindengrafen, der neben ihm ging, einen Blick zu. Auch der Graf wirkte niedergeschlagen, doch während Valentin versuchte, einen klaren Verstand zu wahren und die Probleme logisch anzugehen, knetete der Graf nervös seine Hände und fuhr sich andauernd durch die halblangen Haare, als müsste er sich selbst beruhigen.
»Wir werden dem Baumsterben ein Ende bereiten«, sagte Valentin mit fester Stimme. »Es kommen wieder Menschen, also waren nicht alle unsere Anstrengungen umsonst. Die Kinder werden zurückkommen. Gerald wird uns sicher helfen, zu durchschauen, warum so plötzlich keine Kinder mehr herüberkommen.« Er warf einen Blick zurück, wo Gerald mit den Wachen scherzte, und wünschte für sich selbst diese Unbeschwertheit zurück, die er früher besessen hatte. Doch sie war nur eine Illusion. Er hatte nie ein unbeschwertes Leben führen können. Er hatte es geschafft, vom Tor wegzukommen und nicht mehr in Gefahr zu sein, beim Holen der Menschenkinder selbst in der Menschenwelt verloren zu gehen. So viele Spielleute waren nie zurückgekommen … Als Hüter des Hains hatte er den Hain derart vergrößern können, dass man ihm als besondere Gnade gewährt hatte, auch seine Großeltern vom Tor wegzuholen, und vielleicht hätte er es sogar geschafft, seine Eltern zu retten. Alle hätten in Sicherheit sein können.
Doch immer hatte diese scheinbare Sicherheit auf Messers Schneide gestanden. Ein falsches Wort, eine falsche Bewegung, und er hätte alle Privilegien verloren, die er gewonnen hatte – und womöglich mit seinem Leben bezahlt. Unbeschwert war anders.
»Graf, Ihr müsst etwas für mich tun. Diese Aufgabe möchte ich keinem anderen anvertrauen.« Sie waren in Sichtweite des Hains angekommen. Valentin gab den Wachen ein Zeichen, zurückzubleiben, und zog den Lindengrafen mit sich, bis sie außer Hörweite waren. »Ich wollte es nicht im Rat ansprechen, denn es soll nicht der Eindruck entstehen, dass ich meine persönlichen Belange über die des Volkes stelle. Aber Graf …« Valentin versuchte, das Zittern aus seiner Stimme herauszuhalten. Er war der König und konnte sich keine Schwächen leisten. »… meine Familie … Ihr müsst meine Familie zurückholen …« Seine Stimme brach. Gefühle, die er weder einordnen noch kontrollieren konnte, überrollten ihn. Ein Jahr war es her, dass seine Eltern und Großeltern zusammen mit Leahs Bruder und der Eschenprinzessin in die Menschenwelt geflüchtet waren. Eine Rückkehr wäre ein Leichtes, wenn sie wüssten, dass das Alverreich nun ein sicherer Ort war; doch die Soldaten, die er durch das Tor geschickt hatte, um sie zu holen, waren nicht zurückgekommen. Was war auf der anderen Seite los, dass niemand zurückkehrte?
Sorge um seine Familie schnitt ihm tief ins Herz, doch nichts war so stark wie das Vermissen. Früher hatte er keinen einzigen Tag ohne seine Familie verbracht, und von einem Tag auf den anderen war alles anders geworden. Er hatte keine Zeit gehabt, sich richtig zu verabschieden, seine Familie war verschwunden, bevor er selbst seine Entscheidung, bei den Menschenkindern im Alverreich zu bleiben, wirklich begriffen hatte. In den letzten Monaten hatten sich der Abschiedsschmerz und der Verlust in sein Herz gegraben, und all die Errungenschaften, die Leah und er erreicht hatten, waren nur ein blasser Trost, der nicht das riesige Loch in seiner Seele füllen konnte.
»Das habe ich mir gedacht. Ich habe bereits zwei Kompanien hinübergeschickt, Majestät, ohne es mit Euch abzusprechen. Ich hoffe, Ihr könnt mir verzeihen, dass ich eigenmächtig gehandelt habe.«
Valentin konnte die Tränen nicht aufhalten. »Wenn Ihr wüsstet, wie dankbar ich Euch bin … Ihr habt immer zu mir gehalten, und nun kann ich endlich Hoffnung schöpfen. Wenn Ihr Eure Leute schickt, werden sie sicher eher Erfolg haben als Königswachen oder Soldaten aus anderen Kompanien. Und in der jetzigen Situation … Mein Großvater ist ein Kieferngeborener, und falls wir es nicht schaffen, neue Menschenkinder zu holen … Ich muss ihn sehen, bevor –« Valentin wischte sich die Tränen ab. Es wurde Zeit, wieder klar zu denken, anstatt sich von seinen Gefühlen beeinflussen zu lassen. »– Ihr wisst schon.«
Der Lindengraf nickte nur. »Holen wir Gerald hinzu. Er soll uns erzählen, wie er herübergefunden hat. Vielleicht können wir daraus schließen, warum keine Kinder kommen.«
»Im Garten. Ich will erst hören, was er zu den toten Bäumen zu sagen hat.« Valentin winkte den Wachen und Gerald, ihnen zu folgen. Als er das eiserne Gittertor erreichte, überkam ihn wieder ein Schauer. Das Metall war für ihn nicht formbar, nicht lebendig … Er sollte das Gitter durch eine Holztür ersetzen. Er legte die Hand an das kalte Metall, als könnte es ihm die Festigkeit und Stärke geben, die er brauchte, um seine Aufgabe zu erfüllen.
Das Tor schmolz unter seinen Händen. Erschrocken zog Valentin die Hand zurück.
Der Lindengraf trat zu ihm. »Es ist Zeit, das Tote wieder mit Leben zu erfüllen, oder nicht? Vielleicht könnt Ihr eine Holztür einbauen.«
Valentin lachte erleichtert auf. »Ihr beherrscht wohl nicht nur Metallmagie, sondern auch die Kraft des Gedankenlesens? Ich habe das Gleiche gedacht.«
Der Lindengraf zuckte grinsend mit den Schultern. »Ich bin kein Zauberer, und selbst unter ihnen ist mir kein Gedankenleser bekannt. Eure Traummagie ist das, was dem noch am nächsten kommt.«
Valentin trat durch das Tor. »Ich lasse den Durchgang offen«, sagte er. »Wie früher.« Er hob die Hand, und der Boden an den Seiten des Tores brach auf. Efeu wuchs an der Metallwand empor und krallte sich in die glatte Oberfläche. Einzelne Rosenpflanzen rankten am Efeu in die Höhe und schlossen einen Bogen über Valentins Kopf. Die Knospen brachen auf und die gelbe Farbe der Blüten strahlte mit der Sonne um die Wette.
»Vater!« Eine helle Stimme glitzerte mit der Sonne um die Wette. Ein Mädchen mit weißblonden, kurzen Haaren kam auf ihn zugerannt.
»Rosa!« Valentin öffnete die Arme, doch das Mädchen blieb einige Meter entfernt stehen. »Keine Umarmung heute?« Er runzelte die Stirn.
Rosa trat von einem Fuß auf den anderen. »Alveronen berühren sich nicht. Hat Falk gesagt.«
Valentin musterte seine Adoptivtochter. Sein Stirnrunzeln vertiefte sich. »Hat Falk dir auch gesagt, dass du dir die Haare abschneiden sollst?«
Rosa nickte. »Am besten ganz abrasieren, aber er hat gemeint, dass kurz für den Anfang ausreicht.«
Valentins Magen zog sich zusammen. »Welchen Anfang? Rosa, was soll der Blödsinn? Deine Mutter und ich haben nicht für eure Freiheit gekämpft, damit ihr zum alten System zurückkehrt.«
»Falk sagt, so werde ich eher akzeptiert. Er ist schon siebzehn und sehr schlau, er hat bestimmt recht, das sieht man schließlich bei Alma. Die zupft die ganze Zeit nur an ihrer dämlichen Mandarine herum, spielt nicht mit den alveronischen Kindern und weigert sich, ihre Haare abzuschneiden. Keiner kann sie leiden. Ich will schon niemandem mehr sagen, dass sie meine Schwester ist, da muss man sich ja schämen.«
»Mandoline«, korrigierte Valentin automatisch. Er wollte etwas anderes sagen, wollte sein Erschrecken zum Ausdruck bringen, doch sein Kopf war leer. Er konnte keinen klaren Gedanken fassen. War seine eigene Tochter wirklich eben dabei, das verhasste System wieder aufleben zu lassen, in dem man sich nicht berühren durfte, in dem jede Art von Körperlichkeit verboten gewesen war – und man sich sogar die Haare ausriss, um nicht durch eine Strähne im Gesicht oder Nacken daran erinnert zu werden, dass man einen Körper besaß? Verfolgte ihn der Albtraum aus dem letzten Jahr bis in den Hain, der immer sein Refugium gewesen war? Brachten ihn die kaum verwundenen Schrecken dazu, Rosas Worten eine Bedeutung beizumessen, die sie nicht hatten?
»Wo ist Alma? Im Familienbaum?« Er wartete Rosas Antwort nicht ab, sondern ließ sie und seine Begleiter stehen und eilte den Sandweg entlang. Kinder riefen nach ihm, doch er hörte nicht hin. Gleich. Gleich würde er Zeit für sie haben, doch zuerst brauchte er einen Augenblick Frieden, nur einen einzigen Augenblick. Er lächelte den Kindern flüchtig zu, winkte und beschleunigte seine Schritte.
Als er die Tür zum Familienbaum aufriss, klangen leise Saitentöne an seine Ohren. Es war eine zarte, liebliche Melodie, als könnte das Mädchen spüren, was Valentin jetzt brauchte. Musik. Sie beantwortete alle Fragen, sie heilte alle Wunden. Aus Musik bestand sein Leben, aus Musik bestand seine Seele. Wenn er sie hörte, vergaß er seinen stofflichen Körper, die Welt um sich herum, seine Seele war frei und lebte nur in einer Welt aus Klängen.
Er blinzelte. Er hatte eine Familie, die er liebte, und ein Königreich, das ihn brauchte. Sein Leben bestand nicht mehr nur aus Musik. Doch einen Augenblick innehalten, das musste erlaubt sein. Einen Moment lang vergessen, dass die Misstöne des alten Systems sich in die freudigen Harmonien ihres jungen Reiches mischten …
Er stieg die Treppe hinauf, immer den Tönen nach. Alma saß in ihrem Zimmer auf dem Boden und spielte Mandoline. Weitere Instrumente hingen an den Wänden, doch diesen verzückten Ausdruck hatten ihre dunkelblauen Augen nur, wenn sie ihr allererstes Instrument in den Händen hielt. Sie blickte auf und lächelte Valentin an. »Meine erste Mandoline«, sagte sie beinahe ehrfürchtig. »Darin liegt ein ganz besonderer Zauber.« Sie beendete die Melodie, stand auf und kam auf Valentin zu.
Er öffnete die Arme und hielt den Atem an. Angst vor Zurückweisung zuckte durch seinen Körper. Rosa hatte ihn nicht umarmen wollen. Würde Alma ebenfalls …
Sie ließ sich in seine Arme fallen, immer darauf bedacht, die Mandoline, die sie umklammert hielt, nicht zu zerdrücken. »Ich bin froh, dass du endlich wieder da bist, Papa. Ich habe dich so vermisst. Die anderen Kinder sind nett, aber … sie verstehen die Musik nicht. Sie wollen sie nicht hören, und wenn ich draußen spiele, schicken sie mich weg.«
Valentin schloss sie fest in die Arme und drückte einen Kuss auf ihr schwarzes Haar. »Ich verstehe die Musik.« Ich brauche die Musik, jetzt, sie soll alles andere ausblenden. Die Erinnerungen an die Schrecken, die Sorgen, die das Sterben der Geburtsbäume aufwarfen, die Konflikte im Thronsaal … Diese Gedanken würde er Alma niemals mitteilen. Ihr junges Leben, das von so viel Härte geprägt war, sollte keine zusätzliche Belastung erfahren. Er würde seine Lasten nicht an das Kind weitergeben. Doch sie konnte ihm helfen, das wusste er. »Spiel für mich, ja? Ich würde gern etwas hören.«
Sie nickte und ließ sich wieder auf den Boden sinken. Valentin setzte sich neben sie. Ihm war bewusst, dass draußen der Lindengraf, Gerald und die Wächter darauf warteten, dass er sich um Staatsgeschäfte kümmerte, aber das hier war wichtiger.
Alma zupfte vorsichtig an den Saiten. Sie warf ihrem Vater ein scheues Lächeln zu, als wäre sie sich bewusst, dass der beste Spielmann des Reiches ihr nun lauschte. Einige weitere Töne, und ihr Gesicht bekam einen entrückten Ausdruck. Sie spielte eine traurige, schwere Weise, die in ihrer Süße an Valentins Herz rührte. Es war weit davon entfernt, perfekt zu sein – Valentin vernahm einige schiefe Klänge –, doch Alma schloss die Augen und ließ sich in die Musik hineinfallen, ließ sich von der Melodie in ferne Länder tragen, deren Farben und Gerüche durch die Musik hindurchschimmerten.
Valentin sah, was sie sah, fühlte, was sie fühlte. Eine unendliche Einsamkeit, eine Leere, die mit einem dunkelblauen Nachthimmel und glitzernden Sternen gefüllt wurde. Leahs Bild erschien in der Dunkelheit, dann das von Valentins Eltern, seinen Großeltern. Alma, Rosa … Andere Alveronen, Menschen, Wilde Kinder … Er war nie einsam, würde nie einsam sein. Er trug seine Familie und sein Volk im Herzen. Die liebliche Melodie spann goldene Fäden um alle Wesen und vereinte sie. So konnte es sein. So könnte die Welt aussehen, wenn alle eins waren, wenn sie nicht die Unterschiede sehen würden, die sie trennten, sondern die Liebe, die sie vereinte.
Er öffnete verwundert die Augen und sah, dass Alma immer noch in ihre Musik versunken war. Wie lange saßen sie schon hier? Hatte er wieder geträumt? Hatte sich das angefühlt wie sein Nachtschlaf, in dem die Traumsuchenden zu ihm gekommen waren?
Ja … und nein. Er hatte geträumt, im wachen Zustand. Es waren Traumsuchende gewesen, sein ganzes Volk hatte ihn um Hilfe gebeten. Doch es war ein zaghaftes Gesuch gewesen, ein Wunsch, vielleicht nur eine Illusion … Nicht die Not, mit der die Sucher im Schlaf zu ihm gekommen waren. Dies hier war eine sanfte Vision, eine glänzende Zukunft, die er aufbauen konnte … Wenn er sich entschied, dem Ruf zu folgen.
Sein Blick traf den von Alma. Sie lächelte, und in ihren dunkelblauen Augen spiegelten sich der Nachthimmel und die Sterne und die Sehnsucht, die nie ausgesprochen wurde. Plötzlich war sie nicht mehr das zwölfjährige Kind, das Leah und er als Tochter angenommen hatten, sondern eine unsterbliche Seele, die sich mit seiner verbunden hatte – die schon immer mit seiner verbunden gewesen war, wie die der anderen Kinder, wie die der anderen Wesen des Reiches. Sie alle waren eins, und in Momenten wie diesen spürten sie es.
Valentin lächelte zurück. Er erhob sich. Alma legte ihre Mandoline zur Seite, hüpfte auf ihn zu und kuschelte sich erneut in seine Arme. Er hielt sie fest und wollte sie am liebsten nie wieder loslassen. Doch dort draußen wartete eine neue Welt darauf, geschaffen zu werden. Alle Steine, die ihnen im Weg lagen, hatte es schon immer gegeben, sie waren nicht neu, nicht durch ihn erst entstanden, wie es ihm die harte Stimme des Zweifels oft einreden wollte. Leah und er hatten die Macht, etwas zu verändern. Ihr gesamtes Volk hatte die Macht, etwas zu verändern und die Welt zu gestalten, in der sie leben wollten.
Zeit, damit anzufangen.
Kapitel 4
Als Valentin den Familienbaum verließ, warteten am Fuß des Baumes schon der Lindengraf, Gerald und die Wächter. Der Lindengraf lächelte. »Die Wache wollte Euch folgen, doch ich fand es eine bessere Idee, Euch einen Augenblick Zeit zu geben.«
Valentin nickte dankbar. »Wie lange war ich weg?«
»Nur wenige Minuten, wir sind eben erst hier angekommen.«
»Valentin!« Ein Junge näherte sich der Gruppe. »Ich meine … Majestät.« Er verbeugte sich ungelenk. »Das Mittagessen für die Kinder ist fertig und ich dachte … vielleicht willst du mit uns essen? Ich koche jeden Tag etwas mehr für den Fall, dass du uns besuchst.« Er ließ den Blick unruhig über die Gruppe schweifen. »Es reicht bestimmt auch für deine Begleiter.« Er trat von einem Fuß auf den anderen. »Es ist so lange her, dass du mit uns gegessen hast.«
Valentin seufzte. Es war in der Tat zu lange her gewesen. »Wir sind gleich bei euch, Hans. Lasst uns noch die kranken Bäume besichtigen, dann kommen wir.«
Hans nickte. Dann grinste er Gerald an, hob die Hand und Gerald schlug ein. Valentin runzelte die Stirn.
»Hab den Kindern ein paar Sachen von drüben beigebracht. Einschlagen zum Beispiel. Diese Zwerge sind Euch echt gut geraten. Ich kenn sonst keine Kinder, die freiwillig Gartenarbeit machen, die meisten zerstören die Pflanzen lieber.«
»Ich kenne keine, die gern Pflanzen zerstören. Warum sollten sie?«
Gerald zuckte mit den Schultern. »Ihr fragt einen Gärtner?«
Valentin schmunzelte. »Gehen wir zu den Bäumen. Die Obstbäume hast du am Eingang des Gartens gesehen, bei den Quartieren der Kinder. Hier drüben sind die anderen Bäume.« Er spürte das Holz, bevor er die Bäume sah. Er warf einen prüfenden Blick zu den Weiden hinüber, die noch unversehrt schienen. Er fühlte sich mithilfe seiner Holzmagie in die Bäume hinein, und sie wirkten vollständig gesund. Die meisten Krankheitsanzeichen waren leicht aus der Ferne sichtbar, und um die Weiden schienen sie sich keine Sorgen machen zu müssen. Vorerst.
Der Lindengraf schien nicht überzeugt. Er löste sich von der Gruppe und ging zu den Weiden, um sie näher zu untersuchen.
Gerald brummte. »Hm, bei den Kiefern ist das Elend schon von Weitem zu sehen. Parasiten oder Nährstoffmangel?«
»Parasiten haben wir keine gefunden«, antwortete Valentin. »Aber schaut.« Er ging zu einer Kiefer, deren Borke schon gerissen war und sich vom Stamm wegwölbte. Valentin ließ sich von den Wachen ein Messer reichen und löste ein Stück Borke. Er kniff die Lippen zusammen, als trotz aller Vorsicht der dumpfe Schmerz, der die Kiefer durchdrang, in seinen Körper floss. Holzmagie war normalerweise ein Segen – doch bei sterbenden Bäumen ein Fluch.
Gerald runzelte die Stirn. »Der Bast. So kann er natürlich keine Nährstoffe transportieren. Ausgetrocknet und …« Er strich mit den Fingern darüber. »… schwarz?«
Valentin nickte grimmig. »Die Farbe hat von dem hellen Gelb zu einem derart dunklen Schwarz gewechselt, als würde –«
»– er das Licht schlucken«, vervollständigte Gerald. »Die Kinder haben mir erzählt, dass Euer Volk Magie besitzt … Ist so etwas mit Magie schaffbar?«
»Ich weiß es nicht. Wir haben so viele Arten von Magie, manche werden erst in bestimmten Umständen sichtbar, und die Alveronen wissen bis dahin nicht, welche Magie sie besitzen. Die Elementemagie, wie das Formen von Metall oder Holz, ist meist im frühen Kindesalter sichtbar. Andere Zauber manifestieren sich später. Wenn zum Beispiel jemand alles, was er mit den Händen schafft, unwiderstehlich macht, ist das eine Kraft, die man oft gar nicht bemerkt. Es gibt genügend alveronische Kinder und Jugendliche, die ihre Magie nicht kennen.«
»Hm. Manchmal wünsche ich mir, in der Menschenwelt wäre es genauso. Aber wir haben keine Magie.« Gerald lachte, doch das Lachen erreichte nicht seine Augen. »Ich sollte aufhören zu träumen. Das hat mir nur Ärger eingebracht.«
Valentin sah die Chance, das Gespräch auf die einzige mögliche Lösung ihres Problems zu lenken. »Warum bist du hier, Gerald?«
Gerald nahm ihm das Stück Borke aus der Hand und setzte es behutsam in die Lücke ein. Er hielt die Hand darauf, als könnte er den Baum damit bewegen, seine Wunde zu heilen. »Hab mich in ein Grafenmädchen verliebt. Träumer, hab ich Euch ja gesagt. Ihre Eltern waren nicht begeistert.«
»Kann ich mir vorstellen.« Valentin dachte daran zurück, wie streng hierarchisch das Heiratssystem im Alverreich gegliedert gewesen war.
»Und bei Euch?« Gerald betrachtete ihn aus zusammengekniffenen Augen. »Ihr sagtet, Ihr wart ein Spielmann und Gärtner … Und nun König?«
»Ich wurde gewählt. Das Volk hatte sich ein neues Königspaar gewünscht und hat uns ausgewählt.«
Gerald lächelte. »Dann ist es richtig, dass ich gekommen bin. Wenn Edith es auch herüberschafft, können wir gemeinsam in Sicherheit leben.«
Valentin fragte, was ihm auf der Seele brannte. »Wie hast du es geschafft, herzukommen? Wie kommen Menschen ins Alverreich? Ich habe dich in deiner Welt gesehen, doch nicht ich war es, der das Tor geöffnet hat, das waren die Spielleute.«
Gerald blickte über die Schulter. »Hatte Hans nicht was von Mittagessen erzählt? Ich bin am Verhungern.«
Seit seine Großeltern nicht mehr bei ihm lebten, hatte Valentin oft genug das Essen vergessen, wenn ihn niemand daran erinnerte. »Richtig. Gehen wir essen. Der Lindengraf soll ebenfalls hören, wie du zu uns gekommen bist.«
Sie gingen zu den Hütten der Kinder. Einige kamen auf Gerald zugerannt und hielten ihre Hände hochgereckt, damit er einschlagen konnte. Er grinste. »Sie sind alle so klein«, bemerkte er. »Niemand in meinem Alter. Was passiert mit ihnen, wenn sie erwachsen sind?« Er setzte sich an den gedeckten Tisch. Valentin ließ sich ihm gegenüber nieder.
Der Lindengraf setzte sich neben Gerald. »Sie verlassen den Garten und lernen einen Beruf. Die meisten werden Heiler, denn bis vor Kurzem waren Berührungen verpönt und keiner der Alveronen wollte einen Beruf ergreifen, bei dem man andere Wesen berühren muss.«
Gerald hielt seine Gabel auf halbem Weg zum Mund an. »Bis vor kurzem … keine Berührungen? Hätte ich den Kindern nicht das Einschlagen beibringen dürfen?« Er schob sich das Gemüse in den Mund.
»Alles in Ordnung«, sagte Valentin. »Es gibt noch einige, die Schwierigkeiten haben, sich umzugewöhnen, aber es ist nicht mehr gesetzlich verboten.«
»Gesetzlich verboten? Ihr hattet ein Gesetz …« Sein Mund stand offen.
»Mund zu beim Kauen!«, rief eins der Kinder. »Das ist eklig!«
Valentin musste die Lippen aufeinanderbeißen, um nicht loszulachen. Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie absurd die alveronischen Gesetze auf Menschen wirken mussten. Er kannte die Menschenwelt nur aus Erzählungen von kleinen Kindern und war begierig darauf, mehr zu erfahren.
»Auf Berührungen stand die Todesstrafe«, erwiderte der Lindengraf.
Gerald schluckte. Dann klappte ihm wieder der Mund auf.
»Wir haben das Gesetz abgeschafft«, wiederholte Valentin. »Kein Grund zur Panik. Meine Menschenkinder haben sich ohnehin nie daran gehalten, und bis in die letzten Monate der Schreckensherrschaft haben wir Gärtner niemanden interessiert.«
Gerald fing sich wieder. »Dumme Frage, aber … ähm … ohne Berührungen, wie … Wo kommen die alveronischen Kinder her?«
Valentin antwortete. »Sie werden in Bäumen geboren. Jeder Alverone trägt das Zeichen seines Geburtsbaumes auf dem Handrücken, schau.« Er hielt seine Hand hoch.
»Ah. ›Erlkönig‹, verstehe.« Gerald betrachtete die Hand des Lindengrafen. »Und ›Lindengraf‹. Leuchtet ein. Aber wie … nun ja, wie empfangen Eure Frauen Kinder, ohne Berührungen?«
»Man muss sich ein gemeinsames Kind wünschen«, erwiderte Valentin. »Wenn die Frau in einem Obstbaum geboren wurde und fruchtbar ist, kann sie das Kind empfangen, das in einem Baum zur Welt kommt. Wenn man nicht …« Er biss die Lippen aufeinander. Das dunkle Kapitel seiner eigenen Vergangenheit wollte er nur ungern ans Tageslicht zerren. Doch er hatte sich schuldig gemacht, und Wiederholungen konnten nur durch Aufklärung vermieden werden. »Wenn man nicht den Baum mit Harz verschließt. Bisher glaubte man, dass dies auf schonende Weise die Geburt von Kindern verhindert, doch die Kinder graben sich durch die Erde.«
»Die Babys?« Gerald schüttelte den Kopf.
»Unsere Babys sind nicht ganz so hilflos wie Menschenbabys«, antwortete der Lindengraf. »Sie sind eher mit vier- oder fünfjährigen Menschenkindern vergleichbar.«
Gerald schob sich gedankenverloren eine weitere Gabel mit Essen in den Mund. »Verrückt«, murmelte er.
»Mit vollem Mund spricht man nicht!«, rief Rosa dazwischen.
Valentin rutschte zur Seite und bedeutete ihr, sich zu ihm zu setzen, doch sie schüttelte den Kopf. »Feste Nahrung ist nicht so gut«, sagte sie. »Du solltest auch nicht so viel davon essen, Menschenmann, du bist doch schon breit genug.«
Gerald prustete los. »Die Muskeln brauchen Nahrung«, sagte er lachend. »Von nichts kommt nichts.«
Valentin konnte nicht in sein Lachen einfallen. Nun auch noch die Nahrungsverweigerung … »Rosa, Liebes … Dieser Falk, hat er noch mehr Alveronen dazu gebracht, sich nicht mehr zu berühren, sein Haar zu schneiden und nichts mehr zu essen?«
»Nein.« Die Antwort kam zu hastig.
Valentins Gesicht verdüsterte sich. Ein weiterer Punkt auf der Liste seiner Probleme. Zuerst musste er dafür sorgen, dass neue Menschenkinder nachkamen und die Geburtsbäume gediehen, dass seine Familie endlich zurückkehrte, dass Menschen und Wilde Kinder zu vollwertigen Mitgliedern der Gesellschaft zählten … Dann konnte er sich darum kümmern, dass die letzten Glutherde der Schreckensherrschaft erstickt wurden, bevor irgendetwas Feuer fangen konnte.
Kapitel 5
Valentin wartete ungeduldig, bis Gerald aufgegessen hatte. Dann konnte er seine Fragen nicht mehr länger zurückhalten. »Nun? Wie hast du es geschafft, herüberzukommen? Ich habe dich nur zweimal gesehen. Einmal in einem Garten bei strahlendem Sonnenschein, einmal in fast völliger Dunkelheit. In der Schwärze habe ich dich eher gespürt als gesehen. Die Kälte und Nässe der Umgebung. Dein steifgefrorener Körper, dein erlöschendes Lebenslicht … ich glaubte nicht, dass du überleben würdest.«
»Und trotzdem habt Ihr mich nicht aufgegeben, Majestät. Ich habe Euch ebenfalls wahrgenommen, doch ich hatte meinen eigenen Eindrücken nicht vertraut. Im Sonnenschein hielt ich Euch für eine Spiegelung in den Glasfenstern des Herrenhauses, im Kerker glaubte ich, ich wäre vor Kälte und Schmerzen verrückt geworden. Oder ich würde einem Elfen zum Opfer fallen, und jeder weiß, welch bösartige Kreaturen das sind.«
»Was sind Elfen?« Nicht nur Valentin, auch der Lindengraf lehnte sich gespannt nach vorne, um Gerald zwischen dem Plappern der Kinder besser verstehen zu können.
»Kreaturen, die jeden in ihre Welt zerren, der gegen Sitte und Anstand verstößt. Wer einmal in der Elfenwelt landet, kehrt nie wieder zurück.« Er schmunzelte. »Vielleicht ist ›Elfen‹ nur ein anderes Wort für Euer Volk, Majestät. Die Worte ›Elfen‹ und ›Alveronen‹ liegen nicht so weit auseinander. Und genau wie in den Schreckensmärchen kehrt man nicht in die Menschenwelt zurück, wenn man bei Euch war, oder?«
Valentin runzelte die Stirn. »Ich bin mir nicht sicher. Ich selbst habe noch nie davon gehört, dass ein Mensch überhaupt zurückkehren wollte. Die Traumsuchenden, die ich sehe, scheinen mir in großer Not, vor allem die Kinder. Ohne Not würde sicher keines seine Eltern verlassen. Sie wünschen sich sehnlichst, fliehen zu können, und sie scheinen nicht zurückkehren zu wollen. So wie du.«
»So wie ich.« Gerald nickte. »Und Edith, wenn sie die Frau mit den blonden Locken ist, die Ihr beschreibt. Und so viele andere, die sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen.«
Der Lindengraf warf ein: »Es scheint mir nicht zu viel verlangt, ›Sitte und Anstand‹, wie du es nanntest, zu verfolgen.«
»Nun, galten früher Berührungen bei Euch als anständig? Wer hat entschieden, was anständig ist und was nicht? Wäre ich im Kerker gewesen, weil ich keine standesgemäße Partie für Edith war … ja, das hätte ich verstanden. Aber der Kunst wegen? Kunst ist in unserer Welt ein Laster, und das kann und will ich nicht akzeptieren. Malerei, Poesie …« Er blickte Valentin an. »… Musik.«
Valentin packte ihn am Arm. »Du willst sagen, dass Musik in der Menschenwelt ein Verbrechen ist? Wie absurd!«
»Genauso absurd, wie Berührungen zu verbieten.« Geralds Stimme wurde kalt. »Wie viele haben das hinterfragt? Wie viele haben es zugelassen, dass das, was ein Mensch braucht, bei Todesstrafe verboten ist? Menschen können nicht von Essen und Trinken allein leben, sie brauchen die Kunst. Essen und Trinken ist Nahrung für den Körper, doch Kunst ist die Nahrung der Seele. Und ohne Seele, was ist das Leben dann wert? Was glaubt Ihr, warum die Kinder zu Euch kommen? Egal, wie viel Angst sie vor Eurer Welt haben – die Seelenlosigkeit der eigenen Welt spüren sie jeden Tag, und irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem sie lieber auf den Ruf des Unbekannten hören, als weiter für die Art und Weise bestraft zu werden, wie ihre Seele Ausdruck sucht.«
»Welche Wortgewandtheit!« Der Lindengraf versuchte, die angespannte Stimmung mit Spott zu lösen. »Ihr hättet Poet werden können.«
»Das bin ich, Herr.« Gerald schaute ihn gleichmütig an. »Gärtner ist mein Beruf, Poesie ist meine Seele.« Die wehmütige Schwere in seiner Stimme ließ das Lächeln des Grafen erstarren. Gerald sprach weiter. »Ich habe um Hilfe gebeten, immer und immer wieder. In Gedichten, solange ich noch Worte sinnvoll zusammenfügen konnte. In Wortfetzen, in Fantasievorstellungen, als mir die Sprache versagte. Ich glaubte ganz fest daran, dass es irgendwo eine Macht gab, die das bewahren möchte, was menschlich ist.«
»Ja!« Valentin war aufgesprungen. »Gerald, ich gebe gern jedem Menschen, der mich um Hilfe anfleht, ein Zuhause. Denn es sind nicht nur die Menschen, die das Alverreich brauchen – wir brauchen die Menschen. Warum kommen keine Kinder mehr? Ohne Kinder geht unser Garten zugrunde, und dann …« Er sah Gerald hilfesuchend an. »… und dann unser ganzes Volk.«
»Es hat mit den Elfen zu tun, ganz sicher«, erwiderte Gerald. »Fabelwesen gibt es viele, doch seit Monaten häufen sich in meiner Gegend Geschichten über bösartige Elfen, die Kinder entführen.«
»Und was hat das –« Er sank zurück auf die Bank. »Verstehe.«
»Elfen haben es auf Kinder abgesehen, die zu viel Fantasie haben. Sobald ein Kind sich Geschichten ausdenkt, ersponnene Melodien vor sich hinsummt, Bilder von Wesen malt, die es nicht gibt … All das lockt angeblich die Elfen an.«
Der Lindengraf stellte die Frage, die Valentin auf der Zunge brannte: »Wenn ein Kind sich aber solche Dinge ausdenkt, würde es dann nicht gern mit einem Alveronen mitgehen? Wäre es nicht ein wunderbares Abenteuer?«
»Nicht, wenn einem die Erwachsenen erzählen, dass man stirbt, wenn man die Weltengrenze übertritt«, antwortete Gerald. »Und nicht nur das.« Er blickte zu den Kindern, die das Geschirr zusammenräumten, und senkte seine Stimme zu einem Flüstern. »Sterben ist zu abstrakt für Kinder. Den Geschichten nach tun die Elfen den Kindern Schlimmes an. Sie sperren sie im Dunkeln ein, vergehen sich an ihnen, reißen ihre Herzen heraus, fressen ihre Seelen …« Er schüttelte traurig den Kopf. »Früher waren es nur verhältnismäßig harmlose Drohungen von Feen und Wassermonstern. Elfengeschichten sind neu.«
Valentins Hoffnungen sanken ins Bodenlose. Er sah Gerald stumm an.
Der Lindengraf brach das Schweigen. »Vielleicht brauchen wir keine neuen Menschenkinder. Es sind nur die Bäume im Hain, die krank sind. Vielleicht sterben sie nicht, vielleicht ist dies hier nur die Natur, die uns den Übergang zu einem System der Körpergeburten aufzeigen will. Wenn es keine Geburtsbäume mehr gibt, hört die Diskriminierung unfruchtbarer Frauen auf –«
»Ich warte nicht, bis meine Frau krank wird, Graf!« Valentin hatte mit der Faust auf den Tisch geschlagen und biss die Zähne zusammen, um nicht vor Schmerz aufzuschreien.
Geschirr klirrte. Eines der Mädchen hatte einen Stapel Teller fallen gelassen und starrte Valentin erschrocken an. Tränen stiegen in ihren Augen auf. Sie begann, zitternd die Scherben aufzulesen.
»Es tut mir leid.« Valentin eilte zu ihr, um zu helfen, doch sie ließ alles fallen und rannte davon. Er kniete neben den Scherben und vergrub das Gesicht in den Händen. Ruhig. Er musste sich beruhigen. Es half niemandem, wenn er die Nerven verlor. Er atmete tief durch, einmal, zweimal. Er sammelte die Scherben zusammen und legte sie in einem Haufen auf den Tisch. Ein Junge näherte sich zögernd von der Seite und kehrte die Scherben in einen Eimer.
Valentin wandte sich an den Grafen. »Ich warte nicht, bis noch mehr Alveronen krank werden«, zischte er leise. »Oder sterben. Das ist kein Preis, den ich für ein neues System zu zahlen bereit bin.« Er versuchte mit aller Macht, Gedanken an seinen kieferngeborenen Großvater zu verdrängen. Waren Alveronen in der Menschenwelt genauso betroffen wie im Alverreich? Würde sein Großvater krank niederliegen, in der Fremde … Würde seine Familie überhaupt noch leben?
»Graf«, sagte er heiser. »Bitte, sucht meine Familie und bringt sie zurück. Ich werde inzwischen dafür sorgen, dass Menschenkinder ihre Angst vor den ›Elfen‹ verlieren. Niemand muss fürchten, dass wir ihnen etwas antun. Das Alverreich ist eine Heimat für alle verlorenen Seelen. Wir können uns gegenseitig heilen – wenn wir vertrauen.«
»Wie wollt Ihr das anstellen? Ihr könntet höchstens … Majestät, Ihr könntet spielen! Ihr könntet am Tor spielen und sicher mehr Kinder in einer einzigen Nacht herüberlocken als monatelanges Abmühen anderer Spielleute.«
»Ich danke Euch für Euer Vertrauen in meine Kräfte«, sagte Valentin ernst. Er dachte an Leah, die immerzu auf Reisen war und Notleidenden half. Er dachte an Rosa, die sich einer Gruppe angeschlossen hatte, die das alte System vertrat. An Alma, die nicht akzeptiert wurde, weil sie anders war. An Kinderheime, die geplant und gebaut werden mussten … »Es gibt zu viel zu tun im Königswald«, erwiderte er. »In zwei Wochen kehrt die Weidenkönigin zurück und ich kann …« Sie endlich in die Arme schließen. »… das Reich in treuen Händen zurücklassen, wenn ich mich entscheide, mein Glück am Tor zu versuchen.«
Er seufzte. »Ich zweifele nicht daran, dass es mir gelingt, Kinder anzulocken. Doch ich möchte sie nicht zwingen, sich in ihre größten Ängste zu stürzen.«
»Es gibt sicher einige, die verzweifelt genug wären«, beharrte der Graf. »Es ist die schnellste Lösung.«
»Die schnellste«, gab Valentin zu. Sein Blick ging zu Gerald, der mit dramatischen Gesten Kinderreime vortrug und die Kleinen zum Lachen brachte. »Doch nicht die beste. Ich werde …« Er zögerte. Würde es funktionieren? Ließ sich der Zauber umkehren, so einfach?
»Wachen, holt mir einen Zauberer her, ich habe eine Aufgabe für ihn.«
Der Lindengraf verschränkte die Arme vor der Brust. »Habt Ihr Zeit für einen Zauberer? Zauber dauern Wochen in der Vorbereitung.«
»Die Zeit muss da sein, denn die Alternative, Kinder zu zwingen, ist keine Lösung. Er muss die Traummagie umkehren. Statt Menschenkinder im Traum zu sehen, will ich, dass sie mich sehen. Ich will, dass ich sie in ihren Träumen aufsuchen und ihnen die Angst nehmen kann.«
»Es werden Albträume sein«, gab der Graf zu bedenken. »Menschen fürchten das, was sie nicht kennen.«
»Gibt es keine Märchen in der Menschenwelt? Wenn ich zu einer Märchenfigur werde, haben sie keine Angst. Ich kann ein Magier sein, ein Spielmann, ein Gaukler, ein Prinz … alles, was Kinder sich wünschen. Ich kann ihre Rettung sein, wenn sie ihrer Fantasie nur vertrauen. Wenn sie mir vertrauen.«
»Mehrere Wochen für den Zauber«, sagte der Graf. »Was wird inzwischen mit den Bäumen geschehen?«
Valentin schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht die Gesundheit unseres Volkes mit dem Leben von Menschenkindern bezahlen.«
»Auch nicht die Gesundheit Eurer Frau?«
Valentin biss sich auf die Lippen, bis er Blut schmeckte. »Wenn wir nur den schlimmen Ausgang sehen, haben wir schon verloren. Nur Mut, Graf. Vertraut mir.« Er ballte die Hände zu Fäusten, als könnte er damit seine Entschlusskraft stärken. Leah, seine Eltern, seine Kinder, Alveronen, Menschen … Das Gleichgewicht bekam tiefe Risse, und nur die Zeit würde zeigen, ob es ihm gelang, alle Teile wieder zu einer Einheit zu fügen, bevor es gänzlich zerbrach.
Kapitel 6
Wendelin hatte fünf Wochen für den Traumzauber veranschlagt, drei zugesagt bekommen und bei vier eingewilligt, es zu versuchen. Der Zauberer hatte knurrend darauf hingewiesen, dass starke Zauber Zeit brauchten – genau das gleiche Argument, das der Lindengraf Valentin vorgehalten hatte. Vier Wochen, in denen Valentin den erwachenden Sommer ignorierte, zerstreut der Politik folgte und sich immer mehr in sich zurückzog. Er schlief viel, als könnte er es erzwingen, von Menschenkindern gesehen zu werden. Doch er fand keine Kinder. Wenn Gerald recht hatte, waren alle von den Geschichten verstört. Keiner würde ihn mehr um Hilfe anflehen, keiner mehr dem Ruf ins Alverreich folgen. Er sah Edith, die es nicht herüberzuschaffen schien. Hatte sie Angst, den Klängen der Musik zu folgen? War ihre Liebe zu Gerald nicht stark genug, um erdachte Spukgeschichten in den Wind zu schlagen?
Er sah einen Mann mit blauen Augen und braunem Haar, das mehr und mehr von grauen Strähnen durchzogen wurde, als würden fünf Nächte im Alverreich fünf Jahren in der Menschenwelt entsprechen. Jede Nacht kniete der Mann vornübergebeugt und weinte. Er schien Valentin nicht wahrzunehmen, sah nicht die Hand, die er nach ihm ausstreckte. Er war in seinem Kummer versunken, Nacht um Nacht, und war doch blind für die Hilfe, die man ihm bot.
»Er will einfach nicht herüberkommen!« Valentin fuhr auf.
Leah schreckte neben ihm hoch. »Hast du wieder geträumt, Liebling?« Sie legte ihre Arme um ihn und zog ihn zu sich.
Valentins Anspannung schmolz. Er ließ sich fallen, wollte einen seligen Moment lang die Sorgen der Welten vergessen, doch es wollte ihm nicht gelingen. Leah küsste ihn zärtlich. »Es ist in Ordnung«, flüsterte sie. »Ich könnte mich auch nicht vor der Welt verschließen. Deine Seele ist einfach zu groß, du möchtest am liebsten alle in dein Herz aufnehmen, richtig?«
Er nickte stumm und schmiegte sich an sie. Sie ließ ihre Finger durch sein Haar gleiten. Die sanften Berührungen ließen ihn erschauern. »Kann es nicht immer so sein wie jetzt? Nur wir beide, ganz allein?«
Aus ihren Worten hörte er, dass sie lächelte. »Das willst du nicht wirklich. Du wärest immer noch ein Spielmann, wenn es das Glück im Kleinen wäre, das du erstrebst.«
»Ich will einfach nur meine Familie«, murmelte er. »Dich, Alma, Rosa, meine Eltern und Großeltern … meinetwegen deinen Bruder, auch, wenn wir nicht den besten Start hatten …« Er grinste.
»Sie werden zurückkommen, du wirst schon sehen. Verzweifle nicht an all dem, bei dem du nicht helfen kannst. Konzentriere dich auf das, was du tun kannst. Es dauert nur noch eine Woche, bis der Zauber fertig ist, und dann wirst du dich den Menschenkindern zeigen können.« Sie küsste ihn auf die Nasenspitze.
Er zog sie zu sich heran und ließ seine Hände über ihren Rücken wandern. Ihm kam es so vor, als hätte er in den langen Wochen ihrer Abwesenheit vergessen, wie sich ihr Körper anfühlte, und müsste nun alles neu erkunden. Seine Lippen folgten seinen Händen.
Leah drehte sich von ihm weg. »Ich bin plötzlich sehr müde«, murmelte sie schlaftrunken. »Die letzten Tage waren wohl anstrengender, als ich –« Ihre Stimme brach weg.
Valentin lauschte ihren tiefen, gleichmäßigen Atemzügen. So sehr es ihm nach ihr verlangte, er würde nicht ihrer wohlverdienten Ruhe im Weg stehen. Er drückte einen letzten Kuss auf ihre Wange, kuschelte sich an sie heran und schlief erneut ein. Dieses Mal schlief er traumlos, bis der Morgen dämmerte.
Als er erwachte, huschten Schauer durch seinen Körper. Er fror nie. Die ständige Arbeit im Freien hatte ihn Temperaturschwankungen gegenüber unempfindlich gemacht, und das Gefühl von Kälte um ihn herum verwirrte ihn. Vielleicht war er wieder in einem Traum und spürte die Kälte, die einen Traumsuchenden umgab. Warum sonst sollte er im Bett frieren, wenn er unter Decken eingekuschelt war und seine Frau neben ihm lag?
Er beugte sich hinüber, um ihr einen sanften Kuss auf die Wange zu geben. Kälte umspülte ihn, und als er seine Lippen auf Leahs Haut presste, zuckte er zurück. Sie war kalt. Leah war kalt. Ihre Haut hatte die rosige Farbe verloren und trug einen Grauton, Schweißperlen standen auf ihrer Oberlippe, doch die Haut fühlte sich kalt an, als sei dies in der Tat ein Traum, ein Albtraum. Als sei sie –
»Leah, wach auf! Leah!« Er rüttelte sie. »Leah!« Er schrie. »Wach auf!«
Ein abgehackter Atemzug ließ ihn hoffen. Er zog sie an sich. »Leah, Liebes, wach auf!« Kälte flutete seinen Körper. Leahs Atem erklang stoßweise an seinem Ohr. Er verringerte den Druck, setzte sie auf und stopfte Kissen unter ihren Rücken. »Sitzen, du musst sitzen, dann atmet es sich leichter. Geht es? Bekommst du Luft?«
»Geht … so …« Leah keuchte. Sie lehnte ihren Kopf an Valentins Schulter. »Halt … mich fest …«
Grausen kroch durch seinen Körper. Er schlang die Arme um ihren Oberkörper und presste sie an sich, als könnte er sie für immer festhalten, als würde er nicht spüren, wie das Leben aus ihr herausfloss. »Es ist noch nicht so weit, du wirst mich nicht verlassen!« Er vergrub das Gesicht in ihrem Haar. Es hatte seinen Duft verloren, Leahs charakteristischen Duft, nach würzigen Kräutern, weißen Blüten, Waldluft nach dem Regen … Valentin riss seinen Kopf weg und schrie: »Es ist noch nicht so weit!« Tränen strömten unaufhaltsam über sein Gesicht. »Bleib bei mir! Bleib bei mir …«
Ihr stoßweiser Atem hatte sich beruhigt und erklang nun gleichmäßig an seinem Ohr. Die ersten Sonnenstrahlen brachen durchs Fenster und vertrieben das Grau und die Kälte des frühen Morgens. Mit der Wärme breitete sich Hoffnung aus. Es war noch nicht vorbei, so schnell nicht. Es war noch Zeit. Er würde sie retten. Er würde ein Menschenkind holen, bevor es zu spät war, bevor irgendjemand sein Leben lassen musste. Und es war ihm egal, was die Folgen waren. Zu früh für den Zauber? Egal. Zu schnell, um das Vertrauen eines Kindes zu gewinnen? Egal. Hier ging es darum, Leben zu retten, und was auch immer er tun müsste, er würde nicht davor zurückschrecken.