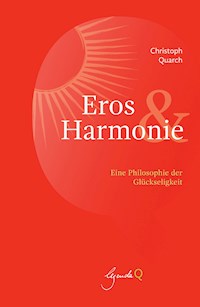
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Christoph Quarch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Glück - wie viel Zauber und Verheißung klingen mit in diesem Wort! Und wie viel Missverständnis und Enttäuschung! Beides hat damit zu tun, dass Glück zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gedeutet wurde, aber nicht alle Deutungen des Glücks dem Glück der Menschen dienlich waren. Christoph Quarch bringt Licht in dieses Durcheinander und schlägt eine praktikable Formel für das Glück vor: Glücklich sind wir, wo wir mit der Welt und uns im Einklang sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Quarch
Eros
&
Harmonie
Eine Philosophie der Glückseligkeit
„Freilich ist ein glückseliges Leben keine ganz einfache Sache.“
Seneca
INHALT
Sonnenlicht und Blumenblick
Einleitende Bemerkungen zum Glück in glückloser Zeit
1 Beate, Felicitas, Fortuna.Drei Damen, die das Glück bedeuten
2 Vom Diesseits ins Jenseits und zurück
Wie das große Glück der Griechen zur happiness verkam
Happiness – das kleine Glück des modernen Menschen
Eudaimōnía und Beatitudo – vom diesseitigen Glück des Weisen zum jenseitigen Glück des Christen
a) Aristoteles
b) Augustinus
Harmonie – das große Glück des ganzen Menschen
a) Sokrates und die Sophisten
b) Platon
3 Unverfügbar, zeitlos, schwebend
Wie Harmonie erfahren wird
„Sämtliche Räder kreisten“. Die Gabe der Fortuna
„Mitsingen im Chor der Sphären“.Eingestimmt in die Harmonie des Kosmos
„Ward die Welt nicht eben vollkommen?“Das große Glück schwingt in der Schwebe
4 Bildung, Ästhetik, Lebenskunst und Mystik
Viele Wege führen zum Glück – aber nicht alle machen glücklich
Paideía – Glück durch Bildung?
a) Platons Weg zum guten Leben
b) Humboldts Bildungsprogramm
Ästhetik – Glück durch Schönheit?
a) Nietzsches Willen zur Macht
b) Schmids Aneignung des Lebens
Mystik – Glück durch Einung?
a) Aufgabe des Eigenwillens
b) Gelassenheit gegenüber dem Kreatürlichen
c) Bildung als Ent-Bildung
d) Empfänglichkeit und Jungfräulichkeit
e) Fruchtbarkeit, Tätigkeit, Weib-Sein
5 Erotik - Der Weg der Liebe führt zum Ziel
a) Hingerissen vom Schönen
b) Zwischen Göttern und Menschen
c) Sowohl weiblich als auch männlich
d) Zum Sex, im Sex und über ihn hinaus
e) Der Geist der Schwebe
f) Verliebt im weiten Meer der Schönheit
6 Verliebe dich ins Leben!
Der erotische Imperativ und zehn Vorschläge, wie Sie ihn befolgen können
1. Erkenne dich selbst! Philosophie – im Einklang mit der Wahrheit
2. Lass dich los und schau hin! Kontemplation & Meditation - im Einklang mit dem, was ist
3. Lass dich bewegen! Wellness, Sport, Kunstgenuss – im Einklang mit Leib und Sinnen
4. Lass gut sein! Seelenforschung – im Einklang mit der eigenen Herkunft
5. Sei dankbar! Achtsamkeit – im Einklang mit deiner Umgebung
6. Sei schöpferisch! Kreativität – im Einklang von Empfänglichkeit und Schaffen
7. Mach dich schön! Kosmetik und Tanz – im Einklang von Leib und Seele
8. Tu den ersten Schritt! Kommunikation – im Einklang mit anderen
9. Spiel mit! Spielen – im Einklang mit dem Leben
10. Bleibt der Erde treu! Demut – im Einklang mit der Endlichkeit
ANMERKUNGEN
ÜBER DEN AUTOR
IMPRESSUM
Sonnenlicht und BlumenblickEinleitende Bemerkungen zum Glück in glückloser Zeit
»Was ist Glück?« – es ist wohl eine der ältesten Menschheitsfragen, die auf den ersten Seiten von Jutta Bauers Kinderbuch Selma(1) aufgeworfen wird – und zwar von einem depressiv ins Leere blickenden Fuchs vor einem halb leeren Glas Rotwein. Da er mit der Frage nicht weitergekommen sei, so lässt uns dieser menschliche, allzu menschliche Repräsentant unserer Gegenwart wissen, habe er den unschwer als Philosophen auszumachenden großen Widder konsultiert, der seine Frage mit der Geschichte des Schafes Selma beantwortet habe. Selma sei auf beispielhafte Weise glücklich, da sie sich nicht mehr und nicht weniger wünsche als das, was sie ohnehin tut: Gras fressen, Sport treiben, plaudern, gut schlafen. Also sprach der große Widder.
Jutta Bauers Büchlein wurde ein Bestseller. Groß ist offenbar die Zahl derer, die sich mit dem rat- und rastlos nach Glück suchenden Fuchs identifizieren. Und groß ist die Zahl derer, die von dem einfachen Glück des Schafes Selma träumen – und doch nicht glücklich sind. Tatsächlich nämlich belehren uns Sozialwissenschaftler und Statistiker darüber, dass unsere an materiellen Gütern reiche und freie westliche Welt im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen eine Region mit einem außergewöhnlich niedrigen Glücksquotienten ist – ganz anders als materiell arme Länder wie Bhutan oder Bangladesch, deren Einwohner sich weit häufiger als glücklich erleben. Irgendwie scheint es mit dem Glück schwieriger zu sein, als uns die reizende Geschichte von Selma, dem wunschlosen Schaf, glauben machen möchte.
Kein Wunder daher, wenn in unseren Breiten das Geschäft mit dem Glück boomt. Jedenfalls steht in eigentümlichem Kontrast zu der vom großen Widder propagierten Einfachheit des Glücks eine nicht mehr zu überblickende Vielfalt von Traktaten, Ratgebern und Abhandlungen über das Glück. Und das nicht erst seit gestern: Von dem römischen Autor Varro wissen wir, dass zu seiner Zeit bereits 288 verschiedene Lehrmeinungen über das Glück existierten (2), und allein aus der Zeit der französischen Aufklärung sind mehr als 50 selbstständige Traktate über das Glück überliefert (3). Doch dies alles hält die Menschen der westlichen Welt nicht davon ab, sich mit neuer und besonderer Verve des Glücks anzunehmen. Der literarische Erfolg von Selma ist nur ein besonders prägnantes Beispiel für die anhaltende Hochkonjunktur des Glücks. Nicht nur Kinderbuch und BILD-Zeitung („Das Glück kam mit dem Alter“) haben sich des Themas angenommen, auch Spiritualität, Philosophie und Wissenschaft scheuen sich nicht mehr, dem Glücke nachzujagen: So rangierte lange Zeit Der Weg zum Glück(4) des Dalai-Lama auf den obersten Plätzen der Bestseller-Charts, mit seiner Philosophie der Lebenskunst(5) gelang es dem Philosophen Wilhelm Schmid in den 1990er-Jahren, das Nachdenken über das Glück akademisch wieder hoffähig zu machen, und im Grenzland zwischen Psychologie und Neurophysiologie hat sich derweil eine eigene empirische Glückswissenschaft etabliert(6), die präzis zu beschreiben beansprucht, was mit uns geschieht, wenn wir glücklich sind. Nur: Was Glück wesentlich ist und wie wir am Ende wirklich glücklich werden – das kann auch sie uns nicht sagen. Und so stehen denn zeitgenössische Glückssehnsucht, Glücksverheißung und Glückserfahrung in einem merkwürdigen Missverhältnis.
Solche Merkwürdigkeiten laden zum Nachdenken ein. Und allein deshalb scheint es angezeigt, dem Reigen der Glücksbücher ein weiteres hinzuzufügen – eines, das der Sorge entwächst, die Konjunktur des Glücks könnte sich bei näherer Betrachtung als Inflation erweisen: als Korruption, in deren Folge das Glück erst banalisiert und dann entwertet wird. Denn: Wer vermag noch, den Reichtum und die Tiefe des Wortes Glück zu erahnen, wenn jeder Zigarettenautomat die fahle Parole: „Rauchen macht glücklich“ ausgibt? Wer spürt noch den Zauber und die Verheißung dieser fünf Buchstaben, wenn das Glück als erwerbbare Ware auf dem Marktplatz feilgeboten wird? Wer hat noch den Sinn und das Gespür eines Hermann Hesse, aus dessen Feder die wohl schönste Meditation über das Wort Glück stammt:
Glück. Es ist eins von den Wörtern, die ich immer geliebt und gern gehört habe. Mochte man über seine Bedeutung noch so viel streiten und räsonieren können, auf jeden Fall bedeutete es etwas Schönes, etwas Gutes und Wünschenswertes. Und dem entsprechend fand ich den Klang des Wortes. Ich fand, dieses Wort habe trotz seiner Kürze etwas erstaunlich Schweres und Volles, etwas, was an Gold erinnerte, und richtig war ihm außer der Fülle und Vollwichtigkeit auch der Glanz eigen, wie der Blitz in der Wolke wohnte er in der kurzen Silbe, die so schmelzend und lächelnd mit dem GL begann, im Ü so lachend ruhte und so kurz, und im CK so entschlossen und knapp endete. Es war ein Wort zum Lachen und Weinen, ein Wort voll Urzauber und Sinnlichkeit; wenn man es recht empfinden wollte, brauchte man nur ein spätes, flaches, müdes Nickel- oder Kupferwort neben das goldene zu stellen, etwa Gegebenheit oder Nutzbarmachung, dann war alles klar. Kein Zweifel, es kam nicht aus Wörterbüchern und Schulstuben, es war nicht erdacht, abgeleitet oder zusammengesetzt, es war Eins und rund, war vollkommen, es kam aus dem Himmel oder aus der Erde wie Sonnenlicht und Blumenblick.(7)
Sonnenlicht und Blumenblick – nicht erdacht und nicht erfunden: Glück ist ein Wort, das aus dem Herzen kommt, ein Wort das mit dem Herzen gehört und mit dem Herzen verstanden sein will. Wenn wir uns auf den folgenden Seiten anschicken, über das Glück nachzudenken, dann mit dieser Zielrichtung: dem Glück seinen Zauber zurückzugeben, diese zarte und empfindliche Pflanze vor Inflation und Vermarktung zu schützen, um ihr dann einen Ort in der Mitte des Lebens zu geben.
Aber um dorthin zu gelangen, ist es zunächst wichtig, sich von den Bildern und Konzepten zu befreien, die das Glück entstellt und seine Kommerzialisierung möglich gemacht haben – denn ob wir wollen oder nicht: immer sitzen uns Bilder und Verheißungen, Ideen und Ideologien wie Brillengläser auf der Nase und verzerren unseren Blick auf das Leben. So lässt sich häufig beobachten, dass eine bestimmte Idee vom Glück, ein bestimmtes Bild, das uns von irgendwoher zugeflogen ist und mit dem wir uns – warum auch immer – identifizieren, uns von unserem Glück abhält: weil wir uns eine Idee zum Maßstab nehmen, die nicht unsere ist, die nicht unserem Herzen erwächst, sondern die gedacht, konzipiert, proklamiert worden und deren Saat mit den Winden der Ideengeschichte dem Garten unserer Seele zugeflogen ist, wo sie sich nunmehr zu wuchern anschickt. Da haben sich Ideen eingenistet, die uns gänzlich überfordern: die uns ein Glück in Aussicht stellen, das nicht das Glück von Menschen, sondern die Seligkeit von Göttern (oder auch von Schafen) ist. Wo solche Ideen sich um unser Leben ranken, verschatten sie jeden Sonnenglanz: Selbst wo wir glücklich sein könnten, sind wir es doch nicht, da wir Maßstäben und Kriterien folgen, die in Wahrheit gerade nicht unsere Maßstäbe und Kriterien sind. Andererseits gedeihen im Garten der Seele ebenso Konzepte, die viel zu kurz greifen: Glücksverheißungen, die leicht erreicht werden, die aber nie einlösen, was sie versprechen (etwa: „Einfach glücklich sein. Jetzt“) und daher stets durch neue, ebenso billige Konzepte ersetzt werden können. Nein, wir müssen zunächst Unkraut jäten, bevor Blumenblick und Sonnenglanz des Glücks unser Herz erleuchten können; wir müssen Ideen kultivieren, die unserem Herzen und Leben entsprechen: die uns das rechte Maß geben.
Und hier ist die Philosophie gefragt. Denn deren Geschäft ist es seit Sokrates, uns in der alltäglichen Gedankenlosigkeit zu erschüttern, mit der wir die Zauberworte und Wahrheiten des Lebens daher plappern und uns dabei zumeist auch noch einbilden zu wissen, wovon die Rede ist. Das Gerede – wie Martin Heidegger unser achtloses und seichtes Alltagsbewusstsein nannte –ist eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu einem erfüllten, eigentlichen und glücklichen Leben.
Dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen, war der erste und wichtigste Schritt der philosophischen Gesprächskunst des Sokrates, dieses Meisters einer „wissenden Unwissenheit“, deren Wahlspruch lautet: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“. Zu den Erfahrungen des Sokrates gehörte freilich auch, dass man sich keineswegs Freunde damit macht, Menschen in ihrem Alltagsbewusstsein zu erschüttern – vor allem dann nicht, wenn man sie in ihrem Verständnis gerade derjenigen Konzepte erschüttert, mit denen sie sich identifizieren, auf denen sie ihr Selbstverständnis und Selbstwertgefühl bauen. Glück ist ein solches Konzept. Wer Menschen in ihrem Verständnis vom Glück in Frage stellt, läuft Gefahr, Hass und Ablehnung zu ernten. Sokrates wurde zum Tode verurteilt.
Nun steht dies in unseren Tagen – Gott sei Dank – nicht mehr zu erwarten, und so machen wir uns frohgemut daran, die Philosophie – im Sinne des Sokrates – als einen geistigen Weg wiederzuentdecken: als Weg zu einem in sich stimmigen, gelingenden, glücklichen Leben – als Weg zum großen Glück. Es geht auf diesem Weg weder darum, neues Wissen anzusammeln, noch wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis zu gewinnen. Es geht darum, die Oberfläche unseres alltäglichen Geredes zu durchstoßen, in die Tiefe zu gehen, um dort die Weisheit freizusetzen und zuzulassen, die in unseren Herzen immer schon da ist. Und es geht darum, dieser Weisheit Ausdruck zu verleihen, ohne sie dabei sogleich wieder zu banalisieren, trivialisieren, korrumpieren. Es geht darum, vom Glück zu reden, ohne dabei dem Gerede zu verfallen. Aus eben diesem Grunde trägt dieses Buch nicht den Untertitel: Eine Philosophie des Glücks, sondern: Eine Philosophie der Glückseligkeit. Dieses etwas altertümlich anmutende Wort soll uns davor bewahren, allzu vorschnell dem alltäglichen Gerede vom Glück aufzusitzen.
Nun gibt es viele Möglichkeiten, auf die Frage nach dem Glück zu antworten. Man kann es – wie schon die Gesprächspartner des Sokrates – mit einer Definition versuchen. So gehen Lexika vor. Etwa das Lexikon für Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG): „Glück meint das Gelingen des Lebens.“(8) Oder die Brockhaus Enzyklopädie, die Glück definiert als „seelisch gehobener Zustand, in welchem der Mensch mit seiner Lage und seinem Schicksal einig und sich dieser Einhelligkeit gefühlsmäßig bewusst ist“. Wer es gerne kurz und prägnant hat, kann Staatsmänner konsultieren, haben diese doch stets eine Neigung zu präzisen Aussagen. So formulierte, kurz nachdem Thomas Jefferson 1776 in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung das Streben nach Glück (pursuit of happiness) in den Rang eines bürgerlichen Grundrechts erhoben hatte, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten, John Adams, kurz und knapp, Glück bestehe aus ease, comfort, security: Wohlbehagen, Zufriedenheit und Sicherheit(9). Damit aber sollten wir uns nicht zufriedengeben. So schreibt Ludwig Marcuse in seiner Philosophie des Glücks:
Zwar wird an jedem Tag von neuem und leichtsinnig der Versuch gemacht, es [das Glück] säuberlich zu definieren. Doch diese kleinen definitorischen Sätzchen, die so duftig und adrett antworten auf die Frage: was ist Glück?, decken sie nur mit ärmlichen Antworten zu. Sie setzen hinter eine lange Geschichte des Nachdenkens – eine kurze Gedankenlosigkeit. […Die lange Reihe der Definitionen zeigt] was alles schon einmal jemand glücklich gemacht hat; wie vielfältig der Mensch Glück hervorgebracht hat. Das eine Glück erhält seine vielen Gesichter von den zahllosen Ursprüngen, aus denen es wuchs. Das große Glück ist wahrscheinlich kein Plural; aber seine Herkunft ist plural. Und alle herrischen, beschränkenden, beschränkten Definitionen: „Glück ist…“, stammen aus dem Irrtum, dass Glück nur auf einem Wege entstehen kann.)(10)
Definitionen, so will uns Marcuse sagen, sind entgegen ihrer Anmutung stets subjektiv und entsprechend relativ auf die Erfahrungen dessen, der sie formuliert hat. So gesehen wäre es redlicher, direkt von diesen Erfahrungen zu erzählen, um so der unhintergehbaren Individualität des Glückserlebens Rechnung zu tragen. Denn solche Zeugnisse sind kostbar, auch wenn sie uns – beziehungsweise gerade weil sie uns – keine allgemeingültigen Sätze zumuten, sondern gelebte Erfahrung vermitteln. Zwar muss hier Marcuses Warnung ernst genommen werden, man könne Gefahr laufen, sich in ein fremdes Glück einzuleben und dabei sein eigenes zu versäumen, doch darf man mit ihm ebenso festhalten, dass „dies vorbildliche Glück nicht gleichgültig“ ist. Es „schenkt zwar kein Rezept, nicht einmal eine Definition. Aber macht Mut zum eigenen Glück; nährt das eigene Talent zum Glück. Und belehrt mich über die Wege, die gangbar, und die Wege, die nicht gangbar sind – zu meinem Glück“ (11).
Verzicht auf Definitionen – Erzählen von Geschichten. Ist es damit wirklich getan? Können wir uns darauf beschränken, wenn uns darum zu tun ist, Sonnenlicht und Blumenglanz des Glücks zurückzugewinnen? Wohl nicht, denn am Ende können Geschichten doch nicht mehr sein als ein Wegweiser, ein Ansporn, eine Aufforderung zum Glück. Sie legen allenfalls Spuren zur Glückseligkeit, ebenso wie jede (brauchbare) Definition eine Spur zu ihr legt. Doch wollen wir diesen Spuren folgen. Denn eben dies ist das Geschäft der Philosophie: dass sie sich anschickt, aus Definitionen und Geschichten, die von dem oder über das infrage stehende Thema vorgetragen werden, ein Gemeinsames zu destillieren, das nicht als Summe oder Extrakt des Vorgetragenen verstanden werden darf, sondern als die Resonanz, die durch Definitionen und Geschichten in unseren Herzen zum Schwingen gebracht wird, weil sie mit der Erfahrung unseres Lebens übereinstimmt. Nur wenn es uns gelingt, diese Resonanz zu vernehmen, werden wir in der Lage sein, uns den ursprünglichen Glanz der Glückseligkeit zu erschließen.
Aus diesen Erwägungen ergeben sich die Abschnitte des geistigen Weges, die in diesem Buch gegangen werden sollen. Am Anfang steht der Versuch, ein wenig Ordnung in unseren Sprachgebrauch zu bringen – uns ein Stück weit über die Konfusion unseres Geredes aufzuklären: Welche Bedeutungen klingen an und schwingen mit, wenn vom Glück die Rede ist? Und wo liegen bereits auf der rein begrifflichen Ebene die Quellen von Missverständnissen und Irrungen? (Kapitel 1)
Diese Fragen verweisen uns auf die Geschichte des Glücks. Wir sollten uns keinen Augenblick darüber täuschen, dass unsere Bilder und Vorstellungen, unsere Assoziationen und Träume vom Glück das Produkt einer Jahrtausende währenden Ideengeschichte sind, in deren Strom wir – ob wir wollen oder nicht – hineingeworfen sind. Um einen freien und unvorbelasteten Zugang zum – eigenen – Glück, zum Glück des eigenen Herzens zu gewinnen, ist es für eine philosophische Lebenskunst unausweichlich, sich über diese Geschichte zu verständigen, um zu entdecken, wie sich in ihrem Verlauf die Konzepte und Theorien des Glücks verändert haben – wie Ursprüngliches entstellt und durch Neuartiges ersetzt wurde. Dabei wird es uns gerade um dieses Ursprüngliche zu tun sein: die Philosophie des antiken Griechenlands, hat diese doch gegenüber allem, was nach ihr kommt, den unschätzbaren Vorteil, nicht durch eine lange Reihe von begrifflichen Aus- und Umarbeitungen belastet zu sein. In Krisen des europäischen Geistes – und unser (Miss-)Verhältnis zum Glück ist das Symptom einer solchen Krise – hat es sich noch immer als hilfreich erwiesen, den Weg zurück zu den Griechen anzutreten, da sie es sind, die uns den Blick für die Unmittelbarkeit unseres Lebens lehren können. (Kapitel 2)
Die alte griechische Theorie vom Glück führt uns auf das Gemeinsame, das Menschliche, das Geheimnisvolle unseres eigenen Herzens, das es nun zu Bewusstsein zu bringen gilt. Im dritten Abschnitt wird es darum gehen, anhand dreier ausgewählter literarischer Glücksbeschreibungen die erarbeiteten Kennzeichen der Glückseligkeit mit menschlichen Glückserfahrungen abzugleichen. (Kapitel 3)
Damit sind wir gut vorbereitet, um uns die Frage zu stellen, die wohl allen unter den Nägeln brennt: Wie wird man glücklich? Die Antwort erfolgt in drei Anläufen: Zunächst, indem wir uns vier gängige und Erfolg versprechende Lebensmodelle anschauen, die den Anspruch erheben, uns Menschen zum Glück zu geleiten: Paideía und Bildung, Ästhetik und Kunst, philosophische Lebenskunst und Mystik. (Kapitel 4)
Dabei wird sich zeigen, dass sie alle – bei allen unbestreitbaren Verdiensten – am Ende allein für sich nicht befriedigen können. Deshalb werden wir neuerlich eine Anleihe bei den alten Griechen machen und eine Lebensform anschauen, die sich mit dem Namen des Eros verbindet und sich daher trefflich als erotische Lebenskunst bezeichnen lässt – allerdings nur, wenn man sich aller modernen Assoziationen enthält, die den Namen des Eros entstellt und in Misskredit gebracht haben. (Kapitel 5) Und im Schlusskapitel (Kapitel 6) wird diese erotischen Lebenskunst mit einigen praktischen und konkreten Anwendungsbeispielen angereichert werden.
Auf diesem Weg, liebe Leserin und lieber Leser, sind Sie selbst gefordert. Wichtiger als das geschriebene Wort ist Ihr Mit- und Nachdenken – ist, dass Sie das Gelesene im Herzen bewegen und immer wieder zu Ihrer Lebenswirklichkeit in Bezug setzen. So sind Sie Gesprächspartner/-in und Mitautor/-in in einem. Lassen Sie uns nun gemeinsam aufbrechen.
1. Beate, Felicitas, Fortuna Drei Damen, die das Glück bedeuten
Was ist Glück? – fragen wir noch einmal diese Frage aller Fragen. Aber fragen wir sie richtig! Fragen wir aus der Mitte unseres Herzens, in dessen Tiefe die Antwort verborgen ist, die wir ihm doch erst über den Umweg des Denkens abringen müssen. Machen wir uns frei von allen fertigen und vorgefertigten Antworten, die uns auf der Zunge liegen und in denen wir so gerne von unseren Ratgebern und Lehrern bestätigt werden wollen. Fragen wir ins Offene, auch wenn das bedeutet, dass wir uns dabei selbst in Frage stellen lassen müssen. Fragen ist nicht nur, wie Heidegger sagte, die „Frömmigkeit des Denkens“ (12), Fragen ist überhaupt der Anfang aller Philosophie. Denn Fragen öffnet – und nur wer offen ist, kann Erfüllung finden. Fragen wir also mit dem depressiven Fuchs aus Selma, fragen wir mit allen aufrichtigen Glückssuchenden: „Was ist Glück?“ – Und lassen wir uns für einen Augenblick ein auf die Antwort jenes wunderlichen Philosophen, der uns von Jutta Bauer als großer Widder vorgestellt wird:
Es war einmal ein Schaf. Das fraß jeden Morgen bei Sonnenaufgang etwas Gras, lehrte bis mittags die Kinder sprechen, machte nachmittags etwas Sport, fraß dann wieder Gras, plauderte abends etwas mit Frau Meier, schlief nachts tief und fest. Gefragt, was es tun würde, wenn es mehr Zeit hätte, sagte es: „Ich würde bei Sonnenaufgang etwas Gras fressen, ich würde mit den Kindern reden – mittags, dann etwas Sport machen, fressen, abends würde ich gern mit Frau Meier plaudern. Nicht zu vergessen: ein guter, fester Schlaf.“ – „Und wenn Sie im Lotto gewinnen würden?“ – „Also, ich würde viel Gras fressen, am liebsten bei Sonnenaufgang, viel mit den Kindern sprechen, dann etwas Sport machen, am Nachmittag Gras fressen, abends würde ich gerne mit Frau Meier plaudern. Dann würde ich in einen tiefen festen Schlaf fallen.“
So die Geschichte von Selma, dem Schaf, geschrieben 1997. Als habe er diese Geschichte antizipiert, verfasste mehr als 100 Jahre zuvor einer, der sich selbst gern als den Philosophen des 21. Jahrhunderts bezeichnete, einen Abschnitt, der sich wie eine Entgegnung auf Jutta Bauers ländliche Idylle liest: Im ersten Abschnitt seiner Unzeitgemäßen Betrachtung „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben“ schreibt Friedrich Nietzsche:
Betrachte die Heerde, die an dir vorüberweidet: sie weiss nicht was Gestern, was Heute ist, springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblickes und deshalb weder schwermüthig noch überdrüssig. Dies zu sehen geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschenthums sich vor dem Thiere brüstet und doch nach seinem Glücke eifersüchtig hinblickt – denn das will er allein, gleich dem Thiere weder überdrüssig noch unter Schmerzen leben, und will es doch vergebens, weil er es nicht will wie das Thier. Der Mensch fragt wohl einmal das Thier: warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Thier will auch antworten und sagen, das kommt daher dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte – da vergass es aber auch schon diese Antwort und schwieg: so dass der Mensch sich darob verwunderte.(13)
Nietzsche, der selbst ernannte „Philosoph mit dem Hammer“, zertrümmert in diesem Passus mit einem gezielten Schlag unsere Selma-Idylle: Das Glück des Tieres ist eine Illusion – es ist das Glück der Geschichts- und Zeitlosigkeit oder wenigstens doch das Glück des Vergessens. Der Mensch aber vergisst nicht so leicht. Er ist ein zeitliches und geschichtliches Wesen und wird deswegen nie das einfache Glück einer Selma teilen können. Dagegen mag man einwenden, dass dies im Ganzen sicher zutrifft – dass wir es aber ungeachtet dessen doch darauf anlegen können, uns wenigstens für einen Augenblick einmal an den „Pflock des Augenblicks“ zu legen: ganz im Hier und Jetzt zu sein und eben darin die Zeit- und Geschichtslosigkeit des Tieres zu teilen. Tatsächlich legen nicht wenige spirituelle Lehrer ihren Adepten diese Strategie nahe – und wir werden sehen, dass sie nicht unrecht daran tun. Und doch ist es gut, sich klarzumachen, dass sich damit ein Konzept von Glück verbindet, das sich vorderhand nicht am menschlichen, sondern am tierischen Leben ausweisen lässt – ein sonderbares Glück, das uns abverlangt, all das auszublenden, was landläufig den Menschen vom Tier unterscheidet und ihm gegenüber seine Würde begründet:
Bewusstsein: die Fähigkeit, sich zu sich selbst ins Verhältnis zu setzen
Zeitlichkeit: das Vermögen, zu erinnern und vorauszuschauen
Identität: das Wissen um die Kontinuität des eigenen Daseins
Freiheit: die Ungebundenheit vom Unmittelbaren
Stattdessen: Bewusstlosigkeit, Zeitlosigkeit, Identitätslosigkeit und Gebundenheit an das Jeweilige, Je-Tunliche, Je-Anstehende. Und – merkwürdig genug – dennoch blicken wir, wie Nietzsche formuliert, eifersüchtig nach diesem Glücke hin, verspricht es doch Freiheit von Schmerz und Überdruss. Offenbar ist es genau dies, was am Tier zu sehen den Menschen „hart angeht“, weil er in seiner Glückssehnsucht davon träumt und doch weit davon entfernt bleibt. Denn wo ist der Mensch, der nicht von Langeweile gemartert ein Selma-Leben führen würde: Gras fressen, mit den Kindern reden, Sport treiben, Gras fressen, plaudern – von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr? Hier wird deutlich, dass wir über unser Menschsein nachdenken müssen, wenn wir verstehen wollen, was menschliches Glück ist. So müssen wir uns fragen, was es über unser Bild von uns selbst sagt, wenn wir auf die Idee kommen, das Glück außerhalb unserer eigenen Existenz zu suchen: bei Tieren oder auch – vor allem in früherer Zeit – bei Göttern?
Götter und Tiere haben eines gemeinsam, das sie vom Menschen unterscheidet: Zeitlosigkeit. Für die alten Griechen war es selbstverständlich, dass die Götter die Unsterblichen sind: diejenigen, denen nicht irgendwann die Stunde schlägt, diejenigen, die nicht den Gesetzen von Alter und Verfall preisgegeben sind, sondern sich in ewiger Jugend ihres Daseins freuen. Frei sind sie von Überdruss und Schmerzen, denn fremd ist ihnen das Wissen vom Ende, der Begrenztheit der Zeit. Wohl wissen sie um ihre Unsterblichkeit, sie sind sich ihrer selbst bewusst, und eben deshalb haben sie Geschichte – eben deshalb können wir Geschichten von ihnen erzählen. Das Glück der Götter ist nicht geschichtslos, da es nicht bewusstlos ist. Aber es ist zeitlos, da ihnen die Zeit nichts anhaben kann. Das ist beim Tier anders: Die Zeitlosigkeit des Tieres gründet in seiner – mutmaßlichen – Geschichts- und Bewusstlosigkeit. Eine Selma kann sich nicht zu sich selbst ins Verhältnis setzen und weiß deshalb nicht, dass sie eine Identität hat, die sich vom eben ins gleich fortschreibt. Sie vergisst, wie Nietzsche sagt, jeden Augenblick den vorherigen – kurz angebunden, unfähig aufzublicken und festzustellen, dass sie eine Geschichte hat.
Wenn wir uns das Glück in Gestalt einer Selma ausmalen, dann blenden wir diesen Aspekt aus. Wir tun so, als könne Selma befragt werden und im Lotto gewinnen. Wir stellen uns vor, sie verfüge über Bewusstsein und sei doch aller Schmerzen und allen Überdrusses enthoben. Kurz: Wir dichten ihr ein Glück an, das nicht menschlich ist und das traditionell eher als das Glück der Götter denn als das Glück der Tiere gedacht wurde. Damit sind wir mitten hineingeworfen ins Schlamassel unserer Begrifflichkeit. Zwar haben wir uns angewöhnt, beim zeitlosen Glück der Götter von „Glück“ zu reden, doch wäre es präziser, dafür andere Begriffe zu verwenden, die nur leider (sicher nicht zufällig) aus der Mode gekommen sind: Wonne etwa oder Seligkeit. Wobei für das Glück der Selma das Wort Wonne wohl am besten passt, da ihm eine Spur von jener Bewusstlosigkeit des Tieres beigemischt ist. Mit Wonne verbindet sich ein Überschwang an emotionaler Erfüllung – eine entrückte Gefühlsdichte, die sich eher mit Rauschzuständen als mit der klaren Bewusstheit göttlicher Seligkeit verbindet.
Mit der göttlichen Seligkeit hingegen klingt eine Wahrnehmung der Wirklichkeit an, die nicht mehr die unsere ist: das Paradigma des Mythos. Tatsächlich ist es gerade die Verwurzelung im mythischen Weltgewahren, die dem griechischen Geist und der griechischen Philosophie – wenigstens bei einigen ihrer wichtigsten Exponenten – große Unmittelbarkeit und Frische verleiht. Denn Mythen sind nichts anderes als hoch konzentrierte Verdichtungen einer umfassend wahrgenommenen Lebendigkeit. Sie sind wie Brausetabletten, die man nur in das Wasser des eigenen Lebens zu tunken braucht, um sie fröhlich sprudeln und ihren Geschmack und Reichtum freisetzen zu lassen.
Diese hochgradig verdichtete Lebendigkeit des Mythos prägt auch die griechische Sprache, die eine überaus differenzierte Begrifflichkeit für die Wirklichkeiten und Phänomene des Lebens aufweist. Daher gibt es zu denken, dass sie für das, was wir „Glück“ nennen, (mindestens) drei grundverschiedene Begriffe kennt. Da ist zunächst das den unsterblichen Göttern vorbehaltene Glück der Seligkeit (makariótēs), von dem noch Friedrich Hölderlin weiß, wenn er dichtet: „Ihr wandelt droben im Licht, selige Genien!“ (14) Daneben steht ein Wort, das unter den Bedingungen von Zeit und Geschichte das rein menschliche Glück benennt: eudaimōnía – zumeist übersetzt als Glückseligkeit. So konnte ganz am Ende der klassischen Phase des griechischen Geistes Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik darauf hinweisen, dass die makariótēs der Götter von der eudaimōnía der Menschen genau darin unterschieden sei, dass die Götter durchweg die vollendetste und beste Tätigkeit der Seele ausübten, während dies bei den Menschen nur partiell der Fall sei:
Das Leben der Götter ist seiner Totalität nach selig, das der Menschen nur, sofern ihnen eine Ähnlichkeit mit dieser Tätigkeit zukommt; von den Tieren aber ist keines glückselig, da sie an der Vernunft in keiner Weise teilhaben. (15)
Aristoteles sagt also: Die Seligkeit der makariótēs gründet in ihrer Unbegrenztheit, Absolutheit, Totalität – in all dem, was sich für den Griechen mit dem Prädikat göttlich verband. Die menschliche Glückseligkeit der eudaimōnía erscheint dagegen mangelhaft, bruchstückhaft. Ihr fehlt jener Glanz des Absoluten. Auf ihr liegt allenfalls dessen Abglanz, wenn der Mensch dem Göttlichen ähnlich wird. Anähnlichung, Ähnlich-Werden mit Gott (homoiōsis theō) konnte folglich bei Aristoteles ebenso wie bei seinem Lehrer Platon zu einem Leitmotiv der philosophischen Lebenskunst werden.
Bleiben wir aber noch ein wenig bei dem Glück der Götter – bleiben wir bei der makariótēs. Die antiken Texte sind voll von schönen und lichten Darstellungen jener göttlichen Seligkeit, und stets spüren wir darin all das Glänzende, Glitzernde, Glamouröse – die Glorie und die Grazie, das Goldene und das Ganze –, das Hermann Hesse aus dem GL des Glückes heraushören konnte. Und so erscheint es gewiss nicht unzulässig, wenn in unserem Sprachgebrauch die Seligkeit nachgerade in das Glück eingegangen und von diesem Begriff geschluckt worden ist.
Allein – wir sollten uns vor dem Missverständnis hüten zu glauben, damit wäre alles über das Glück gesagt. Wir sollten uns in Acht nehmen vor der Selma-Idylle, die so tut, als sei das aller Zeit und Geschichte entrückte Glück in seiner ganzen Ungetrübtheit auch die Glückseligkeit des Menschen. Wir sollten nicht der Versuchung anheimfallen, das Glück auf das goldene GL einzuschränken und das erdhaft-irdische ÜCK dabei zu ignorieren – dieses ÜCK, aus dem all das Lückenhafte, Bruchstückhafte und Bedrückte des menschlichen Lebens klingt. Davor dürfen wir die Augen nicht verschließen, wenn wir unser menschliches GlÜCK bedenken, das eben tiefer reicht als das Glück der GLänzenden göttlichen Seligkeit. Umgekehrt wäre es aber auch zu kurz gegriffen, wenn wir unser menschliches Glück nur als Antwort auf unser Schicksal als Sterbliche begreifen wollten. Am Ende scheinen uns die fünf Buchstaben des Wortes GLÜCK wohl bedeuten zu wollen, dass sich unser Glück aus beidem zusammensetzt – dass es sich irgendwo in der Mitte befinden muss zwischen dem GLanz vollendeter göttlicher Seligkeit und dem Schmerz irdischer BruchstÜCKhaftigkeit – in der Schwebe zwischen Erde und Himmel.
Und noch etwas: Ebenso wie die Vision von der GLanzvollen Seligkeit der Götter und das Bewusstsein um die LÜCKenhaftigkeit des menschlichen Daseins ist das Wissen um die SchiCKsalhaftigkeit des Lebens in unser Verständnis von Glück eingeflossen: Das Wissen um seine Zufälligkeit, seine Unverfügbarkeit – das Wissen um das Glück, das man haben muss, wenn man glücklich sein will. Denken wir nur an all die Glücksspiele, die Glücksbringer, die Glücksfeen und Glückskinder vom Schlage eines Gustav Gans; denken wir an das Glück, das wir hatten, wenn wir knapp einer Gefahr entronnen oder – zufällig – in den Genuss eines Gewinns gekommen sind. Auch das ist Glück, und vermutlich wird in der deutschen Sprache das Wort Glück am häufigsten in diesem Sinne verwendet.
Diesem Glück haben die alten Sprachen einen eigenen Namen gegeben – mehr noch: Es verdichtete sich für sie zu einer göttlichen Gestalt, die von den Griechen Týchē, von den Römern Fortuna genannt wurde. Der Týchē entspricht dabei das Verb tynchánein, dessen Bedeutungsfeld sich um Worte wie treffen und erlangen gruppiert. Týchē ist so gesehen dasjenige, was uns trifft, was sich trifft, was betroffen macht. Týchē ist, um ein mythologisches Wörterbuch zu zitieren, die „schicksalhafte Zuwendung“, wobei zunächst offen ist, ob sie uns im Guten oder im Bösen ereilt. Ursprünglich eigneten sowohl der Fortuna als auch der Týchē zugleich lichte wie dunkle Seiten, und erst im Laufe der Zeit wurde Týchē und stärker noch Fortuna zu jener Glücks- und Segensbringerin, die uns aus den endlosen Gründen ihres Füllhorns Glücksgüter vom SUV bis zum Traumurlaub auf den Malediven beschert.
Wenn man dies hört, ist es nur natürlich und naheliegend, dass Týchē und Fortuna für die mythisch gestimmten Menschen der Antike eine leibhaftige Gestalt annehmen mussten, die durch zweierlei gekennzeichnet ist: Jungfräulichkeit und Flügel. Das mythische Bewusstsein kennt Flügel in erster Linie bei solchen Wesen, die sich im Zwischenreich zwischen Menschen und Göttern bewegen: Daimonen nannten sie die Griechen (16), wobei man nicht an die putzigen Fratzengesichter romanischer Kapitelle denken sollte, sondern an Gestalten wie Nike, die – sei es als „Goldelse“ auf der Berliner Siegessäule oder als Nike von Samothrake im Louvre – den Siegern im Wettkampf den Ruhmeskranz reichte, oder den Eros, der mit Pfeil und Bogen bestückt unsere Herzen trifft. Natürlich gehören auch die Engel zu jenen geflügelten Wesen des Zwischenraums: ob nun als Engel der Verkündigung, als Cherubim und Seraphim, als Erzengel oder als deren abtrünniger Bruder Luzifer.
Es ist aber nicht nur die vermittelnde Tätigkeit zwischen Gott und Mensch, die in den Flügeln der daimonischen Wesen ihren Ausdruck findet, es ist vor allem ihre als Jungfräulichkeit symbolisierte Unverfügbarkeit. Einen Engel können Sie nicht herbeizwingen. Davon weiß sogar die österreichische Verkehrswacht, wenn sie Motorradfahrern nahelegt: „Gib deinem Schutzengel eine Chance.“ Den Geflügelten kann man sich öffnen, man kann sich für sie bereithalten, aber man kann sie sich nicht verfügbar machen. Das hat die Menschheit aber nicht davon abgehalten, Strategien, Kniffe und Mittel zu ersinnen, um sich Fortuna und Týchē gefügig zu machen. Doch am Ende haben sie nur zu einer Einsicht geführt: Das jungfräuliche Glück lässt sich nicht gewaltsam oder strategisch einnehmen. Es wendet sich uns zu oder eben nicht. Das mag – kein Wunder bei den Flügeln – dem einen oder anderen als flatterhaft oder gar zickig erscheinen, ihrem verführerischen Charme tut dies aber keinen Abbruch.
Göttliche Seligkeit (makariótēs), menschliche Glückseligkeit (eudaimōnía), unverfügbare schicksalshafte Zuwendung (týchē): Auch andere europäische Sprachen kennen für diese drei unterschiedliche Worte – Worte, die wir im heutigen Deutsch jeweils korrekt mit Glück wiedergeben können.
Deutsch:
Glück als
Seligkeit
Glück als
Glückseligkeit
Glück als
Zufall
Griechisch:
Makariótēs
Eudaimōnía
Týchē
Lateinisch:
Beatitudo
Felicitas
Fortuna
Italienisch:
Beatitudine
Felicita
Fortuna
Französisch:
Beatitude
Bonheur
Bonne chance
Englisch:
Blessedness
Happiness
Luck
Was machen wir damit? Am einfachsten wäre es zu sagen, uns müsse der sonderbare Sonderstatus unseres Wortes Glück nicht belasten – etwa weil er einer allgemeinen Verflachung der deutschen Sprache geschuldet sei, in deren Folge die schönen alten Worte Seligkeit und Glückseligkeit verdrängt und durch das einfachere Glück überlagert worden seien. Dies hieße aber die Weisheit der Sprache unterschätzen. In der Sprache geschieht nichts zufällig, und selbst wenn alle Sprachen eine Tendenz zur Verflachung aufweisen, haben wir damit noch keinen Anhaltspunkt dafür, warum diese Vereinfachung ausgerechnet darin bestehen soll, dass Glück auch die Bedeutungen von Seligkeit und Glückseligkeit übernommen hat. Naheliegender ist es anzunehmen, dass es trotz der Differenziertheit der anderen Sprachen einen inneren Zusammenhang zwischen Seligkeit, Glückseligkeit und glücklicher Fügung gibt, der es rechtfertigt, alle drei unter die Oberhoheit des einen Glücks zu stellen. Wir werden nicht nur sehen, dass dieser Zusammenhang besteht, sondern auch, dass er so gewichtig ist, dass man Glückseligkeit nicht verstehen kann, wenn er außer Acht gelassen wird.
Aber eben darum ist es uns doch zu tun: um unser menschliches Glück, um unsere Glückseligkeit. So viel dürfte aus dieser kurzen Reflexion über unseren Sprachgebrauch deutlich geworden sein: Wenn wir das spezifisch menschliche Glück – die Glückseligkeit – verstehen wollen, sind wir gut beraten, die anderen Aspekte, die sich offenbar mit der menschlichen Glückseligkeit verbinden, auch wenn andere Sprachen eigene Begriffe für sie haben – die göttliche Seligkeit und das unverfügbare Schicksal –, im Auge zu behalten. Mehr noch: dass wir sie in unser Verständnis der Glückseligkeit integrieren müssen, wenn wir sie in ihrer Tiefe und ihrem umfassenden Reichtum zu Bewusstsein bringen wollen.
Eben darauf weist uns auch das ursprüngliche griechische Wort für das menschliche Glück: eu-daimōnía. Es bezeichnet den Zustand dessen, der in sich einen guten (eu) Geist (daimōn) zum Führer hat, wie es bei Euripides einmal heißt (17). Wobei dieser Geist eben Gabe ist: göttliche Fügung, göttliches Schicksal, unserer menschlichen Verfügung und Gewalt entzogen – aber vielleicht doch göttlich und daher vielleicht auch willig, sich zu uns zu gesellen, wenn wir ihm eine Chance lassen.
Was ist Glückseligkeit? – Die Frage ist noch unbeantwortet. Doch vielleicht stellen wir sie tiefer, wacher und bewusster, wenn wir uns klargemacht haben, wonach wir dabei eigentlich fragen – und was alles mitklingt in dieser Frage, die wir im Herzen bewegen und die unsere Geister bewegt. Damit dürften wir gut gerüstet sein, uns im nächsten Schritt den Antworten zuzuwenden: den vielfältigen (teilweise auch einfältigen) Antworten, die die Geschichte des Glücks für uns bereithält. Wenn wir uns ihr nunmehr zuwenden, dann nicht in der Erwartung, in ihr die eine, einzig richtige Antwort zu finden, sondern mit dem Vorsatz, aus der Zusammenschau des bislang Gedachten einen frischen und ursprünglichen Zugang zum Glück zu gewinnen – einen Zugang, zu dem wir im Herzen „Ja“ sagen können, weil unser Herz in seiner Tiefe seine Wahrheit kennt.
2. Vom Diesseits ins Jenseits und zurückWie das große Glück der Griechen zur happiness verkam
Zum Auftakt dieses zweiten Kapitels wird Ihnen eine kleine Reflexion zugemutet, die Sie vielleicht überraschen wird. Aber erinnern Sie sich an das, was Friedrich Nietzsche gegen das idyllische Glück der Schafe einzuwenden wusste: Er verweist uns darauf, dass der Mensch ein geschichtliches Wesen ist – und dass wir uns nur dann recht begreifen, wenn wir anerkennen, dass wir nicht zufällig so sind, wie wir sind, sondern dass wir sind, wie wir sind, weil wir eine bestimmte Geschichte haben. Folglich hat auch unser Verständnis vom Glück, haben unsere Bewertung vom Glück und unsere Glückserfahrung eine Geschichte. Und wenn es auf dem Weg des Denkens zunächst darum geht, uns Klarheit darüber zu verschaffen, welche Vorurteile und Voraussetzungen wir auf unseren Weg zum Glück mitbringen, wird es nicht unnütz sein, uns einen Gang durch die Geschichte des Glücks zuzumuten – ganz nach dem Motto: Zurück in die Zukunft. Wir beginnen dort, wo wir sind – in der Gegenwart.
Happiness – das kleine Glück des modernen Menschen
Wir stehen am Beginn des 21. Jahrhunderts. Da mag es passend erscheinen, zunächst einen – vielleicht den – Philosophen des 21. Jahrhunderts zu Wort kommen zu lassen, auch wenn er längst gestorben ist. Sie ahnen es schon: Die Rede ist erneut von Friedrich Nietzsche, der sich als Philosoph des 21. Jahrhunderts sah. Bedenkt man, wie einflussreich er nicht nur für die Philosophie, sondern auch für das Alltagsverständnis der Gegenwart wurde, ist man – bei allem, was man gegen ihn einwenden mag – versucht, seiner Prognose zu folgen: Nietzsche ist ein geistiger Zeitgenosse. Und als solchen wollen wir ihn nun in seiner ätzenden Kritik an unser aller Glücksbemühen zu Wort kommen lassen. Angesichts des eingangs beschriebenen inflationären Gebrauchs von Glück, angesichts seiner kommerziellen Ausbeutung und Trivialisierung drängt sich gleichsam der Eindruck auf, er habe bei der Abfassung der Vorrede seines großen Werkes Also sprach Zarathustra die Menschen der Jetztzeit vor Augen gehabt, wenn er seinen Helden – Zarathustra – die letzten Menschen geißeln lässt:
»Wir haben das Glück erfunden« – sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen.
»Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?« – so fragt der letzte Mensch und blinzelt.
Die Erde ist dann klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der Alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar, wie der Erdfloh; der letzte Mensch lebt am längsten.
»Wir haben das Glück erfunden« – sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben: denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm: denn man braucht Wärme.
Krankwerden und Mißtrauenhaben gilt ihnen sündhaft: man geht achtsam einher. Ein Tor, der noch über Steine oder Menschen stolpert!
Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und viel Gift zuletzt, zu einem angenehmen Sterben.
Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, daß die Unterhaltung nicht angreife.
Man wird nicht mehr arm und reich: beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren? Wer noch gehorchen? Beides ist zu beschwerlich.
Kein Hirt und eine Herde! Jeder will das Gleiche, jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus.
»Ehemals war alle Welt irre« – sagen die Feinsten und blinzeln.
Man ist klug und weiß alles, was geschehn ist: so hat man kein Ende zu spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald – sonst verdirbt es den Magen.
Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht; aber man ehrt die Gesundheit.
»Wir haben das Glück erfunden« – sagen die letzten Menschen und blinzeln.(18)





























